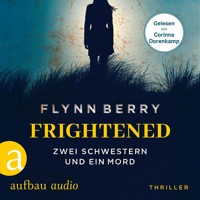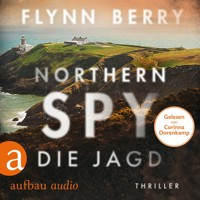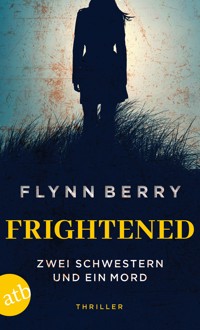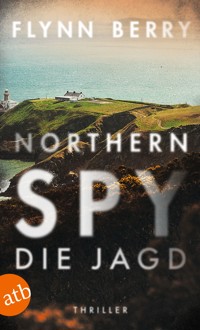
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Ich habe den Nervenkitzel geliebt – ein hochspannendes Buch.« Reese Witherspoon.
Tessa arbeitet im Büro der BBC in Belfast, als sie plötzlich ihre Schwester im TV sieht – als Täterin bei einem Raubüberfall. Marian sei bei der IRA, erklärt die Polizei und leitet eine Großfahndung ein. Aber wie kann das sein? Tessa und Marian haben sich immer gegen die Gewalt in Nordirland eingesetzt. Als Tessa die Wahrheit über ihre Schwester erfährt, muss sie sich entscheiden: zwischen ihren Idealen und ihrer Familie, zwischen Unbeteiligtheit und Handeln. Und darüber, was sie tun muss, um die einzige Person zu schützen, die sie noch mehr liebt als ihre Schwester: ihren kleinen Sohn ...
»Flynn Berry schreibt mitreißend über Frauen, die gegen eine Welt wüten, die grausame und rücksichtslose Männer schützt.« New York Times.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Ähnliche
Über das Buch
Tessa ist Produzentin im BBC-Büro in Belfast und im Sender, als eines Tages die Nachricht von einem Überfall hereinkommt. Die IRA mag in den Untergrund gegangen sein, aber sie ist nie wirklich verschwunden, und in letzter Zeit gehören Anschläge wieder zum Alltag. Als der Moderator um Hilfe bei der Suche nach den Verantwortlichen für den jüngsten Überfall bittet, erscheint Tessas Schwester auf dem Bildschirm. Tessa beobachtet schockiert, wie Marian sich eine schwarze Maske über das Gesicht zieht. Die Polizei glaubt, dass Marian sich der IRA angeschlossen hat, aber Tessa meint zu wissen, dass man ihre Schwester zu diesem Überfall gezwungen hat. Schließlich wurden sie beide dazu erzogen, jede Gewalt abzulehnen. Und außerdem macht Marian gerade Urlaub am Meer. Tessa hat erst kürzlich mit ihr gesprochen.
Doch als die Wahrheit über Marian ans Licht kommt, ist Tessa gezwungen, sich zu entscheiden: zwischen ihren Idealen und ihrer Familie, zwischen Unbeteiligtheit und Handeln. Sie begibt sich auf einen zunehmend gefährlichen Weg und fürchtet nichts mehr, als die einzige Person zu gefährden, die sie noch mehr liebt als ihre Schwester: ihren kleinen Sohn.
Über Flynn Berry
Flynn Berry ist eine amerikanische Autorin, die bisher bereits mit dem Edgar Award ausgezeichnet wurde. »Northern Spy« wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und von der Washington Post als einer der besten Thriller des Jahres ausgezeichnet.
Wolfgang Thon, geboren 1954 in Mönchengladbach, studierte Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Thon arbeitet als Übersetzer und seit 2014 auch als Autor in Hamburg, tanzt leidenschaftlich gern Argentinischen Tango und hat bereits etliche Thriller von u. a. Brad Meltzer, Joseph Finder, Robin Hobb, Steve Barry und Paul Grossman ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Flynn Berry
Northern Spy – Die Jagd
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
TEIL EINS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
TEIL ZWEI
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
TEIL DREI
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
DANKSAGUNGEN
Impressum
Wer von diesem Thriller begesitert ist, liest auch ...
Für Ronan und Declan
Sie werden euch vergessen. Wir nicht.
IRA-Graffito, 2019
TEIL EINS
1
Wir werden mit einem Schreckreflex geboren. Offenbar wird er durch das Gefühl des Fallens ausgelöst. Manchmal streckt mein Sohn in seiner Wiege die Arme aus, und ich lege meine Hand auf seine Brust, um ihn zu beruhigen.
Das passiert jetzt seltener als in den ersten Monaten. Er denkt jetzt nicht mehr ständig, dass ihm der Boden unter den Füßen wegbricht. Ich dagegen denke das schon. Mein Schreckreflex war noch nie so stark wie jetzt. Das ist auch klar, denn es trifft im Moment auf jeden hier zu. Es gehört zum Leben in Nordirland, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Phase des Terrorismus.
Es ist schwer zu sagen, wie viel von der Angst begründet ist. Die Bedrohungslage ist ernst, andererseits ist sie das schon seit Jahren. Die Regierung stuft terroristische Organisationen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, ihres Zeitrahmens und ihrer Absichten ein. Im Moment sollten wir uns bei der IRA in allen drei Punkten Sorgen machen. Ein weiterer Anschlag könnte unmittelbar bevorstehen, aber niemand kann vorhersagen, wo.
Immerhin stehen die Chancen gut, dass es nicht hier geschieht. Nicht auf diesem Weg, auf dem ich mit dem Baby spazieren gehe. Kein Bewaffneter wird plötzlich hinter einer Biegung dieser Straße auftauchen. In Belfast, auf dem Weg zur Arbeit, halte ich immer Ausschau nach ihnen, aber nicht hier draußen, zwischen Hecken und Kartoffelfeldern.
Wir leben im Grunde genommen mitten im Nirgendwo. Mein Haus liegt auf der Halbinsel Ards, einer Landzunge zwischen dem Strangford Lough, einer tiefen Salzwasserbucht, und dem Meer. Greyabbey ist ein kleines Dorf an einer Biegung der Straße zum Lough. Vierhundert Häuser inmitten grüner Felder, Gassen und Obstgärten. Am Ufer des Loughs dümpeln Kanus im Schilf. Das hier sieht nicht wie ein Konfliktgebiet aus, sondern wie ein Ort, an den man nach einem Krieg zurückkehrt.
Finn sitzt in seiner Babytrage auf meiner Brust und blickt nach vorn auf die Straße. Ich plaudere mit ihm. Er reagiert mit Plappern und stößt mit den Fersen gegen meine Oberschenkel. Vor uns verschwinden Vögel in Lücken der Hecke. Am Rand der Weide zieht sich eine Reihe von Telefonmasten an der Straße entlang. Der Himmel hinter ihnen ist weiß bis zum Meer.
Mein Sohn ist sechs Monate alt. Der Konflikt könnte zu Ende sein, wenn er laufen oder lesen kann. Er könnte zu Ende sein, bevor er klatschen lernt oder sein erstes Wort spricht oder aus einer Tasse trinkt oder ganze Früchte statt Püree isst. All das wird ihn vielleicht nie berühren.
Eigentlich sollte es längst vorbei sein. Meine Schwester und ich wurden kurz vor dem Ende der Unruhen geboren. Als im Jahr 1998 das Karfreitagsabkommen unterzeichnet wurde, waren wir noch Kinder. Wir malten Friedenszeichen und Tauben auf Bettlaken und hängten sie in unsere Fenster. Damals sollte all das eigentlich zu Ende sein.
Allerdings wurden immer noch Leichen in Torfmooren entlang der Grenze gefunden. Man suchte weiter nach Informanten, welche die IRA hatte verschwinden lassen. Noch waren nicht alle Untersuchungen der Rechtsmediziner abgeschlossen, ebenso wenig wie die Ermittlungen über die geheimen Absprachen mit der Polizei. Und noch immer kommt es jedes Jahr während der Marching Season zu Ausschreitungen. Bei bestimmten Beerdigungsmärschen mischen sich Männer mit Skimasken und verspiegelten Sonnenbrillen in die Trauerzüge, zücken Pistolen und ballern neben den Särgen in die Luft. Sonderbar, da sie behauptet hatten, sie hätten alle ihre Waffen abgegeben.
Es herrschte also nie wirklich Frieden. Denn das Grundproblem des Konflikts war noch nicht gelöst: Die meisten Katholiken wollten immer noch ein vereinigtes Irland, die meisten Protestanten wollten Teil des Vereinigten Königreichs bleiben. Die Schulen waren immer noch streng nach Religion getrennt. In jeder Stadt wusste man, wo die katholische Bäckerei war und wer das protestantische Taxiunternehmen führte.
Wieso haben die Menschen es nicht kommen sehen? Wir lebten auf einem Pulverfass. Es war klar, dass es sich irgendwann entzünden würde, und als es dann so weit war, waren viele Männer bereit, sich wieder in den Kampf zu stürzen. Frieden war nichts für sie. Sie hatten davon nicht profitiert. In ihren Erklärungen und Mitteilungen spürte ich ihre Erleichterung, als wären sie Schläfer, die in einem feindlichen Land zurückgelassen worden waren und jetzt froh waren, dass man sie nicht vergessen hatte.
Von der Straße biege ich auf den Feldweg zum Lough ab. Das Wasser glänzt im Sonnenlicht wie Platin. Heute wird es wieder heiß. Ich möchte, dass dieser Spaziergang nie aufhört, aber schon bald sind wir an der Hauptstraße und in der Kindertagesstätte. Ich küsse Finn zum Abschied, wie immer zuversichtlich, dass ich bis morgen früh endlich den Trick herausfinde, wie ich den Tag sowohl auf der Arbeit als auch mit ihm verbringen kann.
Mein Handy klingelt, als ich mich der Bushaltestelle nähere. »Hast du heute schon etwas von Marian gehört?«, fragt meine Mutter.
»Nein, warum?«
»Es soll ein Gewitter geben.« Meine Schwester Marian ist für ein paar Tage an die Nordküste gefahren. Sie wohnt in einem gemieteten Cottage auf einer Landzunge bei Ballycastle. »Sie geht doch nicht tauchen, oder?«
»Nein«, sage ich. Ich erwähne nicht, dass Marian mir erzählt hat, sie wollte in den Höhlen von Ballintoy schwimmen, wenn sie es mit den Gezeiten abstimmen könnte.
Ich hatte gehofft, dass sie es tun könnte. Mir gefiel die Vorstellung, wie sie durch die Kalksteinbögen tauchte und im Wasser des Höhleneingangs schwamm. Die Ruhe und die Weite wären wie ein Gegengift, das genaue Gegenteil von Belfast, von ihrer Arbeit als Sanitäterin. Da saß sie hinten in einem Krankenwagen, der über rote Ampeln raste, und bereitete sich auf den Moment vor, in dem sich die Türen öffneten.
»Es wäre dumm, das allein zu tun.«
»Sie geht nicht tauchen, Mom. Wir sehen uns heute Abend, okay?«
Donnerstags senden wir unser Programm. Dann holt meine Mutter Finn immer aus der Kindertagesstätte ab, da ich es nicht rechtzeitig nach Hause schaffe. Das bedeutet, sie hat einen langen Tag. Sie arbeitet als Haushälterin bei einem Ehepaar in Bangor. Sie putzt das Haus, kauft ein und wäscht die Wäsche. Die Heizung ist das ganze Jahr über so hoch eingestellt, dass sie in Shorts und Tanktop arbeitet. Zweimal pro Woche zieht sie einen Mantel über, um die Mülltonnen die lange Kiesauffahrt hinunter- und wieder hinaufzuschleppen. Vor Kurzem haben sie eine halbe Million Pfund für einen beheizten Swimmingpool unter ihrem Haus ausgegeben. Meine Schwester und ich können nicht glauben, dass Mom ihn noch nie genutzt hat.
»Nicht mal, wenn sie weg sind?«, fragte Marian.
Unsere Mutter lachte darüber. »Sei nicht albern.«
2
Während der Busfahrt in die Stadt schaue ich durch meine Reflexion in der Scheibe auf den See. Auf seiner riesigen Oberfläche spiegeln sich schwach die Formen der fernen Mourne-Berge.
Ich schicke Marian eine Nachricht und scrolle dann nach oben zu dem Bild, das sie mir gestern geschickt hat. Sie steht auf der Seilbrücke von Carrick‑a-Rede. Früher warteten die Touristen stundenlang, um die Brücke überqueren zu können, aber jetzt ist sie die meiste Zeit des Jahres verlassen, und nur die Wellen brechen sich hundert Meter darunter am Ufer. Auf dem Bild ist Marian allein, hält sich an den Seilen fest und lacht.
Marian trägt ihr welliges braunes Haar offen oder steckt es mit einer goldenen Spange auf dem Kopf zusammen. Wir sehen uns ähnlich, wir haben die gleichen Augen, Wangenknochen und die gleiche dunkle Mähne. Allerdings sind Marians Haare einen Zentimeter kürzer als meine und weicher. Wenn sie nicht spricht, wirkt ihre Miene offen und amüsiert, als warte sie darauf, das Ende eines Witzes zu hören, während ich eher ernst bin. Beides hat seine Schattenseiten. Ich muss den Leuten oft versichern, dass ich mir keine Sorgen mache, wenn ich in Wirklichkeit nur nachdenke, und Marian, die seit sechs Jahren Rettungssanitäterin ist, wird immer noch bei jeder Schicht gefragt, ob sie neu in diesem Job sei. Sie sagt zum Beispiel: »Ich lege jetzt einen Infusionsschlauch.« Dann sieht der Patient sie erschrocken an und fragt: »Haben Sie das denn schon mal gemacht?«
Keine von uns sieht aus wie unsere Mutter. Die ist blond und untersetzt und strahlt eine lebhafte Herzlichkeit aus. Wir schlagen nach unserem Vater und seiner Seite der Familie, seinen Schwestern und Eltern. Das ist irgendwie ungerecht, da wir weder ihn noch einen aus seiner Sippe jemals zu Gesicht bekommen.
Ich träume vor mich hin, bis die Straße wieder vom See wegführt, dann aktiviere ich mein Smartphone und lese die Nachrichten. Ich produziere ein wöchentliches politisches Radioprogramm bei der BBC. Manchmal enden die Sendungen damit, dass sich Lokalpolitiker gegenseitig anschreien, andere dagegen sind sehr spannend, besonders zurzeit. Man kann heutzutage nicht in Nordirland leben und sich nicht für Politik interessieren.
Als wir Belfast erreichen, hole ich mir kurz bei Deanes einen Flat White. Das Café und die anderen Kunden wirken vollkommen normal. Man sieht es der Stadt nicht an, aber die IRA hat sie unter ihrer Fuchtel. Sie betreiben Schutzgelderpressung im großen Stil. Jede Baustelle muss ihnen Schutzgeld zahlen, und alle Restaurants in West-Belfast haben Türsteher. Ein IRA-Repräsentant sagt zu dem Besitzer: »Du brauchst zwei Türsteher, am Donnerstag- und Freitagabend.«
»Sei kein Idiot«, erwidert der Besitzer. »Ich brauche keine Türsteher, das hier ist doch nur ein Restaurant.«
Dann schicken sie ihm zwanzig Schläger, die den Laden demolieren, kommen am nächsten Tag zurück und sagen: »Siehst du, wir haben dir doch gesagt, du brauchst Türsteher.«
Es ist einfacher, sie zu bezahlen, als sich zu beschweren. In Anbetracht der Alternativen ist es bei vielen Dingen einfacher, zu tun, was sie verlangen.
Der Sohn unserer ehemaligen Nachbarin wurde von der IRA beim Drogenverkauf erwischt. Sie beschuldigten ihn – ohne jeden Funken Humor –, das Wohl der Allgemeinheit zu gefährden. Man befahl ihr, ihn zur Bestrafung hinter die Riverview-Läden zu bringen. Es endete damit, dass sie ihm die Kniescheiben zerschossen.
»Du hast ihn dorthin gebracht, damit sie ihn zusammenschlagen konnten?«, fragte ich sie.
»Ja, aber ich habe ihnen nicht erlaubt, auf ihn zu schießen. Sie hatten keinen verfickten Grund, ihm die Knie zu zerschießen.«
Ich verlasse das Café und biege in die Dublin Road ein. Das Broadcasting House liegt vor mir, ein Kalksteinbau mit riesigen Satellitenschüsseln auf dem Dach. Ich bin erst seit ein paar Wochen wieder bei der Arbeit. Die sechs Monate Mutterschaftsurlaub waren sehr intensiv und wichtig. Als ich zur Arbeit zurückkehrte, fühlte ich mich wie Rip Van Winkle, als wäre ich nach Jahrzehnten wieder aufgewacht, nur dass niemand sonst gealtert war. Im Büro hat sich nichts verändert, und ich muss so tun, als hätte auch ich mich nicht verändert. Wirke ich abgelenkt oder müde oder arbeite langsamer als früher, könnten meine Chefs auf die Idee kommen, dass jemand ohne Baby oder zumindest eine nicht alleinerziehende Mutter die Arbeit besser bewältigen könnte. Also tue ich so, als wäre ich ausgeruht und konzentriert, obwohl ich nachts in Vier-Stunden-Schichten schlafe und Finn mehrmals am Tag so sehr vermisse, dass mir jeder Atemzug wehtut.
Im Funkhaus halte ich meinen Ausweis an den Scanner und lege mir dann das Schlüsselband um den Hals. Unsere morgendliche Mitarbeiterbesprechung beginnt gleich. Ich laufe die Treppe hinauf, einen Korridor hinunter und betrete einen Besprechungsraum, in dem sich Redakteure und Korrespondenten drängen.
»Morgen«, sagt Simon, als ich einen Platz gefunden habe. »Heute ist ganz schön was los. Es geht offensichtlich um die Schießerei auf dem Milltown-Friedhof. Was ist da passiert?«
»Es war ein Selbstmordversuch«, informiert ihn Clodagh.
»Und wie ist der Zustand des Opfers?«
»Die Irish News schreibt, sein Zustand sei kritisch, und der Belfast Telegraph schreibt, er sei tot.«
»Na klar. Wir warten ab, bevor wir etwas veröffentlichen.«
»Wen haben wir letztes Jahr noch mal vorzeitig für tot erklärt?«, fragt James.
»Lord Stanhope«, antwortet Simon. »Ich habe einen sehr lebhaften Anruf von ihm bekommen.«
»Und wer ist jetzt dieser Kerl?«
»Sein Name ist Andrew Wheeler«, informiert ihn Clodagh. »Er ist Projektentwickler.«
»Warum sollte sich ein Projektentwickler auf dem Friedhof von Milltown erschießen wollen?«, werfe ich ein.
Clodagh zuckt mit den Schultern. »Wir wissen nur, dass er auf dem Friedhof gefunden wurde.«
»Wir sollten abwarten«, sagt Esther. Ihr Ton ist neutral, aber alle fühlen sich trotzdem getadelt. Wir berichten nicht über Selbstmorde, um nicht unbeabsichtigt andere Menschen ebenfalls dazu zu ermutigen.
»Liegt es überhaupt im Interesse der Öffentlichkeit, sie über den Fall zu informieren?«, fragt Simon. »Hat er irgendeine paramilitärische Verbindung?«
»Keine Gruppe hat ihn für sich beansprucht.«
»Okay«, entscheidet er. »Esther hat recht, halten wir uns erst einmal bedeckt. Gibt es heute noch andere interessante Themen?«
»Ein weiterer Spesenskandal«, sagt Nicholas. »Roger Colefax war heute Morgen in Today.«
»Er war alles andere als brillant, das muss man schon sagen. Die ganze Sache war sehr dubios.«
»Hat er sich entschuldigt?«
»Das nicht, aber es sieht so aus, als würde er zurücktreten.«
»Das bringen wir heute nicht, es sei denn, er tritt tatsächlich zurück. Priya?«
»Wir berichten über den Prozess gegen Cillian Burke. Er dürfte jeden Moment platzen.«
»Hat man sein Geständnis nicht schon aufgezeichnet?«, will Nicholas wissen.
»Es war eine verdeckte Überwachung«, antwortet Priya. »Und der MI5 weigert sich, seine Methoden offenzulegen. Ihr Zeuge behauptet immer wieder, er könnte aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht aussagen.«
Nicholas stößt einen Pfiff aus. Cillian Burke steht vor Gericht, weil er den Anschlag auf einen Markt in Castlerock befohlen hat, bei dem zwölf Menschen getötet wurden. Er ist seit dem Ausbruch des Konflikts ein Anführer der IRA und verantwortlich für mehrere Autobomben und Schießereien. Nun wird er entweder zu lebenslanger Haft verurteilt oder freigesprochen und weitermachen.
»Es wird nicht zu einer Verurteilung kommen«, spekuliert Priya. »Nicht, wenn der MI5 die Aufnahme nicht herausrückt.«
Ich bezweifle, dass der Geheimdienst Kompromisse eingehen wird. Der MI5 kommt hierher, um neue Methoden zu testen, um Kapazitäten aufzubauen, um seine Agenten auf ihren eigentlichen Kampf gegen internationale Terrorgruppen vorzubereiten. Wir hier dienen ihnen nur als Übungsplatz.
Simon dreht sich zu mir um. »Tessa? Was hast du diese Woche in Politik?«
»Die Justizministerin kommt«, antworte ich, und einen Moment genieße ich erfreulicherweise allgemeine Aufmerksamkeit. »Das ist ihr erstes Interview, seit sie das Gesetz vorgeschlagen hat.«
»Gut gemacht!«, lobt Esther, und die Runde geht weiter, bis sie beim Sport angelangt ist und keiner mehr glaubt, zuhören zu müssen. Ein paar Mitarbeiter lesen auf dem Schoß Zeitung, während Harry etwas über Rugby erzählt. Aber wir alle sind der Sportredaktion dankbar, denn sie kann sämtliche Lücken in der Sendung füllen, so sehr sind sie daran gewöhnt, ausführlich über nichts zu reden.
…
Nach dem Treffen suchen Nicholas und ich uns einen Tisch in der Kantine im obersten Stockwerk. Es liegt auf der Höhe der anderen Dächer und der Rathauskuppel. »Also gut, was haben wir?«
Ich präsentiere ihm die Reihenfolge der Beiträge, obwohl er nur sehr wenig Nachhilfe braucht. Nicholas wurde schon vor Jahren unser politischer Korrespondent. Er fing in den 90er Jahren bei der BBC an, fuhr mit dem Fahrrad zu Aufständen und lief durch Felder, um britische Spezialeinheiten zu interviewen.
Ich spiele gern mit mir selbst das Spiel, eine politische Figur oder Statistik zu finden, die Nicholas noch nicht kennt. Er könnte das Programm des heutigen Abends wahrscheinlich aus einem Graben präsentieren, aber wir sitzen trotzdem zusammen und arbeiten die Fragen durch. Eine liest er laut vor. »Hier sollten wir etwas schärfer rangehen, meinst du nicht?«
Persönlich ist er freundlich und liebenswürdig, aber er ist ein sehr unangenehmer Interviewpartner. »Diese Leute haben eine Menge Macht«, sagt er. »Das Mindeste, was sie tun können, ist, sich zu erklären.«
Wir arbeiten weiter, bis Clodagh ihn anruft. »Helen Lucas wartet an der Rezeption, und Danny ist noch nicht aus Stormont zurück. Kannst du das Interview aufnehmen?«
»Na klar, sicher.« Nicholas sammelt seine Unterlagen und seine Kaffeetasse ein. »Tessa, wir sind gut gerüstet für heute Abend, nicht wahr?«
»Wir sind großartig.«
Nachdem er gegangen ist, setze ich mir Kopfhörer auf und höre mir eine Rede an, die Rebecca Main letzte Woche in einer Schule in Carrickmacross gehalten hat. Sie ist erst seit ein paar Wochen Justizministerin, aber sie mobilisiert jetzt schon eine große Menge von Anhängern und Demonstranten. »Das Vereinigte Königreich wird sich niemals dem Terrorismus beugen«, sagt sie. Ich halte den Clip an und lehne mich vor. Sie trägt eine kugelsichere Weste. Unter ihrem Hosenanzug erkennt man schwach die klobigen Umrisse.
Rebecca Main lebt in einem Haus in Süd-Belfast mit einem Panikraum und Sicherheitsbeamten vor dem Haus. Ich frage mich, ob ihr das beides hilft, sich sicher zu fühlen. Und wie sie mit dem Gefühl, ständig bedroht zu werden, klarkommt.
Am Anfang, als der Konflikt gerade begann, war es noch spannend. Niemand will das zugeben, aber man muss es einmal aussprechen. In den ersten Wochen, als die Proteste, die Unruhen und die Entführungen anfingen, war der Konflikt nur lästig und hat den Alltag durcheinandergewirbelt. Man konnte nicht mehr seine gewohnten Wege gehen. Bestimmte Kreuzungen waren von Menschenmengen blockiert – meist von schreienden jungen Männern, einige mit freiem Oberkörper, von denen manche Steine warfen – oder durch einen Bus, der auf die Seite gekippt und in Brand gesetzt worden war. Manchmal standen wir auf dem Dach des Broadcasting House und sahen, wie schwarze Rauchfahnen über der Stadt aufstiegen. Bei der Arbeit oder auf dem Weg zu meiner Wohnung in Belfast fühlte ich mich einfallsreich und kompetent, weil ich einfach das tat, was ich immer getan hatte.
Eines Morgens hockte ein amerikanisches Nachrichtenteam in dem Café um die Ecke von meiner Wohnung. Der Reporter trug Bauarbeiterstiefel, Jeans und eine kugelsichere Weste. Ich beobachtete mit Neugier und Spott seine Vorsichtsmaßnahmen. Ich dachte: Du bist nur auf der Durchreise, du lebst nicht hier wie ich.
Ich habe mich oft gefragt, wie es wohl wäre, damals in den Vierzigern während des Blitz gelebt zu haben, und ich glaube, jetzt weiß ich es. Zuerst wirkten Angst und Adrenalin wie Scharfmacher, sie machten einen wacher. Vielleicht sogar glücklicher. Nichts war mehr langweilig. Jede Handlung – das Aufhängen nasser Wäsche, der Kauf einer Flasche Bier – fühlte sich bedeutsam an, schicksalhaft. In gewisser Weise war es eine Erleichterung, sich um größere Dinge als um sich selbst kümmern zu müssen. Und dass andere Menschen diese Sorgen teilten.
Kürzlich las ich eine wissenschaftliche Abhandlung, in der es hieß, dass Mordopfer vor ihrem Tod mit Serotonin, Oxytocin und anderen Hormonen überschwemmt werden, die ein Gefühl der Euphorie hervorrufen, da der Körper versucht, sich vor dem Wissen um das, was passiert, zu schützen. Das ist, glaube ich, mit mir in diesen ersten Wochen passiert.
…
An meinem Schreibtisch formuliere ich Nicholas’ Einleitung für Rebecca Main. Ich feile an der Reihenfolge der restlichen Beiträge herum, rufe Pressesprecher an und beantworte E-Mails. Dabei habe ich ein Auge auf die Nachrichten, die von unseren externen Quellen eingehen. In einer Meldung heißt es, die Kraftwerke befürchten Stromausfälle. Es wird erwartet, dass das Gewitter bis zum Abend das Land erreicht. Ich denke an Marian, wie sie das Unwetter heraufziehen sieht. Vielleicht hat sich der Himmel über der Nordküste bereits verdunkelt, haben sich die Wolken über den Fischerbooten im Hafen von Ballycastle, der Seilbrücke und den Schornsteinen zugezogen. Vielleicht schwimmt sie schon, wenn die See nicht schon zu rau ist. Ich checke mein Handy, obwohl sie meine Textnachricht noch nicht beantwortet hat.
Bevor unser Gast eintrifft, setze ich mich nach draußen auf die Feuertreppe, esse einen Mars-Riegel und trinke eine Tasse Tee, während Colette eine Zigarette raucht. Sie kommt auch aus West-Belfast, aus Ballymurphy. Sie kennt meine Cousins und Cousinen und meine Onkel.
»Wie kommt Rory in der Schule klar?«, frage ich.
»Er hasst sie immer noch. Wer kann es ihm verdenken?«
»Liegt es an den Kindern, oder sind es die Lehrer?«
»Beides. Er sagt, er will auf das St. Joseph’s, kannst du das glauben?«
»Mein Gott, dann muss es ja wirklich schlimm sein.«
Colette seufzt. »Ich denke über einen Hund für ihn nach.«
Letzten Sommer war Colette auf der Falls Road unterwegs, als eine Autobombe explodierte. Sie wurde durch die Explosion zu Boden geschleudert, hatte aber nur Prellungen davongetragen und schaffte es nach Hause. Bei der Arbeit am nächsten Tag sah sie Esther an, als wäre sie verrückt geworden, weil sie ihr eine Auszeit angeboten hatte.
»Wer ist heute Abend in Politics?«, fragt sie.
»Die Justizministerin, Rebecca Main. Hattest du sie schon mal auf deinem Stuhl?«
Colette kriegt als Maskenbildnerin alle Gäste in den Abendnachrichten auf ihren Sessel, seien es Politiker, Akademiker oder Schauspielerinnen. Oft verraten sie ihr in ihrem Schminkraum, ihrem kleinen Beichtstuhl, ihre tiefsten Geheimnisse.
Sie nickt. »Ich mochte Rebecca.«
»Hat sie dir etwas erzählt?«
»Nein. Dafür ist sie viel zu clever.«
Colette drückt ihre Zigarette aus. Wir stehen auf, und sie tippt den Sicherheitscode für die Brandschutztür ein.
…
Die Justizministerin trifft in Begleitung von zwei Personenschützern ein.
Sie schüttelt erst Nicholas und dann mir die Hand. Unser Laufbursche rollt den Servierwagen heran und schenkt ihr einen Kaffee aus einer silbernen Karaffe ein. Ich verzichte darauf, ihre Leibwächter zu fragen, was sie wollen. Sie sagen sowieso immer Nein, lehnen sogar versiegelte Wasserflaschen ab.
Wir gehen ins Studio. Ich verschwinde in der Tonkabine. John nickt mir zu und nuckelt an seiner E‑Zigarette, während die Dire Straits aus den Lautsprechern dröhnen.
»Hast du Spaß hier drin?«
»Die Ruhe vor dem Sturm«, erwidert er.
»Nein, das hier wird ein Kinderspiel.«
Wir heben beide den Blick. Auf der anderen Seite der Glasscheibe stülpt sich Rebecca Main die Kopfhörer über. »Können Sie mich gut hören?«, fragt Nicholas. Sie nickt und legt ihre verschränkten Hände vor sich auf den Tisch.
Über dem Mischpult läuft auf einem Fernsehbildschirm BBC One. Die Abendnachrichten fangen gleich an, zur vollen Stunde. Auf der anderen Seite des Gebäudes, im Hauptstudio, sitzen unsere Moderatoren unter den Scheinwerfern und warten darauf, die Schlagzeilen des Tages zu verlesen.
Unser Laufbursche kommt herein. »Hat Nicholas Wasser?«, frage ich ihn.
»Oh, Scheiße.«
»Du hast noch Zeit.«
»Ist er neu?«, murmelt John, nachdem er verschwunden ist.
Ich nicke. »Jeder hat mal angefangen.«
»Schon klar.« John stellt das Mischpult ein, und die Frequenznadeln schlagen aus, gelb, rot, blau.
»Willst du die Einleitung üben?«, frage ich ins Mikro. Nicholas schüttelt den Kopf.
John speist unsere Musik ein. Ich beuge mich vor. »In dreißig Sekunden, Nicholas.«
Als die Sechs-Uhr-Nachrichten zu Ende sind, leuchtet unsere On‑Air-Lampe gelb auf. Nicholas verliest meine Einleitung und sagt dann: »Danke, dass Sie bei uns sind, Ms Main.«
»Ist mir ein Vergnügen.«
»Sie haben kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, die Beschränkungen von Ermittlungsbefugnissen zu lockern. Eine Klausel in diesem Gesetzentwurf würde der Polizei erlauben, einen Verdächtigen dreißig Tage lang ohne Anklage festzuhalten. Warum gerade jetzt? Meinen Sie nicht, dass unsere Polizei stärker kontrolliert werden muss und nicht weniger?«
»Wir leben in einer schwierigen Zeit«, antwortet sie ruhig und deutlich. »Terrorgruppen wollen nicht, dass wir uns ihren Methoden anpassen, sie wollen nicht, dass wir uns ihnen effektiv entgegenstellen. Dieses Gesetz schränkt ihre Möglichkeiten, in unserer Gesellschaft zu manövrieren, erheblich ein.«
»Vielleicht«, räumt Nicholas ein. »Vielleicht spielt die Einführung dieser Maßnahmen ihnen aber auch in die Hände, weil sie damit einen noch größeren Teil unserer Bevölkerung von Ihrer Regierung entfremden. Sie könnten damit neue Rekruten für den Terror schaffen.«
»Ganz und gar nicht. Das sind einfache, vernünftige Maßnahmen«, behauptet die Ministerin. Mein Puls rast, und mein Gesicht wird heiß. Tausende Menschen in der ganzen Provinz hören zu. Während wir auf Sendung sind, darf nichts schiefgehen.
Einer ihrer Personenschützer steht in der Halle und einer im Studio in der Ecke. Durch das Glas sehe ich sein weißes Hemd und die weiße Spirale seines Ohrhörers.
»Aber dreißig Tage – das ist doch wie eine Internierung, oder?«
»Die Polizei braucht Zeit, um die Beweise für eine Strafverfolgung zu sammeln, damit sie weitere Straftaten verhindern kann.«
»Die aktuelle Grenze liegt bei sechsunddreißig Stunden. Ihr Entwurf ist eine ziemlich drastische Steigerung, nicht wahr?« Ich drücke das Mikrophon und spreche in seinen Ohrhörer: »Zweitausend Prozent«.
»Um zweitausend Prozent«, greift er die Info auf. »Das ist die längste Haftzeit ohne Anklage in ganz Europa.«
»Nun, wir können diese Entscheidungen durchaus unabhängig von Europa treffen und damit auf unsere eigenen besonderen Umstände reagieren.«
John wendet sich an mich. »Hast du Musik für das Ende?«
»Ich schick sie dir rüber.«
Nicholas erkundigt sich nach weiteren Einzelheiten des Gesetzentwurfs und kommt dann auf die gegen sie gerichteten Morddrohungen zu sprechen. Die Ministerin tut sie einfach ab und scherzt über die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen, nur damit sie ein Rugbyspiel ihres Sohnes besuchen kann.
Es sind noch einige Minuten übrig, und ich drücke erneut auf die Mikrophontaste. »Du wolltest sie nach den Flugblättern fragen.«
»Lassen Sie uns über die Postwurfsendungen sprechen, die Ihre Partei an Haushalte in Belfast verschickt hat«, sagt Nicholas. »Finden Sie nicht, dass diese Flugblätter die Gesellschaft spalten, wenn Sie Bürger auffordern, ihre Nachbarn auszuspionieren?«
»Sehen Sie, solche Anschläge bedürfen gründlicher Planung«, erwidert sie. »Jeder Bürger sollte wissen, wie er verdächtiges Verhalten erkennen kann. Es geht nicht darum, die Nachbarn auszuspionieren, sondern darum, den nächsten Anschlag zu verhindern.«
Als ich von meinen Notizen aufschaue, sehe ich meine Schwester auf dem Fernsehschirm. Ihre Wangen sind gerötet, als wäre sie draußen in der Kälte gewesen.
Sie steht mit zwei Männern an einer Tankstelle, neben einer Reihe von Zapfsäulen. Ihr Krankenwagen wurde wohl zu einem Einsatz geschickt, obwohl sie aus irgendeinem Grund keine Uniform trägt.
»Die Polizei sucht nach einem bewaffneten Raubüberfall in Templepatrick nach Zeugen«, heißt es in der Bildunterschrift. In meinen Ohren klingelt es. Auf der Überwachungskamera ist nur Marians Gesicht zu sehen, die beiden Männer haben sich von der Kamera abgewendet.
»Tessa?« John klingt panisch, und ich schicke ihm den Musikclip, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden.
»Haben wir überzogen?« Meine Stimme klingt fremd.
»Nein, wir liegen gut in der Zeit«, beruhigt er mich.
Marian hält etwas in ihren Händen. Sie bückt sich und zieht es sich über den Kopf. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was ich da sehe, denn erst verschwindet ihr Haar und danach auch ihr Gesicht. Als sie sich wieder aufrichtet, trägt sie eine schwarze Skimaske.
3
Ich stürme förmlich aus dem Funkhaus und wende mich nach Norden zum Polizeirevier. Liefe ich in die entgegengesetzte Richtung, zu ihrer Wohnung, würde mir Marian vielleicht die Tür öffnen. Vielleicht stände sie da unter der gelben Papierlaterne in ihrer Diele und sagte: »Tessa, was machst du denn hier?«
Ich bleibe schwankend stehen und versuche, eine Entscheidung zu treffen. Ihr Haus ist nicht weit entfernt. Marian wohnt in Süd-Belfast, in der Adelaide Avenue, einer ruhigen Reihenhauszeile zwischen der Eisenbahnlinie und der Lisburn Road. Ich könnte in zwanzig Minuten dort sein. Die Fußgängerampel blinkt, und ich zwinge mich, die Straße zu überqueren. Aber ihre Wohnung wird leer sein, sie wollte bis Freitag an der Nordküste bleiben. Und sie geht nicht an ihr Handy. Auf dem Weg hinaus habe ich bei Mom und Marians besten Freunden angerufen, aber keiner von ihnen hat etwas von ihr gehört.
Das Polizeirevier befindet sich hinter einem hohen Wellblechzaun. Ich spreche mit dem diensthabenden Officer am Empfang, der hinter einem kugelsicheren Fenster sitzt. Die Spiegelungen im Glas legen sich über sein Gesicht, und ich kann nicht erkennen, ob er mich versteht und ob ich überhaupt etwas Sinnvolles herausbringe. Eine Frau vor seiner Kabine ist in Tränen aufgelöst. Der Officer muss wohl daran gewöhnt sein, denn meine Verzweiflung scheint ihn nicht im Geringsten zu beunruhigen. Er steckt meinen Führerschein in einen Schlitz auf seiner Tastatur und tippt langsam meinen Namen ein. Er hat es nicht eilig, auch wenn vielleicht jemand von der anderen Straßenseite aus zusieht. Die IRA scheint immer zu wissen, wenn jemand aus der Gemeinde zur Polizei gegangen ist. Wenn später jemand fragt, werde ich sagen, dass ich wegen der Arbeit hier bin, wegen eines Interviews. Ich wische mir das verheulte Gesicht mit dem Handrücken ab, dann weist er mir den Weg zu einem Vorraum.
Zwei Officers mit automatischen Gewehren fordern mich auf, Schuhe und Tasche abzulegen. Ich strecke meine Arme seitlich aus. Ich bin barfuß und trage ein Sommerkleid aus Leinen. Die Gesichter der Soldaten sind ausdruckslos. Mir geht durch den Kopf, dass sie gerade vielleicht mehr Angst haben als ich. Hätte ich eine Bombe unter meinem Kleid versteckt, wären sie die Ersten in der Wache, die es erwischte.
»Strecken Sie die Hände aus!«, fordert mich einer auf und wischt sie mit einem Scanner nach Sprengstoffspuren ab. Ich habe plötzlich Angst, dass ich irgendwann am Tag vielleicht etwas angefasst habe, das auf meinen Handflächen Flecken von Plastiksprengstoff oder Semtex hinterlassen haben könnte. Die Soldaten warten, bis die Maschine summt, dann öffnen sie die Tür zum Vorraum. Ein Constable begleitet mich über den Hof zu einem Verhörraum in der Abteilung für Gewaltverbrechen. Von hier aus hat man einen Panoramablick über die Stadt, die Dächer und Baukräne, bis hin zu der dunklen Erhebung des Cave Hill in der Ferne. Ich beobachte, wie die Wolken hinter dem Hügel aufziehen, als der Detective eintrifft. Er ist in den Fünfzigern, trägt einen zerknitterten Anzug und hat ein markantes Gesicht mit tiefen Falten. »DI Fenton«, stellt er sich vor und schüttelt mir die Hand. »Wir sind froh, dass Sie zu uns gekommen sind, Tessa.«
Er öffnet einen Notizblock, sucht in seinen Taschen nach einem Stift. Diese Desorganisation könnte Taktik sein, denke ich, ein Mittel, um die Leute zu beruhigen.
»Ich habe gehört, Sie möchten über Marian Daly sprechen«, sagt er, und ich runzle die Stirn. Er sagt ihren Namen, als sei sie eine bekannte Persönlichkeit. »Können Sie für die Aufnahme Ihre Beziehung zu Marian angeben?«
»Sie ist meine Schwester.«
»Wissen Sie, wo Marian im Moment ist?«
»Nein.«
Ich hätte gern gesagt: Eigentlich wissen wir, wo sie ist. An der Küste, in der Nähe von Ballycastle, sie wandert auf dem Klippenpfad und ist auf dem Weg nach Dunseverick Castle.
»Sie fuhr mit einem weißen Mercedes Sprinter an der Tankstelle in Templepatrick vor«, fährt er fort. »Haben Sie dieses Fahrzeug schon einmal gesehen?«
»Nein.« Marian fährt einen gebrauchten Polo, an dessen Rückspiegel ein Amulett gegen den Bösen Blick hängt. Natürlich ist so etwas Unsinn, aber man kann es ihr nicht verübeln. Ihr Krankenwagen war schon bei genug Verkehrsunfällen im Einsatz, und sie hat stundenlang auf Glasscherben am Rand einer Autobahn gehockt.
»Sind Sie sicher?«
»Ja.« Meine Ohren klingeln immer noch.
»Wann ist Ihre Schwester der IRA beigetreten?«, will er dann wissen.
»Sie ist nicht in der IRA.«
Der Detective legt den Kopf schief. Hinter dem Fenster kräuseln sich die Wolken über den Wohnblocks. Der Verkehr kriecht zäh über den Westlink.
»Sie war heute Nachmittag an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt«, entgegnet er. »Die IRA hat sich dazu bekannt.«
»Marian ist kein Mitglied der IRA.«
»Es kann einen wie ein Schock treffen«, sagt er, »wenn man erfährt, dass jemand, den man liebt, sich ihnen angeschlossen hat. Selbst wenn man das als völlig untypisch für die Person hält.«
»Ich stehe nicht unter Schock«, sage ich, wohl wissend, wie wenig überzeugend das klingt, wenn mein Gesicht und mein Hals von Tränen klebrig sind und der Kragen meines Kleides feucht ist.
»Warum war Marian mit diesen Männern an der Tankstelle?«
»Sie müssen sie gezwungen haben, mit ihnen zu gehen.« Er antwortet nicht, und ich setze hinzu: »Die IRA zwingt die Leute ständig, etwas für sie zu tun.«
»Marian war bewaffnet«, erwidert der Detectiv. »Wenn das, was Sie sagen, zuträfe, warum sollten sie ihr eine Waffe geben?«
»Sie wissen, dass das üblich ist. Sie zwingen die Leute dazu, für sie zur Strafe Menschen zu erschießen.«
»Als Teil ihrer Rekrutierung«, sagt er. »Wurde Marian angeworben?«
»Nein, natürlich nicht. Sie müssen sie bedroht haben.«
»Ihre Schwester hätte um Hilfe bitten können. Sie war während des Überfalls auch von anderen Personen umgeben.«
»Es waren zwei Männer bei ihr, und beide hatten Waffen. Wie hoch schätzen Sie ihre Chancen ein?«
Der Detective betrachtet mich schweigend. Draußen drehte sich einer der Baukräne langsam unter dem schweren Himmel. »Wollen Sie sagen, Ihre Schwester wurde entführt? Wollen Sie eine Vermisstenanzeige aufgeben?«
»Ich sage nur, sie wurde gezwungen.«
»Marian hat ihren Entschluss, sich der IRA anzuschließen, wohl für sich behalten.«
»Sie erzählt mir alles«, behaupte ich. Der Detective sieht mich mitleidig an.
Ich denke an Marians Wohnung, an das Stück Seife neben ihrem Waschbecken, an die Lebensmittel und die Schachteln mit Kräutertee in ihren Schränken, an die Schnur mit Gebetsfahnen am Fenster, an die Sanitäteruniform in ihrem Schrank, an die Stiefel neben der Tür.
»Marian ist keine Terroristin. Wenn sie mitspielt, dann nur, damit sie ihr nichts tun. Sie gehört nicht zu ihnen.«
Der Detective seufzt. »Möchten Sie einen Tee?«, fragt er dann. Ich nicke, und kurz darauf kommt er mit zwei kleinen Plastikbechern zurück.
»Danke.« Ich reiße ein Päckchen Zucker auf, und plötzlich kommt es mir fast unheimlich vor, etwas so Gewöhnliches zu tun, während meine Schwester verschwunden ist. Der Detective trägt einen Ehering. Ich frage mich, ob er Kinder hat oder Geschwister.
»Wo sind Sie und Ihre Schwester aufgewachsen?«, fragt er über den Rand seiner Teetasse hinweg.
»Andersonstown.«
»Das ist eine ziemlich miese Gegend, stimmt’s?«
»Es gibt schlimmere Orte.« Meine Cousins aus Ballymurphy haben uns immer gehänselt, weil wir so vornehm wären. Die Häuser in unserer Sozialsiedlung sind zwar nur etwa einen Fuß breiter als die in ihrer, aber trotzdem.
»Hoher Anteil von Alkoholikern«, fährt der Detective fort. »Hohe Arbeitslosigkeit.«
Er versteht das nicht, er ist nicht aus unserer Gemeinde. Mitten in der Silvesternacht traten alle Bewohner unserer Siedlung nach draußen, wir bildeten einen Kreis entlang der Straße und sangen gemeinsam »Auld Lang Syne«. Nach dem Verschwinden meines Vaters schenkten unsere Nachbarn uns Geld, damit wir uns über Wasser halten konnten. Meine Mutter wohnt immer noch dort, und sie tat dasselbe für ihre Nachbarn, als die eine Durststrecke hatten. Niemand muss lange darum bitten.
»Welcher Religion gehört Ihre Familie an?«, fragt er.
»Ich bin Agnostikerin«, erwidere ich.
»Und die anderen?« Er ist geduldig.
»Katholisch.« Aber das wusste er natürlich schon allein wegen unserer Namen und wegen des Ortes, an dem wir aufgewachsen sind, in einer republikanischen Hochburg. Die Polizei wagt sich nur gepanzert und bis an die Zähne bewaffnet nach Andersonstown.
»Ist jemand aus Ihrer Familie in der IRA?«, fragt er.
»Nein.«
»Überhaupt niemand?«
»Unser Urgroßvater war Mitglied.« Er trat der IRA in West Cork bei und kämpfte in einer fliegenden Kolonne. Er reiste kreuz und quer über die Insel, schlief unter Hecken und führte Überfälle auf Polizeireviere durch. Es waren, wie er sagt, die glücklichsten Jahre seines Lebens.
»Hat Marian seine Vergangenheit vielleicht romantisiert?«, bohrt der Detective weiter.
»Nein«, sage ich, obwohl wir das beide getan haben, damals, als wir klein waren. Unser Urgroßvater schlief im Moor von Caher unter einem neolithischen Steintisch oder steuerte ein Boot um Mizen Head, oder er versteckte sich vor Soldaten auf einer Insel in der Bantry Bay.
»Sie und Marian kommen also aus einer republikanischen Familie?«, fragt er.
»Unsere Eltern sind nicht politisch.«
Meine Mutter war immer höflich zu den britischen Soldaten, obwohl zwei ihrer Brüder als Teenager von Soldaten verprügelt, bespuckt und getreten wurden, bis sie beide gebrochene Rippen hatten. Sie hat die Soldaten nie angeschrien, wie es einige Frauen in unserer Straße taten, oder Steine auf ihre Patrouillen geworfen. Ich verstehe jetzt, dass sie uns damit nur schützen wollte.
»Was ist mit ihren Eltern?«
Ich zucke mit den Schultern. Meine Oma war von den Bombenanschlägen während der Unruhen völlig unbeeindruckt. Ich erinnere mich, dass sie einmal mit einem Sicherheitsbeamten stritt, der versuchte, einen Laden zu evakuieren, und sagte: »Moment noch, ich hole nur schnell meine Wurstsemmeln.«
Der Detective lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Wenn er mich nach meinen Onkeln fragt, muss ich ihm die Wahrheit sagen. Meine Onkel gehen am Rebel Sunday in die Rock Bar, sie singen »Go Home British Soldiers«, »The Ballad of Joe McDonnell«, »Come Out Ye Black and Tans«. Aber sie tun nie mehr, als sich zu besaufen und Rebellenlieder zu grölen.
»Betrachtet sich Marian als britische oder irische Staatsbürgerin?«
»Irisch.«
»Wie wird ihrer Meinung nach ein vereinigtes Irland erreicht werden?«
»Auf demokratische Weise. Sie glaubt, dass es eine Abstimmung über die Grenze geben wird. Aber Marian ist nicht politisch«, fahre ich fort. Letztes Jahr musste ich sie sogar daran erinnern, zur Wahl zu gehen.
Wenn ich die Gäste in unserer Sendung erwähne, weiß sie selten, wer sie sind.
Auf der anderen Straßenseite blinkt die rote Leuchtreklame von Elliott’s Bar. Die Leute stehen draußen und halten ihre Halben in die feuchte Luft, bevor der Sturm losbricht. Ich puste auf meinen Tee, will diesen Raum nicht verlassen. Jede Nachricht über Marian wird zuerst hier eintreffen. Ich würde sogar hier schlafen, wenn sie mich lassen würden.
»Warum, glauben Sie, schließen sich Menschen der IRA an?«, erkundigt sich der Detective.
»Weil sie Fanatiker sind«, sage ich. »Oder sie sind gelangweilt. Oder einsam.«
Er dreht seinen Stift auf dem Tisch. »Wir wollen Ihre Schwester zurückholen«, sagt er. »Sie kann selbst erklären, was passiert ist, sie kann uns sagen, ob sie gezwungen wurde, aber zuerst müssen wir sie finden, richtig?«
Ich nicke. Ich muss höflich zu ihm sein. Marian und ich müssen jetzt im Einklang arbeiten, ohne zu sehen, was die andere tut – sie von innen und ich von hier draußen, als würden wir ein Schloss von der jeweils anderen Seite der Tür knacken.
»Marians Adresse lautet Eighty-Seven Adelaide Avenue. Ist das korrekt?«
»Ja.«
»Hat sie weitere Wohnsitze?«
»Nein, aber sie ist diese Woche nicht zu Hause, sie hat ein Ferienhaus an der Nordküste gemietet.«
Ich nenne ihm den Namen der Vermietungsagentur. Alles, was ich über den Ort weiß, ist, dass sich ein Wasserfall in der Nähe befindet. Marian sagte, sie sei bis zum Ende der Landzunge unterhalb der Hütte gewandert, und als sie sich umdrehte, schlängelte sich ein Wasserfall über die Spitze der Klippe. Ich möchte, dass der Detective das vor sich sieht: Marian steht allein auf einer Landzunge, in Wanderstiefeln und einer regenfesten Jacke, und beobachtet, wie das Wasser ins Meer stürzt.
»Hat jemand sie auf dieser Reise begleitet?«
»Nein.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen, seit sie weg ist?«
Ich öffne unsere Nachrichten und reiche ihm mein Handy.
Er scrollt nach oben, liest unsere Texte und hält bei dem Bild inne, das sie gestern Morgen von Ursa Minor geschickt hat. Sie hat zwei Schillerlocken in der Hand. Ich ertrage es nicht, es anzuschauen, mir vorzustellen, wie sie in einer Bäckerei sitzt, das Gebäck in sich hineinstopft, ohne zu ahnen, was gleich passieren wird.
»Sind Sie sicher, dass sie allein gefahren ist?«, fragt er.
»Ja.«
»Wer hat dann dieses Foto gemacht?«, fragt er und dreht das Handy zu mir. Auf dem Display ist das Foto von Marian, die lachend auf der Hängebrücke steht.
»Ich weiß es nicht. Sie muss einen anderen Touristen darum gebeten haben.«
»Hat Marian in letzter Zeit weitere Reisen unternommen?«
»Nein.«
»Besitzt sie Reisedokumente auf andere Namen?«
»Natürlich nicht.«
Ich weiß noch, wie verzweifelt sie nach dem Anschlag auf den Victoria Square im April war, wie verkniffen ihr Gesicht aussah. Marian hatte während des Anschlags dienstfrei, eilte aber trotzdem zu Hilfe. Die IRA