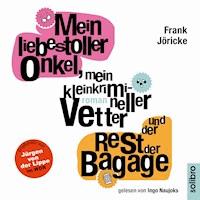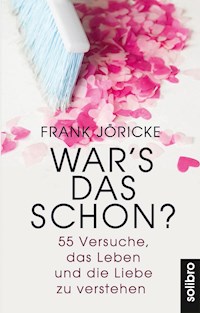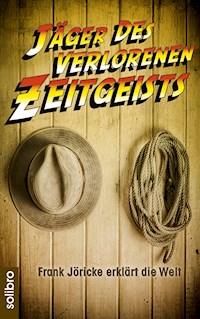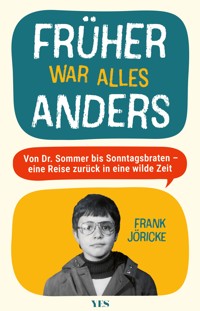
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yes Publishing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Jenseits der 40 beginnt die Nostalgie: Früher war alles… Nein, eben nicht besser, sondern anders. Man besuchte die Tanzschule, trug Schlips, aß Sonntagsbraten, ging zum Stammtisch, fuhr mit dem Reisebus nach Spanien, versandte Telegramme, schaute Schwarzweiß und den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Dann kamen Pille, Partykeller und Diskotheken, und alles veränderte sich. Der Sex sowieso, aber auch die Arbeitswelt, das Bier, die Bundesliga, das Telefonieren und und und. Heute laufen Boomer und Generation X, die letzten im analogen Zeitalter Geborenen, durch die Gegenwart und staunen: Was sich in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren alles verändert hat! Die Welt ist nicht mehr wiederzuerkennen. So müssen sich die Menschen des frühen 20. Jahrhunderts gefühlt haben, als es plötzlich Elektrizität, Autos, Telefone und Flugzeuge gab. In 60 kurzweiligen Texten, die sich jeweils einem typischen Phänomen der 60er- bis 80er-Jahre widmen, unternimmt dieses Buch den Versuch, die vor-digitale Welt zu rekonstruieren, ohne sie zu verklären. Herausgekommen ist ein ebenso amüsanter wie ehrlicher Blick auf die Zeit, in der die heutigen Älteren aufgewachsen sind: von der "Bravo" bis zur Bratensoße, vom Schlager bis zum Sendeschluss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Impressum
Quellenangabe
Die Texte erschienen zunächst im Trierischen Volksfreund, mit Ausnahme von »Hamburger Royal TS« und »Südfrüchte« (im nd) sowie »Eisdiele« und »Wirtshaus« (im Freitag«).
Originalausgabe2. Auflage 2025© 2025 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbRTürkenstraße 89, 80799 Mü[email protected] Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Marija DžafoAutorenfoto Seite 207 rechts: Michael ThielenLayout und Satz: Daniel FörstereBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-96905-368-3ISBN E-Book 978-3-96905-369-0
Inhalt
VorwortAls dieses Buch entstand
Ich bin von Beruf Werbetexter. Meine Aufgabe ist es, das Neue abzufeiern. Denn Regel Nr. 1 der Werbung lautet: »Das Neue ist stets das Bessere.«
Das ist natürlich Quatsch! Es gibt Tage, da wünsche ich mir, das Internet und die vermaledeiten Smartphones wären nie erfunden worden. Und die sozialen Netzwerke schon gar nicht. Leider wird es – fürchte ich – noch eine Generation dauern, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass TikTok gefährlicher ist als Marlboro. Da kann man schon mal wehmütig werden und aufseufzen: »Früher war alles besser.«
Das ist natürlich ebenfalls Quatsch! Immer wenn ich Gefahr laufe, die Vergangenheit zu verklären, vergegenwärtige ich mir, wie es früher wirklich war. Manches war besser, manches war schlechter, vieles war anders.
So reifte die Idee zu diesem Buch. Es sollte zunächst nur eine überschaubare Serie in einer regionalen Tageszeitung werden. Peter Reinhart, stellvertretender Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds, und ich vereinbarten einen Zwölfteiler. Ich schätze Peter als Freund und Mentor, weil er mir vor Jahren als Autor einen Weg eröffnete, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt – den des Zeitreisenden.
Nur sollte diesmal die Vergangenheit systematisch abgeklappert werden. Anhand von konkreten Beispielen wie dem Telegramm, der Vokuhilafrisur und dem Sendeschluss wollte ich veranschaulichen, was früher anders war.
Bald schon merkte ich, es gab viel mehr zu entdecken, als ich geglaubt hatte. Selbst vermeintlich zeitlose Dinge wie die Bierkultur haben einen – wie man neudeutsch sagt – »Transformationsprozess« durchlaufen. Zwar hat sich der Geschmack von Pils und Co. kaum verändert, wohl aber das Lebensgefühl, das mit Biertrinken verbunden ist. Und wer heute von Telefonieren spricht, meint etwas grundlegend anderes als in den 70ern.
Manchmal bleibt die Vergangenheit sogar sichtbar. Sie wird zum Denk-mal (drüber nach, wie die damals tickten). Hochhaussiedlungen und oberirdische Garagenlandschaften erinnern daran, was man einst unter modernem Bauen verstand. Und hier und da sieht man noch Hartplätze, auf denen Fußball ziemlich schmerzhaft sein kann.
So kam es, dass die Serie ein Eigenleben entwickelte. Leser, Freunde und Verwandte stießen mich auf Themen wie Comics, Emanzipation und Partykeller. Und vom Partykeller bis zur Diskothek ist es nur ein Gedankensprung. Da kann man schnell noch einen Zwischenstopp in der Tanzschule machen. Aber besser nicht im Reisebus. Es war ein Abenteuer, in den 80ern an die Costa Brava zu fahren.
Am Ende war aus dem geplanten Zwölfteiler eine Serie geworden, die über ein Jahr lief – und dieses Buch. Wenn Ihnen das Lesen so viel Freude bereitet wie mir das Schreiben, dann finde ich das »superdufte« (Chris Roberts, »Chiquita Ho«, 1974) und »affenaffengeil« (Bruce & Bongo, »Geil«, 1986).
PartykellerAls unten der Punk abging
Sie waren zu früh am Start gewesen. Vor den großen Erschütterungen. In ihrer Jugend hörten sie schwüle Schlager und biederen Rock ’n’ Roll. Peter Kraus (»Sugar Baby«), Freddy (»La Paloma«), Ted Herold (»Moonlight«). Selbst Elvis war brav geworden und radebrechte »Muss i denn zum Städtele hinaus« (»Wooden Heart«). Schmalz der 50er und frühen 60er, der heute ein wenig streng riecht. Seltsam muffig.
Als endlich das Gewitter namens Beatles losbrach, da war es zu spät – der sogenannte »Ernst des Lebens« hielt die in den Vorkriegs- und Kriegsjahren Geborenen bereits in seinem Würgegriff. Schlechtes Timing. Sie hatten das Aufregendste verpasst. Wie eine Party, die man verlässt, kurz bevor sie richtig losgeht.
Statt zu feiern, klotzten sie ran. Beruf, Ehe, Kinder, Hausbau, am besten alles gleichzeitig. Das volle Programm. Was heuer viele erst mit 35, 40 angehen, absolvierten sie bereits mit Mitte 20. Doch während sie Betonwände hochzogen, wurden anderweitig Mauern eingerissen. Am Rande – durch das Fernsehen und Illustrierte wie den Stern – bekamen sie mit, dass die Welt dort draußen gerade explodierte. Swinging London, Woodstock, Studentenunruhen, Kommune 1. Allenthalben Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll (aber der wilderen Art). Im Radio schrie Mick Jagger »I can’t get no satisfaction«, und Jim Morrison raunte »Come on, baby, light my fire«.
Und siehe da, das Feuer war auch in ihnen, den Zu-früh-Geborenen, entzündet. Selbst wenn sie es sich nie eingestanden hätten: Insgeheim beneideten sie die Hippies. »Freie Liebe«, das klang zu verlockend. Vor allem, wenn die eigene Ehe zur lustfreien Zweckgemeinschaft geworden war. Da kam ihnen die Idee mit dem Partykeller. Er sollte ihr altes Leben mit der neuen Zeit versöhnen.
Heraus kam ein Zeitgeistzwitter, den sich kein Filmemacher auf LSD hätte ausdenken können. Das fing schon an bei der Möblierung. Für die selbst gezimmerte Theke – nach Möglichkeit mit eigener Zapfanlage – verwendete man bevorzugt Schwartenbretter, also Latten mit Rinde. Die waren nicht nur günstiger (schließlich musste der Baukredit fürs Haus noch abbezahlt werden), sondern verliehen der Kellerbar auch das Flair einer Holzfällerhütte.
Wer es sich leisten konnte, baute separate Sitzecken und Couchlandschaften ein, die den 70er-typischen Mut zu knalligen Farben bewiesen. Doch zur Not taten es auch die Schenkungen der buckligen Verwandtschaft: durchgesessene Sessel und Sofas, die auf diese Weise dem Sperrmüll entgingen. Man platzierte sie in dunkleren Ecken; so fiel nicht auf, dass auch das Design in die Jahre gekommen war.
Auf der Höhe der Zeit war hingegen die Technik. Wenn man schon zu alt für Diskotheken war, dann sollte wenigstens die Lichtorgel das Feeling dieses unerreichbaren Ortes simulieren. Auch auf guten Sound legte man wert. Eine Hifi-Stereoanlage mit integriertem Plattenspieler musste es schon sein. Manche beklebten die Kellerwände zusätzlich mit Eierkartons, damit es nicht so hallte. Das brachte zwar in puncto Schallschutz gar nichts (die Reihenhausnachbarn bekamen dennoch die volle Dröhnung der 2 × 25-Watt-Boxen ab), sah aber futuristisch aus.
Diese groteske Mischung aus Gelsenkirchener Barock, krachgemütlicher Jägerstube und 70er-Bad-Taste komplettierten Spielgeräte. Für den Teenager im Manne wurden ein ausrangierter Flipper und ein Kicker mit Hartbällen aufgestellt. Und zur Reaktivierung süßer Kindheitsgefühle diente ein Drehspender, der kandierte Erdnüsse auswarf.
Natürlich gab es nicht nur Knabbergebäck. Um die Unmengen an Alkohol zu verdauen, benötigten die Feiernden eine fettige Unterlage. Daher wurde schüsselweise Kartoffel- und Nudelsalat aufgefahren, der in Mayonnaise ertrank. Wer demonstrieren wollte, dass er die feine Küche beherrschte, nutzte Letztere auch für die in Schinken eingewickelten Spargelröllchen. Als Häppchen standen Käse- und Mettigel bereit. Die Party konnte beginnen.
Natürlich hatte man nichts gegen moderne Rock- und Popmusik. Aber konnte sie nicht etwas gemäßigter sein, vielleicht mit weniger elektrischen Gitarren, dafür mit mehr Geigen und Trompeten?
Der Wunsch wurde erhört. Mit seinen Non Stop Dancing-Platten lieferte James Last über Jahre hinweg den Klangteppich für die Partykeller der Nation. Es war Gute-Laune-Musik zum Fußwippen, nicht zum Abrocken – man war schließlich kein Teenager mehr. Das Orchester verpasste jedem Hit ein »Happy Sound«-Gewand. Selbst härtere Stücke wie »Honky Tonk Women«, »Ballroom Blitz« und »Radar Love« mutierten auf diese Weise zur Schwofmucke. Und die James-Last-Version von »Je t’aime …« hätte sogar Radio Vatikan gespielt.
Doch in Verbindung mit dem reichlich fließenden Alkohol – man sollte Asbach-Cola nicht unterschätzen – entfaltete der jugendfreie »Happy Sound« die gewünschte enthemmende Wirkung. Zu vorgerückter Stunde machte manch frustrierte Ehefrau die Erfahrung, dass der Mannschaftskollege des Gatten nicht nur gut Fußball spielen konnte. Im Idealfall knutschte und fummelte auch der Herr Gemahl fremd. So würden am nächsten Tag die Schuldzuweisungen ausbleiben.
Und wenn am Ende alle beim Bäumchen-wechsle-Dich mitspielten? Umso besser! Dann hatte der Partykeller seinen Zweck erfüllt. Wenigstens einen Abend lang hatte man sich wie Mick Jagger gefühlt. Zumindest ein bisschen, während »I Can’t Get No Satisfaction« im Hintergrund lief, natürlich von James Last.
TelefonierenAls heiße Telefonate 20 Pfennig kosteten
1876 meldete der Amerikaner Alexander Graham Bell eine Apparatur zum Patent an, die die Welt radikal veränderte: den Fernsprecher. Allerdings sollte es noch 100 Jahre dauern, bis auch meine Großtante ein solches Gerät ihr Eigen nennen durfte.
Ihr Eigen? Natürlich nicht. Die Deutsche Bundespost blieb Besitzerin aller Telefone, die sie installiert hatte.
Die Deutsche Bundespost? »Jeder kennt doch diesen Ton; die Post schickt ihn durchs Telefon«, sang Andreas Dorau noch 1994 (in: »Das Telefon sagt Du«). Das war, wenige Monate bevor aus jenem riesigen Staatsbetrieb namens Deutsche Bundespost drei Privatkonzerne wurden: die Deutsche Post AG, die Deutsche Postbank AG und die Deutsche Telekom AG.
Aber wir schreiten zu schnell in der Geschichte voran. Und schnell, das war die Deutsche Bundespost nie. Man musste lange, sehr lange warten, bis das Telefon Du sagte. In den 60ern vergingen ohne Vitamin B (»ich kenn da jemanden, der könnte die Sache beschleunigen«) zwischen Antrag und Installation oft Jahre. Wenn man Glück hatte, war man der Erste in der Straße mit eigenem Telefonanschluss. Und wenn man Pech hatte, bekam die Nachbarschaft davon Wind und fragte nach, ob man das Telefon »gelegentlich« mitnutzen könne. So wurde aus einem privaten ein öffentlicher Anschluss (wenigstens das geschah schnell).
Aber mit Privatsphäre war es beim Telefonieren ohnehin nicht weit her. In vielen Haushalten befand sich der Apparat auf einer Anrichte in der Diele. So konnte man ihn von allen Räumen aus bequem erreichen – und so konnte man vor allem von jedem Raum aus mithören. Zu allem Übel war das Telefonkabel nie lang genug, um in eines dieser Zimmer zu flüchten.
Wer nicht wollte, dass Mama den aktuellen Beziehungsstatus aus erster Hand erfuhr, musste daher ein »Fernsprechhäuschen«, also eine Telefonzelle, aufsuchen. Dort konnte man bis 1980 (als Postminister Kurt Gscheidle für Ortsgespräche den 8-Minuten-Takt einführte und so zum unbeliebtesten Politiker der Republik wurde) für ganze zwei Groschen stundenlang mit Freund oder Freundin telefonieren. Zumindest theoretisch.
Die Praxis sah anders aus. Des Hinweisschildes »Nimm Rücksicht auf Wartende! Fasse dich kurz!« hätte es nicht bedurft. In der Regel klopfte bereits nach wenigen Minuten ein Ungeduldiger an die Scheibe. Darunter sogar Leute, die über ein Telefon verfügten, aber von Zeit zu Zeit den öffentlichen Münzfernsprecher aufsuchten, weil dort die Gesprächseinheit drei Pfennig weniger kostete als in den eigenen vier Wänden – Dagobert Duck lässt grüßen.
Auch fasste man sich im Winter und Hochsommer schon deshalb kurz, weil die Alternativen Erfrieren und Hitzschlag gewesen wären. Im Innern einer sonnengefluteten Telefonzelle konnten die Temperaturen auf über 60 Grad ansteigen. Da bekam die Formulierung, man habe ein heißes Telefonat geführt, eine ganz neue Bedeutung.
Zudem machte es selbst in den 90er-Jahren noch einen Unterschied, ob man innerhalb eines Ortsnetzes telefonierte oder auf der Drehscheibe erst eine Vorwahl eingeben musste. Die Entfernung war dabei nicht unwichtig. Es gab Ferngespräche bis 50, bis 200 und über 200 Kilometer.
Wenn zum Beispiel Oma Waltrude vormittags ihren Hausarzt anrief, zahlte sie 8 Pfennig pro Minute. Kontaktierte sie ihre Tochter, die im Nachbarkreis wohnte, waren es bereits rund 28 Pfennig. Und rief sie die Enkelin an, die in der nächstgelegenen Universitätsstadt studierte, wurden 60 Pfennig fällig. Immerhin: Zwischen zwei und fünf Uhr morgens hätte sie für 6 Pfennig pro Minute sogar mit Bekannten in Flensburg oder Garmisch telefonieren können. Wer unter seniler Bettflucht litt oder gern die Nacht zum Tage machte, war also tarifmäßig im Vorteil.
Zu jener Zeit, 1996, war auch das Internet noch eine teure Angelegenheit. Wer jeden Tag eine Stunde surfte, war im Monat 180 Mark an Telefongebühren los. Denn die Daten wurden über die Telefonleitung übertragen. Hierzu musste man sich per Modem am Computer einwählen. Es konnte dauern, bis die Verbindung zwischen PC und Telefonleitung hergestellt war. Irgendwann fiepte es, und man wusste, man war »drin«, also online.
Weil das Internet nun die Leitung blockierte, konnte man jedoch nicht mehr telefonieren. Damit war in Familien der Ärger vorprogrammiert. Die Tochter wartete auf den Anruf ihres Freundes, der Sohn wollte surfen, und wenn die monatliche Telefonrechnung eintraf, war auch Papa stinksauer.
In Zeiten von Smartphones und Flatrates kann man über solche Probleme schmunzeln. Wo jeder ein Handy hat, braucht es keinen gemeinsamen Festnetzanschluss. Die Jugend von heute telefoniert ohnehin kaum noch. Sie kommuniziert nicht mehr fernmündlich, sondern schriftlich. »Kannst du mir deine Nummer geben, dann können wir über WhatsApp schreiben«, ist so ein typischer Teenagersatz, den kein Mensch jenseits der 40 begreift. Warum sollte man sich Nachrichten schicken, wenn man telefonieren kann? Und vor allem: Wie lassen sich per Kurztext Beziehungsprobleme besprechen, für deren Lösung man früher stundenlange Telefongespräche brauchte?
ZigarettenAls Kippen den Liebespfad teerten
Ein Text über Zigaretten? Das geht nicht ohne Warnhinweis: Die Lektüre gefährdet Ihr seelisches Gleichgewicht. Falls Sie militanter Nichtraucher sind, wird Ihr Kopf danach qualmen – vor Wut. Denn es wird darin das Hohelied auf die Zigarette gesungen. Und das, obwohl ich selber Nichtraucher bin.
Wobei dies, streng genommen, nicht stimmt. Bis in die 90er- Jahre hinein war es unmöglich, Nichtraucher zu sein. Passiv rauchte man überall mit. Ob Kinder anwesend waren, interessierte keine Sau. Die Leute qualmten in der Schule, im Krankenhaus, im Restaurant, im Büro und sogar im Auto. Niemand nahm Anstoß daran, wenn sich der Fahrer eines voll besetzten Käfers eine Zigarre anzündete und die Mitreisenden in eine Rauchwolke einhüllte. Die Scheiben blieben dabei selbstverständlich zu – mit Durchzug war nicht zu spaßen.
Natürlich wurde auch in den eigenen vier Wänden gequarzt. Nie wäre der Gastgeber auf die Idee gekommen, sein Wohnzimmer zu verlassen, um sich auf Balkon oder Terrasse eine anzustecken. Wer rauchte, ließ die Gäste an seiner Sucht teilhaben.
Was aber kein Problem darstellte. Vor allem in den 60ern und 70ern rauchte gefühlt jeder. Zigaretten galten als Grundnahrungsmittel. Da lag es nahe, dass Finanzminister Helmut Schmidt 1972 mithilfe von Glimmstängeln veranschaulichte, was Geldentwertung bedeutet: »Inflation ist, wenn die Schachtel Zigaretten fünf Mark kostet.«
Das Beispiel verstand jeder. Sogar Kinder. Schließlich zog der Nachwuchs am Automaten um die Ecke regelmäßig »Kippen für meine Eltern« (wovon diese nicht immer wussten). Die Packung kostete damals übrigens zwei Mark. Heute zahlt man umgerechnet 16 Mark.
Zwar verbot der Staat bereits 1975 Zigarettenwerbung in Rundfunk und Fernsehen, doch zugleich verdiente er kräftig an der stetig steigenden Tabaksteuer. Eine Nation von Nichtrauchern war nicht im Sinne des Bundeshaushalts. Und auch wenn die Volksgesundheit unter Teer und Kondensat litt, so tat es doch der kollektiven Psyche gut.
Im Zeitalter des Individualismus (»Unterm Strich zähl nur ich«) wird gern vergessen, dass der Mensch ein Herdentier ist. Er rottet sich in Gruppen zusammen, um stärker zu sein. Wenn es dabei um Weltanschauungen, Staatenzugehörigkeiten und Glaubensfragen geht, kann dies unangenehm enden. In Europa führte man 30 Jahre lang Krieg gegeneinander, weil sich Katholiken und Protestanten nicht einigen konnten, wer den besseren Draht zum Allmächtigen hatte. Nach Millionen von Toten und der Entvölkerung ganzer Landstriche verständigte man sich – Gott sei Dank! – auf ein Unentschieden.
Da ist die Gruppe der Raucher doch wesentlich friedvoller. Schüler, die pafften, lernten frühzeitig Toleranz. In der Raucherecke fanden sich Ökos, Popper, Gruftis und weitere Vertreter der verschiedenen Jugendkulturen notgedrungen zusammen und machten dabei die Erfahrung: Das gemeinsame Laster war stärker als unterschiedliche ästhetische und ethische Vorstellungen. So erfuhren Teenager durch den blauen Dunst, dass es in der Welt nicht nur Schwarz und Weiß gab.
Auch zwischen den Geschlechtern vermochte die Zigarette Großes zu leisten. Viele Menschen sind leider schüchtern bis zur Selbstlähmung. Sie verzweifeln über der Frage, wie man das Polarmeer zum Objekt der Begierde durchqueren könnte. Oft wird der erste Satz, der das Eis brechen würde, nie ausgesprochen. Raucher haben es in dieser Hinsicht einfacher. Aus der beiläufigen Frage »Haste mal ’ne Kippe?« entwickelte sich nicht selten eine Beziehung mit Feuer. Und da beide rauchten, störte sich auch keiner am Geruch des anderen.
Ohnehin ist es an der Zeit für eine Ehrenrettung des Zigarettenqualms. Wer heute ein Nichtraucherlokal betritt, macht eine irritierende Erfahrung: Es riecht unangenehm. Eine seltsame Mischung aus Schweiß, abgestandenem Bier und aufdringlichem Parfüm – um nur die primären Duftnoten zu nennen. Da sehnt man sich nach der guten alten Raucherkneipe zurück. Gnädig verschluckte der Zigarettenqualm alle anderen Gerüche.
Und da die Nase sich schon in Kindheitstagen an den Tabakrauch gewöhnt hatte, störte er auch nicht weiter. Selbst am Morgen danach nicht – warum hätte man die qualmdurchsetzte Jacke lüften oder gar waschen sollen! So trug man den alten Rauch in den Alltag. In Klassenzimmer, Hörsäle und Büros. Und falls es doch mal ein wenig müffelte? Dann zündete man sich einfach eine an, und schon roch man nach frischem, neuem Tabakrauch.
KinderserienAls den Erwachsenen eingeheizt wurde
Nein, es war keine heile Welt, in die wir hineinwuchsen. Das wurde uns schon in der Grundschule klar. Die Backpfeifen des Rektors hallten zuhause noch nach. Und wenn der Musiklehrer das Ohrläppchen umdrehte, gaben die kindlichen Opfer Töne von sich, die in keinem Gesangsbuch zu finden waren.
Wir hielten dies für normal. Das Wort »Mikroaggression« hätten wir nicht verstanden; für uns gab es nur »voll auf die Zwölf«. Wir wussten, wem wir auf dem Schulhof besser kein Juckpulver (also Hagebuttenkerne) in den Rückenausschnitt steckten, wenn wir die große Pause unversehrt überstehen wollten. Und wir bekamen mit, wessen Eltern eher wenig von gewaltfreier Erziehung hielten.
Doch Erwachsene waren ohnehin der natürliche Feind. Sie verjagten uns von öffentlichen Grünflächen, sobald wir die Fußspitze draufsetzten, und sie schrien uns zusammen, wenn ein Ball mal gegen ein Garagentor prallte. Manchmal genügte schon unsere bloße Anwesenheit, um sie grantig und pampig werden zu lassen. Ihre chronische Übellaunigkeit legte nahe, dass sie Kinder nicht mochten. Und von dieser Sorte Mensch gab es viele.
Aber wir hatten Verbündete. Wir brauchten nur sonntags um 14 Uhr das Fernsehen einzuschalten; dann lief im ZDF die Rappelkiste. Dort hieß es gleich im Intro: »Willste übern Rasen laufen, musst du dir ’n Grundstück kaufen, spielste mal im Treppenhaus, schmeißt dich gleich der Hauswart raus.« Zwar verstanden wir nicht ganz, was mit der Aussage »Grundstück kaufen« gemeint war, doch wir begriffen, dass jene singenden Dreikäsehochs die gleichen Erfahrungen gemacht hatten wie wir. Was die Rappelkiste allwöchentlich zeigte, waren Griesgrame, die Kinder immer wieder schurigelten und anblafften. Vor allem, wenn es um die heilige Mittagsruhe ging.
Was also tun? Auch hier hielt das Fernsehen die passende Antwort bereit: Man musste den Erwachsenen die Stirn bieten. Dafür brauchte man kein halbstarker Teenager (der uns genauso wenig mochte) mit Jeansjacke und frisiertem Moped zu sein. Schon ein neunjähriges Mädchen war in der Lage, sich gegen Autoritätspersonen wie Lehrerinnen und Polizisten zu behaupten – vorausgesetzt, es hieß Pippi Langstrumpf. Ja, sogar ein Fünfjähriger konnte die Erwachsenen an der Nase herumführen, wenn er so pfiffig war wie Michel aus Lönneberga.
Doch niemand ging so weit wie Karlsson vom Dach. Seine Selbsteinschätzung, »Ich bin ein schöner und grundgescheiter und gerade richtig dicker Mann in meinen besten Jahren«, möchte man heute nicht mehr uneingeschränkt teilen. Tatsächlich ist Karlsson – psychologisch betrachtet – ein narzisstischer Egomane mit einem gestörten Verhältnis zur Wahrheit und zudem ein Raffzahn und Gierschlund. Als es darum geht, neun Zimtschnecken gerecht aufzuteilen, lässt er den kleinen Lillebror wissen: »Jeder bekommt sieben. Ich hab meine sieben schon.« Damit nicht genug entwickelt er bisweilen ein geradezu sadistisches Vergnügen, Menschen zu ärgern und zu quälen (z. B. Fräulein Bock, den »Hausbock«).
Und dennoch war dieses zutiefst unsympathische Wesen der Held unserer Kindheit. Zum einen, weil auch wir gern einen versteckten Rückzugsort auf dem Dach gehabt hätten, zum anderen, weil Karlsson sich von niemandem etwas gefallen ließ, sondern zurückschlug. Dafür verehrten wir ihn. Er beherzigte die Pippi-Langstrumpf-Devise: »Ich mach mir die Welt, widdewidde, wie sie mir gefällt.«
Wie gerne hätten wir den beiden nachgeeifert! Zumal uns auch Zeichentrickserien vorführten, dass es im Leben nicht darauf ankam, wie alt man war. Der kleine Wickie demonstrierte den ausgewachsenen Wikingerkolossen in schöner Regelmäßigkeit, dass eine gute Idee mehr wert sein konnte als Muskelkraft und rohe Gewalt.
Sagte ich »der« Wickie? Noch heute wird im Internet darüber debattiert, ob Wickie ein Junge oder Mädchen ist. Letzteres legen nicht nur die langen Haare und das »unmännliche« Auftreten nahe, sondern auch die Titelliedzeile »Zieh fest das Segel an«, die sich gesungen anhört wie »sie fasst das Segel an«.
Gewundert hätte es uns nicht. In Zeichentrickserien der 70er- Jahre waren Mädchen das klügere Geschlecht. Hier lernten schon Wackelzahnkinder, was Emanzipation bedeutet. Gegen Heidi und die Biene Maja machten der Ziegenpeter und Willi keinen Stich. So wurde im Kinderprogramm die Gleichberechtigung vorweggenommen. Feministisch betrachtet war Pippi Langstrumpf eine Hardcore-Emanze.
Auf diese Weise entstand eine paradoxe Situation. Das Kinderfernsehen präsentierte eine Welt, in der die Unterjochten die Oberhand behielten. Selbst in der Rappelkiste zeigten die Kinder den Erwachsenen zu guter Letzt, wo der Hammer hing. Aber diese Happy Ends hatten mit unserer Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun. Dort gab es keine Villa Kunterbunt, in der wir Kleinen das Sagen gehabt hätten.
Und doch verfehlten die Serien ihre Wirkung nicht. Pippi, Wickie & Co. hatten uns gedanklich infiziert. Wir würden es später als Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Vorgesetzte besser machen. Deshalb gibt es heute in Deutschland Hunderte von Villa Kunterbunts. Die meisten von ihnen sind Kitas oder Betreuungseinrichtungen für Grundschüler. Ich bin mir sicher, dass sie einen hohen pädagogischen Anspruch haben und dass dort gute Arbeit geleistet wird. Aber ich glaube nicht, dass Pippi Langstrumpf sich dort wohlfühlen würde.
Garage, oberirdischAls das Auto zur Familie gehörte
Das Auto war mal unser Freund. Nein, mehr noch, es war unser Glücksbringer. Im wörtlichen Sinn: Es brachte uns dorthin, wo das Glück war. Zu Stätten und Städten, die viel aufregender waren als das Dorf oder Viertel, in dem wir tagein, tagaus lebten – und zwar ratzfatz! Strecken, für die wir zu Fuß sechs Stunden gebraucht hätten, bewältigte es in 20 Minuten. Ohne zu murren. Niemals muckte es auf oder stellte sich quer.
Eine Spaßbremse war es definitiv nicht. Eher der Kumpel, der für alles zu haben war. Es brachte uns zu entlegenen Partys und Clubs, zu Badeseen und Freilichtfestivals. Selbst wenn wir um Mitternacht auf die absurde Idee verfielen, man könne ja mal Paris besuchen, war es sofort startklar und raste los. Im Gegenzug verlangte es lediglich ein bisschen Sprit. Was verständlich war. Wer derart Gas gab, bekam zwangsläufig Durst.
Das Auto war unsere Verbindung zu einer Welt, die uns sonst verschlossen geblieben wäre. Zu Zeiten, als Flugreisen noch unbezahlbar waren, eröffnete es neue Horizonte. Unsere Großeltern und Eltern konnten erst durch das Auto mobil werden. So lernten sie Italien kennen. Und wenn sie wieder nach Hause kamen, hatten sie nicht nur diese seltsamen langen Nudeln namens Spaghetti kennengelernt, sondern auch ein anderes Lebensgefühl. Mit einem Mal erkannten sie: Es gibt eine Welt jenseits der Gemeinde- oder Stadtgrenzen. Das machte sie offener, aufgeschlossener und auch ein wenig freier.
Dafür waren sie dem Auto dankbar. Sie wollten, dass es ihm gut geht. Liebevoll wuschen und polierten sie es von Hand. Ja, sie bauten ihm sogar ein eigenes Haus: die Garage. In den 60ern, 70ern und 80ern, als Baugrund noch im Überfluss vorhanden und entsprechend günstig war, entstanden in Neubaugebieten auf diese Weise ganze Garagenlandschaften. Hier war das Auto sicher vor den Unbilden des Lebens.
Und wer es besonders verehrte, der integrierte die Garage ins eigene Haus. Dadurch wurde es gleichsam zum Familienmitglied. Es hatte einen eigenen Raum, der nur wenige Schritte vom Wohnzimmer entfernt war. Und wenn es draußen wie aus Eimern schüttete, saßen nicht nur Eltern und Kinder im Trockenen, sondern auch der geliebte Familienwagen.
Aber dann geschah etwas, was die Verehrung für unser Gefährt, das mit den Jahren zu unserem Gefährten geworden war, untergrub. Böse Zungen verbreiteten, das Auto mache krank. Es vergifte die Luft, zerstöre natürliche Ressourcen und trage dazu bei, dass Grünflächen zubetoniert würden. Wir bekamen ein schlechtes Gewissen.
Auch die Stadtplaner und Immobilienentwickler waren auf das Auto nicht länger gut zu sprechen. Es galt nun als Verschwendung, das teuer gewordene Bauland mit 2,50 Meter hohen Reihengaragen zuzupflastern! Viel lukrativer war es, diese Fläche mit mehrstöckigen Apartmenthäusern (inklusive millionenschwerem Penthouse) zu bebauen. Und die Autos der Bewohner? Die verfrachtete man unter die Erde. So konnte man auch noch mit dem Untergrund Geld verdienen.
Aber selbst jene, die sich noch eine oberirdische Garage leisten können, verzichten zunehmend darauf. Man ist nicht länger bereit, 10 000 Euro und mehr für das Zuhause seines Autos auszugeben. Lieber entscheidet man sich für einen günstigen Carport – einen offenen Unterstand, bei dem das Fahrzeug auch schon mal ein paar Tropfen abbekommt, wenn es unwettert. Was soll’s! Die Liebe zum Auto ist erkaltet.
Daran wird auch die E-Mobilität nichts ändern. Im Gegenteil. Tanken war ein sinnliches Erlebnis. Der Geruch von Benzin vermittelte die Illusion, man füttere ein Lebewesen. Nicht zufällig warb Esso mit dem Slogan »Pack den Tiger in den Tank!«. Ein Stecker, der in einer Buchse landet, dürfte kaum solche Assoziationen wecken. Aber das ist eine andere Geschichte, die der Tankstellen.
SchlagerAls Peter Alexander zum Tiger wurde
Ein kleines Quiz vorab: Von welchem Liedermacher stammen die folgenden Zeilen? »Telefone, Schreibmaschinen, Ladentische, finst’re Mienen – keiner hat mehr Zeit, die Welt zu sehen. (…) Kinderlärm und Steuerprüfer, Luftverschmutzung, 1000 Spießer machen jede Stunde zum Vulkan.« Hannes Wader? Georg Danzer? Konstantin Wecker?
Alles falsch! Ich habe Sie auf eine falsche Fährte gelockt. Es war kein Liedermacher, sondern Chris Roberts in »Hab’ ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe?« (1971). Da behaupte noch einer, der Schlager hätte nichts mit Gegenwart und Wirklichkeit zu tun!