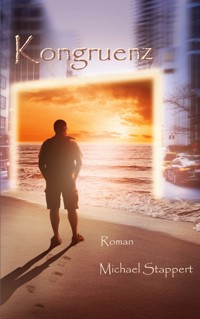Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Dinge, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben, wachsen zusammen. So gelingt es einer Gruppe von Wissenschaftlern, ein elektronisches Gerät zu entwickeln, das mit den Synapsen des menschlichen Gehirns verknüpft werden kann. Behinderte oder Unfallopfer sind dadurch wieder in der Lage, künstliche Gliedmaßen direkt durch Gedankenbefehle zu steuern, oder über elektronische Medien mit der menschlichen Gesellschaft in Kontakt zu treten. Doch auch nicht behinderte Menschen können in den Genuss dieser Technologie kommen und zukünftig von zu Hause über spezielle Internetleitungen in virtuellen Räumen ihrer Arbeitsstellen arbeiten. Es entsteht ein ungeahntes Sparpotenzial bei Firmen, die plötzlich keinen Bedarf mehr an Grundstücken und Gebäuden haben. Leider hat diese Technologie auch eine Kehrseite, wie Sascha Leyden erfahren muss, als er eines Tages vor der Wahl steht, entlassen zu werden oder sich eines der neuen Interfaces implantieren zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Michael Stappert
Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Dinge, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben, wachsen zusammen. So gelingt es einer Gruppe von Wissenschaftlern, ein elektronisches Gerät zu entwickeln, das mit den Synapsen des menschlichen Gehirns verknüpft werden kann. Behinderte oder Unfallopfer sind dadurch wieder in der Lage, künstliche Gliedmaßen direkt durch Gedankenbefehle zu steuern, oder über elektronische Medien mit der menschlichen Gesellschaft in Kontakt zu treten. Doch auch nicht behinderte Menschen können in den Genuss dieser Technologie kommen und zukünftig von zu Hause über spezielle
Internetleitungen in virtuellen Räumen ihrer Arbeitsstellen arbeiten.
Es entsteht ein ungeahntes Sparpotenzial bei Firmen, die plötzlich keinen Bedarf mehr an Grundstücken und Gebäuden haben. Leider hat diese Technologie auch eine Kehrseite, wie Sascha Leyden erfahren muss, als er eines Tages vor der Wahl steht, entlassen zu werden oder sich eines der neuen Interfaces implantieren zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: 2. Mai
2. Kapitel: 3. Mai
3. Kapitel: 5. Mai
4. Kapitel: 7. Mai
5. Kapitel: Das Kartell… Monate zuvor
6. Kapitel: Besuch bei LIBERTAS
7. Kapitel: Das Kartell beginnt mit der Arbeit
8. Kapitel: Die Operation
9. Kapitel: 10. Mai
10. Kapitel: Zwischenbericht
11. Kapitel: Dienstaufnahme
12. Kapitel: 16. Mai
13. Kapitel: Lara
14. Kapitel: LIBERTAS
15. Kapitel: 24. Mai
16. Kapitel: 26. Mai
17. Kapitel: 28. Mai
18. Kapitel: 36. Mai
19. Kapitel: 38. Mai
20. Kapitel: 40. Mai
21. Kapitel: 42. Mai
22. Kapitel: 46. Mai
23. Kapitel: 50. Mai
Begriffsbestimmungen:
1. Kapitel: 2. Mai
Sascha Leyden hatte sich schon seit einigen Tagen nicht wohlgefühlt. Er vermutete, dass er sich einen grippalen Infekt zugezogen hatte, wie er im Augenblick grassierte. Gerade jetzt, wo es innerhalb seiner Firma betriebsbedingte Kündigungen gab, passte es ihm ganz und gar nicht, möglicherweise das Bett hüten zu müssen. Er hatte lange gekämpft, bis er endlich eine Festanstellung bei der AXXIUM-Versicherungsgesellschaft bekommen hatte. Seine Freundin Conny hatte nicht so viel Glück gehabt, und hielt sich durch eine Kombination von kurzfristigen Teilzeitjobs über Wasser. Eigentlich hatten sie längst heiraten wollen, doch hatten sie es immer hinausgeschoben, weil sie zunächst eine sichere finanzielle Basis haben wollten. Wie es aussah, würde es noch eine Weile dauern, bis das erreicht war.
Sascha schaute auf seinen Computermonitor und musste sich anstrengen, dort etwas zu erkennen. Im Laufe des Tages hatte er bohrende Kopfschmerzen bekommen, die er auch mithilfe eines Schmerzmittels nicht in den Griff bekommen hatte. Inzwischen schien die Schrift auf dem Bildschirm vor seinen Augen zu verschwimmen. Verzweifelt blickte er über die zahlreichen Unterlagen auf seinem Schreibtisch, die er noch bearbeiten musste. Er fragte sich, wie er das heute schaffen sollte – oder morgen, wenn es tatsächlich die Grippe sein sollte. Sascha wusste, dass man zwar nicht entlassen werden konnte, weil man krank war, doch die Praxis sah anders aus. In diesen Zeiten fanden Arbeitgeber immer eine Möglichkeit, Arbeitnehmer loszuwerden, die keine Effektivität versprachen. Er machte sich keine Illusionen darüber, dass bereits zwei bis drei Tage Krankheit ausreichen konnten, seinen Job infrage zu stellen. Sascha griff die nächste Mappe und las die Beschreibung des Schadenfalles. Es war seine Aufgabe, Schadensfälle zu bewerten, und die Folgen einer Schadenregulierung auf die Beitragsentwicklung des Kunden zu kalkulieren. Er las den Vorgang drei Mal, doch konnte er sich einfach nicht ausreichend auf den Text konzentrieren. Er befühlte seine Stirn und fand sie schweißnass. Vermutlich hatte er Fieber. Er gehörte nur noch ins Bett.
Sascha beschloss, alles auf eine Karte zu setzen und seinen Vorgesetzten zu bitten, ihn früher nach Hause gehen zu lassen. Er klappte die Mappe zu und legte sie zurück auf den Stapel der unerledigten Akten. Er erhob sich und verließ seine Arbeitskabine, die nur durch einige Stellwände von den übrigen Arbeitsplätzen im Großraumbüro abgetrennt war. Im Gang auf dem Weg zum Büro des Leiters traf er auf Lara Schmidt, die als Mädchen für alles im Büro eine relativ sichere Arbeitsstelle hatte.
Lara war wie immer gut gelaunt. »Hallo Sascha.«
Dann umwölkte sich ihre Miene. »Geht es dir nicht gut?«
»Nein Lara, ich glaub, ich hab mir eine Grippe eingefangen. Komm mir am Besten nicht zu nah, sonst steckst du dich noch an.«
Sie rückte gleich etwas von ihm ab. »Gebrauchen kann ich's nicht, aber es ist auch keine Katastrophe, oder?«
»Na ja, wenn ich mir Harald Feininger ansehe, – er hat sich ein Bein gebrochen und wurde aus betriebsbedingten Gründen bereits am folgenden Tag entlassen – dann ist es schon eine Katastrophe.«
»Harald!«, stieß Lara verächtlich hervor. »Er hat es selbst verschuldet.«
Sascha hatte so einen abfälligen Tonfall von ihr bisher nicht gehört.
»Den Beinbruch?«, fragte er entgeistert.
»Blödsinn! Er hat alle Vorschläge der Geschäftsführung abgelehnt. Da muss er sich nicht wundern, wenn er gefeuert wird.«
Sie waren mittlerweile am Büro des Leiters angekommen. Lara hielt Sascha kurz an der Schulter fest und flüsterte ihm ins Ohr: »Flexibilität ist der Schlüssel, Sascha. Mach da drin keinen Fehler. Kurier dich aus, aber sei flexibel. Du bist nett. Ich würde es nicht gern sehen, wenn du nicht mehr hier wärst.«
Lara ließ seine Schulter los und tänzelte auf ihren langen Beinen den Gang hinunter. Sascha stieß die Luft aus und sah ihr hinterher. Sie war durchaus eine Augenweide. Er machte sich von dem Anblick los. Ihm reichten die Probleme, die er bekommen hatte, als Conny ihn kürzlich von der Arbeit abgeholt hatte, und ihn mit Lara aus dem Haupteingang kommen sah. Sie konnte so entsetzlich eifersüchtig sein. Aber was hatte Lara eben gemeint?
Sascha klopfte an die Tür des Vorgesetzten, wartete einen Augenblick und öffnete, als er nichts hörte, vorsichtig die Tür.
Der Leiter der Schadenabteilung, Ryan Foster, kam von der englischen Muttergesellschaft und hatte sich zum Ziel gesetzt, seine Abteilung zum Aushängeschild der deutschen Niederlassung zu machen. Er blickte fragend von seiner Arbeit auf. »Herr Leyden, kommen sie herein, was kann ich für sie tun?«,
Wie immer begleitete ein breites Lächeln seine Worte. Sascha trat ein und schloss die Tür. Er setzte sich auf einen freien Stuhl vor dem Schreibtisch und sagte: »Herr Foster, ich fühle mich nicht gut.«
Foster lächelte immer noch. »Und warum erzählen sie mir das? Sie wollen doch nicht etwa Urlaub beantragen? Sie sind meines Wissens noch kein halbes Jahr in Ihrer jetzigen Position, da steht Ihnen ein Erholungsurlaub nicht zu.«
»Nein Herr Foster, das ist mir klar, aber ich habe mir eine Grippe eingefangen. Ich bin krank und wollte nach Hause gehen, um mich auszukurieren.«
Das Lächeln verschwand aus Fosters Gesicht. »Herr Leyden, ich habe sie bisher als zuverlässigen Mitarbeiter kennengelernt. Aber sie wissen auch, dass wir uns in einer schwierigen Wirtschaftslage befinden. Überall muss gespart werden. Wir alle müssen Opfer bringen. Überlegen sie, ob es die Sache Wert ist, daheimzubleiben und die Firma im Stich zu lassen.«
»Ich will doch nicht die Firma im Stich lassen!«, brauste Sascha auf. »Es kann doch nur im Sinne der Firma sein, wenn ich nach einem oder zwei Tagen wieder voll einsatzfähig bin.«
»Wenn sie dann wieder arbeiten können, mag das sein, Herr Leyden – aber was, wenn es länger dauert? Dann entsteht unserem Unternehmen bereits ein Schaden, dem wir unter Umständen nur entgehen könnten, indem wir sie durch einen gesunden Mitarbeiter ersetzen. Sie wissen selbst, dass es genügend Menschen gibt, die nur darauf warten, ihren Job ebenso gewissenhaft zu erledigen, wie sie es bisher getan haben.«
Sascha war entsetzt und hatte das Gefühl, alles zu verlieren, wenn er nicht mitspielte. Er war jedoch nicht bereit, kampflos aufzugeben und machte einen letzten Versuch. »Wenn ich könnte, würde ich mich sofort zurück an meinen Platz setzen, Herr Foster. Aber heute geht es einfach nicht, selbst dann nicht, wenn sie mir drohen.«
Foster schüttelte den Kopf. »Ich drohe ihnen doch nicht, Herr Leyden – ich zeige nur auf, wie die Situation derzeit ist. Ich weiß doch selbst, dass sie…«
Foster hielt inne und überlegte einen Augenblick. »Sagen sie, besitzen sie eigentlich ein Interface?«
»Natürlich hab ich zu Hause einen Computer mit Internetzugang.«
Foster winkte ab. »Nein, das meine ich nicht. Mir ist klar, dass sie einen Internetzugang haben – schließlich ist das seit zwei Jahren Pflicht. Was ich meine, ist ein Interface.«
Foster sah ihn an und stellte fest, dass er überhaupt nicht zu wissen schien, wovon er sprach.
»Sie müssen doch davon zumindest gehört haben«, sagte er vorwurfsvoll. »Eine Schnittstelle direkt zum Gehirn. Es wird seit fast zwei Jahren häufig bei Menschen eingesetzt, die körperliche Gebrechen haben, um ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.«
Sascha überlegte. »Doch davon habe ich gehört. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin schließlich nicht gebrechlich, sondern nur ein bisschen krank.«
Foster sah ihn intensiv an. »Herr Leyden, das ist nicht der Punkt. Flexibilität ist das Stichwort. Sie wollen doch flexibel sein, oder?«
Sascha fiel der Satz von Lara wieder ein. Sie hatte ihm vorhin vor der Tür dasselbe gesagt. Vorsichtig sagte er: »Sicher bin ich flexibel. Deshalb hatte ich mich ja auch bei AXXIUM beworben, aber ich verstehe immer noch nicht…«
Foster setzte erneut sein bekanntes Lächeln auf und griff in seine Jackentasche. Er zog ein kleines Kärtchen heraus und reichte es Sascha. »Sie werden es verstehen, junger Mann. Nehmen Sie diese Karte und suchen Sie die aufgedruckte Abteilung auf – am Besten noch, bevor sie nach Hause gehen. Betrachten Sie es als Chance für ihre Zukunft.«
Sascha wollte noch eine Frage stellen, doch Foster machte deutlich, dass das Gespräch beendet war. Also erhob er sich und wandte sich zur Tür.
»Erholen sie sich Herr Leyden«, sagte Foster. »Aber denken Sie an die Karte. Wir reden weiter, wenn Sie wieder zurück im Dienst sind.«
Vor der Tür betrachtete Sascha die Karte und las die aufgedruckte Adresse:
AXXIUM – Development Inc., medizinische Interface-Installation, Dr. Med. Paul Görtgen.
Es war dieselbe Adresse wie seine Arbeitsstätte, demnach musste Dr. Görtgen im selben Gebäude sein. Es war ihm noch nie aufgefallen, aber im Info-Terminal am Eingang musste ja verzeichnet sein, wo er zu finden war. In diesem Moment schwebte Lara an ihm vorbei. »Nun, wie habt Ihr Euch geeinigt?«
Dann bemerkte sie die Karte in seiner Hand und lächelte verschwörerisch. »Ich wusste, dass Du nicht so ein Schlappschwanz bist wie Harald.«
Sie zwinkerte ihm zu und deutete einen Kuss an und tänzelte davon. Sascha wusste nie, wie er Lara einschätzen sollte. Wollte sie etwas von ihm, oder spielte sie eines ihrer üblichen Spielchen. Aber was sollte es auch? Er hatte ja schließlich Conny und würde nie etwas mit Lara anfangen.
Sascha kehrte noch einmal zu seinem Arbeitsplatz zurück und holte Jacke und Aktentasche, dann ging er zu den Aufzügen. Intensiv studierte er die Beschriftungen der einzelnen Stockwerke und fand endlich, wonach er suchte: Dr. Med. Paul Görtgen, Interf.-Inst. 9. Etage.
Er hatte das Schild tatsächlich schon gesehen, ihm aber bisher keine Beachtung geschenkt. Also drückte er den Knopf neben dem Namen und fuhr in die neunte Etage. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, betrat Sascha eine andere Welt – weiß, steril und futuristisch gestaltet. Ein hübsches Mädchen an der Anmeldung fragte ihn, ob er eine Anmeldekarte erhalten habe. Sascha händigte ihr die kleine Karte aus, die er von Foster erhalten hatte – etwas Anderes hatte er ja nicht. Das Mädchen war jedoch zufrieden und tippte etwas in ihren Computer ein.
»Würden Sie mir bitte Ihre Personalnummer nennen?«
Sascha diktierte ihr die Nummer, worauf sie auf einen der Sitze in der Anmeldung zeigte. »Bitte haben Sie noch ein paar Minuten Geduld, Herr Leyden, der Doktor hat gleich Zeit für Sie.«
Sie zögerte kurz, dann fragte sie: »Hat man Ihnen schon in Ihrer Abteilung die Einzelheiten erläutert? Wissen Sie, worauf Sie sich einlassen, und haben es sich auch gut überlegt?«
Sascha, noch etwas verwirrt, wegen der Ereignisse des Morgens und die ungewohnte Umgebung, war durch diese Fragen im Augenblick völlig überfordert und stammelte: »Oh, was? Ja, ich denke schon.«
Sie zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. Sascha nahm Platz und griff nach einer der dort herumliegenden Zeitschriften. Er kam sich vor wie beim Zahnarzt. Seine Kopfschmerzen waren schon viel schwächer geworden. Sascha wusste, dass es sich hier nur um eine Art Wartezimmersyndrom handeln konnte, denn er fühlte sich noch immer fiebrig. Nach wenigen Minuten kam das Mädchen der Anmeldung aus ihrem Kommandostand heraus und trat lächelnd auf ihn zu.
»Würden Sie mir bitte folgen?« Allein dem Lächeln wäre Sascha überall hin gefolgt.
»Benimm dich nicht so verdammt unreif!«, schalt er sich in Gedanken. »Sie macht nur ihren Job, so wie du ihn da unten in der Abteilung auch machst.«
Er folgte ihr durch mehrere kurze Gänge bis in einen ärztlichen Behandlungsraum.
»Ich bringe Ihnen Herrn Leyden, Dr. Görtgen.« Sie ließ Sascha passieren und zog sich zurück.
Dr. Görtgen war ein untersetzter, etwa fünfzig Jahre alter Mann, der einen kompetenten Eindruck vermittelte. Er blickte von seinen Unterlagen auf und erhob sich. Er kam auf ihn zu und schüttelte ihm die Hand. »Sie sind also der junge Mann, der entschlossen ist, der Gruppe der Interface-Nutzer beizutreten?«
»Nun, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich hier soll«, sagte Sascha wahrheitsgemäß. Dr. Görtgen deutete auf einen Stuhl und bat ihn, sich zu setzen.
»Es ist immer dasselbe«, sagte er. »Nie erklären sie den Leuten, worum es geht. Also, ich vermute mal, sie wollten sich krankmelden – denn sie wirken nicht, als ginge es Ihnen gut.«
Er wartete die Antwort nicht ab und erzählte weiter: »In unserer gegenwärtigen Lage kann es sich kein Arbeitgeber leisten, auf die Arbeitskraft seiner Mitarbeiter zu verzichten, nur weil sie krank sind. Natürlich muss man differenzieren. Es gibt durchaus Erkrankungen, die nicht nur den Körper, sondern auch die Leistungsfähigkeit des Geistes in Mitleidenschaft ziehen. Gegen solche Fälle sind wir machtlos. In den meisten Fällen jedoch sind es einfache Infektionen, die zwar schnell vorübergehen, die jedoch dem Betrieb ihre Arbeitskraft für einige Tage entziehen. Sie kennen die Arbeitsmarktlage selbst. Normalerweise gibt es kein Arbeitsgericht in diesem Staat mehr, das einer betriebsbedingten Kündigung aus diesem Grunde Steine in den Weg legen würde. Doch gibt es seit Jahren eine Möglichkeit, diese Unpässlichkeit von Mitarbeitern zu überbrücken. Leider wurde diese Möglichkeit lange nicht als solche erkannt. Eine für behinderte und gebrechliche Menschen geschaffene Technologie hilft uns hier weiter: das Interface. Sie wissen, was das ist?«
Sascha schüttelte den Kopf. »Nicht genau. Ich weiß nur, dass es bei körperlich behinderten Menschen eingesetzt wird, um ihnen einen Zugang zum Internet zu ermöglichen, damit sie Kontakte pflegen oder im Notfall Hilfe herbeiholen können.«
»Das ist ein Aspekt der Sache«, stimmte Dr. Görtgen zu. »Aber das Interface ist weitaus mehr. Aber Sie haben durchaus recht. Man hat schwerst körperlich behinderten Menschen eine Schnittstelle implantiert, über die sie sich in neuronale Netzwerke - wie beispielsweise das Internet einklinken können. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der ab dem Halswirbel gelähmt ist. Er ist zwar noch in der Lage, verbal zu kommunizieren, aber mehr auch nicht. Oder einen Menschen mit einem Locked-in-Syndrom, der in seinem Körper gefangen ist, ohne jemals mit der Außenwelt kommunizieren zu können. Solche Menschen können plötzlich - dank der Technik - mit der ganzen Welt sprechen. Es macht sie zwar nicht gesund, aber es liefert ihnen eine neue Lebensqualität.«
»Ich verstehe noch immer nicht, was das mit mir…«
Dr. Görtgen hob eine Hand. »Dazu komme ich jetzt. Warum sollte man eine Technik, die Behinderten helfen kann, nicht auch bei gesunden Menschen einsetzen? Natürlich brauchen Sie das normalerweise nicht, aber…« er machte eine kleine Kunstpause. »... jetzt sind Sie krank und würden am liebsten zu Hause im Bett liegen, um sich auszukurieren.«
»Das hab ich bereits Herrn Foster gesagt.«
»Ja, und er hat Sie zu mir geschickt, weil er Ihnen helfen will. Wenn Sie sich bereit erklären, sich einem kleinen Eingriff zu unterziehen und ein Interface akzeptieren, wird Ihnen das ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.«
Sascha war noch immer skeptisch. »Und welche wären das konkret?«
»Es kann helfen, die Arbeit von zu Hause zu erledigen, wenn sie sich körperlich nicht in der Lage fühlen, ins Büro zu gehen.«
»Sie meinen, ich könnte von zu Hause arbeiten, ohne ins Büro zu gehen? Ich könnte mich auskurieren, und trotzdem arbeiten?«
Dr. Görtgen lachte. »Sie haben es erfasst.«
Er schaltete einen Bildschirm ein, auf dem eine schematische Darstellung von einem Mechanismus zu erkennen war.
»Das Einzige, das sie benötigen, ist dieses Interface. Es wird im Bereich des Hinterkopfes in ihr Gehirn eingesetzt und hier und hier…«, er deutete auf den Bildschirm, »... mit den Synapsen der Großhirnrinde verschweißt.«
Sascha wurde hellhörig. »Sie wollen ein Gerät mit meinem Hirn verschweißen? Er erhob sich von seinem Stuhl. »Ich denke, ich werde mir das doch lieber noch mal überlegen.«
Görtgen hob beschwichtigend seine Hände. »Nehmen Sie bitte wieder Platz. Der Begriff ’Verschweißen' hat absolut nichts mit dem Schweißen zu tun, das Sie vielleicht kennen. Es geht vielmehr darum, eine Schnittstelle zwischen dem technischen Gerät eines Interfaces zu bestimmten Nervenleitern zu erzeugen. Wir nennen es ’Verschweißen', aber in der Realität legen wir lediglich hauchfeine Leiter zu bestimmten Nervenknoten Ihres Hirns. Den Rest erledigen Hirn und Interface von allein. Es mag sich für Sie beunruhigend anhören, aber der Eingriff ist völlig ungefährlich.«
»Aber Sie müssen doch meinen Schädel dafür öffnen und am offenen Hirn arbeiten…«
Görtgen winkte ab. »Ich zeig es Ihnen. Die Wissenschaft hat enorme Fortschritte gemacht. Noch vor einigen Jahren galt das menschliche Hirn als Mysterium. Man wusste zwar, welche Regionen für welche Dinge zuständig waren, aber es gab Sektoren, deren Zweck man lange nicht begriff. Heute ist das anders, auch wenn die Öffentlichkeit das immer noch nicht glauben mag. Arbeiten am Hirn ist heute so normal wie das Schienen eines Armes. Na ja, vielleicht ist das nicht der korrekte Vergleich, aber denken Sie an die Transplantation einer Niere. Früher undenkbar und heute ein Routineeingriff.« Er drückte ein paar Tasten und die Darstellung auf dem Bildschirm änderte sich. »Das ist unser Implantator. Der Patient wird auf dem Arbeitstisch fixiert. Den Rest erledigt unser Präzionsroboter. Die betroffenen Stellen werden natürlich betäubt. Anschließend öffnet der Implantator an vier winzigen Stellen Ihre Schädeldecke und durch hauchfeine Instrumente werden die Leiter in den Zielbereichen des Hirns platziert. Das Interface selbst ist recht klein und sitzt an Ihrem Hinterkopf. Die in den Schädel gebohrten Löcher werden durch die Haltekrallen des Geräts abgedeckt und mit Biokleber steril verschlossen. In den ersten Tagen kann es noch zu leichtem Wundschmerz führen, aber dann werden Sie es überhaupt nicht mehr bemerken. Sie können weiterleben wie bisher, haben aber die Option, das Interface zu benutzen, wenn es erforderlich ist.«
Sascha schüttelte den Kopf. »Ich kann mir das nicht vorstellen. Sie bohren Löcher in meinen Schädel und das soll ungefährlich sein? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!«
Görtgen nickte. »Oh doch, das ist mein voller Ernst. Das Gerät benötigt so gut wie keinen Strom und versorgt sich durch die angeschlossene Computerschnittstelle mit der notwendigen Energie. Ein Versagen des Interfaces ist quasi ausgeschlossen. Ich habe schon viele Menschen mit diesem Hilfsmittel versorgt und bisher gab ein in keinem einzigen Fall Probleme.«
»Sie wollen ernsthaft dieses Ding da direkt in mein Gehirn pflanzen, und ich soll es dann mit einem Kabel an den Computer anschließen?«
»Zurzeit geht es leider noch nicht anders«, sagte Dr. Görtgen entschuldigend, »Wir arbeiten fieberhaft an einer drahtlosen Möglichkeit, aber alle aktuell verfügbaren Verfahren sind noch zu anfällig und würden das Gehirn schädigen, da Sender und Empfänger direkt im Gehirn liegen würden. Der kabelgebundene Anschluss hingegen ist technisch ausgereift.«
»Sie müssten mir den Schädel aufschneiden – ich könnte sterben.«
»Das Argument hört man oft, aber Sie haben mir nicht richtig zugehört. Das Verfahren wurde schon oft angewandt und es hat noch keine Komplikationen gegeben. Wir sind sogar schon so weit, es ambulant machen zu können. Sie könnten anschließend gleich nach Hause gehen, könnten sich einen Tag an das Gerät gewöhnen und anschließend würde Ihnen die ganze Welt der virtuellen Büroarbeit offenstehen.«
»Ich weiß nicht recht. So ein großer Eingriff, um einen Job nicht zu verlieren? Ist das nicht etwas viel verlangt? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ein Arbeitgeber so etwas verlangen darf.«
Görtgen lächelte schmallippig. »Ich kann die Entscheidung nicht für Sie treffen, Herr Leyden. Ich kenne nur die aktuelle Wirtschaftslage und sehe, wie Sie sich augenblicklich fühlen müssen. Natürlich verlangt die AXXIUM-Versicherung nicht von Ihnen, sich mit einem Interface ausstatten zu lassen, aber sehen Sie es doch mal realistisch: Sie würden ganz sicher für einige Tage ausfallen. Was denken Sie, wie lange man darauf verzichten würde, einen arbeitslosen Menschen mit ähnlicher Ausbildung auf Ihren Platz zu setzen? Haben Sie ein vielversprechendes Alternativangebot in der Tasche? Können Sie auf Ihren Job bei AXXIUM verzichten? Sollte das so sein, brauchen wir uns nicht weiter unterhalten - dann stehen Sie jetzt auf und gehen nach Hause. Wenn Sie aber auf Ihren Job angewiesen sind, haben Sie kaum eine andere Wahl.«
Ich schlage vor, es jetzt gleich einsetzen – was meinen sie? Der Zeitpunkt wäre ideal. Sie könnten die Zeit, die sie brauchen, um wieder fit zu werden, nutzen, um sich an das Interface zu gewöhnen.«
Saschas Gedanken kreisten. Was, wenn er den Job wirklich verlieren würde? Die Chancen, bald etwas Neues zu finden, standen schlecht und Conny allein konnte nicht genug verdienen, um ihre Rechnungen zu bezahlen.
Görtgen sah ihn prüfend an. »Viele Ihrer Kollegen haben bereits ein solches Interface und sind sehr zufrieden damit. Wenn sie es nicht brauchen, müssen sie es ja nicht benutzen. Es wird durch die Haare verdeckt und ist normalerweise kaum sichtbar. Nur, wenn sie es brauchen, wie in ihrer gegenwärtigen Situation, kann es Ihnen die finanzielle Existenz retten. Sie sind noch jung. Sie müssen auch an die Zukunft denken. Vielleicht wollen sie irgendwann eine Familie gründen. Sie wissen selbst – wenn man erst einmal aus dem Arbeitsprozess heraus ist, kommt man nur schwer wieder hinein.«
Dr. Görtgen ließ Sascha etwas Zeit, sich zu entscheiden, dann drängte er: »Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass dieses Angebot nur einmal gemacht wird. Lehnen sie jetzt ab, wird man es Ihnen als Desinteresse am Job auslegen. Ich muss nicht erklären, was das bedeutet, oder?«
»Gut, dann machen sie es«, hörte Sascha sich sagen und hatte dabei das Gefühl, als wenn jemand Anderes die Entscheidung längst getroffen hatte.
Dr. Görtgen schien nie daran gezweifelt zu haben, wie Sascha sich entscheiden würde, denn unmittelbar nach dieser Äußerung zog er ein paar Formulare aus seiner Schublade.
»Diese Unterlagen lesen Sie bitte gründlich durch und unterschreiben danach eigenhändig«, sagte er. »Die Firma will sich nur absichern, dass nicht später Forderungen seitens der Mitarbeiter geltend gemacht werden können. Eine reine Formalität.«
Wie automatisch las Sascha die Bögen durch und setzte seinen Namen unter die Formulare. Nun war es geschehen. Er hatte sich auf Gedeih und Verderb seiner Firma ausgeliefert. Was würde Conny dazu sagen? Würde sie Verständnis dafür haben, oder entsetzt reagieren? Müßig, sich darüber noch Gedanken zu machen – er hatte sich entschieden.
Sascha wurde in einen weiteren Behandlungsraum geführt, wo er sich mit nacktem Oberkörper auf einer Liege auf den Bauch legen musste. Über der Liege schwebte – gehalten durch eine massive Halterung an der Decke – ein chromblitzender Automat. Dabei musste es sich um den Implantator handeln, den Dr. Görtgen ihm erklärt hatte.
Das Mädchen von der Anmeldung kam herein und fixierte Saschas Schultern und Kopf mit zahlreichen, einstellbaren Halterungen.
»Was hatten Sie vorhin in der Anmeldung gemeint?«, fragte er leise.
Sie beugte sich zu ihm hinunter und ihre Haare kitzelten an seinem Ohr. »Nicht hier. Nur eine Frage: Hat man Ihnen eine Wahl gelassen?«
»Nicht wirklich.«
»Das dachte ich mir.«
Als sie fertig war, konnte er sich keinen Millimeter mehr bewegen. Da in die Liege eine Aussparung für das Gesicht eingearbeitet war, konnte Sascha auch nicht mehr sehen, was sich über und hinter ihm abspielte. Lediglich die Stimme von Dr. Görtgen konnte er hören: »Wir werden jetzt gleich mit der Implantation beginnen. Sie werden einen kleinen Einstich spüren, danach wird Ihr Hinterkopf sich kalt anfühlen. Es ist nicht angenehm, wird aber auszuhalten sein.«
»Wie lange wird es dauern?«, fragte Sascha, dem die Angst nun doch in die Glieder fuhr, mit rauer Stimme.
»Wenn alles glattgeht, sind wir in einer Stunde fertig. In einer weiteren Stunde wird das Kältegefühl verschwunden sein. Anschließend können Sie nach Hause gehen.«
Sascha wappnete sich, doch empfand er den Einstich in seinem Nacken als äußerst schmerzhaft. Er spürte, wie ihm Schweiß von der Stirn tropfte. Die angekündigte Kälte machte sich in seinem Hinterkopf breit. Gleichzeitig kam Bewegung in die Anlage über dem Behandlungstisch. Jetzt fand Sascha es doch gut, dass ihm der Anblick dessen, was mit ihm geschah, erspart blieb. Er hatte das Gefühl, als wenn Dr. Görtgen eben erst begonnen hatte, da hörte er bereits: »So, das war's schon. Bleiben sie noch ein paar Minuten liegen, bis meine Assistentin sie wieder aus den Halterungen befreit hat. Wir sehen uns dann gleich noch zu einem abschließenden Gespräch.«
Dann war Sascha allein. Er versuchte, herauszufinden, ob etwas anders war als vorher, doch wegen des unangenehmen Kältegefühls in seinem Hinterkopf war er dazu nicht in der Lage. Er wusste nicht, wie lange er dort gelegen hatte, als er die Beine des Mädchens von der Anmeldung neben sich auftauchen sah. Mit sanften Händen befreite sie ihn von seinen Fesseln.
»Richten Sie sich vorsichtig auf«, forderte sie ihn auf. »Manchen Patienten wird nach einer solchen Behandlung schwindelig.«
Sascha drehte sich herum und richtete sich vorsichtig auf. Der Schwindel blieb erträglich. In seinem Hinterkopf pochte es. Das Mädchen stand vor ihm und sah ihn eindringlich an.
»Was ist?«, fragte Sascha.
»Passen sie auf sich auf«, sagte sie leise. »Es ist nicht alles nur positiv – auch wenn mein Chef es in den freundlichsten Farben darstellt. Benutzen sie eine Firewall – und verwenden sie nicht die billigste.«
»Aber was…?«
»Mehr darf ich nicht sagen«, sagte sie, und legte einen Finger über ihre Lippen. »Sie müssen zum Abschlussgespräch.«
»Eine Frage noch«, hielt Sascha das Mädchen zurück. »Woher wissen sie…?«
Sie fasste sich mit der rechten Hand in ihre langen Haare und zog sie zur Seite, wobei sie ihren Hinterkopf entblößte, auf dem eine kleine metallene Platte mit mehren Anschlussbuchsen zu sehen war. Sascha nickte. »Gut, ich werde vorsichtig sein.«
Dann stand er auf und zog sich sein Hemd über, das er für die Behandlung ausziehen musste. Im Nachbarraum wartete bereits Dr. Görtgen und hielt mehrere Unterlagen in der Hand.
»Die Behandlung ist zu unserer Zufriedenheit verlaufen«, sagte er. »Hier sind noch ein paar Dinge, die Sie in Zukunft brauchen werden: eine Dokumentation, die Sie bitte aufmerksam lesen, mehrere Anschlusskabel für verschiedene Systeme, eine DVD mit Programmen und Treibern für das Interface. Fahren Sie nach Hause und ruhen sich aus. Versuchen sie vor morgen Abend nicht, Ihr Interface zu testen. Ihr Kopf muss sich erst daran gewöhnen. Auch die Synapsenverbindungen müssen sich erst beruhigen. Morgen Abend können Sie den ersten Ausflug wagen. Lesen Sie alles genau, bevor sie anfangen. Wenn noch Fragen auftreten, rufen Sie mich an. Hier ist meine Karte.«
Damit war Sascha entlassen. Er ging durch den Gang zurück in die Anmeldung, wo das Mädchen wieder hinter ihrem Kommandostand saß. Sie lächelte ihm zu und winkte ihn zu sich heran. Als er direkt vor ihr stand, steckte sie ihm einen kleinen Zettel zu. 'Kira 98989110' stand darauf.
»Was ist das? Ihre Telefonnummer?«, fragte er.
»Prägen sie es sich einfach ein und werfen den Zettel danach weg. Sie werden es benötigen, wenn es so weit ist«, antwortete sie rätselhaft.
Mehr sagte sie nicht, also verabschiedete er sich und verließ die Praxis. Sascha fand, dass es ihm bereits viel besser ging, aber das konnte eigentlich nicht sein. Mit dem Aufzug fuhr er hinunter und ging mit raschen Schritten zur U-Bahn. Er wollte nur noch weg und nach Hause, wo er sich sicher fühlte.
Zu Hause angekommen, fand er in der Küche einen Zettel von Conny vor, die ihm mitteilte, dass sie schon wieder einen neuen Job hatte, der jetzt gleich begann. Sie wäre in vier Stunden zurück. Das Essen stehe im Kühlschrank. Sascha sah in den Kühlschrank, doch hatte er keinen Hunger. Im Bad stellte er sich vor den Spiegelschrank, der über dem Waschbecken hing. Er konnte sehen, dass er erkältet war. Er stellte die geteilten Spiegel so, dass er seinen eigenen Hinterkopf sehen konnte, wenn er seinen Kopf ein wenig zur Seite drehte. Mit einer Hand versuchte er, seine Haare an die Seite zu schieben, zuckte aber zurück, als er einen stechenden Schmerz verspürte. Er schalt sich einen Idioten. Er war eben dort operiert worden und wunderte sich darüber, dass die Stelle empfindlich war. Im Spiegel konnte er eine Anschlussplatte erkennen, die genauso aussah, wie die, die ihm Kira gezeigt hatte. Kira – hieß das Mädchen überhaupt Kira? Er nahm den Zettel heraus und studierte ihn. Er konnte mit den Daten nichts anfangen. Also steckte er den Zettel wieder weg und nahm die Dokumentation in die Hand. Sascha setzte sich ins Bett und begann zu lesen.
Irgendwann in der Nacht wurde er wach und stellte fest, dass er einen Schlafanzug trug und im Bett lag. Sascha richtete sich auf und sah, dass es vier Uhr nachts war. Seine Dokumentation und die anderen Dinge lagen sauber auf dem Nachttisch. Er drehte sich auf die andere Seite und sah Conny, die sanft schnaufelnd neben ihm im Bett lag und schlief. Er gab ihr einen leichten Kuss auf die Lippen, worauf sie wohlig brummelte und sich auf die andere Seite wälzte. Diese Frau war ihm immer noch ein Rätsel. Offenbar hatte sie ihn umgezogen, als sie nach Hause gekommen war, ohne, dass er davon etwas mitbekommen hatte. Sascha wollte sie nicht wecken, also drehte er sich ebenfalls in seine Decke und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen wurde er durch das Sonnenlicht und einen überwältigenden Geruch nach frisch aufgebrühtem Kaffee geweckt. Conny werkelte bereits in der Küche herum. Er erhob sich und ging in die Küche. Er umarmte Conny von hinten und küsste sie auf den Hals.
»Guten Morgen, mein Schatz.«
Conny drehte sich zu ihm um. »Müsstest du nicht längst im Büro sein?«
»Ich bin heute krank. Ich hab mich für zwei Tage krankgemeldet.«
Conny sah ihn erschreckt an. »Und was ist mit dem Job? Wirst du ihn behalten können?«
Sascha machte eine beruhigende Handbewegung. »Ich hatte auch erst Bedenken, aber sie haben mir einen Vorschlag gemacht. Dadurch kann ich auch arbeiten, wenn ich krank bin. Ich weiß zwar noch nicht, wie es funktionieren soll, aber ab heute Abend kann ich es testen.«
Conny sah ihn misstrauisch an. »Testen? Was testen?«
»Ich hab jetzt so ein Interface. Das soll mir ermöglichen, meine Arbeit von zu Hause zu erledigen. Ich kann mich regenerieren und trotzdem arbeiten, haben sie mir gesagt. Dadurch behalte ich meinen Job. Es hört sich jedenfalls gut an.«
»Was soll denn das sein – ein Interface?«, fragte Conny. »Ich kann mich nur erinnern, dass ich den Begriff vor einiger Zeit einmal gelesen habe – aber im Zusammenhang mit Behinderten. Man hat ihnen irgendetwas eingepflanzt und danach konnten sie fast normal am täglichen Leben teilnehmen. Ich glaub, es kam sogar in den Nachrichten. Jemand hatte einen Preis dafür bekommen. Aber was hast Du damit zu tun?«
»Sie haben mir ein solches Gerät eingepflanzt, Conny. Dr. Görtgen hat es mir genau erklärt. Sie benutzen es heute nicht nur für Behinderte. Auch ganz normale Menschen wie Du und ich können es nutzen, um über das Netz direkt am virtuellen Arbeitsplatz zu arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren wird – ich muss noch warten, bis sich meine Nerven beruhigt haben – aber es soll subjektiv so sein, als wenn ich selbst dort wäre. Wir werden vielleicht mehr Zeit für uns haben, Conny. Was sagst du?«
Sascha hatte gar nicht bemerkt, dass Connys Gesicht einen immer entgeisterteren Ausdruck angenommen hatte. »Moment Sascha! Hab ich das richtig mitbekommen? Man hat Dir mal eben heute etwas in Deinen Kopf eingepflanzt? Und Du hast das auch noch freiwillig mitgemacht? Was wäre gewesen, wenn sie dabei einen Fehler gemacht hätten? Was wäre dann aus Dir, was wäre aus uns geworden?«
Sascha hob beschwichtigend die Hände. »Es war überhaupt nicht gefährlich, Conny. Sie machen solche Eingriffe heute ständig. Es ist Routine.«
Sascha drehte seinen Kopf zur Seite und hob seine Haare im Nacken an, damit Conny die kleine Metallplatte sehen konnte. Sie betrachtete das Interface wie ein ekliges Insekt.
»Ich finde es abartig und unnormal«, sagte sie. Vorsichtig berührte sie das Metall und die umgebende Haut mit dem Zeigefinger. Sascha zuckte zusammen und Conny fuhr erschreckt zurück.
»Was habe ich getan?«
Sascha wandte sich seiner Freundin zu. »Es ist einfach noch empfindlich. Schließlich haben sie es mir erst vor wenigen Stunden eingesetzt. In einem oder zwei Tagen wirst du es überhaupt nicht mehr bemerken. Komm Conny, schau mich nicht so an. Gib mir lieber einen Kuss.«
Sie schmiegte sich in seine Arme und küsste ihn lange und intensiv. Schließlich schob sie sich von ihm weg. »Sascha, ich hab Angst um Dich. Ich kann damit leben, kein Geld zu haben und ständig von der Hand in den Mund leben müssen, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn Dir etwas zustieße. Du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein!«
»Das verspreche ich«, sagte Sascha. »Deine Ängste sind bestimmt unbegründet.«
»Warum hast Du nicht vorher mit mir darüber gesprochen? Vielleicht hätten wir auch eine andere Lösung finden können.«
»Ich hatte keine Wahl«, meinte Sascha. »Ich musste mich sofort entscheiden.«
»Wir sollten nachher noch einmal darüber reden«, sagte Conny. »Ich muss jetzt leider zum Dienst.«
»Du bist doch erst seit ein paar Stunden hier. Zu welchem Dienst musst Du denn schon wieder?«
»Nicht jeder hat es so gut wie Du, mein Schatz. Ich hab leider mehrere Teilzeitjobs. Aber wenn ich nachher zurückkomme, hab ich Zeit, okay?«
Sascha nahm sie in die Arme und küsste sie, während sie ihm mit der Hand leicht den Nacken kraulte, wie sie es gern tat. Plötzlich hielt sie inne.
»Ich weiß nicht, ob ich mich an dieses Ding in Deinem Nacken gewöhnen kann.«
Die Stimmung war verflogen. Sie sprachen noch über verschiedene Dinge, die zu erledigen waren, dann verließ Conny die Wohnung und ging zur Arbeit.
Sascha nahm die Dokumentation zur Hand und begann zu lesen. In der Beschreibung des Interfaces stand, dass es an nahezu jedes aktuelle Computersystem angeschlossen werden konnte. Er musste lediglich ein Treiberprogramm installieren, dann konnte es losgehen. Die beiliegenden Kabel sahen normal aus. Sascha blätterte die Unterlagen durch, doch nirgends konnte er finden, wie das System letztendlich zu bedienen war. Technische Informationen gab es in unübersichtlicher Menge, doch die praktische Anwendung hatte man offenbar vergessen. Plötzlich fiel ihm etwas ein: was war mit Wasser? Er musste sich doch waschen oder duschen. Konnte er jetzt noch schwimmen gehen? Nach kurzer Zeit fand er die Information. Das Interface war unempfindlich gegen Hitze, Kälte und Wasser. Allerdings riet man dringend davon ab, es innerhalb einer Stunde nach Wasserkontakt zu benutzen. Es wäre zwar nicht gefährlich, doch wären die möglicherweise auftretenden synaptischen Fehlfunktionen nicht angenehm. Nach einer Stunde hatte er die Unterlagen durchgearbeitet und es drängte ihn, sein neues Interface auszuprobieren. Sascha blickte auf die Uhr. Es war erst 10 Uhr morgens. Erst am Abend sollte er sich zum ersten Mal anschließen, hatte Dr. Görtgen gesagt. Er hatte gemeint, das Hirn müsse sich erst beruhigen, bevor er zum ersten Mal das Interface benutzen sollte. Sascha beschloss, nichts zu überstürzen und noch zu warten. Er ging in die Küche und schüttete sich einen Kaffee ein, den Conny noch aufgebrüht hatte, bevor sie gegangen war.
Als er so an der Küchenanrichte stand, wurde ihm bewusst, dass er sich noch immer erkältet fühlte. Durch die Ereignisse der letzten Stunden hatte er wohl so unter Adrenalin gestanden, dass er nicht mehr auf die Signale seines Körpers geachtet hatte. Doch jetzt stellte er fest, dass die Schlappheit der Glieder und die Kopfschmerzen noch immer da waren. Er beschloss, sich wieder ins Bett zu legen und noch etwas zu schlafen.
Als er wieder wach wurde, fühlte er sich etwas besser. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass es inzwischen schon 16 Uhr war. Conny war noch nicht zurück. Sascha nahm sein Mobiltelefon zur Hand und warf einen Blick auf das Display. Eine Nachricht von Conny wurde angezeigt. Sie müsse etwas länger arbeiten, als normal, weil ihre Ablösung nicht gekommen war. Sascha warf das Telefon auf den Nachttisch und richtete sich auf. Er überlegte. Bis Conny nach Hause kam, würde es sicher noch etwas dauern. Ob er wohl schon lange genug gewartet hatte, um sein Interface auszuprobieren? Sascha entschloss sich, einen Versuch zu wagen. Er stand auf, holte die Unterlagen und das Zubehör aus dem Wohnzimmer und setzte sich vor den Computer, den sie aus Platzgründen in ihrer Diele angeschlossen hatten. Er schaltete das Gerät ein und ließ es hochfahren. Nachdem der Computer einsatzbereit war, legte er die Treiber-DVD in das Laufwerk und installierte das Programm. Die Installationsroutine unterschied sich nicht von der anderer Softwareprodukte. Als die Installation abgeschlossen war, erschien ein neues Icon am unteren Bildschirmrand und eine Grafik forderte den Nutzer auf, die Kabelverbindung zwischen dem Hochgeschwindigkeitsdatenbus und dem Anschluss im Interface herzustellen. Sascha nahm eines der Kabel, welches der Abbildung auf dem Bildschirm ähnelte und steckte einen der Stecker in den Datenbus. Die Farbe des Icons wechselte von grau zu gelb. Nun griff er nach dem anderen Stecker des Kabels und führte ihn vorsichtig zu seinem Nacken. Er stellte sich noch etwas ungeschickt an, doch nach einigen Versuchen gelang es ihm, den Stecker in die passende Buchse an seinem Interface einzuführen. Mit einem hörbaren Knacken rastete der Stecker dort ein. Auf dem Bildschirm öffnete sich nun ein neues Fenster, welches darüber informierte, dass nun eine erstmalige Initialisierung des Interfaces erfolgen würde. Sascha erwartete, etwas zu spüren, doch das war nicht der Fall. Nach einer kurzen Wartezeit meldete der Computer, dass die neue Komponente einsatzbereit war. Es öffnete sich ein weiteres Fenster. Diesmal hatte er die Auswahl zwischen Internet allgemein und AXXIUM. Sascha klickte auf den Button mit dem AXXIUM-Symbol und wartete.
Es folgten einige Statusmeldungen, wie: Der Datenstrom wird optimiert, oder: Ein Anwender wird aufgrund der Hardware-ID erstellt. Dann hörten die Meldungen auf und die Fenster schlossen sich. Sascha starrte auf den Monitor und fragte sich bereits, ob er etwas falsch gemacht hatte, als etwas passierte. Sein Blick trübte sich und er konnte immer schlechter erkennen, was sich auf dem Monitor abspielte. Er rieb sich die Augen, doch das Bild wurde eher noch unschärfer. Dann schob sich von der Seite her das AXXIUM-Logo in sein Sichtfeld. Es schien direkt vor ihm zu schweben, sodass er das Gefühl hatte, danach greifen zu können. Als er versucht war, es auch zu tun, verschwand das Logo wieder und die Welt um ihn herum versank. Aus dem Nebel heraus schälte sich die Eingangstür seines Großraumbüros. Sascha war verwirrt und fühlte sich schwindelig. Er musste sich festhalten und griff nach dem Türöffner. Wie gewohnt schwang die Tür weit auf und gab den Blick auf das Großraumbüro frei. Der Anblick wirkte auf eine Art gewohnt, andererseits war es auch irgendwie fremd, obwohl er nicht sagen konnte, was ihn störte. Sascha betrat das Büro und hörte die Tür hinter sich zufallen. Er blickte sich um und entdeckte die Ecke, in der sein Schreibtisch stand. Die Stellwände standen noch genau so, wie er sie an seinem letzten Arbeitstag arrangiert hatte. Langsam ging er auf seinen Arbeitsplatz zu und grüßte verschiedentlich Kollegen, deren Tische er passierte. Plötzlich fiel ihm etwas auf: Einige der Kollegen wirkten merkwürdig fahl und blass. Wenn er sie grüßte, reagierten sie nicht auf ihn. Andere wiederum reagierten wie gewohnt. Als er fast an seinem Arbeitsplatz angekommen war, sah er Lara den Gang hinunterschreiten. Es fiel ihm immer schwer, sie nicht anzustarren. Wie üblich trug sie einen relativ kurzen Rock und eine etwas zu enge Bluse. Als sie auf ihn zukam, warf sie ihre langen, blonden Haare gekonnt nach hinten. Sie lächelte ihn an. »Hallo Sascha, schön, dass du wieder da bist.«
Sascha war noch immer etwas verwirrt. »Wieso bin ich eigentlich hier? Eigentlich bin ich doch krank und eben war ich auch noch zu Hause.«
Lara lachte hell auf und einige der Kollegen reckten ihre Köpfe hinter den Stellwänden hervor.
»Sascha, Du Dummchen. Natürlich bist Du zu Hause. Wir sind hier im virtuellen Büro von AXXIUM. Über das Interface läuft eine Instanz von Dir hier auf dem Server und hat den virtuellen Arbeitsraum betreten. Es ist das absolut Neueste. Man hat das komplette Büro digitalisiert und eine Umgebung geschaffen, die der Realität in nichts nachsteht. Die Illusion ist so perfekt, dass man nach kurzer Zeit nicht mehr den Unterschied feststellen kann. Sogar die Personen werden mit ihrem normalen Aussehen und ihrer Wesensart abgebildet. Du hast Empfindungen und Gefühle wie im wirklichen Leben.«
Lara machte eine Pause und beugte sich vor, bis ihre Lippen beinahe sein Ohr berührten. Sie hauchte: »Du würdest staunen, was hier alles möglich ist.«
Sascha bildete sich ein, sogar ihr Parfüm zu riechen, das sie aufgelegt hatte. Er wich ein wenig zurück, da diese Art der Annäherung in ihm Schuldgefühle gegenüber Conny aufkeimen ließ.
Lara machte ein enttäuschtes Gesicht und wurde dienstlicher: »Ich hab gestern, nachdem Du weg warst, alle Mappen auf Deinem Tisch gescannt. Du kannst also gleich mit der Arbeit beginnen und da weitermachen, wo Du gestern aufgehört hast. Trotzdem würde ich dir raten, dich erst noch einmal bei Foster zu melden.«
»Sind eigentlich alle Kollegen hier im virtuellen Büro?«
»Nein. Es gibt immer noch viele Mitarbeiter, die diesen Schritt nicht machen wollen. Sie ahnen gar nicht, was ihnen entgeht. Wenn man nicht will, bleibt man einfach zu Hause und klinkt sich ein. Es ist, als wäre man tatsächlich hier.«
Sie deutete auf die etwas farblosen Gestalten. »Das sind die Realen. Sie können uns natürlich weder hören noch sehen, aber wir sehen und hören sie, weil das reale Büro ständig gescannt und im virtuellen Bereich abgebildet wird. Ich bin gerne hier, schon allein, weil man hier etwas mehr Freiheiten genießt, wenn man seine Arbeit tut und der Laden läuft.«
Lara zwinkerte ihm wieder verführerisch zu. »Aber ich denke, da wirst Du auch noch dahinter kommen.«
Sie wandte sich ab, warf noch einmal ihre Haare zurück und schritt davon. Sascha zwang sich in die Realität zurück und sah zum Büro des Leiters hinüber. Er musste unwillkürlich lächeln. Sich in die Realität zurückbringen – und das hier in der virtuellen Realität. Ein Widerspruch in sich selbst. Er ging zu Fosters Büro und klopfte an. Es war faszinierend, dass er sogar den Widerstand der Tür fühlen und das Klopfen hören konnte.
»Herein!«, tönte es von drinnen. Sascha öffnete die Tür und trat ein. Hinter dem Schreibtisch saß Ryan Foster und sah auf. In seinem Gesicht erschien das breite Lächeln, das sein Markenzeichen war.
»Hallo Herr Leyden, ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Entscheidung, unserer firmeneigenen VR beigetreten zu sein.«
Er stand auf und kam um den Tisch herum, um ihm die Hand zu schütteln. Das hatte er während seiner sechs Monate währenden Beschäftigung in dieser Abteilung bisher noch nie gemacht.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte er. »Hier werden Sie sicher nicht von einer Grippe beeinträchtigt. Sie können gleich mit Ihrer Arbeit fortfahren, wenn Sie sich hier eingelebt haben. Manche Dinge laufen hier halt doch etwas anders als in der realen Welt. Aber Sie werden es schon schaffen, denn Sie haben sich ja bereits für die Flexibilität entschieden.«
Sascha ging zu seinem Schreibtisch zurück und nahm dort Platz. Alles war da: sein Computer, seine Akten, sein Telefon, sogar Connys Foto in dem Kirschholzrahmen – einfach alles. Er startete den Computer auf seinem Schreibtisch und ergriff die erste der Akten. Wie Foster es ihm prophezeit hatte, wurde er überhaupt nicht durch seine Kopfschmerzen oder die Grippe behindert. Nach kurzer Zeit vergaß er völlig, dass er sich hier nicht in der wirklichen Welt befand. Er las Berichte, gab Daten in den Computer ein, führte längere Gespräche mit Kunden. Lediglich von Zeit zu Zeit kam neben normal erscheinenden Personen auch schon mal eine der grauen Personen vorbei, die sich in der wirklichen Welt befand. Noch einen Tag zuvor war er selbst hier herumgelaufen, ohne zu ahnen, dass es noch eine andere Ebene der Wirklichkeit gab, auf der sich zahlreiche Kollegen und Kolleginnen tummelten. Stunden später blickte er auf seine Armbanduhr und ihm fiel auf, dass er seine normale Essenspause vollkommen vergessen hatte – sein virtueller Körper hatte ihm keinen Hunger signalisiert. Sascha begann sich zu fragen, wie man eigentlich dieses Problem gelöst hatte. Im wirklichen Leben empfand man Hunger und Durst – hier arbeitete man konzentriert und kontinuierlich durch. Das konnte nicht gut sein, denn zu jeder virtuellen Person gehörte schließlich auch eine reale Person mit realen Bedürfnissen. Er stand auf und machte sich auf den Weg zur Teeküche, um sich anzusehen, ob man auch diesen Bereich mit seinem Boiler, den Kühlschränken und der Kaffeemaschine genau so akribisch korrekt kopiert hatte, wie alles Übrige. Wenn man in der Virtualität keinen Hunger und keinen Durst verspürte, wäre es vielleicht denkbar, dass man diesen Bereich ausgespart hatte. Auf dem Gang traf er Hagen Fonseca, den Kollegen aus der Regressabteilung. Er hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen – jetzt wusste er, warum – auch er arbeitete hauptsächlich virtuell.
»Hallo Sascha«, sagte er. »Ich bin überrascht, Dich hier zu sehen. Ich hatte immer geglaubt, Du wärst einer der ganz Konservativen.«
»Ich hatte bisher überhaupt keine Ahnung, dass es so etwas wie ein virtuelles Büro überhaupt gibt«, sagte Sascha. »Erst, als ich mich krankmelden wollte, machte Foster mir diesen Vorschlag.«
»Du wirst es lieben«, meinte Hagen. »Du schaffst hier mehr von Deiner Arbeit in kürzerer Zeit und in der Regel wird man Dein Gehalt erhöhen, wenn Du Dich verpflichtest, überwiegend virtuell zu arbeiten. AXXIUM ist dabei, sein Geschäft vollständig in die Virtualität zu verlagern. Da benötigt man keine Gebäude mehr, kein Mobiliar. Die Standortkosten entfallen vollständig. Das sind riesige Ersparnisse für den Konzern. Gerade jetzt in der Übergangsphase ist man bereit, die Mitarbeiter mit guten Konditionen zu ködern. Sei schlau und spiel das Spiel mit. Es ist äußerst lukrativ.«
»Danke für den Tipp.«
»Wo willst du eigentlich hin?«, fragte Hagen.
»Ich wollte mir die Küche ansehen.«
Hagen lachte. »Du willst mir aber nicht erzählen wollen, dass Du Hunger hast oder so etwas, oder?«
»Nein, ich bin einfach neugierig, wie exakt man alles kopiert hat.«
»Gut, aber ich kann dir versichern, dass auch die Küche exakt nachgebildet wurde.«
Sascha wandte sich um und ging los.
Hagen blieb stehen und rief ihm hinterher: »Warte Sascha, Du solltest vielleicht nicht gerade jetzt dort hineingehen.«
Doch Sascha war schon ein paar Meter weiter und in seine Gedanken vertieft, sodass er Hagen nicht mehr hörte. Bereits vor der Tür hörte er Geräusche, die sich verstärkten, als er die Küchentür öffnete. Vor ihm auf dem Boden lag etwas Rotes – es war ein winziger Damen-Slip. Sascha blickte hoch und sah Foster, mit heruntergelassener Hose zwischen den Beinen von Lara, die auf der Anrichte saß und ihre Beine um Fosters Hüften geschlungen hatte. Die Bewegungen der beiden, sowie die Laute, die sie ausstießen, ließen keinen Zweifel daran aufkommen, was sie hier taten. Sascha stand wie vom Donner gerührt und wusste nicht, was er tun sollte. Eigentlich hätte er sofort wieder gehen sollen, bevor sie ihn bemerkten, doch hielt ihn irgendetwas fest und er konnte seinen Blick nicht von der Szene lösen. Die beiden hingegen ließen sich überhaupt nicht stören und brachten es genussvoll zu Ende. Foster zog seine Hose anschließend hoch und brachte sein Äußeres in Ordnung. Die Situation schien ihm nicht einmal peinlich zu sein. Er ging an Sascha vorbei und klopfte ihm jovial auf die Schulter.
»Willkommen in der virtuellen Welt, Leyden«, sagte er. »Neben der Arbeit kann man hier Dinge tun, die in der Realität nicht möglich wären. Sie sind noch neu hier. Wenn die Arbeit läuft, ist gegen ein bisschen Spaß nichts einzuwenden – und Spaß hat hier keine Folgen, Leyden, das sollten Sie sich durch den Kopf gehen lassen.«
Vor der Tür wandte er sich noch einmal zu ihm um. »Ach Leyden, Sie haben das hier natürlich niemals gesehen.«
Dann ging er hinaus. Sascha stand immer noch wie angewurzelt da und sah Lara an, die völlig ungeniert mit immer noch gespreizten Beinen auf der Anrichte saß und mit beiden Händen ihre Haare ordnete. Ihre Bluse war bis zum Nabel aufgeknöpft und gab den Blick auf ihre wohlgeformten Brüste frei. Sie sah zu ihm hinüber und begann provozierend langsam damit, die Knöpfe der Bluse wieder zu schließen.
»Was sollte das hier eben?«, fragte Sascha. »Seit wann treibt Ihr es miteinander?«
Lara lächelte ihn an. »Wie kommst Du darauf, dass ich es mit ihm treibe? Rein technisch gesehen hat es das überhaupt nicht gegeben. Es war doch nur virtuell. In der Realität ist nichts passiert. Hast du noch nie ein Mädchen angesehen und dir insgeheim vorgestellt, wie es wäre, mit ihr zu schlafen? Das hier ist doch nichts anderes – nur dass es sich nicht nur in Deinem Kopf abspielt, sondern dass du den vollen Spaß haben kannst.«
Sascha schüttelte fassungslos seinen Kopf. »Lara, ich versteh Dich nicht. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Drei Jahre? Mein Gott, Du siehst gut aus, und Du weißt das auch. Aber hast Du das hier wirklich nötig? Das bist doch nicht Du…«
Lara hüpfte von der Anrichte herunter und strich sich den weit hochgerutschten Rock mit den Händen glatt. Sie bückte sich, hob ihr Höschen auf und ließ es in ihrer Hand verschwinden. Lara sah Sascha tief in die Augen. »Du meinst, drei Jahre gemeinsame Arbeit in einem Büro reichen aus, mich zu kennen? Vielleicht bin ich ja ganz anders, als Du glaubst. Girls wanna have Fun.… und ich hab gerne Spaß. Da Du mich ja jetzt besser kennst… Du weißt, dass ich Dich immer gemocht habe. Conny muss es ja nicht…«
»Lara, lass es!«, unterbrach Sascha sie wütend. »Was ist nur mit Dir los? Ein lockerer Umgang mit den Kollegen ist eine Sache, aber eine so öffentliche Affäre mit dem Chef? In der Büroküche?«
Sie schmunzelte. »Und? Stört Dich das?«
»Wenn Du es genau wissen willst: Ja, ich finde es absolut unmöglich, was Du hier treibst. Du wirfst Dich diesem… Foster an den Hals. Aber gleich hier im Büro? Hast Du es so nötig? So warst Du doch sonst nicht.«
Lara zog ihre Brauen hoch und lachte. »Ich hätte nicht geglaubt, dass Du ein Spießer bist.«
Sie ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu.
Sascha blickte nachdenklich auf die geschlossene Tür und fragte sich, ob er die letzten Minuten tatsächlich erlebt hatte. Lara benahm sich wie eine Nymphomanin. Das hätte er nie für möglich gehalten. Irgendwie hatte er das Gefühl von etwas Surrealem. kurz darauf verließ er die Küche.
Von Lara war nichts mehr zu sehen. Er ging zurück zu seinem Arbeitsplatz und setzte sich nachdenklich hin. Hatte Lara durchaus recht, mit dem was sie sagte, dass diese virtuelle Geschichte eigentlich nicht existent war? Er war hier in einer virtuellen Welt. Was war es anderes, als die früheren Computerspiele, die sie immer gespielt hatten. Auch dort schlüpfte man in Rollen und tat Dinge jenseits aller Legalität, tötete Menschen und raubte Dinge, um Punkte zu bekommen. War man deshalb ein Mörder? Natürlich nicht! Also war das, was er in der Büroküche gesehen hatte, auch nichts anderes als ein Spiel. Sascha nahm sich vor, seine Arbeit zu tun und im Übrigen diese virtuelle Welt nicht ganz so ernst zu nehmen. Er griff wieder zu seinen Akten und schlug den nächsten unbearbeiteten Fall auf.
Stunden später war er endlich fertig und sein Schreibtisch war blank. Er sah auf seine Uhr und las: 2. Mai, 22:34 Uhr. Es war Sascha überhaupt nicht aufgefallen, wie lange er schon hier war. Er blickte von seinem Arbeitsplatz auf und lugte über die Trennwand. Es war fast niemand mehr im Dienst. Er hatte den Feierabend völlig übersehen. Schnell schnappte er sich seine Aktentasche, die neben seinem Schreibtisch stand, und fuhr seinen Computer herunter. Mit raschem Schritt lief er zur großen Eingangstür und öffnete sie…