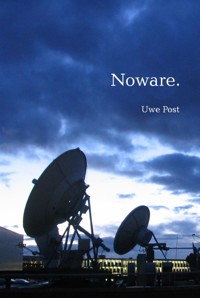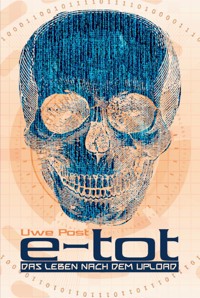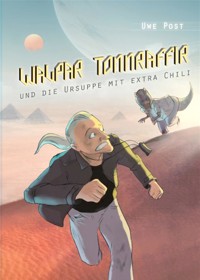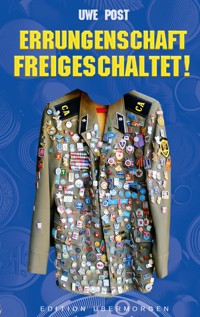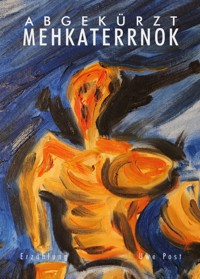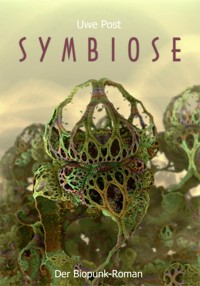3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die sechste Ausgabe unseres mit dem europäischen SF-Preis ausgezeichneten Magazins bringt erneut Geschichten aus unserer nahen Zukunft von deutschen und internationalen Autorinnen und Autoren. Mit neuen Geschichten von: Aiki Mira und Joshua Tree aus Deutschland Tais Teng mit Ziltpunk aus den Niederlanden Modupe H. Ayinde und Hannu Afere mit African Futurism Kelsea Yu mit Biofiction Sowie Artikel und Interview von Bettina Wurche über Future Food
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Intro
Joshua Tree – Mensch/Nicht
Tais Teng – Auf dem Wasser gehen
Future Fiction Talk – Ziltpunk – TYPISCH HOLLÄNDISCHE KLIMA-LITERATUR: TAIS TENG IM GESPRÄCH
Hannu Afere – Einen Gott töten
Bettina Wurche – Future Food
Future Fiction Talk: Essen für die Zukunft – Dr. Rita Grünbein im Gespräch
Aiki Mira – Glitch im Rapid
Modupe H. Ayinde – Die Mauern von Benin City
Future Fiction Talk: Modupe H. Ayinde
Kelsea Yu – Ein Mangel an Haien
Intro
Neues aus der Zukunft
Auch im Jahr 2024 arbeiten wir hart daran, für euch das bestmögliche Zukunftsmagazin zu gestalten. 2023 war richtig cool für uns, denn unser FFM wurde nicht nur mit dem europäischen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet, sondern ihr, unser Publikum, sorgt für konstante Verkäufe und ermöglicht uns damit die Fortsetzung unseres Projekts. Wir konnten sogar das Honorar für Textbeiträge und Cover-Illustrationen von 50 auf 60 Euro erhöhen, denn wir wollen mit unserem Non-Profit-Magazin ja nicht reich werden, sondern eine reiche Kultur moderner, optimistischer Fiktion fördern.
Erneut hat sich die Auswahl der Geschichten als größter Brocken unserer Arbeit erwiesen. Von den über 40 eingesendeten und anderweitig in Betracht gezogenen Texten waren die meisten thematisch zu weit von Near Future entfernt oder zeigten eine zu pessimistische Perspektive – sorry, traurige Postapokalypsen gibt es schon genug, sowohl in Textform als auch in Wirklichkeit.
Existenziell wichtig ist für uns, dass wir Yvonne Tunnat für unser Team gewinnen konnten, die uns (nicht nur) bei der Story-Auswahl tatkräftig unterstützt.
In der vorliegenden Ausgabe gibt es keinen Themenschwerpunkt, sondern im Gegenteil einen bunten Strauß an Visionen aus der nahen Zukunft: Biofiction (»Ein Mangel an Haien«) aus den USA ist genauso vertreten wie Klima-Fiktion (»Auf dem Wasser gehen«) aus unserem Nachbarland, den Niederlanden. Weil Geschichten aus Afrika zuletzt besonders gut angekommen sind, haben wir gleich zweimal Afro- bzw. African futurism am Start – und diese Storys haben es echt in sich!
Aus Deutschland kommen eine brandneue Story von Aiki Mira sowie eine knackige Erstkontakt-Erzählung von Bestseller-Autor Joshua Tree. Außerdem haben wir Bettina Wurche und Dr. Rita Grünbein gewinnen können, um gemeinsam einen frischen Blick auf die Ernährung der Zukunft zu werfen – ein Thema, das in der SF meist nur am Rande stattfindet und oft leider gar nicht. Dabei ist Nahrung doch ein menschliches Grundbedürfnis genau wie der Hunger auf eine bessere Zukunft, den wir trotz schlimmer Magenschmerzen wegen der vielen Probleme überall auf der Welt versuchen, mit einer Prise würziger Future Fiction ein wenig zu stillen.
Terra, im Frühjahr 2024:
Sylvana Freyberg Uwe Post Yvonna Tunnat
Joshua Tree – Mensch/Nicht
#story #aliens #hardsf
»Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Friede Gottes.«
Helen Schucman, klinische Psychologin (1909-1981)
»Um alles zu verstehen, ist es notwendig, alles zu vergessen.«
Siddhartha Gautama / Buddha (563 v. Chr. – 483 v. Chr.)
Ich hasse den Horizont«, sage ich und starre in die Ferne. Amon, mein iranischer Erster Offizier, erwidert nichts. Er kennt meine Stimmungen und weiß, wann es besser ist zu schweigen. Dort, wo sich Himmel und Ozean zu berühren scheinen, versinkt gerade die tiefrote Sonne wie ein sterbender Gott, dessen verblassender Ichor sich in die Wellen ergießt und einen goldenen Schimmer hinterlässt. »Man kann ihn nie erreichen. Egal wie weit du reist, wie sehr du dich beeilst; er bleibt unerreichbar.«
Umah, meine Navigatorin, kommt hereingestürmt. In der Hand hält sie ein Radio mit Satellitenempfänger. Ihre Augen sind geweitet. »Fünf Minuten!«
Amon sieht mich an und ich nicke. Er läuft ihr hinterher nach draußen und ich folge ihnen mit gemessenem Schritt, wie es sich für einen Kapitän gehört. Die Sonne verschwindet gerade und weicht Schattierungen von Mitternachtsblau. Erste Sterne beginnen am Himmel zu funkeln.
Umah hält ihr Smartphone über sich und bewegt es immer wieder hin und her.
»Da!«, ruft sie schließlich aufgeregt und deutet auf einen der leuchtenden Punkte. Er sieht ganz unscheinbar aus und ist doch der bedeutendste von allen. »Das ist er! Der Besucher!«
Ich kneife die Augen zusammen und versuche ihn auszumachen: Den Besucher, jenes Objekt, das Astronomen noch vor einem halben Jahr für einen potenziellen Meteoriten gehalten haben, der in Sibirien für zerborstene Fensterscheiben sorgen würde. Wie sich herausgestellt hat, lagen sie falsch. Bis heute weiß niemand genau, was er ist, aber es gibt Aufnahmen von ihm, unscharf und nachbearbeitet, dennoch recht eindeutig: Es handelt sich um eine metallisch glänzende Kugel mit stachelartigen Aufbauten. Sie absorbiert sämtliche elektromagnetischen Wellen, mit denen die NASA und andere Weltraumbehörden versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Niemand Offizielles redet darüber, aber die ganze Welt weiß, dass da oben ein außerirdisches Objekt seine Kreise um uns zieht, ohne dass wir etwas dagegen unternehmen können.
Und es schweigt.
Das soll sich heute ändern.
»Denkt ihr, es wird funktionieren?«, fragt Umah aufgeregt, den Kopf im Nacken, die Augen senkrecht nach oben gerichtet.
»Natürlich nicht«, sage ich und schnaube. »Die Eierköpfe wissen nicht einmal, was das ist. Es hat offensichtlich kein Interesse daran, mit uns zu reden und hat es erstaunlicherweise bis hierher geschafft. Wir wissen also nicht einmal, mit was wir es zu tun haben, trotzdem wollen sie es mit einer umgebauten Dragon-Kapsel aufsammeln und hier runter bringen? Das ist vollkommen verrückt, wenn ihr mich fragt.«
»Ich frage mich eher, was sie damit machen werden, wenn sie es haben«, sagt Amon nachdenklich.
»Wir sind eine Spezies, die nach Feierabend den Fernseher anschaltet und sich anschaut, wie andere Menschen ermordet und gequält werden. Was denkst du, werden sie damit machen?«, erwidere ich kopfschüttelnd.
»Pssst«, macht Amon, als Umah das Satellitenradio lauter stellt.
»... den Annäherungsvektor eingeleitet«, erklingt die von statischem Rauschen begleitete Stimme der Nachrichtensprecherin. »Die Ambassador nähert sich jetzt mit den manuellen Steuereingaben von Missionskommandantin Hendricks. In Houston steigt die Aufregung, denn die letzten Meter sind die kritischsten. Die vordere Öffnung der Ambassador ist gerade groß genug, um ... Augenblick ...«
Wir sehen es mit eigenen Augen: Eine kurzlebige Feuerblume erwacht vierhundert Kilometer über uns zum Leben, breitet sich aus und verebbt rasch wieder.
»Mein Gott«, entfährt es Umah und sie senkt kraftlos das Radio, während sie ungläubig nach oben starrt. Der Himmel sieht wieder aus wie zuvor, als wäre nichts geschehen.
»... Kontakt zur Ambassador verloren«, tönt es kratzend aus dem Gerät in Umahs Hand. »... wurde von unabhängiger Seite bestätigt, dass das Objekt beschleunigt und sich in eine neue Position begeben hat, bei der es sich möglicherweise um einen geostationären Orbit über dem nordaustralischen Becken handelt. Es ist noch zu früh für ...«
»Nordaustralisches Becken«, wiederholt Amon und sieht mit bleicher Miene zu mir. »Das ist direkt über uns.«
Ich nicke bloß, während ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Angst rührt sich in mir, doch ein anderes Gefühl behält die Oberhand: Neugierde. Ich denke an das Funksignal, das der Empfänger des Tauchboots seit Tagen auffängt, obwohl es in seiner Halterung auf dem Achterdeck vertäut ist. Den Grund, weshalb wir diesen Umweg genommen haben und die Forscher an Bord mich ständig belagern. Die Lügen über eine Sturmfront auf unserer Route werden nicht ewig funktionieren. Aber das müssen sie auch nicht. Nur, bis ich herausgefunden habe, was ...
»Boss, wir sollten hier verschwinden«, ermahnt mich Umah. »Hier wird es bald von jeder verfluchten Navy der Region nur so wimmeln. Wenn die an Bord kommen, sind wir erledigt.«
»Dann sollten wir uns umso mehr beeilen. Wir müssten die Stelle fast erreicht haben. Mach das Tauchboot klar«, befehle ich.
»Das wird den Wissenschaftlern nicht gefallen. Es war nie geplant, dass du ...«
»Ist mir egal«, schneide ich ihr barscher als beabsichtigt das Wort ab. »Die Triton gehört uns und wir können sie testen wann immer wir wollen.«
»Du weißt, dass ich das nicht gemeint habe. Unser Versteck auf der Triton, es ...«
»Still jetzt!« Ich funkele sie zornig an. »Nach Pjöngjang hattest du keine Probleme, unseren Fahrtenschreiber zu frisieren, oder in Bangkok die Forscher als Tarnung an Bord zu nehmen. Jetzt machst du dir in die Hose, weil ich unser Versteck außerplanmäßig spazieren fahre?«
»Wir sollten einfach Richtung persischen Golf fahren, unterwegs die Forscher in Indien absetzen, bei Amons Kontaktleuten unsere Lieferung abgeben und uns dann zur Ruhe setzen«, gibt sie zurück. Sie blickt wieder in den mittlerweile dunkel gewordenen Himmel hinauf. Der Besucher ist jetzt nur noch ein funkelnder Stern unter vielen. Vereinzelte Wolken fließen über uns im Licht des aufgegangenen Mondes gen Osten wie vergossene Milch. »Die heißen nicht ohne Grund Forscher. Sie werden Fragen stellen.«
»Was denkst du, wie wir es bis hierher geschafft haben? Warum ich die Telefonnummern von Firmenbossen und Ministern hier drin habe, hm?« Ich ziehe mein Smartphone aus der Tasche und wackele damit vor ihrem Gesicht. »Nicht, weil ich bei der kleinsten Schwierigkeit den Schwanz einziehe. Bis die eine Hypothese aufgestellt haben, bin ich längst wieder zurück.«
»Du hast schon einmal mehr verloren, als...«
»Vorsicht.« Meine Finger wandern zu den beiden chinesischen Schriftzeichen an meiner Brust, die an einer feingliedrigen Goldkette hängen. Obwohl ganz leicht, ist ihr Gewicht an meinem Hals niederziehend. Ein schmerzhafter Stich fährt durch mein Herz, als ich Yins Gesicht vor mir sehe, blass und leblos und doch mit dieser Andeutung eines Lächelns auf den blutleeren Lippen, als wollte das Schicksal mich verspotten. Ich kann noch immer den Druck der Kette in meiner Handfläche spüren, obwohl es beinahe zehn Jahre her ist, dass sie sie mir mit letzter Kraft in die Hand gelegt hat.
»Es kann kein Zufall sein, dass uns das Signal aus dem Berlintief genau hierher geführt hat, wo das ... Ding da oben seinen Orbit verlässt und anhält«, sage ich schließlich in die angespannte Stille hinein. »Ich gehe runter und schaue nach, ob es was zu holen gibt. Denkt nur daran, was es wert sein könnte, wenn selbst der Besucher Interesse daran hat.«
»Das wissen wir doch gar nicht. Du ...«
»Das war mein letztes Wort! Mach die Triton klar!« Ich scheuche Umah fort. Sie seufzt, nickt jedoch ergeben und läuft zum Achterdeck der Medusa, wo das Tauchboot vertäut ist.
Amon und ich blicken auf die dunklen Wellen des nordaustralischen Beckens hinaus. Sie erheben und senken sich wie flüssiger Obsidian, strahlen mit einem Mal etwas Bedrohliches aus.
»Sie hat nicht ganz unrecht«, sagt mein Erster Offizier. »Solltest du geschnappt werden und das Militär kommt mit einem Geigerzähler an Bord der Triton, dann werfen sie dich in das tiefste Loch, das sie finden.«
»Schon klar. Aber wenn du etwas willst, musst du es dir nehmen.« Ich wende mich ihm zu und sehe ihm in die nussbraunen Augen. »Das Militär wird hier in Kürze eine Sperrzone errichten. Wenn wir gerufen werden, verlässt du das Gebiet Richtung Nord-Nord-Ost, klar? Ich gehe ohne Kabel runter ...«
»Das ist zu gefährlich, was, wenn wir den Kontakt verlieren?«
»Niemand kann wissen, dass ich da unten bin. Wenn ich was finde, müssen wir es hier wegschaffen. Oder willst du, dass sie es uns wegnehmen?«, frage ich und nicke, als er zögert. »Habe ich mir gedacht. Unsere Fracht wird uns zu den reichsten Schmugglern aller Zeiten machen, aber was da unten auf mich – auf uns – warten könnte, liegt vielleicht jenseits unserer Fantasie – und davon habe ich eine ganze Menge.«
»Ich hoffe, du weißt, was du tust«, murmelt Amon besorgt.
»Immer.« Ich zwinkere scheinbar unbeschwert, als mein Walkie Talkie ein lautes Rauschen von sich gibt, gefolgt von Umahs Stimme: »Boss? Die Alte Lady ist bereit, aber die Eierköpfe sind alles andere als erfreut.«
Ich grunze missmutig und laufe die vielen Treppen bis zum Achterdeck hinab, das eine lange Fläche am Heck der Medusa bildet. An einem großen Kran baumelt das kleine Tiefsee-Tauchboot. Es sieht aus wie eine besonders korpulente Hummel mit seinen gelb-schwarzen Dorsalsegmenten. Mitglieder meiner Crew in orangenen Overalls ziehen an mehreren Seilen, um das Uboot stabil zu halten. Zwei Forscher stehen bei Umah und reden aufgebracht auf sie ein. Einer von ihnen ist Professor Rennenkampf, den ich an der Wolke aus weißen Haaren erkenne, die seinen faltigen Kopf umgibt.
»Da sind sie!«, braust er auf, als er mich sieht. »Die erste Testfahrt ist erst für morgen geplant!«
»Ich weiß, aber euer Pilot ist immer noch seekrank und wird es auch morgen noch sein. Von Süden zieht ein Sturm auf, also beschleunige ich den Plan. Ich habe eine Tauchboot-Lizenz und werde den Test selbst durchführen«, erkläre ich und hebe eine Hand, um seinen Einwand im Keim zu ersticken. »Sie sollten mir danken, dafür haben Sie mich nämlich nicht bezahlt.«
»Aber die Versicherung! Und nach allem, was gerade passiert ist, sollten wir da nicht ...«
»Wollen Sie zurück zur Uni und sagen, dass Ihr Projekt, auf das Sie fünf Jahre hingearbeitet haben, gescheitert ist, wegen Versicherungsbedenken?« Ich schnaube. »Keine Sorge, ich weiß, was ich tue.«
Mit schnellen Schritten laufe ich zu der Schiebeleiter, die meine Mannschaft an die große Glasglocke des Tauchboots geschoben hat, und klettere geschickt hinauf. Meine Fingerspitzen kribbeln vor Aufregung. Es ist das gleiche Gefühl, das ich immer habe, wenn etwas Großes bevorsteht. Ich weiß, dass dieses Signal kein Zufall gewesen sein kann. Zufall ist schließlich das, was mir aufgrund meines So-Seins immer wieder zufällt.
Ich klettere in die kleine Pilotenkanzel und versuche dabei nicht auf die Abdeckung des ehemaligen Batteriefachs zu blicken, die sich hinter dem Stuhl befindet. Umah hat die Systeme bereits gecheckt, also recke ich einen Daumen hoch, setze das Headset auf und mache eine kreisende Handbewegung, damit ich möglichst rasch zu Wasser gelassen werde.
Als das Tauchboot in die dunklen Fluten des Indischen Ozeans eintaucht, kribbelt es in meinem Nacken, als würden Ameisen über meine Haut laufen. Ich stelle mir vor, dass ich mich gerade genau zwischen dem Besucher im Orbit und der mysteriösen Signalquelle am Grund des Berlintiefs sechstausend Meter unter mir befinde. Mein Magen zieht sich bei dem Gedanken zusammen. Aber ich schiebe das Gefühl beiseite, als das, was es ist: etwas, das überwunden werden muss, um hinter den Horizont zu greifen.
»Triton-1, Medusa, kommen«, sage ich.
»Medusa hier, hören dich klar und deutlich«, antwortet Umah von der Brücke meines Schiffes.
»Bei mir alles auf grün. Beginne jetzt mit dem Abstieg. Macht euch direkt auf den Weg, ich komme nach.«
»Okay.«
Ein ›pass auf dich auf‹ wäre auch nett gewesen, denke ich, schüttele den Kopf und damit den Gedanken fort. Währenddessen kümmere ich mich um die Trimmung und verfolge auf dem Mosaik aus Displays, das sich halbkreisförmig vor mir ausbreitet, die sich verändernden Werte von Tiefe, Druck, Sinkgeschwindigkeit und Lebenserhaltungssystemen.
Das Wasser vor der Kanzel aus Acrylpolymeren sieht aus wie siedendes Pech. Kleine Bläschen in der schwarzen Flüssigkeit wandern an der Scheibe entlang und scheinen an die Oberfläche zu flüchten, während ich entgegengesetzt in die Dunkelheit hinabgleite. Kein Kabel verbindet mich mit der Medusa, also habe ich weder eine stabile Kommunikations- noch eine Rettungsleine, aber das Risiko ist mir bewusst.
Es ist notwendig.
Die Tiefe nimmt immer weiter zu und mit ihr der Druck. Alle hundert Meter sind es zehn bar mehr.
Partialdruck des Sauerstoffs in der Norm, denke ich und überwache weiter jedes System, ohne in die Finsternis vor mir zu blicken. Bei sechshundert Metern weiß ich, dass eine Coladose bereits zerquetscht werden würde, dabei habe ich nicht einmal zehn Prozent der vertikalen Strecke zurückgelegt.
Ich schaue immer wieder auf das Funksignal, das die Tauchsonde aufgefangen hat und das auch von der Triton klar und deutlich empfangen wird, obwohl sie einen sehr schwachen Funkempfänger besitzt. Seine Frequenz ist äußerst stabil, es gibt keinerlei erwartbare Fluktuationen, kein Muster lässt sich erkennen. Ein Teil von mir würde am liebsten umdrehen, denn ich weiß, dass die Medusa das Signal nicht empfangen hat, was praktisch unmöglich ist. Etwas geht hier vor und genau das zieht mich weiter hinab in die Dunkelheit. Die Vorstellung, in einem Tiefseegraben nach etwas zu suchen, das mit dem Besucher in Zusammenhang stehen könnte, erinnert mich an Odysseus und die Sirenen. Folge ich gerade ihrem Ruf, der mich ins Verderben führen wird? Hätte ich mir Wachs in die Ohren stopfen und einfach weiter in Richtung des persischen Golfs fahren sollen? Die Forscher in Kerala absetzen und mich an dem Reichtum erfreuen, den der Abschluss meiner Fahrt mir verspricht?
Ich schüttele den Kopf, weiß ich doch, dass sich Zufriedenheit mit keinem Geld der Welt kaufen lässt. Nicht für mich jedenfalls. Nicht, so lange es einen Horizont gibt, den ich mein ganzes Leben versucht habe zu erreichen.
»Was bist du?«, murmele ich mit Blick auf das Signal und stelle die Kühlung ein wenig höher, als mir unter den Armen und auf der Stirn unangenehm warm wird. Die Funksendung bleibt konstant, als wolle sie meiner Frage bewusst trotzen.
Den restlichen Abstieg lenke ich mich mit der Überwachung der Systeme ab, vertreibe die Gedanken an implodierende Hüllen, unheimliche Aliens und Torpedos der Marine, die mit jedem Kilometer Tiefe zunehmen. Es knistert immer stärker und knackt in den Kompositstrukturen um mich herum. Das Rauschen der Ventilatoren scheint zugenommen zu haben, die Wände näher gekommen zu sein.
Dann, nach zähen Stunden, sehe ich endlich den Boden der tiefsten Stelle des nordaustralischen Beckens vor mir im fahlen Licht der Scheinwerfer: Sand erstreckt sich zwischen winzigen schwarzen Schloten, aus denen hunderte Grad heißes, mineralienhaltiges Wasser entströmt. Es erzeugt merkwürdige Verzerrungen, wie Hitzeschlieren in der Wüste. Schwarzer Schlamm aus Eisen, Schwefel, Kupfer, Zink und Blei löst sich durch den extremen Temperaturunterschied aus den Fontänen in Form dichter Flocken, die um das Gemisch aus Methan und Schwefelwasserstoff tanzen und scheinbar schwerelos in die Finsternis aufsteigen. Der Bereich, den meine Scheinwerfer ausleuchten, ist sehr klein und die Dunkelheit ringsherum wirkt wie eine massive Wand. Es ist beinahe so, als hätten die Schatten ein Eigenleben entwickelt und wollten das störende Licht mit aller Kraft ersticken.
Die Signalquelle muss jetzt ganz nah sein. In dieser Tiefe ist keine Messung mit hundertprozentiger Genauigkeit möglich, doch angeblich sind es nur wenige Dutzend Meter in nördliche Richtung.
»Da!«, entfährt es mir kurze Zeit später, während ich um einen größeren schwarzen Raucher herumfahre. Meine Hände an den Steuersticks beginnen leicht zu zittern. Ich habe ein rotes Leuchten gesehen. Zumindest glaube ich das.
Einige Minuten später – die Triton bewegt sich vorwärts wie eine Schnecke, um nicht zu viel Energie zu verbrauchen – ertasten die Lichtkegel der Frontscheinwerfer eine Struktur, die ich zuerst für raues Felsgestein halte. Doch je näher ich komme, desto klarer erkenne ich eine unnatürliche Form: Eine etwa zwanzig Meter breite, abgeflachte Scheibe aus dunklem, fugenlosem Material, die quer im Boden des Tiefseegrabens steckt. Im Zentrum befindet sich eine Art Kugel, die sämtliche Photonen der Umgebung zu absorbieren scheint wie ein schwarzes Loch.
»Heilige Scheiße!«, krächze ich und taste nach meinem Smartphone, um ein Video aufzuzeichnen. »Ich bin dem Signal gefolgt und hier in knapp sechstausend Metern Tiefe kann es keinen Zweifel mehr geben, warum der Besucher über genau dieser Position im Orbit angehalten hat. Wenn das hier kein verdammtes UFO ist, dann weiß ich gar nichts mehr. Mein Name ist Janus Wakefield.«
Und ich habe es, verdammt nochmal, entdeckt!
Ich stoppe die Aufnahme und stecke das Handy zurück in meine Hosentasche. Ich hatte fast erwartet, dass es nicht funktioniert, wie in einem jener schlechten Science-Fiction-Filme, in denen es nie ein Beweis für außerirdisches Leben an die Öffentlichkeit schafft.