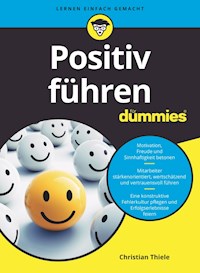12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die patagonischen Weiten, die ewige Pampa und die größten Wasserfälle der Welt; lateinamerikanisches Temperament, europäische Vielfalt und französisches Stilempfinden; alte Pracht und neue Einfachheit; großartige Literatur, Gauchofolklore, trendiges Design und Tangonostalgie: Das sind nur einige der Gegensätze, die Buenos Aires zur spannenden Metropole und Argentinien zum boomenden Reiseland machen. Um es zu entschlüsseln, begegnet Christian Thiele den Menschen – dem Friedhofswächter an Eva Peróns Grab; dem wie ein Gott verehrten Diego Maradona; Angel, der als Cartonero den Müll der Reichen verwertet; einem Rinderauktionator, einer der Mütter vom Plaza de Mayo und dem Pförtner eines »telo«, das viel mehr ist als ein Stundenhotel. Argentinien ist Gastland auf der Frankfurter Buchmesse 2010.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Christian Thiele
Gebrauchsanweisung für Argentinien
Piper München Zürich
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige eBook-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95042-8
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagabbildung: Hugh Sitton/Corbis
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»Aunque he nacido en el corazón de la Argentina y he vivido casi toda la vida allí, cada vez que la visito, cinco a seis veces por año, la entiendo menos.«
»Auch wenn ich im Herzen Argentiniens geboren bin und dort fast mein ganzes Leben gelebt habe – jedes Mal, wenn ich das Land besuche, fünf- oder sechsmal pro Jahr, verstehe ich es weniger.«
Tomás Eloy Martínez
»Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico pa’ ver si lo puede arreglar.«
»Der Welt fehlt eine Schraube Soll doch ein Handwerker kommen und sehen, dass er sie repariert bekommt.«
Enrique Cadícamo, Tango von 1933, bekannt geworden durch Carlos Gardel
Vorwort
Wenn Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser, verwundert feststellen, dass
Sie an der Uni zwölf Semester Spanisch studiert haben und jetzt einen Übersetzer brauchen, um ein Busticket zu kaufen;
die Menschen um Sie herum mit einer Thermoskanne unter dem Ellenbogen und einem Matebecher in der Hand auf die Welt gekommen zu sein scheinen;
Einheimische, die Ihnen bis vor fünf Minuten unbekannt waren, Sie als hermano (»Bruder«) oder amigo (»mein Freund«) oder querido (»mein Lieber«) anreden;
der Straßenverkehr Ihnen vorkommt wie Bürgerkrieg auf vier Rädern;
Sie vor einem Grillrost stehen, auf dem eine halbe tote Kuh geröstet wird, und der Gastgeber sagt: »Ich weiß nicht, ob das für uns beide reicht«;
sich die Fußgänger und Taxifahrer beim Passieren einer Kirche oder eines Straßenaltares bekreuzigen – und gleichzeitig über »diesen Hurensohn von Präsidenten, diesen arschfickenden River-Verteidiger oder die Fotze deiner Schwester« sprechen, als wären dies Liebkosungen;
das ganze Land einer Gruppe von Inseln hinterherzutrauern scheint, die knapp vor dem Südpol liegen und außer Schafscheiße nicht viel zu bieten haben;
morgens, mittags und nachts, im Joghurt, auf dem Brot, im Kuchen, im Marmeladenglas dulce de leche serviert wird;
in der gesprochenen Rede auf jedes normale Wort dreimal dale (»auf geht’s«), viermal che (»ey«) und sechzehnmal boludo (»Schwachkopf«) kommen;
ein einheimischer Bekannter Ihnen am Handy mitteilt: »Ich bin nur fünf Straßenblöcke von dir entfernt« – und Sie nach anderthalb Stunden immer noch warten;
die Menschen um Sie herum nicht bei Ihren Vornamen, sondern immer nur »Dicke«, »Dünner«, »Zwergin«, »Glatzkopf«, »Türke« oder »Neger« gerufen werden;
Sie bei Einheimischen zum Abendessen eingeladen sind und um Mitternacht die Vorspeise abgeräumt und so langsam der Hauptgang aufgetragen wird;
Sie beim Abspielen der Nationalhymne nur stumme Lippenbewegungen verfolgen und keiner der um Sie Herumstehenden weiß, wie der Text geht;
in einer Woche der Staatspräsident fünfmal einen anderen Namen trägt und ein anderes Gesicht hat;
die Einheimischen Sie entgeistert anschauen, sobald Sie sagen, wie gut es Ihnen doch in Lateinamerika gefalle,
dann sind Sie, verehrte Leserinnen und Leser, in Argentinien.
Das ist nicht schlimm, kein Grund zur Panik, das ist schon vielen vor Ihnen passiert und wird anderen nach Ihnen passieren. Was Sie in solchen Fällen tun können und vor allem warum das alles so ist – das wissen Sie hoffentlich nach Lektüre dieses Buches.
Wenn Sie dieses Land allerdings ausgiebig bereist haben, wenn Sie Freundschaften oder gar Liebschaften mit Einheimischen geschlossen haben, wenn Sie Bücher über Argentinien gelesen und Filme gesehen haben, wenn Sie also kurzum das Gefühl haben, das Land gut zu kennen, aber Sie gleichzeitig das Gefühl haben, je mehr Sie über Argentinien wissen, desto weniger begreifen Sie das Land – dann, aber auch wirklich erst dann haben Sie Argentinien verstanden.
Dann allerdings sollten Sie die Finger von diesem Buch lassen. Es wird Ihnen auch nicht weiterhelfen.
Eine Liebe auf den anderthalbten Blick
Maradona, Tango, Militärdiktatur: Das war so ziemlich alles, was ich von Argentinien wusste, als ich im Oktober 2005 in Buenos Aires aufschlug. Ich wusste so ungefähr, auf welchen Kontinent ich musste, ich konnte gracias sagen – das war’s aber auch schon. Ich hatte, kurzum, nicht die geringste Ahnung von Argentinien und den Argentiniern.
Meine damalige Freundin war nach Buenos Aires versetzt worden, und so ging ich eben mit. Und bereiste in den folgenden Jahren als Journalist das Land, von oben nach unten und von links nach rechts. Und ich muss gestehen: Eine Liebe auf den allerersten Blick war es nicht.
Wenn man – so wie ich damals – Lateinamerika nicht kennt und vorwiegend in europäischen und nordamerikanischen Großstädten unterwegs war, dann kommt einem Buenos Aires nicht unbedingt wie ein »südamerikanisches Paris« vor. Sondern wie ein lauter, dreckiger, fieser Moloch.
Wenn man – so wie ich damals – kein Spanisch spricht, dann kann man die vermeintliche Witzigkeit und Ironie der Argentinier erst mal nicht wirklich selber einschätzen.
Wenn man dann auch noch – und jetzt wird die Sache brenzlig, liebe argentinischen Freunde! – seine Steaks am liebsten mit einem feinen Pfeffersößchen hier und etwas Gemüsebeilage dort zu bestellen pflegt, dann wundert man sich erst mal, warum die tote Kuh hier besser schmecken soll als überall anders auf der Welt.
Mir war so viel vorgeschwärmt worden vom Land und seinen Bewohnern, die Erwartungen waren so hoch, dass ich von Argentinien zunächst enttäuscht war. Es hielt auf den ersten Blick nicht, was es mir versprochen hatte.
Doch mit jedem spanischen Wort, das mir Inda und Fernanda beibrachten; mit jeder Fußballnacht (immer montags) und jeder Diskussionsnacht (immer donnerstags), die ich mir auf Einladung von Matías um die Ohren schlug; mit jedem Asado, zu dem ich eingeladen war; mit jeder neuen Ecke von Buenos Aires, die ich kennenlernte; und mit jeder Reise ins Landesinnere, die ich machte; mit jedem Eis, das ich aß; mit jedem Taxifahrer, der mir in fünf Minuten das argentinische Drama im Speziellen und die Welt im Allgemeinen zu erklären vermochte; mit jedem Matetee, der mir angeboten wurde; mit jedem Film, den ich sah; mit jedem Buch, das ich las; kurzum, mit jedem Atemzug, den ich in Argentinien und/oder in Gegenwart von Argentiniern tat, zog mich dieses Land immer mehr in seinen Bann.
Das mag pathetisch klingen und kitschig.
Aber Pathos und Melodrama sind die einzig angemessenen Gefühlslagen gegenüber diesem Land. Von diesem Land kommt man nicht mehr los. Das so weit weg ist von allem und doch so nah dran. Dem Land, das den Tango erfunden, das so viele Reize und so viel Potenzial zu bieten und doch so finstere Abstürze zu erleiden und erdulden gelernt hat. Und das wegen alledem und trotz alledem so freundlich und so aufmerksam einem Ahnungslosen wie mir seine Arme geöffnet hat. Sodass ich der stolzeste Mensch auf Erden war, als mich in meinem zweiten Jahr in Argentinien, kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland, wohl aufgrund meines Akzentes ein Spanier fragte: »Y entonces, eres Argentino?«, »Und, du bist also Argentinier?«
Ich antwortete ihm, stolz, gerührt, und im breitesten Akzent der Porteños, dass ich, ja, auf gewisse Weise Argentinier sei. Und dass ich nur jedem empfehlen könne, es zu werden und für immer zu bleiben.
Eine Stadt und ihr Land
»A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
la juzgo tan eterna como el agua y el aire.«
(Ich halte es für ein Märchen, dass Buenos Aires einst begann:
Ich finde es so ewig wie das Wasser und die Luft.)
Jorge Luis Borges, Fundación mítica de Buenos Aires
Der Mexikaner, sagt man in Argentinien gerne, stammt von den Azteken ab; der Peruaner stammt von den Inkas ab; und der Argentinier, der stammt von den Booten ab. Dieser Spruch ist nicht nur ein Spruch, er enthält viel Wahres. Und er verrät in seiner Ironie einiges über die argentinische Selbstwahrnehmung. Davon wird im Laufe dieses Buches die Rede sein. Aber er erklärt auch, warum der Bewohner von Buenos Aires von sich als porteño spricht, als »Hafenbewohner« (von spanisch puerto, »Hafen«).
Aus Sicht der Porteños jedenfalls, und die ist erst mal maßgeblich, setzt sich Argentinien aus drei Teilen zusammen, und zwar drei sehr unterschiedlich wichtigen Teilen: aus capital, der Hauptstadt Buenos Aires (ziemlich wichtig); aus dem conurbano, dem Speckgürtel (ziemlich unwichtig); und aus la provincia, der Provinz (völlig unwichtig).
Gott hat seine Sprechzeiten in Buenos Aires
Argentinien ist fast achtmal so groß und hat etwa halb so viele Einwohner wie Deutschland. Es streckt sich vom 22. bis zum 55. Grad südlicher Breite – auf die Nordhalbkugel übertragen, wäre das von Moskau bis Dschidda am Roten Meer – und vom 54. bis zum 73. Grad westlicher Länge, das wäre etwa von Paris bis nach Warschau.
Aber von den rund 40 Millionen Argentiniern leben fast 13 Millionen im Großraum Buenos Aires – damit ist die argentinische Hauptstadt nach Mexiko und São Paulo die drittgrößte Megacity in Lateinamerika. Die großen Theater, das höchste Gericht, die wichtigsten Zeitungen, die besten Fußballclubs, die besten Universitäten: alles in Buenos Aires. Für die Radiomoderatoren im ganzen Land – behauptet man zumindest im ganzen Land – ist der Akzent der Hauptstadt verpflichtend. Wer in Ushuaia im Café sitzt, also ganz im Süden von Feuerland, 3080 Kilometer von Buenos Aires entfernt, der sieht auf dem Fernseher die Staumeldungen für – la capital federal, die Hauptstadt. Genauso wie der, der in San Salvador de Jujuy sitzt – 1500 Kilometer weiter nördlich. Und wenn er dort die Zeitung aufschlägt, liest er, dass auf der Avenida Corrientes im Herzen von Buenos Aires mal wieder einer schwedischen Touristin die Handtasche abgenommen wurde. Das ist in etwa so, als würde man im norwegischen Hammerfest die Blitzerwarnung für Neapel mitgeteilt bekommen.
Wer es einmal oder wessen Familie es einmal in die Hauptstadt geschafft hat, der zieht nicht nach Rosario oder nach Córdoba, die beiden zweitgrößten Städte, oder gar sonst woandershin, um zu studieren oder um einen Job zu finden. Er bleibt in Buenos Aires. Im Vergleich zu Argentinien ist das zentralistische Frankreich ein föderalistischer Flickenteppich.
Dass politische Karrieren bisweilen in der Provinz gemacht werden, widerspricht dieser Feststellung nicht, im Gegenteil: Es bestätigt sie. Carlos Menem, der spätere Staatspräsident, konnte nur in seiner Provinz La Rioja als Gouverneur groß werden, weil sie so weitab vom Schuss war. Auch Néstor und Cristina Kirchner, seine Nachnachnachnachnachnach- und Nachnachnachnachnachnachnachnachfolger im Casa Rosada, dem rosa Präsidentenpalast, bastelten sich ihre Karrieren im patagonischen Hinterland, ebenfalls weit jenseits des hauptstädtischen Radars.
Der erfolgreiche Estanciero, ob er mit gigantischen Schafherden in Feuerland sein Geld gemacht hat oder mit riesigen Sojafeldern im Nordosten, an der Grenze zu Brasilien, genauso wie der Winzer aus Mendoza ganz im Westen, der seinen Malbec in alle Welt importiert: Sie haben alle ihr Apartment im Barrio Norte in Buenos Aires – schon alleine, damit ihre Gattinnen standesgemäß shoppen und die Sprösslinge auf eine vernünftige Schule gehen können. Von den 20 Fußballvereinen in der höchsten Spielklasse, der Primera División, kommen immer alle bis auf eine Handvoll aus dem Großraum Buenos Aires – und nur alle Jubeljahre gewinnen die Newell’s Old Boys oder Central aus Rosario oder – noch seltener – die Estudiantes aus La Plata. Ansonsten bleibt der Titel immer schön in der Hauptstadt. Wer als Tourist von den Gletschern in Patagonien zu den Weinbergen von Mendoza will, wer aus der Hochebene Saltas zu den Wasserfällen von Iguazú will, der muss immer über Buenos Aires fliegen.
Kurzum: »Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires«, sagen die Argentinier gerne: »Gott ist überall – aber seine Sprechzeiten hat er in Buenos Aires. «
Der Porteño prägt die Wahrnehmung des Argentiniers im Ausland. Die – vergleichsweise – paar argentinischen Touristen aus anderen Landesteilen entschuldigen sich laufend, wenn sie in Bolivien oder Brasilien unterwegs sind, dass sie erstens keine Porteños seien und sie sich zweitens von deren ständigem Dame-dos-Geprahle (»Gib mir gleich zwei«) aufs Schärfste distanzieren wollen. Was übrigens meistens nichts bringt, aber das ist ein Thema für sich.
In diesem Buch werden deshalb die Hauptstadt und der Hauptstädter auf gänzlich ungerechte Weise bevorzugt und völlig überdimensioniert dargestellt. Ungerecht gegenüber den vielen interessanten, schönen anderen Flecken und Gebräuchen etc., die Argentinien zu bieten hat. Völlig überdimensioniert im Verhältnis der Hauptstadt zu seinem restlichen Land.
Aber eben – man mag das bedauern – in völligem Einklang mit dem in Argentinien ganz Üblichen.
Die Stadt am Silberfluss: Aus Versehen entdeckt und zweimal gegründet
Wann genau Buenos Aires gegründet wurde? 1535, hieß es lange. Bis Historiker nachwiesen, dass der Stadtgründer, der Spanier Pedro de Mendoza, für das Jahr 1535 ein ziemlich wasserdichtes Alibi hat und sich nicht in Südamerika aufgehalten haben kann. So hat man sich auf 1536 geeinigt, und zwar auf den 3. Februar. Aber ob es wirklich der Tag war und der Monat und wie die sonstigen genaueren Umstände waren, all das liegt im Dunkeln. Dokumente, Gründungsakten gab es nie, oder wenn es sie gab, sind sie verloren gegangen.
Die Entdeckung des Río de la Plata und die Gründung von Buenos Aires, so viel lässt sich allerdings mit ziemlicher Sicherheit sagen, ist eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen:
Der junge spanisch-portugiesische Juan Díaz de Solís (vermutlich 1470 bis 1516) fühlt sich als junger Seemann der Marine Ihrer portugiesischen Majestät offensichtlich derart unterbezahlt, dass er gemeinsam mit französischen Korsaren ein Schiff der portugiesischen Marine plündert. Um der Todesstrafe zu entgehen, heuert er bei den Spaniern an und sucht nun im Auftrag König Ferdinands nach einem Seeweg über den Süden in den Osten, zu den sagenhaften Ländern Indiens – dort, wo die Gewürze sein sollen, die Seide, das Opium und die Sklaven. Ferdinand hat den erfahrenen Seemann zum Piloto Mayor de Castilla und damit zum Nachfolger des verstorbenen Amerigo Vespucci ernannt. Als Admiral der spanischen Entdeckungsflotte bricht er 1515 mit drei Karavellen und 70 Seemännern auf, um eine Verbindung vom Atlantik zum Pazifik zu finden. So stößt Solís mit seinen Männern im Februar 1516 am Zusammenfluss von Río Uruguay und Río Paraná auf eine riesige Süßwasserfläche, den heutigen Río de la Plata, und tauft sie Mar Dulce, das »Süße Meer«. Solís glaubt, den sagenhaften Seeweg gefunden zu haben, geht mit Offizieren an Land und wird von kannibalischen Ureinwohnern gefressen – sagen die einen. Diese Geschichte haben die Überlebenden der Crew nur erfunden, um die Meuterei an Bord zu vertuschen – sagen die anderen.
Im spanischen Mutterland wird Legendäres von jenem Mar Dulce berichtet, das Solís als erster Nichtamerikaner besegelt hat. Ein venezianischer Entdecker tauft es den Río de la Plata, den »Silberfluss«, obwohl der Fluss im Laufe seiner Geschichte wohl nie mehr Silber als ein paar verlorene Besteckteile enthalten hat und seine Farbe auch bei größter Rot-Grün-Schwäche eindeutig als bräunlich beschrieben werden muss. Doch die Portugiesen machen Land in der Neuen Welt, da will sich der spanische König nicht abhängen lassen: Er will Forts, Städte, Sklaven, Reichtümer. Er will in der Gegend jenes sagenhaften Río de la Plata spanische Kolonien gründen lassen. Für 2000 Dukaten pro Jahr heuert Karl V. den Seefahrer Pedro de Mendoza an, verpasst ihm den Rang eines Admirals, gibt ihm ein gutes Dutzend Schiffe und an die 30 Hundertschaften Soldaten. Vermutlich 1536 – angeblich eben an jenem 3. Februar – kommt die Flotte Mendozas an ihrem Ziel an. Aus dem Holz einiger Begleitschiffe lässt Mendoza ein Fort bauen und tauft es auf den Namen El Puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, »Der Hafen unserer Frau Maria der guten Lüfte« – das heutige Buenos Aires.
Es wird sich bald herausstellen, dass der Río de la Plata nicht der erträumte Silberfluss ist und dass das Land, wo Milch und Honig fließen, anderswo zu suchen ist. Der Straubinger Landsknecht Ulrich Schmid(e)l zählt zum Expeditionskorps von Mendoza und schreibt später seinen Reisebericht über »Warhafftige Historien einer wunderbaren Schiffart. Welche Ulrich Schmidel von Straubing von anno 1534 biss 1554 in Americam oder Neuwewelt, Bey Brasilia und Rio della Plata gethan«. Darin enthalten ist eine Radierung Schmidls, die das Fort von »Buenas Aeres« zeigt, wohl die erste Darstellung der Stadt. Die Menschen auf diesem Bild fallen übereinander her, den drei Pferdedieben, die am Galgen vor den Mauern des Forts hängen, fehlen die Beine: Aus lauter Hunger hat man sie ihnen weggegessen. Die Spanier, schreibt Schmidl in seinem Expeditionsbericht, aßen sogar das Fleisch ihrer eigenen Brüder, sobald diese gestorben waren.
Mendoza verliert immer mehr Männer an den Hunger und an die Auseinandersetzungen mit den Indios, nach nicht einmal vier Jahren wird das Fort aufgegeben, die europäischen Kolonisten siedeln über nach Asunción im heutigen Paraguay. Das ist näher dran an den tatsächlichen Silberminen im Vizekönigreich Peru.
Doch der Mensch gibt nicht auf, an das zu glauben, woran er glauben will: Die europäischen Kartografen des 16. Jahrhunderts bezeichnen den Río de la Plata auf Lateinisch als Mare Argenteum und die angrenzenden Landmassen als Terra Argentea, als »Silberland«. Daraus wird später einmal das Wort für ein Land – Argentinien.
Und 1580 gründet Juan de Garay die Stadt neu, an fast derselben Stelle, an der einst Mendozas Fort stand. Denn das Vizekönigreich Peru braucht einen Atlantikhafen, um das Silber aus Potosí, im heutigen Bolivien, gen Europa zu verschiffen. Und so verstehen sich die Bewohner von Buenos Aires bis heute als porteños, als »Hafenbewohner«.
24 Stunden in Buenos Aires
7 Uhr: Auf dem Mercado de Liniers, dem größten Viehmarkt der Welt, 50 Fußballfelder groß, im Süden von Buenos Aires gelegen, läutet die große Glocke. Die LKWs, die aus dem ganzen Land hergefahren sind und die Nacht über gewartet haben, haben ihre muhende Fracht längst durch die Gatter in die Ställe entlassen. Der Tierarzt hat die Viecher inspiziert und ihnen in die Mäuler und zwischen die Klauen geschaut. Mit dem Glockengeläut beginnt die Versteigerung.
8 Uhr: In den schicken Wohnvierteln im Norden der Hauptstadt spritzen die letzten porteros die Bürgersteige ab. Die Putzfrauen in ihren schwarz-weißen Uniformen holen für den Señor die Zeitung vom Kiosk nebenan und für die Señora ein fettarmes Croissant vom Bäcker.
9 Uhr: Auf der Avenida General Paz hebt das tägliche Hupkonzert zu einem Crescendo an. Den Autofahrern dauert es zu lange, bis die Schranken an der Mautstation oben sind. Angeblich müssen die Schranken, sobald mehr als acht Autos hintereinander in der Schlange stehen, geöffnet werden – aber dann hat die Mautgesellschaft keine Einnahmen mehr. Also müssen sich die Kassierer den Zorn der Berufspendler anhören.
10 Uhr: Auf vier Spuren rattern, pfeifen und ächzen die Busse über die Avenida del Libertador. Vollgestopft mit Bürovolk. Sie fahren vorbei an Häusern, die auch auf dem Boulevard Haussmann in Paris stehen könnten, Seite an Seite mit einem Glaskasten, der Manhattan gut stehen würde – und dazwischen ein abgeranzter Fünfzigerjahre-Block, der eigentlich nach Kabul oder Dnipropetrowsk gehören würde. Und dann, links der Eisenbahnlinie, die »Villa 31«, das größte Wellblechviertel von Buenos Aires, fast 30000 Menschen sollen hier leben. Erste und Dritte Welt sind in dieser Stadt verdammt nahe beieinander. Im Microcentro, nicht weit vom Hafen, spucken die Busse ihre Ladung aus. Die Büromenschen steigen aus, werfen einen kurzen Blick auf die Neon-Anzeigen in den Wechselstuben: Wo steht der Dollar heute? Ah, 3,89 Peso. In schwarzen oder grauen Anzügen und schwarzen oder grauen Kostümen wuseln sie in ihre Büros.
11 Uhr: Im Parque de Palermo empfangen die Fitnesstrainer ihre Kunden, um mit ihnen keuchend um den Teich zu watscheln. Ein paar Bauchmuskelübungen müssen auch noch sein. Wer das auch nur halbwegs in der Realität einlösen kann, schreibt in Argentinien »buena presencia«, in etwa »ansprechende Erscheinung«, in den Lebenslauf. Oder sogar »muy buena presencia«.
Ein junger Mann im Muskelshirt liegt dösend in der Morgensonne. Im Ohr hat er einen Kopfhörer, damit er die zwölf Hunde nicht hören muss, die er eigentlich ausführen sollte. Er hat sie einfach an einen Baum gebunden und macht jetzt Siesta. Nebenan von den Sandplätzen im Tennisclub von Guillermo Vilas das übliche Plopp-plopp-plopp.
12 Uhr: Mittlerweile ist auch das Da-muss-man-hin-Viertel Palermo Hollywood wach, der Prenzlauer Berg, Meatpacking District und Marais von Buenos Aires. Die Filmproduzenten, Modedesigner oder sonstwie Kreativen treffen sich in der Bar 6 oder im Olsen, ein Kaffee zum Wachwerden. Sie fühlen sich näher an Paris oder an New York als an La Paz oder an Brasília, den Hauptstädten ihrer Nachbarländer. Und irgendwie haben sie auch recht damit.
13 Uhr: Auf dem Markt von Liniers sind heute 1289 Rinder angeliefert worden, 21 davon tot, die muss man also von der Verkaufszahl abrechnen – ein schwacher Wert für einen Donnerstag. In der Luft knattert ein Hubschrauber, es wird wohl die Präsidentin sein, die sich von ihrer Residenz in Olivos zum Präsidentenpalast, dem Casa Rosada, im Zentrum einfliegen lässt.
14 Uhr: Die mucamas, die Putzfrauen, stehen in ihren Dienstuniformen Schlange an den Supermarktkassen. An den Wänden hängen Preislisten mit dem Staatswappen. Die Regierung hat mal wieder, um sich die Gunst des Wahlvolkes zu sichern, die Supermarktbetreiber dazu gezwungen, die Preise für Margarine, Butter, Tomaten, Nudeln und noch ein paar Grundgüter zu senken. Dafür werden eben die anderen Preise erhöht, die mucamas kommen mit ihrem Haushaltsgeld für die Herrschaften und vor allem mit dem für ihre eigene Familie nicht weit.
15 Uhr: Auf dem Plaza de Mayo drehen die Frauen mit den weißen Kopftüchern ihre Runden, seit dem 30. April 1977 tun sie das, jeden Donnerstag, immer um 15 Uhr, eine halbe Stunde lang. Es ist ihre stumme Anklage gegen die Militärdiktatur, die ihnen die Töchter und Söhne geraubt hat. Aber auch heute werden die madres de Plaza de Mayo keine Auskunft bekommen und immer noch nicht erfahren, was mit den »Verschwundenen« ist.
15 Uhr: Wer es sich leisten und wer es sich einrichten kann, liegt bei seinem Psychiater auf der Couch. Es geht um den oder die Ex, die Schwiegereltern, die Probleme mit der Tochter. Buenos Aires ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Psychiatern weltweit, angeblich sind es fünfmal so viele wie in New York. Jeder Fünfte geht demnach regelmäßig zum Psychologen oder Psychiater – in Argentinien wird da kein großer Unterschied gemacht. Und jedes Jahr werden an den Universitäten rund 3000 neue von ihnen ausgebildet.
16 Uhr: Eigentlich ist diese Stadt nicht dafür gemacht, um nachzudenken, um dicke, schwere Bücher zu lesen. Dafür sind die Frauen zu schön, das Rindfleisch zu gut, das Klima zu mild und die Menschen viel zu freundlich. Und doch wissen die Menschen hier alles, jeder Taxifahrer kann erklären, warum Hitler an die Macht kam, wofür Marie Curie einen Nobelpreis bekommen hat und weshalb Amerika im Irak scheitern muss. Im Café Biela sitzen die Menschen und lesen italienische, englische und argentinische Zeitungen und werden wieder ein bisschen schlauer.
17 Uhr: Lauter kleine Engel strömen durch die Straßen: Die Schule ist aus, und nur wenn sie ihre Schuluniform, die guardapolvos blancos, die »weißen Staubfänger«, tragen, dürfen sie umsonst im Bus fahren.
18 Uhr: Die ersten cartoneros, die Papiersammler, steigen aus dem Vorortzug. Hinter sich ihren Wagen, noch ist er leicht, nur das kleine Töchterchen, eine Thermoskanne und ein Sandwich liegen drin. Die Angestellten im Bankenviertel strömen nach und nach aus ihren Bürogebäuden. Ein kurzer Blick auf die Anzeigen in den Wechselstuben, der Dollar steht bei 3,88 Peso, es hat sich nicht viel getan.
19 Uhr: Auf der Avenida General Paz hupen sich die Autofahrer wieder ihre Wut aus dem Bauch. Sie wollen nach Hause in ihre Wohlstandsinseln hinter Gittern im Norden der Hauptstadt, sie wollen sich das Kleingeld sparen und keine Minute mehr verlieren. Aber die Mautschranke bleibt unten, einer nach dem anderen wird abgefertigt.
20 Uhr: Buenos Aires macht sich mal wieder fein für eine lange Nacht. Überall in der Stadt beginnen die Tangoklassen. Auf der Plaza Dorrego in San Telmo wird das Licht langsam schummrig, die Taschendiebe machen sich bereit für die Abendschicht. In den Bars läuft der Fernseher, die Copa Libertadores läuft, Boca spielt gegen die Corinthians aus São Paulo. Die cartoneros ziehen durch die Straßen. Die porteros, die es gut mit ihnen meinen, haben ihnen den Müll sauber getrennt auf den Bürgersteig gestellt, der eine oder andere steckt ihnen sogar ein Sandwich oder ein ausrangiertes Kleidchen für die Tochter zu. Im Teatro Colón an der Avenida 9 de Julio steht Puccini auf dem Programm, wieder mal La Bohème. Die feinen Porteñas funkeln mit den Kristalllüstern um die Wette. Wer im schwarzen Anzug statt im Smoking kommt, fühlt sich underdressed – wer in Jeans kommt, wird nicht einmal ignoriert.
21 Uhr: Die Restaurants machen auf. Aber außer ein paar Touristen, die sich an den Takt dieser Stadt noch nicht gewöhnt haben, ist nichts zu tun. Man wienert die Tische, poliert noch mal ein paar Gläser, entstaubt ein paar Weinflaschen. Lange Schlangen vor den Kinos, die Abendvorstellung beginnt. Die einen ziehen sich den neuesten Hollywoodschinken rein, die anderen freuen sich auf irgendeine französische Komödie, die in der Nación gelobt wurde. Klar, sie kommt ja schließlich aus Frankreich, aus Europa.
22 Uhr: In den telos, den Stundenhotels, herrscht so langsam erste Rushhour. »Du, Schatz, es wird wohl später, ich muss noch in eine Konferenz, deshalb schalte ich gleich das Handy aus. Ein Küsschen, bis später.« Diese oder ähnliche Sätze haben mal wieder Tausende von Frauen und Tausende von Männern in ihre Telefone gelogen.
23 Uhr: Die Abendvorstellung in den Kinos ist zu Ende, am Teatro Colón ist der letzte Vorhang gefallen. Man strömt in die Restaurants. An langen Tischen sitzen Freundesgruppen, in der Regel getrennt nach Geschlecht. Denn donnerstags ist man mit den Freunden oder den Freundinnen unterwegs, Donnerstag ist der jueves de trampa, der »Fremdgehtag«. Das heißt, die telos werden guten Umsatz machen heute Nacht.
0 Uhr: Auch der letzte Tangokurs ist beendet. Nun beginnen die Milongas, die Tangonächte. Die cartoneros gehen ihre letzten Straßen ab, die Wagen sind nun schwer beladen.
1 Uhr: Auf dem Mietfußballplatz im Barrio de Parque stehen die Letzten unter der Dusche. Eigentlich wäre nur bis Mitternacht gebucht gewesen, dann hat der Platzwart noch mal ein Auge zugedrückt, aber um halb eins hat er endgültig das Flutlicht abgedreht.
2 Uhr: Die Tangoshows für die Touristen sind vorbei, professionelle Tänzer drehen noch eine Runde durch die Milongas. Ein, zwei Stündchen noch, ein, zwei Bierchen noch.
3 Uhr: Das Handy klingelt: Matías ist dran, er kommt gerade vom Grupo de los Jueves, seinem politischen Debattierzirkel. Ob man nicht noch Lust habe auszugehen, er sei gerade in der Gegend. Tja, warum nicht, die Nacht ist ja noch jung.
4 Uhr: Wir treffen Martín Churba, er ist einer der argentinischen Modedesigner, die nach der Krise 2001 international groß rausgekommen sind. Mit seinem Defilee ist heute die Modewoche eröffnet worden, in der mächtigen Asociación Rural, wo ansonsten die Rinderbarone ihre neuen Superkühe vorstellen. Jetzt feiert Churba auf einem Hausdach in Palermo, er lässt sich feiern, und er dreht die Musik lauter. Es wird sich schon keiner von den Nachbarn beschweren, ist ja schließlich erst 4 Uhr morgens.
5 Uhr: Die Putzfrauen und die Hausmeister reiben sich den Schlaf aus den Augen und schlürfen den ersten Mate des Tages. Sie stehen an den Vorortbahnhöfen oder den Bushaltestellen und machen sich auf zu den Herrschaften in der Hauptstadt.
6 Uhr: Jetzt ist auch Matías müde. Man besorgt sich beim Kiosk an der Ecke ein letztes Bier, erzählt sich noch einmal die Anekdoten des Abends, und dann geht es nach Hause. Ein paar Stunden Schlaf müssen reichen, diese Stadt hat zu viel zu bieten.
7 Uhr: Auf dem Viehmarkt in Liniers sind die letzten LKWs angekommen. 1221 Rinder werden heute den Besitzer wechseln.
Allein unter Menschen: In den Cafés von Buenos Aires»
»Wie soll ich Dich vergessen in diesem Klagelied,
Cafetín von Buenos Aires?
Wenn Du doch das Einzige in meinem Leben bist,
das meiner Mutter glich.
In Deiner wundersamen Mischung
aus Weisen und Selbstmördern
lernte ich Philosophie … die Würfel … das Spiel
und die grauenhafte Poesie,
nicht mehr länger an mich zu denken.
Du gabst mir in Gold eine Handvoll Freunde
welche meine Stunden erheitern …«
Enrique Santos Discépolo, Cafetín de Buenos Aires, Tango von 1948
Sicher, der Porteño hat in aller Regel ein Zuhause, einen Ort, an dem er lebt; und er hat ein Büro, einen Ort, an dem er arbeitet. Aber der Ort, an dem der Porteño seine Zeitung liest, seinen Kaffee trinkt, sein Feierabendbier zu sich nimmt, das Sonntagsspiel anschaut, wo er seine Steuererklärung macht, den nächsten Roman schreibt, die letzte Scheidung durchrechnet und sein Ferienhaus plant, kurzum: der Ort, an dem der Porteño die wirklich wichtigen Dinge des Lebens verhandelt, ist das Café. Die großen Dinge, der neue Präsident, der Rindfleischpreis, die Verderbtheit der Jugend, sie werden im Café ganz klein. Und die kleinen Dinge, dieses verdammte Gegentor von Racing in der letzten Minute oder der Regen draußen vor der Tür, sie werden ganz groß im Café. Der Arbeiter, der Intellektuelle und der, der sich dafür hält – im Café hat er sein eigentliches Wohnzimmer.
Genauer gesagt: im cáfe de la esquina, im Café am Eck. Man fährt als Porteño nicht durch die halbe Stadt, um in irgendeinem angesagten Café irgendjemanden zu treffen, sondern man geht in sein Café an der und um die Ecke. Schon alleine, um dem Wahnsinn daheim zu entfliehen. Dem Vater, der einen nicht versteht; der Frau, die auf einem anderen Planeten lebt; der Schwester, die den ganzen Tag vom neuen oder vom ehemaligen Freund redet. Alleine sein unter Menschen, darum geht es im Café. Der argentinische Philosoph Rodolfo Kuch schreibt: »Es gibt wohl keine typischere Erfahrung in Buenos Aires als die, am Tisch eines Cafés zu sitzen und über das Vorbeilaufen der Menschen vor dem Fenster nachzudenken.«
Es gibt angeblich 8000 Cafés in Buenos Aires. Es gibt die berühmten, das Tortoni, das La Biela, das Las Violetas, die Confitería Ideal. Holzvertäfelte Wände, große Spiegel, Waschbecken aus Marmor: Ja, diese Überbleibsel aus der argentinischen Belle Epoque muss man gesehen haben. Schließlich haben da die Patrioten gegen den spanischen Vizekönig die Mai-Revolution von 1810 ausgeheckt, schließlich haben da die Borges und die Cortázars ihre Bücher geschrieben. Per Gesetz ist 1998 sogar die Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires geschaffen worden, die »Kommission zur Erhaltung und zur Förderung der würdigen Cafés, Bars, Billardsalons und Konfiserien der Stadt von Buenos Aires«. Sie veröffentlicht und aktualisiert ständig ein Verzeichnis der traditionellen Cafés, organisiert dort umsatzfördernde Lesungen und Tangoabende und leistet Hilfestellung bei der Restaurierung.
Aber der Geist des »Cafetín de Buenos Aires« lässt sich auch in jenen klimaanlagengekühlten Kettencafés mit ihrem Franchisekettendekor erspüren, die seit den Menem-Jahren immer mehr und mehr geworden sind.
Es gibt in jedem Café, das diesen Namen verdient, die aktuellen Zeitungen, und es gibt einen Fernseher, der in der Ecke hängt und die aktuellen Staumeldungen anzeigt. Es gibt einen Mann an der Kasse – meistens ist es ein Mann –, der den Kellnern die Bestellungen boniert und die Rechnungen macht. Zigaretten gibt es übrigens im Café nicht mehr, seitdem Buenos Aires, buchstäblich über Nacht, 2005 das Rauchen in öffentlichen Gebäuden abgeschafft hat. Dass solche Dinge ohne Murren und ohne Ausnahmen einfach durchgesetzt werden, trägt zur grundsätzlichen Unverständlichkeit des Landes bei – erklärt aber, warum Argentinier bisweilen als die »Preußen Südamerikas« gelten.
Die Hauptperson im Café ist übrigens nicht etwa der Gast, sondern der mozo, der Kellner. Wer in Buenos Aires kellnert, hat nicht – wie etwa in Berlin – ein Studium oder ein sonst wie wichtiges Projekt laufen, das er durch das mal mehr und mal weniger engagierte Herumlungern in bauchfreier Kleidung finanziert. Der Kellner sieht sich in Buenos Aires als Vertreter eines ehrenwerten Berufsstandes. Seine Kellnerehre baut auf vier essenziellen Dingen auf:
Ende der Leseprobe