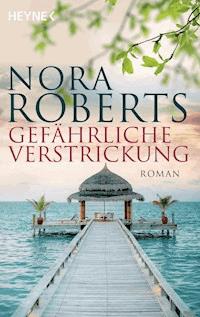
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diamanten, Leidenschaft und süße Rache
Die schöne Adrianne führt ein Doppelleben. Bei Tag ist sie die elegante Society-Lady, bei Nacht eine gefürchtete Juwelendiebin. Doch all ihre Einbrüche sind nur Fingerübungen für ihren größten Coup. Sie will jenen Mann bestehlen, der einst ihrer Mutter das Leben zur Hölle machte - ihren eigenen Vater, einen arabischen Scheich. Nur einer könnte ihre Pläne vereiteln: der attraktive Philip Chamberlain, Ex-Juwelendieb und Interpol-Agent. Er heftet sich an ihre Fersen und lässt sich nicht mehr abschütteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
NORA ROBERTS IM INTERVIEW
Sind sie eine Romantikerin?
Das kommt darauf an, wie Romantikerin definiert ist. Ich sehe mich nicht als traditionelle Romantikerin, die von einem Essen zu zweit bei Kerzenlicht träumt und sich fragt, ob ihr Ehemann ihr wohl Blumen mitbringt. Ich bin eher pragmatisch veranlagt und finde es ungeheuer romantisch, dass mein Ehemann den Abwasch erledigt.
Gibt es für Ihre Heldinnen Vorbilder in der Realität?
Mir ähneln sie ganz bestimmt nicht – das wäre schrecklich langweilig. Ich bin nicht einmal annähernd so abenteuerlustig, mutig oder selbstlos wie meine weiblichen Hauptfiguren. Ich kenne auch niemanden, der so interessant wäre. Meine Aufgabe als Autorin ist es, solche Personen zu erfinden.
Ist es wahr, dass Sie schlecht in Rechtschreibung sind?
Darin bin ich schrecklich! Zwar mittlerweile besser als zu Beginn meiner Autorenlaufbahn, aber ich muss Gott immer noch danken für Rechtschreibkorrekturprogramme.
ÜBER DIE AUTORIN
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren und gehört heute zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von über 400 Millionen Exemplaren. Auch in Deutschland erobert sie mit ihren Romanen regelmäßig die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland.
Inhaltsverzeichnis
Für Carolyn Nichols, als Dank für ihre Unterstützung und ihre Freundschaft.
TEIL 1
DAS BITTERE
Die Weiber sind euere Acker,geht auf eueren Acker, wann und wie ihr wollt.
Der Koran
Er war ihr Mann, aber er hat ihr Unrecht getan.
»Frankie und Johnny«
1. Kapitel
New York, 1989
Stuart Spencer haßte sein Hotelzimmer wie die Pest. Der einzige Vorteil, den sein Aufenthalt in New York mit sich brachte, war, daß seine Frau weit weg in London weilte und somit nicht über die Einhaltung seiner Diät wachen konnte. Er hatte sich beim Zimmerservice ein Club-Sandwich bestellt und ließ jeden einzelnen Bissen genüßlich auf der Zunge zergehen.
Spencer war ein korpulenter Mann mit beginnender Glatze, ohne jedoch die gutmütige Heiterkeit zu besitzen, die man von einem Mann seines Äußeren gemeinhin erwartet. Ihn plagte eine schmerzhafte Blase an der Ferse, und er litt an einem hartnäckigen Schnupfen, den er nicht loswurde. Nachdem er eine halbe Tasse Tee geschlürft hatte, kam er mit dem verschrobenen Chauvinismus, der vielen Engländern eigen ist, zu dem Ergebnis, daß die Amerikaner einfach nicht in der Lage waren, einen anständigen Tee zu kochen, sosehr sie sich auch darum bemühen mochten.
Alles, was er sich im Moment wünschte, war ein heißes Bad, eine gute Tasse Earl-Grey-Tee und ein anschließendes Nickerchen. Doch der rastlose Herr, der da am Fenster stand, so fürchtete er, würde ihn dazu zwingen, all dies aufzuschieben… vielleicht sogar für immer.
»Hier bin ich, verdammt noch mal.« Er bedachte Philip Chamberlain mit einem finsteren Blick, als dieser den Vorhang zur Seite schob.
»Wirklich, eine reizende Aussicht«, bemerkte Philip und starrte auf die Hausmauer gegenüber. »Verleiht dem Ort hier doch eine gewisse Behaglichkeit.«
»Philip, ich muß Sie wohl nicht daran erinnern, daß ich es verabscheue, im Winter den Atlantik zu überqueren. Außerdem wartet in London ein unerfreulicher Stapel Papierkram auf mich, und den größten Teil davon habe ich Ihnen und Ihren ungesetzlichen Machenschaften zu verdanken. Also, wenn Sie mir etwas mitzuteilen haben, dann bitte, spucken Sie es aus. Sofort, wenn es nicht zuviel verlangt ist.«
Philip blickte weiterhin aus dem Fenster. Er war nervös, was den Ausgang des informellen Treffens betraf, das er anberaumt hatte, aber nichts an seinem gleichgültigen Benehmen verriet die Anspannung, die auf ihm lastete.
»Ich muß Sie unbedingt zu einer Show mitnehmen, solange Sie in New York sind. In ein Musical. Sie werden ja richtig griesgrämig, auf Ihre alten Tage.«
»Also, spucken Sie’s endlich aus.«
Philip ließ den Vorhang wieder zurückfallen und bewegte sich leichtfüßig auf den Mann zu, dem er die letzten Jahre unterstellt war. Sein Beruf verlangte vertrauenswürdige, athletische Grazie. Er war erst fünfunddreißig, konnte aber bereits auf ein Vierteljahrhundert Berufserfahrung zurückblicken. Obwohl in den Londoner Slums geboren und aufgewachsen, hatte er es schon immer verstanden, sich Einladungen zu den wichtigsten Partys der besseren Gesellschaft zu ergaunern. Und das war kein Kinderspiel gewesen, zumal in der Zeit, bevor das strikte Klassenbewußtsein der Engländer unter den Attacken der Mods und Rockers zusammengebrochen war. Das Gefühl eines knurrenden Magens war ihm ebenso vertraut wie der Anblick eines gutgefüllten Schälchens mit Beluga-Kaviar. Da er aber Kaviar bevorzugte, sah er zu, daß sein Leben letzteres mit einschloß. Er war gut, sehr gut in seinem Job, aber der Erfolg war nicht über Nacht gekommen.
»Ich habe einen rein hypothetischen Vorschlag für Sie, Stuart«, sagte Philip, nahm Platz und schenkte sich eine Tasse Tee ein. »Zunächst eine Frage: War ich Ihnen in den letzten Jahren eine Hilfe?«
Spencer nahm einen herzhaften Bissen von seinem Sandwich und hoffte, daß weder das Sandwich noch Philip ihm auf den Magen drücken würden. »Steuern Sie auf eine Gehaltserhöhung zu?«
»Auch kein schlechter Gedanke, aber darum geht es mir im Moment eigentlich nicht.« Wenn er wollte, konnte er ein hinreißendes Lächeln auf sein Gesicht zaubern, das stets den gewünschten Erfolg zeitigte. Und genau das tat er jetzt. »Die Frage lautet: Hat sich für Sie ein Dieb auf der Gehaltsliste von Interpol bezahlt gemacht?«
Spencer schnüffelte, kramte ein Kleenex aus der Tasche und schneuzte sich geräuschvoll die Nase. »Von Zeit zu Zeit.«
Philip fiel auf – und er fragte sich, ob Stuart es auch bemerkt hatte –, daß er diesmal nicht das Adjektiv »ehemaliger« vor das Wort »Dieb« gestellt hatte und daß Stuart ihn dahingehend auch nicht korrigiert hatte. »Sie sind mit Ihren Komplimenten ganz schön geizig geworden.«
»Ich bin nicht hier, um Ihnen mit Komplimenten zu schmeicheln, Philip, sondern allenfalls, um herauszufinden, was zum Teufel so wichtig sein könnte, daß Sie mich mitten in diesem verdammten Winter nach New York gehetzt haben.«
»Würden Sie Wert auf zwei legen?«
»Zwei was?«
»Diebe, Stuart.« Er nahm sich eines der kleinen Dreiecke von Spencers Teller und meinte: »Sie sollten das mal mit Vollkorntoast probieren.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
Für Philip stand in diesem Augenblick eine Menge auf dem Spiel, aber das war in seinem Leben schon immer so gewesen: Stets hing sein Glück an einem seidenen Faden und vom richtigen Handeln im richtigen Moment ab. Er war ein Dieb gewesen, ein ganz exzellenter Dieb, der Leute wie Captain Stuart Spencer auf tausend Umwegen immer wieder in Sackgassen gelockt, sie von London nach Paris, von Paris nach Marokko und von dort zu irgendeinem anderen Ort der Welt gehetzt hatte, wo die nächste Beute auf ihn wartete. Dann jedoch hatte er eine Wende um hundertachtzig Grad vollzogen, die Seiten gewechselt und von da ab für Spencer und Interpol gearbeitet, statt gegen sie.
Es war eine rein rechnerische Entscheidung gewesen; eine Frage von finanziellen Vor- und Nachteilen. Worum es ihm jetzt ging, war eine eher persönliche Angelegenheit.
»Lassen Sie uns mal rein hypothetisch annehmen, ich würde einen absolut cleveren Dieb kennen, einen, der Interpol die letzten zehn Jahre erfolgreich an der Nase herumgeführt hat, einen, der vorhat, sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückzuziehen und seine Dienste im Austausch für gerichtliche Nachsicht anzubieten.«
»Sie sprechen vom Schatten.«
Mit übertriebener Akribie zupfte sich Philip die Toastkrümel von den Fingerkuppen. Er war ein überaus ordentlicher Mensch, teils aus Gewohnheit, teils aus Notwendigkeit. »Rein hypothetisch, wohlgemerkt.«
Der Schatten. Spencer vergaß seine schmerzende Ferse und die Unannehmlichkeiten der Zeitverschiebung nach dem langen Flug. Juwelen, deren Werte in die Millionen Dollar gingen, hatte dieser gesichtslose Dieb gestohlen, den man »den Schatten« nannte. Zehn Jahre lang hatte Spencer ihn verfolgt, gejagt, und immer wieder war er ihm entwischt. Seit acht Monaten hatte Interpol die Fahndung nach ihm verstärkt, war sogar so weit gegangen, einen Dieb zu engagieren, um einen anderen zu fangen – Philip Chamberlain, den einzigen Dieb, dessen Beute die des Schattens noch um einiges übertraf. Den Mann, dachte Spencer, und kalte Wut stieg in ihm hoch, dem er vertraut hatte.
»Verdammt, Sie wissen, wer er ist. Sie haben gewußt, wo er ist und wo wir ihn finden können.« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Zehn Jahre. Zehn verdammte Jahre lang waren wir hinter dem Kerl her. Der Teufel soll Sie holen. Seit Monaten bezahlen wir Sie schon dafür, ihn zu finden, und Sie spielen mit uns Katz und Maus. Sie haben die ganze Zeit gewußt, wer er ist und wo er ist. Die ganze Zeit!«
»Vielleicht.« Philip spreizte seine langen, kunstfertigen Finger. »Vielleicht auch nicht.«
»Am liebsten würde ich Sie in einen Käfig sperren und den Schlüssel in die Themse werfen.«
»Aber das tun Sie nicht, weil ich der Sohn bin, den Sie nie hatten.«
»Ich habe einen Sohn, verflucht noch mal!«
»Aber keinen wie mich.« Philip lehnte sich bequem in seinen Stuhl zurück und fuhr fort: »Was ich Ihnen vorschlagen will, ist der gleiche Deal, den wir beide vor fünf Jahren abgeschlossen haben. Damals waren Sie der Meinung, daß es entscheidende Vorteile bringt, den Besten anzuheuern, anstatt den Besten zu jagen.«
»Wir haben Sie engagiert, den Schatten dingfest zu machen, und nicht, um über ihn zu verhandeln. Wenn Sie einen Namen haben, so will ich ihn wissen. Wenn Sie eine Beschreibung von ihm haben, dann her damit. Fakten will ich sehen, Philip, keine hypothetischen Vorschläge.«
»Sie haben nichts in der Hand«, stieß Philip hervor. »Absolut nichts, nach zehn Jahren. Wenn ich jetzt hier rausspaziere, haben Sie immer noch nichts.«
»Sie werde ich haben.« Spencers Stimme klang ausdruckslos, aber entschieden genug, daß Philips Augen schmal wurden. »Einem Mann Ihrer Lebensart würde es im Knast nicht gefallen.«
»Drohungen?« Ein rascher, doch sehr deutlicher Schauer durchzuckte Philips Miene. Er legte die Hände ineinander, bemühte sich um einen festen Blick, im Vertrauen darauf, daß sein Gegenüber nur bluffte. Philip bluffte nicht. »Ich habe einen Anspruch auf Straffreiheit, erinnern Sie sich? Das war Teil unserer Abmachung.«
»Sie waren es doch, der die Regeln geändert hat. Geben Sie mir den Namen, Philip, und lassen Sie mich meinen Job tun.«
»Sie denken kleinlich, Stuart. Deshalb haben Sie auch nur wenige Steinchen gefunden, wohingegen ich Ihnen das Zeug händeweise verschafft habe. Wenn Sie den Schatten einlochen, haben Sie nur einen Dieb gefaßt. Glauben Sie im Ernst, auch nur einen Bruchteil dessen zu finden, was er im Laufe der Jahre geklaut hat?«
»Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.«
»Ja.«
Philips Tonfall hatte sich verändert, bemerkte Spencer, und zum ersten Mal während ihres Gesprächs senkte er seinen Blick. Aber nicht aus Scham. Spencer kannte Philip viel zu gut, um zu glauben, daß dieser Mann sich so leicht aus der Fassung bringen ließe.
»Es ist in der Tat eine Frage der Gerechtigkeit, aber darauf kommen wir noch.« Philip, zu nervös, um still sitzen zu bleiben, erhob sich wieder aus seinem Stuhl. »Als Sie mich für diesen Job abgeheuert haben, sagte ich zu, weil mich dieser spezielle Dieb interessiert hat. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Man kann sogar sagen, daß sich mein Interesse noch erheblich gesteigert hat.« Es war sinnlos, Spencer zu sehr zuzusetzen. Zugegeben, sie hatten im Laufe der Jahre eine wenn auch widerwillige Bewunderung füreinander entwickelt, doch Spencer war bisher nie vom Pfad der Tugend abgewichen und würde es auch zukünftig nicht tun. »Angenommen, rein hypothetisch selbstverständlich, ich würde tatsächlich die Identität des Schattens kennen. Weiter angenommen, ich würde unseren Gesprächen entnehmen können, daß Sie aus den Fähigkeiten dieses Individuums Nutzen ziehen möchten und ihm als kleine Gegenleistung eine reine Weste garantierten.«
»Kleine Gegenleistung nennen Sie das? Der Bastard hat sogar noch mehr Schaden angerichtet als Sie.«
Philips Augenbraue schoß in die Höhe. Mit einem leichten Stirnrunzeln wischte er sich einen Krümel von Ärmel. »Ich glaube nicht, daß es nötig ist, mich zu beleidigen. Niemand hat Diamanten von einem größeren Gesamtwert gestohlen als ich in meiner Laufbahn.«
»Sie sind stolz auf Ihre Karriere, nicht wahr?« Spencers Gesichtsfarbe wechselte zu einem alarmierenden Rot. »Das Leben eines gemeinen Diebes zu führen ist etwas, womit ich mich nicht brüsten würde.«
»Darin unterscheiden wir uns eben.«
»Durch Fenster klettern, in dunklen Hausecken Geschäfte abwickeln…«
»Bitte hören Sie auf, ich werde gleich sentimental. Nein, halten Sie lieber die Luft an, und zählen Sie ganz ruhig bis zehn, Stuart. Ich möchte nicht für einen bedrohlichen Anstieg Ihres Blutdrucks verantwortlich sein.« Er griff zur Teekanne. »Vielleicht ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, Ihnen zu erzählen, daß ich in der Zeit, als ich Schlösser knackte, großen Respekt Ihnen gegenüber entwickelt habe. Wahrscheinlich würde ich jetzt immer noch mit Nacht- und Nebelaktionen mein Geld verdienen, wenn Sie mir nicht mit jedem meiner Einbrüche ein Stück näher auf den Pelz gerückt wären. Ich bedauere keine Sekunde des Lebens, das ich gelebt habe, ebensowenig wie ich es bedauere, die Seiten gewechselt zu haben.«
Stuart hatte sich soweit wieder beruhigt, um den Tee hinunterzustürzen, den Philip ihm eingeschenkt hatte. »Darum geht es doch gar nicht.« Aber er mußte sich eingestehen, daß ihm Philips Geständnis schmeichelte. »Tatsache ist, daß Sie jetzt für mich arbeiten.«
»Das habe ich nicht vergessen.« Philip wandte sich von ihm ab und schaute wieder versonnen aus dem Fenster. Es war ein eiskalter, klarer Tag, der seine Sehnsucht nach Frühling nur noch steigerte. »Nun, um Ihnen weiterhin als loyaler Untergebener zu dienen«, fuhr Philip gestelzt fort, wobei er sich abrupt umdrehte und Stuart mit festem Blick ansah, »erachte ich es als meine Pflicht, Unterstützung für Sie anzuwerben, falls ich auf einen passenden Kandidaten stoßen sollte.«
»Auf einen Dieb?«
»Ja, und einen ausgezeichneten dazu.« Wieder erhellte ein strahlendes Lächeln seine Miene. »Darüber hinaus bin ich bereit, meinen Kopf dafür zu verwetten, daß weder Ihre noch irgendeine andere Vollstreckungsbehörde einen Schimmer der wahren Identität dieses Diebes erhaschen wird.« Sein Lächeln verlor sich ein wenig, als er sich vorbeugte. »Weder jetzt, Stuart, noch später, das verspreche ich Ihnen.«
»Er wird wieder aktiv werden.«
»Nein, das wird er nicht.«
»Wie können Sie sich dessen so sicher sein?«
Philip faltete wieder die Hände. Sein Ehering glänzte matt. »Weil ich dafür sorgen werde. Höchstpersönlich.«
»In welchem Verhältnis steht er zu Ihnen?«
»Schwer zu erklären. Hören Sie mir zu, Stuart. Fünf Jahre habe ich nun schon für Sie und mit Ihnen gearbeitet. Einige meiner Aufträge waren gelinde gesagt schmutzig, die meisten jedoch waren schmutzig und gefährlich. Ich habe Sie nie um etwas gebeten, nun aber bitte ich Sie um eines: Straffreiheit für meinen hypothetischen Dieb.«
»Ich kann keine Garantie…«
»Ihr Wort ist mir Garantie genug«, unterbrach ihn Philip und brachte ihn so zum Schweigen. »Als Gegenleistung werde ich Ihnen den Rubens wiederbeschaffen. Und außerdem glaube ich Sie einer Belohnung versichern zu können, die genug politisches Gewicht besitzt, um eine gewisse heikle Situation zu entschärfen.«
Spencer hatte einige Schwierigkeiten, zwei und zwei zusammenzuzählen. »Im Mittleren Osten?«
Philip zuckte die Achseln und schenkte sich Tee nach. »Möglich.« Wie auch immer seine Antwort ausfallen würde, Philip war entschlossen, Stuart zu dem Rubens und zu Abdu zu führen. Doch wie gewöhnlich legte er erst kurz vor Schluß die Karten auf den Tisch. »Man könnte sagen, daß England mit den Informationen, die ich Ihnen geben werde, in der Lage sein wird, an den geeigneten Stellen Druck auszuüben.«
Spencer musterte sein Gegenüber mit einem harten Blick. Ihre Unterhaltung war weit über die Themen Diamanten und Rubine, Strafe und Verbrechen hinausgegangen. »Das ist eine Nummer zu groß für Sie, Philip.«
»Ihre Besorgnis ehrt mich.« Er stellte fest, daß sich das Blatt zu wenden begann, und lehnte sich ein wenig entspannter zurück. »Ich versichere Ihnen, daß ich sehr wohl weiß, was ich tue.«
»Das ist ein äußerst delikates Spiel, das Sie da spielen.«
Das delikateste überhaupt, dachte Philip bei sich, und das wichtigste für mich. »Ein Spiel, das wir beide gewinnen können, Stuart.«
Schwer atmend erhob sich Spencer aus seinem Stuhl, um eine Flasche Scotch zu öffnen. Er goß einen großzügigen Schluck in ein Whiskyglas, zögerte einen Moment und füllte dann ein zweites. »Nun gut, erzählen Sie mir, was Sie wissen, Philip. Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Er überlegte einen Augenblick. »Ich lege das einzige, das mir wirklich etwas bedeutet, in Ihre Hände. Das dürfen Sie nie vergessen, Stuart.« Er schob seine Teetasse beiseite und griff nach dem Glas. »Ich habe den Rubens in der Schatzkammer König Abdus von Jaquir gesehen.«
2. Kapitel
Jaquir, 1968
Adrianne lag zusammengerollt auf der Seite und beobachtete hellwach vor Aufregung, wie die Zeiger der Uhr auf Mitternacht zutickten. Gleich hatte sie Geburtstag. Dann würde sie fünf Jahre alt sein. Sie drehte sich auf den Rücken und umarmte sich aus lauter Vorfreude selbst. Der ganze Palast lag in tiefem Schlummer, doch in wenigen Stunden würde die Sonne aufgehen und der Muezzin die Stufen der Moschee hochsteigen, um die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Der Tag, der wundervollste Tag ihres Lebens, würde dann endlich beginnen.
Am Nachmittag würde es Musik und Geschenke für sie geben und Teller voller Schokolade. Die Frauen würden ihre schönsten Kleider tragen und tanzen. Alle würden kommen: Großmutter, um ihr Geschichten zu erzählen; Tante Latifa, die immer lächelte und niemals schimpfte, würde Duja mitbringen; Favel mit ihrem lustigen Lachen würde ihre Stute führen. Adrianne lächelte. Durch die Gemächer der Frauen würde helles, fröhliches Lachen erklingen, und jeder würde ihr sagen, wie hübsch sie sei.
Mama hatte ihr versprochen, daß es ein ganz besonderer Tag sein werde. Ihr Festtag. Mit der Erlaubnis ihres Vaters würden sie nachmittags einen Ausflug zum Meer unternehmen. Sie hatte ein neues Kleid bekommen, ein wunderschönes gestreiftes Seidenkleid, das in allen Farben des Regenbogens schillerte. Die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt, drehte sich Adrianne zu ihrer Mutter hin.
Phoebe schlief, im Mondlicht schimmerte ihr Gesicht wie Marmor und sah auf einmal ganz friedlich aus. Adrianne liebte diese Tage, wenn ihre Mutter ihr erlaubte, zu ihr in dieses große, weiche Bett zu kriechen. Das war etwas ganz Besonderes. Dann kuschelte sie sich dicht an sie heran und lauschte den Geschichten, die Phoebe ihr von fremden Orten wie New York oder Paris erzählte. Manchmal kicherten sie auch wie kleine Gänschen.
Ganz behutsam, um sie nicht aufzuwecken, streichelte Adrianne über das Haar ihrer Mutter. Es faszinierte sie. Wie Feuer schimmerte es auf dem weißen Kopfkissen, ein gewaltiges, glühendes Feuer. Mit ihren fünf Jahren war Adrianne bereits Frau genug, um ihre Mutter um ihr Haar zu beneiden. Ihr eigenes Haar war fest und schwarz wie das der anderen Frauen in Jaquir. Nur Phoebe hatte rotes Haar und eine weiße Haut. Nur Phoebe war Amerikanerin. Adrianne war Halbamerikanerin, doch darin erinnerte Phoebe sie nur, wenn sie allein waren.
Solche Gespräche machten ihren Vater ärgerlich. Adrianne hatte ein gutes Gespür entwickelt, wenn es darum ging, Themen zu vermeiden, die ihren Vater zornig machten; obwohl sie nicht ganz verstand, warum bei der Erwähnung, daß ihre Mutter Amerikanerin ist, die Augen ihres Vaters hart und seine Lippen schmal wurden. Sie war ein Movie-Star gewesen. Dieser Ausdruck verwirrte Adrianne immer ein wenig, aber sie liebte dessen fremdartigen Klang. Movie-Star. Bei diesen Worten dachte sie an geheimnisvolle Lichter an einem schwarzen Himmel.
Ihre Mutter war ein Star gewesen, und nun war sie eine Königin; die erste Frau von Abdu ibn Faisal Rahman al-Jaquir, dem Herrscher von Jaquir, dem Scheich der Scheichs. Ihre Mutter war die schönste aller Frauen, mit ihren großen blauen Augen und dem vollen, weichen Mund. Sie überragte die Frauen des Harems um Haupteslänge und ließ sie wie kleine Vögelchen erscheinen. Adrianne hatte nur einen Wunsch: ihre Mutter glücklich zu sehen. Mit ihren fünf Jahren hoffte Adrianne, nun endlich verstehen zu können, warum ihre Mutter oft so traurig war und heimlich weinte, wenn sie sich unbeobachtet fühlte.
In Jaquir wurden die Frauen beschützt und behütet. Diejenigen, die im Palast von Jaquir lebten, wurden von der Außenwelt abgeschirmt, und es war ihnen nicht gestattet zu arbeiten. Sie bekamen alles, was sie brauchten – schöne Kleider und die erlesensten Parfums. Ihre Mutter besaß traumhafte Roben und Juwelen. Sie besaß das berühmte Kollier Sonne und Mond.
Adrianne schloß die Augen, um das Bild dieses Kolliers am Hals ihrer Mutter herbeizuzaubern. Wie dieser große Diamant, genannt die Sonne, funkelte, und die unbezahlbare Perle, der Mond, schimmerte. Eines Tages, hatte ihr Phoebe versprochen, würde sie dieses Kollier tragen.
Wenn sie erwachsen war. Wohlig und zufrieden, dem ruhigen Atem ihrer Mutter lauschend, stellte Adrianne sich die Zukunft vor. Wenn sie erwachsen war, wenn aus dem kleinen Mädchen eine Frau geworden war, würde sie einen Gesichtsschleier tragen. Dann würde man einen Ehemann für sie auswählen und sie verheiraten. An ihrem Hochzeitstag würde sie Sonne und Mond tragen und eine gute, fruchtbare Frau werden.
Sie würde Feste für die anderen Frauen geben und eisgekühlte Torten und Pralinen herumreichen lassen. Ihr Ehemann würde so gutaussehend und mächtig sein wie ihr Vater. Vielleicht würde auch er ein König sein und sie auf Händen tragen.
Während sie dann langsam einschlummerte, drehte sie eine Locke ihres langen Haars um den Zeigefinger. Ihr Ehemann würde sie mit derselben Innigkeit lieben, die sie sich von ihrem Vater so sehr wünschte. Sie würde ihrem Gemahl prächtige Söhne schenken, viele prächtige Söhne, so daß die anderen Frauen sie mit Neid und Respekt betrachten würden. Nicht mit Mitleid. Nicht mit dem mitleidigen Lächeln, mit dem sie ihre Mutter stets bedachten.
Ein Licht weckte sie. Es fiel durch die geöffnete Tür und warf einen harten Streifen auf den Fußboden. Durch den hauchdünnen Vorhang, der das Bett einhüllte wie ein Kokon, sah sie einen Schatten.
Erst stieg Freude in ihr auf, ein schmerzlicher Ausbruch, den zu verstehen sie noch zu jung war. Doch gleich darauf kam Angst, die Angst, die stets der Liebe folgte, die sie spürte, wenn sie ihren Vater sah.
Er würde ärgerlich werden, wenn er sie hier entdeckte, im Bett ihrer Mutter. Das wußte sie, denn es war ein offenes Geheimnis im Harem, daß ihr Vater ihre Mutter nur selten besuchte, seit die Ärzte ihm eröffnet hatten, daß sie keine Kinder mehr bekommen könne. Adrianne glaubte, daß er Phoebe vielleicht nur betrachten wollte, weil sie so wunderschön war. Doch als er näher kam, schnürte ihr eine plötzliche Furcht die Kehle zu. Rasch schlüpfte sie aus dem Bett und verbarg sich im Schatten dahinter.
Abdu, seine Augen auf Phoebe gerichtet, zog den Vorhang beiseite. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Tür zu schließen. Niemand würde es wagen, ihn zu stören.
Bläuliches Mondlicht ergoß sich über Phoebes Haar und ihr schlafendes Gesicht. Sie sah aus wie eine Göttin, genau wie damals, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Dieses Gesicht mit seiner berauschenden Schönheit und dem erregenden Sex-Appeal hatte die ganze Leinwand ausgefüllt und zum Knistern gebracht. Phoebe Spring, die amerikanische Schauspielerin, die Frau, die die Männer wegen ihres sinnlichen Körpers und ihrer unschuldigen Augen gleichzeitig begehrten und fürchteten. Abdu war ein Mann, der nur das Beste, Größte und Teuerste gewöhnt war. Damals hatte er sie begehrt, wie er noch nie eine Frau zuvor begehrt hatte. Er hatte sie aufgespürt und ihr den Hof gemacht, wie es westliche Frauen lieben. Er hatte sie zu seiner Königin gemacht.
Und sie hatte ihn verzaubert. Um ihretwegen hatte er sein Erbe verraten und mit der Tradition gebrochen. Er hatte eine westliche Frau zur Gemahlin genommen, eine Schauspielerin, eine Christin. Und er war dafür bestraft worden. Sein Samen hatte in ihr nur ein einziges Kind gezeugt – ein Mädchen.
Doch sie erregte ihn noch immer. Ihr Leib war unfruchtbar, aber ihr Körper reizte ihn. Obgleich sich seine Faszination in Abscheu verwandelt hatte, begehrte er sie. Sie beschämte ihn, besudelte sein sharaf, seine Ehre, durch ihre Ignoranz gegenüber dem Islam, doch sein Körper verlangte nach ihr.
Wenn er seine Männlichkeit tief in den Körper einer anderen Frau versenkte, war es Phoebe, die er liebte; Phoebe, deren Haut er roch; Phoebe, deren Schreie er hörte. Das war seine heimliche Schmach. Allein dafür hätte er sie hassen können. Doch es war vielmehr die öffentliche Schande, die Tatsache, daß sie ihm nur diese einzige Tochter geboren hatte, die ihn dazu brachte, sie zu verachten.
Er wollte, daß sie litt, dafür bezahlte, genau wie er gelitten und dafür bezahlt hatte. Er griff nach dem Laken und zog es mit einem Ruck beiseite.
Phoebe erwachte, noch ganz benommen, doch ihr Herz begann schon wild zu klopfen. Sie sah ihn nur als Schatten über ihr stehen. Zuerst glaubte sie sich noch in dem Traum, den sie gerade geträumt hatte, in dem er zurückgekommen war, um sie so zu lieben, wie er sie einst geliebt hatte. Aber dann sah sie seine Augen und wußte, dies war kein Traum und keine Liebe.
»Abdu.« Sie dachte an das Kind und blickte rasch neben sich. Das Bett war leer. Adrianne war nicht mehr da. Phoebe schickte ein stummes Dankgebet gen Himmel. »Es ist spät«, begann sie, doch ihre Kehle war trocken und die Worte kaum hörbar. Unwillkürlich wich sie zurück; die seidenen Laken knisterten leise, als sie sich wie ein Embryo zusammenkrümmte. Er sagte kein Wort, streifte nur seine weiße throbe ab. »Bitte.« Obwohl sie wußte, daß es ihr nichts nützte, brach sie in Tränen aus. »Tu es nicht.«
»Eine Frau hat kein Recht, ihrem Mann seine Wünsche zu verweigern.« Der Anblick ihres reifen Körpers, der nun vor Angst zitterte, vermittelte ihm ein Gefühl von Macht, das Gefühl, seine Geschicke in der Hand zu halten. Was immer sie sonst sein mochte, sie war sein Eigentum – sie gehörte ihm wie die Diamantringe an seinen Fingern und die Pferde in seinem Stall. Er packte sie am Träger ihres Nachthemds und stieß sie zurück.
Verborgen im Schatten neben dem Bett begann Adrianne zu zittern.
Ihre Mutter weinte. Sie kämpften, schrien Worte, die sie nicht verstand. Ihr Vater stand nackt im Mondlicht, seine dunkle Haut schimmerte unter einem Film feuchten Schweißes, der nicht von der drückenden Schwüle herrührte, sondern von seinem leidenschaftlichen Verlangen. Adrianne hatte noch nie zuvor den nackten Körper eines Mannes gesehen, geriet bei dem Anblick aber nicht außer Fassung. Sie wußte über Sex Bescheid und daß das Glied ihres Vaters, das so hart und bedrohlich wirkte, dazu bestimmt war, in den Körper ihrer Mutter einzudringen, um dort ein Kind zu zeugen. Sie wußte, daß man dabei Vergnügen empfand, daß die Frauen diesen Akt als höchste Lust ersehnten. Tatsächlich hatte sie dies in ihrem jungen Leben schon tausendfach gehört, denn im Harem wurde unaufhörlich über Sex gesprochen.
Aber ihre Mutter konnte keine Kinder mehr bekommen, und wenn man dabei doch Vergnügen empfinden sollte, warum weinte sie dann und bat ihren Vater, von ihr abzulassen?
Eine Frau mußte ihren Mann im Ehebett empfangen, dachte Adrianne, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie mußte ihm alles geben, was er verlangte. Sie mußte Freude darüber empfinden, daß sie begehrt wurde und seine Kinder austragen durfte.
Sie hörte das Wort Hure. Sie kannte es nicht, aber von den Lippen ihres Vaters klang es so schmutzig, daß sie es nie wieder vergessen würde.
»Wie kannst du es wagen, so etwas zu mir zu sagen?« Phoebes Stimme bebte unter ihren Schluchzern, während sie versuchte, sich von ihm zu befreien. Einst hatte sie seine Umarmungen und das Schimmern seiner nackten Haut im Mondlicht geliebt. Jetzt empfand sie nur noch Angst. »Ich habe mich nie einem anderen Mann hingegeben. Nur dir. Du hast dir eine andere Frau genommen, sogar als wir schon ein Kind hatten.«
»Du hast mir nichts gegeben.« Er grub seine Hand in ihr Haar. Es faszinierte ihn, obwohl er die Farbe verabscheute. »Ein Mädchen. Das ist weniger als nichts. Ich brauche sie nur anzusehen, um die Schmach zu spüren.«
Sie schlug ihm ins Gesicht, fest genug, daß sein Kopf nach hinten schnellte. Selbst wenn sie schneller als er gewesen wäre, wohin hätte sie sich flüchten sollen? Sein Handrücken schmetterte über ihr Gesicht und ließ sie taumeln. Aufgestachelt durch Begierde und Wut, riß er ihr das Nachthemd vom Leib.
Sie hatte den Körper einer Göttin, einen Körper, von dem jeder Mann träumte. Ihr Herz raste vor Angst und brachte ihre üppigen Brüste zum Beben. Ihr sonst so blasser Teint glühte im Mondlicht und zeigte bereits die ersten dunklen Spuren seiner Schläge. Ihre Lippen waren aufgeworfen. Wenn Phoebe von Leidenschaft gefesselt war, konnten ihre Lippen wie Blitze zucken, im Einklang mit seinen Stößen. Schamlos. Sein Verlangen kam einem körperlichen Schmerz gleich, brannte, als hätten sich die Klauen des Teufels in seine Eingeweide geschlagen. Mitten in diesem heftigen Kampf löste sich eine Lampe aus der Halterung und zersplitterte auf dem Tischchen neben dem Bett.
Gelähmt vor Entsetzen mußte Adrianne mit ansehen, wie sich die Finger ihres Vaters in Phoebes entblößte, weiße Brüste gruben. Sie versuchte sich nach Kräften zu wehren und flehte ihn an, von ihr abzulassen. Ein Mann hatte das Recht, seine Frau zu schlagen. Sie durfte sich ihm nicht verweigern. So stand es im Gesetz. Und dennoch… Adrianne hielt sich die Ohren zu, um nicht die Schreie ihrer Mutter hören zu müssen, als sich ihr Vater über sie schob und gewaltsam in sie eindrang, wieder und immer wieder.
Tränenüberströmt kroch Adrianne unters Bett. Sie preßte die Hände so fest auf die Ohren, bis sie schmerzten, doch selbst dann hörte sie noch immer das tiefe Stöhnen ihres Vaters und das verzweifelte Schluchzen ihrer Mutter. Das Bett über ihr schwankte. Sie ringelte sich ein wie eine Schnecke, machte sich so klein wie möglich, so klein, daß sie nichts mehr hören würde, eigentlich gar nicht mehr da war.
Das Wort Vergewaltigung kannte sie nicht, aber nach dieser Nacht brauchte ihr niemand mehr dessen Bedeutung zu erklären.
»Du bist so still, Addy.« Phoebe bürstete mit zärtlichen, langsamen Bewegungen das hüftlange Haar ihrer Tochter. Addy. Abdu verachtete diesen Kosenamen und duldete auch das formellere Adrianne nur, weil seine Erstgeborene ein Mädchen war und gemischtes Blut besaß. Dennoch hatte er, um seinem Stolz Genüge zu tun, verfügt, daß seine Tochter neben diesem Namen auch einen arabischen Namen bekam. Auf allen offiziellen Dokumenten erschien »Adrianne« als Ad Riyahd An, woran sich noch die endlose Reihe von Abdus Familiennamen anschloß. Phoebe wiederholte den Kosenamen noch einmal und fragte dann: »Gefallen dir deine Geschenke nicht?«
»Doch, ich finde sie sehr schön.« Adrianne trug ihr neues Kleid, aber es gefiel ihr nicht mehr. Im Spiegel konnte sie hinter dem ihren das Gesicht ihrer Mutter sehen. Phoebe hatte zwar die Spuren der Schläge sorgsam mit Make-up abgedeckt, doch Adrianne blieben die dunklen Schatten nicht verborgen.
»Du siehst wunderhübsch aus.« Phoebe drehte ihre kleine Tochter zu sich herum, um sie zu umarmen. An einem anderen Tag hätte Adrianne nicht bemerkt, wie eng ihre Mutter sie an sich drückte, nicht die Verzweiflung in ihrer Stimme wahrgenommen. »Meine kleine Prinzessin. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Mehr als alles auf der Welt.«
Sie duftete nach Blumen, duftete wie die vollreifen üppigen Blüten draußen im Garten. Tief sog Adrianne diesen Duft ein, als sie ihr Gesicht an Phoebes Brüste drückte. Sie küßte sie und erinnerte sich daran, wie grob und häßlich ihr Vater sie in der Nacht zuvor behandelt hatte.
»Du wirst nicht weggehen? Du wirst mich nicht verlassen?«
»Wie kommst du denn auf diesen Gedanken?« Mit einem halbherzigen Lachen drückte sie ihre Tochter auf Armlänge von sich weg, um sie anzusehen. Als sie ihrer Tränen gewahr wurde, erstarb ihr Lachen. »Oh, mein armer Liebling, was hast du denn?«
Traurig ließ Adrianne ihren Kopf auf Phoebes Schulter sinken. »Ich habe geträumt, daß er dich weggeschickt hat. Daß du fortgehst und ich dich nie wiedersehe.«
Phoebe zögerte einen Augenblick, bevor sie fortfuhr, ihre Tochter behutsam zu streicheln. »Das war doch nur ein Traum, mein Kleines. Ich werde dich nie verlassen.«
Adrianne kuschelte sich auf Phoebes Schoß und genoß die zärtlichen Tröstungen ihrer Mutter. Durch das Gitterwerk vor den Fenstern fielen warme Sonnenstrahlen ins Zimmer und brachen sich auf den bunten Mustern der Teppiche. »Wenn ich ein Junge wäre, dann würde Vater uns beide lieben.«
Kalte Wut stieg plötzlich in Phoebe hoch, die sie geradezu auf der Zunge schmecken konnte. Doch so schnell, wie sie gekommen war, verwandelte sie sich in Verzweiflung. Aber Phoebe war immer noch eine Schauspielerin. Wenn sie ihr Talent schon ansonsten nicht nutzen konnte, dann wenigstens dazu, das zu schützen, was ihr am nächsten stand. »Welch ein Unsinn, und auch noch an deinem Geburtstag. Was kann schon daran schön sein, ein Junge zu sein. Die können keine so hübschen Kleider tragen wie du.«
Adrianne kicherte über diese Vorstellung und schmiegte sich noch enger an ihre Mutter. »Wenn ich Fahid ein Kleid überziehe, sieht er aus wie eine Puppe.«
Phoebe preßte ihre Lippen aufeinander und versuchte den kommenden Schmerz zu ignorieren. Fahid. Fahid war der Sohn, den Abdus zweite Frau zur Welt gebracht hatte, nachdem sie versagt hatte. Nein, nicht versagt, ermahnte sie sich. Sie fing schon an, wie eine Moslemfrau zu denken. Wie könnte sie versagt haben, wenn sie gerade ihr wunderschönes Kind in den Armen hielt?
Du hast mir nichts gegeben. Ein Mädchen. Das ist weniger als nichts.
Alles, dachte Phoebe wütend. Ich habe dir alles gegeben.
»Mama?«
»Ich war in Gedanken.« Phoebe lächelte, als sie Adrianne sanft von ihrem Schoß schob. »Ich habe mir gerade überlegt, daß du noch ein Geschenk bekommen sollst. Ein ganz besonderes.«
»Ein besonderes?« Adrianne klatschte vor Freude in die Hände. Die Tränen waren vergessen.
»Setz dich hin und mach die Augen zu.«
Adrianne gehorchte sofort, und obwohl sie versuchte, still zu sitzen, zappelte sie ungeduldig auf dem Stuhl hin und her. Phoebe hatte die kleine Glaskugel im Schrank zwischen ihren Kleidern versteckt. Es war nicht einfach gewesen, sie ins Land zu schmuggeln, aber sie hatte gelernt, erfinderisch zu sein. Auch mit den Pillen war es nicht leicht gewesen, die kleinen, rosa Pillen, die es ihr ermöglichten, die Tage durchzustehen. Sie betäubten den Schmerz und erleichterten das Herz. Der beste Freund einer Frau. Weiß Gott, in diesem Land ist eine Frau wahrhaftig auf jeden Freund angewiesen. Wenn man die Pillen bei ihr entdeckte, würde man sie öffentlich hinrichten. Und wenn sie diese Pillen nicht hätte, wüßte sie auch nicht, ob sie ohne sie überleben würde.
Ein gefährlicher Kreislauf ohne Ende. Der einzige Mensch, der sie am Leben erhielt, war Adrianne.
»So, da ist es.« Phoebe kniete sich vor den Stuhl. Das Kind trug eine Saphirkette um den Hals und funkelnde Ohrringe. Phoebe dachte, nein, sie hoffte, daß dieses kleine Geschenk, das sie Adrianne nun geben wollte, ihr mehr bedeuten würde. »Jetzt kannst du deine Augen wieder aufmachen.«
Es war ein einfaches, beinahe lächerliches Geschenk. Für ein paar Dollar konnte man es in den Staaten vor Weihnachten in jedem x-beliebigen Laden kaufen. Adriannes Augen weiteten sich, als hielte sie ein magisches Zauberding in Händen.
»Das ist Schnee.« Phoebe schüttelte die Glaskugel nochmals, bis die weißen Flocken darin herumwirbelten. »In Amerika schneit es im Winter. Nun, an den meisten Orten. Zur Weihnachtszeit schmücken wir kleine Bäumchen mit Lichterketten und bunten Glaskugeln. Tannenbäume, solche wie die hier. Als ich klein war, bin ich mit meinem Großvater auch auf einem solchen Schlitten gefahren, wie du ihn hier siehst.« Ihren Kopf an Adriannes Schulter gelehnt, betrachtete sie das kleine Pferdchen und den Schlitten in der Glaskugel. »Eines Tages, Addy, werde ich dir dies alles zeigen.«
»Tut das weh?«
»Schnee?« Phoebe lachte und schüttelte die Kugel wieder. Die Szene belebte sich aufs neue, und die Schneeflocken tanzten wieder um den kleinen, geschmückten Christbaum und das winzige Männchen auf dem roten Schlitten herum, der von einem braunen Pferdchen gezogen wurde. Nur eine Illusion. Alles, was ihr geblieben war, waren ihre Erinnerungen und ein kleines Mädchen, das sie beschützen mußte. »Nein. Schnee ist nur kalt und naß. Man kann daraus etwas bauen. Schneemänner, Schneebälle und Schneeburgen. Es sieht unheimlich schön aus, wenn Schnee auf den Bäumen liegt. Schau, genau wie hier.«
Adrianne nahm die Kugel und begann sie nun selbst zu schütteln. Das kleine braune Pferdchen hob ein Bein an, während die weißen Flocken langsam auf es niederrieselten. »Es ist wunderschön, viel schöner als mein neues Kleid. Ich möchte es gern Duja zeigen.«
»Nein.« Phoebe wußte genau, was passieren würde, wenn Abdu davon erführe. Diese Glaskugel war für ihn das Symbol eines christlichen Feiertags. Seit Adriannes Geburt war er regelrecht fanatisch geworden, was Religion und Tradition anbelangte. »Es ist unser Geheimnis, denk daran. Wenn wir beide allein sind, darfst du es dir ansehen, aber niemals, wenn irgend jemand anderer dabei ist.« Phoebe nahm ihr die Glaskugel aus der Hand und versteckte sie wieder in ihrem Schrank. »Jetzt ist es Zeit für deine Party.«
Trotz der zahlreichen Ventilatoren und der zugezogenen Vorhänge gegen die gleißende Sonne war es drückend heiß im Harem. Die gläsernen Filigranlampen spendeten gedämpftes, weiches Licht. Die Frauen trugen ihre schönsten und kostbarsten Gewänder. Ihre schwarzen abaayas hatten sie an der Tür abgelegt und sich innerhalb eines Augenblicks von schwarzen Krähen in buntschillernde Pfauen verwandelt.
Mit den Schleiern hatten die Frauen auch ihr Schweigen abgelegt und schnatterten nun vergnügt über Kinder, Sex, Mode und Fruchtbarkeit. Der Harem mit seinem schummrigen Licht und den dicken weichen Kissen war bald erfüllt vom schweren Duft der Frauen und der glimmenden Räucherkerzen.
Ihrem hohen Rang zufolge begrüßte Adrianne ihre Gäste mit einem Kuß auf beide Wangen, während grüner Tee und gewürzter Kaffee in kleinen, zerbrechlichen Täßchen ohne Henkel herumgereicht wurde. Es kamen Tanten und Cousinen und etliche rangniedrigere Prinzessinnen, die, genau wie die anderen Frauen, mit unverhülltem Stolz ihren Schmuck und ihre Kinder zur Schau trugen, die beiden wichtigsten Statussymbole im Leben einer Frau.
Adrianne erschienen sie wunderschön in ihren langen, raschelnden und vor allem farbenprächtigen Gewändern. Phoebe, die hinter ihr stand, kam sich angesichts dieser Kostümparade vor wie in einem Spielfilm über das 18. Jahrhundert. Sie nahm die auf sie gemünzten mitleidigen Blicke der Frauen mit derselben stoischen Ruhe entgegen, mit der sie auch deren blasierte Eitelkeiten ertrug. Sie war sich voll bewußt, daß sie hier eine Außenseiterin war, eine westliche Frau, der es nicht gelungen war, dem König einen männlichen Erben zu gebären. Es war gleichgültig, sagte sie sich, ob man sie hier akzeptierte oder nicht, solange die Frauen zu Adrianne nett waren.
Es hatte alles seine Richtigkeit. Adrianne war einfach ein Teil dieser Frauengesellschaft, zu der sie selbst nie gehören würde.
Hungrig stürzten sich die Frauen auf das Buffet, probierten alle Speisen und benutzten dazu so selbstverständlich ihre Finger wie Phoebe die kleinen silbernen Löffelchen. Wenn sie zu dick wurden, kauften sie sich einfach neue Kleider. Einkaufen gehen, das war es, womit sich die arabischen Frauen den Tag vertrieben, genau wie sie es mit ihren rosa Pillen tat. Kein Mann, außer dem Ehemann oder den Brüdern, bekam je ihre lächerlichen Gewänder zu Gesicht. Wenn sie den Harem verließen, verhüllten sie sich wieder unter der abaaya, verbargen Gesicht und Haar unter einem Schleier. Außerhalb der Mauern herrschte aurat, da durften sie nichts von ihrem Körper zeigen.
Was spielten sie nur für seltsame Spiele! dachte Phoebe. Henna, Parfums und die protzigen Ringe. Glaubten sie wirklich, glücklich zu sein, wenn selbst sie, die es eigentlich nichts anging, die Langeweile in ihren Gesichtern erkannte? Sie betete zu Gott, daß sie diesen Ausdruck nie auf Adriannes Gesicht sehen möge.
Mit ihren fünf Jahren trat Adrianne schon recht selbstsicher auf und achtete darauf, daß ihre Gäste sich gut unterhielten und wohl fühlten. Mit ihnen sprach sie selbstverständlich Arabisch, leise und sehr melodisch. Adrianne hatte es bislang nicht fertiggebracht, ihrer Mutter zu erzählen, daß ihr Arabisch viel leichter fiel als Englisch. Sie dachte in Arabisch, fühlte Arabisch, und ihre Gedanken wie auch ihre Gefühle mußte sie oft erst ins Englische übersetzen, bevor sie diese ihrer Mutter mitteilen konnte.
Adrianne fühlte sich wohl in diesem Raum, genoß die Stimmen und Gerüche der Frauen. Die Welt, von der ihr ihre Mutter von Zeit zu Zeit erzählte, bedeutete ihr nicht mehr als ein Märchen. Schnee war nur etwas, das in einer bunten Glaskugel tanzte.
»Duja.« Adrianne rannte quer durchs Zimmer, um ihre Lieblingscousine zu begrüßen. Duja war beinahe zehn und – wofür Adrianne sie gleichzeitig beneidete und bewunderte – schon fast eine Frau.
Duja erwiderte ihre herzliche Umarmung. »Dein Kleid ist wunderschön.«
»Ich weiß«, entgegnete Adrianne, konnte es sich aber nicht verkneifen, bewundernd über Dujas Kleid zu streichen.
»Es ist aus Samt«, erklärte Duja mit wichtiger Miene. Daß der dicke Stoff bei dieser Hitze nahezu unerträglich war, war für sie zur Nebensache geraten, als sie sich zuvor im Spiegel betrachtet hatte. »Mein Vater hat es für mich in Paris gekauft.« Sie drehte sich einmal im Kreis herum, ein schlankes, dunkles Geschöpf mit feingeschnittenen Zügen und hübschen, großen Augen. »Wenn er das nächste Mal dorthin fährt, nimmt er mich mit, das hat er mir versprochen.«
»Wirklich?« Adrianne unterdrücke einen Anflug von Neid, der in ihr hochwallte. Es war ein offenes Geheimnis, daß Duja der Liebling ihres Vaters, des Bruders des Königs, war. »Meine Mutter ist schon dort gewesen.«
Von Haus aus ein freundliches Kind und nun auch noch besonders glücklich über ihr Samtkleid, streichelte Duja liebevoll über Adriannes Haar. »Eines Tages wirst du auch einmal nach Paris fahren. Vielleicht reisen wir ja zusammen, wenn wir groß sind.«
Adrianne bemerkte, wie jemand an ihrem Kleidersaum zupfte. Es war Fahid, ihr Halbbruder. Sie hob ihn hoch, um sein kleines Gesichtchen mit Küssen zu bedecken und ihn dadurch zum Juchzen zu bringen. »Du bist das hübscheste Baby in ganz Jaquir.« Obwohl nur zwei Jahre jünger als sie selbst, hatte der pummelige Fahid fast ihr Gewicht. Heftig schnaufend schleppte sie den kleinen Kerl zum Buffet, um ihm einen besonderen Leckerbissen auszusuchen.
Auch die anderen Babys wurden geherzt und verhätschelt. Alle Mädchen bemutterten die kleinen Buben, streichelten und verwöhnten sie nach Strich und Faden. Von Geburt an lernten die Mädchen, ihre ganze Zeit und Kraft nur dazu zu verwenden, die Männer zu verwöhnen. Adrianne wußte nur, daß sie ihren kleinen Halbbruder anbetete und ihn immer zum Lachen bringen wollte.
Phoebe konnte dieses ganze Getue nicht ertragen. Sie beobachtete ihre Tochter dabei, wie sie das Kind der Frau, die ihren Platz im Bett und im Herzen ihres Ehemannes eingenommen hatte, liebkoste. Was bedeutete es schon, wenn es das hiesige Gesetz einem Manne erlaubte, sich vier Frauen zu nehmen? Schließlich war es nicht ihr Gesetz und nicht ihre Welt. Sechs Jahre lebte sie nun schon in dieser fremden Welt; und sie könnte noch sechzig weitere hier verbringen, aber es würde niemals ihre Welt sein. Sie haßte die Gerüche, die schweren, unerträglichen Düfte, die ihr Tag für Tag den Atem nahmen. Phoebe preßte eine Hand an ihre Schläfe, hinter der ein beginnender Kopfschmerz sich pochend bemerkbar machte. Die Räucherstäbchen, die Blumen, die Parfumschwaden, die sich gegenseitig zu übertrumpfen suchten.
Sie haßte die Hitze, diese unerbittliche Hitze.
Sie wollte etwas trinken, aber nicht den üblichen Kaffee oder Tee, der immer bereitstand, sondern ein Glas Wein. Doch Wein war in Jaquir verboten. Vergewaltigung dagegen war erlaubt, dachte sie bitter, als sie ihre schmerzende Wange berührte. Vergewaltigung ja, aber Wein nicht! Kamelpeitschen und Schleier, Gebete und Polygamie, aber nicht ein Tropfen kühler Chablis oder ein Schlückchen trockener Sancerre.
Wie hatte sie dieses Land nur so wundervoll finden können, damals, als sie als Braut hierhergekommen war. Sie hatte die Wüste und das Meer gesehen, die hohen, weißen Mauern des Palastes, und sie hatte sich im geheimnisvollsten, exotischsten Ort der Welt geglaubt.
Damals war sie verliebt gewesen. Und Gott mochte ihr beistehen, sie war es immer noch.
In den Anfangszeiten ihrer Ehe hatte Abdu ihr all die Schönheiten seines Landes und die Reichtümer seiner Kultur gezeigt. Sie hatte ihre Heimat und ihre Gewohnheiten aufgegeben, um so zu werden, wie er es von ihr erwartete. Was er wollte, so stellte sich bald heraus, war die Frau, die er auf der Leinwand gesehen hatte, ein Symbol für Erotik und Unschuld, das zu verkörpern sie gelernt hatte. Phoebe hingegen war leider nur allzu menschlich.
3. Kapitel
Kurz vor seinem dreizehnten Geburtstag war Philip Chamberlain bereits ein professioneller Dieb. Im Alter von zehn Jahren war er schon darüber hinausgewachsen, betuchten Geschäftsleuten auf ihrem Weg zur Bank, zu Börsenmaklern und Rechtsanwälten die prallgefüllten Taschen auszuräumen, oder achtlosen Touristen, die sich am Trafalgar Square tummelten, die Brieftaschen zu klauen. Man konnte ihn fast einen erstklassigen Dieb nennen, obgleich jeder, der ihm begegnete, in ihm nur einen hübschen, adretten und etwas schlaksigen Jungen sah.
Er besaß geschickte Hände, scharfe Augen und die athletischen Voraussetzungen für einen Fassadenkletterer. Mit seinen gewieften, cleveren und stets einsatzbereiten Fäusten hatte er es geschafft, sich nicht von einer der vielen Straßenbanden vereinnahmen zu lassen, die in den späten Sechzigern die Londoner Straßen unsicher machten. Noch fühlte er sich zu den Gruppen von Jugendlichen hingezogen, die Blumen streuten und indische Perlenketten um den Hals trugen. Der vierzehnjährige Philip war weder ein Mod noch ein Rocker. Er arbeitete nun nur noch für sich selbst und sah keinen Sinn darin, die Insignien irgendeiner Gruppe zu tragen. Er war ein Dieb und kein Schläger und hatte nur Verachtung übrig für die Halbstarken, die alte Omas überfielen und ihnen das Einkaufsgeld abnahmen. Er war ein Geschäftsmann und hatte für Jugendliche seiner Generation, die über Wohngemeinschaften diskutierten oder auf Secondhand-Gitarren herumklimperten und dabei von einer besseren Zukunft träumten, nur ein müdes Lächeln übrig.
Er hatte seine eigenen Pläne, große Pläne.
Und im Mittelpunkt dieser Pläne stand seine Mutter. Er beabsichtigte, seine Von-der-Hand-in-den-Mund-Existenz baldmöglichst hinter sich zu lassen, und träumte von einem geräumigen Landhaus, einem teuren Wagen, eleganten Anzügen und exklusiven Partys. Und seit einigen Jahren hatte er auch begonnen, von eleganten Damen zu träumen. Doch im Augenblick war die einzige Frau in seinem Leben Mary Chamberlain, die Frau, die ihn geboren und alleine großgezogen hatte. Mehr als alles andere wünschte er sich, ihr das Beste angedeihen zu lassen, was das Leben zu bieten hatte, ihren glitzernden Modeschmuck durch echten zu ersetzen und sie aus der winzigen Wohnung am Rande von Chelsea herauszuholen, einer Gegend, die ganz plötzlich in Mode zu kommen schien.
Es war kalt in London. Der Wind peitschte nasse Schneeflocken in Philips Gesicht, als er zum Faraday’s Cinema lief, wo Mary Chamberlain arbeitete. Er war ordentlich angezogen. Ein Straßenpolizist würde einem so adretten Burschen mit einem sauberen Kragen keinen zweiten Blick schenken. Er verabscheute sowieso geflickte Hosen und ausgefranste Ärmel. Ehrgeizig, unabhängig und immer ein Auge auf die Zukunft gerichtet, hatte Philip einen Weg gefunden, sich das Leben so einzurichten, wie er es sich wünschte.
Er war arm und vaterlos auf die Welt gekommen. Mit seinen vierzehn Jahren war er jedoch noch nicht erwachsen genug, um darin vielleicht auch einen Vorteil zu sehen, einen äußeren Umstand, der ihn stark gemacht hatte. Er verabscheute Armut – aber mehr als er je in der Lage sein würde auszudrücken, haßte er den Mann, der seine Mutter geschwängert und sie dann verlassen hatte. Seiner Meinung nach hatte seine Mutter etwas Besseres verdient. Und, bei Gott, er auch. Schon von frühester Jugend an hatte er seine flinken Finger und seinen klugen Verstand dazu benützt, sich und seiner Mutter das Leben sorgenfreier und angenehmer zu gestalten.
In seiner Hosentasche befanden sich ein mit Perlen und Brillanten besetztes Armband und die dazu passenden Ohrringe. Er war ein wenig enttäuscht gewesen, nachdem er den Schmuck mit seiner kleinen Lupe examiniert hatte. Die Brillanten waren nicht lupenrein, und der größte von ihnen hatte nicht einmal ein halbes Karat. Immerhin, die Perlen besaßen einen schönen Glanz, und er war sicher, daß ihm der Hehler in der Broad Street dafür einen guten Preis zahlen würde. Philip verstand es ebensogut zu handeln wie Schlösser zu knacken. Er wußte ganz genau, was die Klunker in seiner Tasche wert waren. Genug, um seiner Mutter zu Weihnachten einen neuen Mantel mit einem echten Pelzkragen zu kaufen und um darüber hinaus noch eine kleine Summe für seinen, wie er es nannte, Zukunftsfonds zurückzulegen.
Vor der Kinokasse des Faraday’s hatte sich eine lange Warteschlange gebildet. Die Filmplakate kündigten Walt Disneys Cinderella an, daher bestand das Publikum hauptsächlich aus aufgeregten, quengelnden Kindern und den dazugehörigen genervten Müttern und Kindermädchen. Philip lächelte fröhlich, als er das Foyer betrat. Seine Mutter, so schätzte er, hatte diesen Film bestimmt schon ein dutzendmal gesehen. Nichts stimmte sie glücklicher als ein schönes Happy-End.
»Mum.« Er schlüpfte durch die schmale Tür des Kassenhäuschens und gab ihr einen Kuß auf die Wange. In der engen Glaskabine war es kaum wärmer als draußen auf der Straße. Er dachte an den roten Wollschal, den er in der Auslage bei Harrods gesehen hatte. Rot würde seiner Mutter fabelhaft stehen.
»Phil.« Wie immer trat ein Leuchten in ihre Augen, wenn Mary ihren Sohn ansah. Ein hübscher Junge mit seinem schmalen Schulbubengesicht und den goldblonden Haaren. Anders als vielen anderen Müttern versetzte es ihr keinen unangenehmen Schock, wenn sie in den Zügen ihres Sohnes den Mann wiedererkannte, den sie so innig, aber nur so kurze Zeit geliebt hatte. Philip gehörte ihr. Ihr ganz allein. Nie hatte er ihr auch nur einen Augenblick Schwierigkeiten gemacht, nicht einmal als Baby. Keine Sekunde ihres Lebens hatte sie es bedauert, ihn zur Welt gebracht zu haben, obwohl sie alleine dagestanden hatte, ohne Mann und ohne eigene Familie. Tatsächlich war es Mary damals nie in den Sinn gekommen, eines dieser muffigen, fleischfarben getünchten Hinterzimmer aufzusuchen, wo sich die Frauen von ihrem Problem befreien lassen konnten, bevor es zu einem wurde.
Philip machte ihr große Freude, schon vom ersten Tag ihrer Schwangerschaft an. Wenn sie überhaupt etwas bedauerte, dann, daß Philip den Vater, den er nie gesehen hatte, aus tiefster Seele haßte und ihn in jedem Mann, der ihm begegnete, zu finden versuchte.
»Deine Hände sind ja eiskalt«, sagte er zu ihr. »Du solltest Handschuhe anziehen.«
»Die nützen auch nicht viel.« Mary lächelte ein wenig, als sie die junge Frau vor ihrer Kasse ansah, die ihren Jungen am Schlafittchen gepackt hatte. Ihren Philip hatte sie nie so gängeln müssen. »So, mein Schatz. Amüsier dich gut bei dem Film«, hörte Mary die Frau sagen.
Sie arbeitet zu viel, dachte Philip. Zu schwer und zu viele Stunden für das bißchen Geld. Obwohl sie nicht gern über ihr Alter sprach, wußte er, daß sie gerade mal dreißig war. Und sehr hübsch. Die sanften, mädchenhaften Züge seiner Mutter erfüllten ihn mit Stolz. Mary Chamberlain konnte sich bestimmt nicht viel leisten, doch das wenige, das sie besaß, wählte sie mit Geschmack aus und einem sicheren Gefühl für die Farben, die ihr standen. Sie liebte es, in Mode- und Filmzeitschriften zu blättern und die Frisuren auszuprobieren, die gerade en vogue waren. Sie mochte vielleicht ihre Strümpfe ausbessern, doch Mary Chamberlain war alles andere als eine ungepflegte Frau.
Er wartete immer noch darauf, daß ihr ein neuer Mann begegnete und ihr ein neues, besseres Leben bieten würde. Wie er sich in dem kleinen, engen Kassenhäuschen umsah, in dem es immer so abscheulich nach Autoabgasen roch, faßte er seinen Entschluß: Ab jetzt würde er selbst die Dinge in die Hand nehmen und ändern.
»Du solltest Faraday sagen, daß er dir mal einen anständigen Ofen hier reinstellen soll, anstelle von diesem alten, klapprigen Ding.«
»Nun mach mal keinen Wirbel, Phil.« Mary zählte zwei kichernden Mädchen das Wechselgeld hin, die ihrerseits eifrig dabei waren, mit Philip zu flirten. Mit einem kleinen Lachen schob sie ihnen die Münzen durch die halbrunde Öffnung in der Scheibe. Sie konnte ihnen nicht böse sein. Warum auch, sie hatte sogar die Nichte ihrer Nachbarn – und die war immerhin schon fünfundzwanzig – dabei ertappt, wie sie sich an Phil heranmachte. Tee hat sie ihm angeboten. Ihn gebeten, hereinzukommen und ihre quietschende Tür zu ölen. Quietschende Tür, so konnte man es auch nennen! Das nächste Wechselgeld schmiß Mary derart unfreundlich hin, daß das mondgesichtige Kindermädchen verärgert den Kopf schüttelte.
Schluß mit solchen Gedanken, auf der Stelle. Sie wußte, daß Phil sie eines Tages verlassen würde und daß es wegen einer anderen Frau geschehen würde. Aber bestimmt nicht wegen einer vollbusigen Ziege, die auch noch zwölf Jahre älter war als er. Nicht, solange sie, Mary Chamberlain, noch auf Erden weilte.
»Is’ was mit dir, Mum?«
»Wie bitte?« Leicht errötend kehrte Mary wieder in die Wirklichkeit zurück. »Nein, nein, es ist nichts, mein Liebling. Möchtest du dir vielleicht den Film ansehen? Mr. Faraday hat sicher nichts dagegen.«
Solange er mich nicht sieht, bestimmt nicht, dachte Philip grinsend. Er dankte Gott dafür, daß er diesen Faraday schon seit geraumer Zeit von der Liste seiner möglichen Väter hatte streichen können. »Nein, danke. Ich bin nur vorbeigekommen, um dir zu sagen, daß ich noch ein paar Besorgungen machen muß. Soll ich dir was vom Markt mitbringen?«
»Nun, wie wär’s mit einem schönen Huhn?« Abwesend hauchte Mary in ihre kalten Hände, als sie sich zurücklehnte. Es war verdammt kalt in dem Kassenhäuschen, und es würde noch viel kälter werden, denn der Winter hatte erst begonnen. Im Sommer war es da drinnen so heiß und stickig wie in einem dieser türkischen Dampfbäder, von denen sie gelesen hatte. Aber zumindest hatte sie Arbeit. Wenn eine Frau ihren Jungen allein großziehen muß und dazu noch keine besondere Schulbildung hat, muß sie eben nehmen, was sie bekommen kann, dachte sie. Sie langte nach ihrem Geldbeutel aus imitiertem Leder. Es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, sich eine Pfundnote oder auch zwei aus der Kasse zu nehmen.
»Ich hab’ selbst noch ein bißchen Geld einstecken.«
»Na gut. Aber paß auf, daß das Huhn auch frisch ist«, ermahnte sie Phil und schob einer entnervten Frau, die versuchte, zwei zankende Jungs und ein kleines Mädchen mit verheulten Augen in Zaum zu halten, vier Eintrittskarten zu.
In fünf Minuten würde die Vorstellung beginnen. Sie mußte noch weitere zwanzig Minuten in der Kasse bleiben, falls noch Nachzügler kämen. »Vergiß nicht, dir das Geld für das Huhn aus der Dose zu nehmen, wenn du heimkommst«, ermahnte sie ihn, wohl wissend, daß er es nicht tun würde. So ein guter Junge, stets legte er Geld in die Dose, anstatt sich welches rauszunehmen. »Aber sag mal, solltest du nicht in der Schule sein?«
»Heute ist doch Samstag, Mum.«
»Samstag. Ja, natürlich, du hast recht.« Sie versuchte, nicht zu seufzen, als sie ihren Rücken streckte, und griff nach einem ihrer schon sehr abgegriffenen Hochglanzmagazine. »Mr. Faraday will nächsten Monat ein Cary-Grant-Festival ansetzen. Er hat mich sogar gebeten, ihm bei der Auswahl der Filme behilflich zu sein.«
»Das ist aber nett.« Die kleine Lederbörse in seiner Tasche wurde merklich schwerer, und es drängte ihn, nach Hause zu kommen.
»Wir werden das Festival mit meinem Lieblingsfilm beginnen. To Catch a Thief. Er wird dir gefallen.«
»Möglich«, murmelte er und blickte in die arglosen Augen seiner Mutter. Wieviel wußte sie? fragte er sich. Niemals erkundigte sie sich nach der Herkunft der kleinen Geldbeträge, die er nach Hause brachte. Dabei war sie alles andere als dumm. Nur optimistisch, dachte er und gab ihr wieder einen Kuß auf die Wange. »Sollen wir uns den Film an deinem freien Abend nicht zusammen ansehen?«
»Oh, ja, das wäre schön.« Sie unterdrückte das Bedürfnis, ihm übers Haar zu streichen, weil sie wußte, daß es ihn verlegen machte. »Grace Kelly spielt mit. Stell dir vor, eine echte Prinzessin! Gerade heute morgen mußte ich daran denken, als ich diese Zeitschrift aufschlug und den Artikel über Phoebe Spring las.«
»Über wen?«
»Oh, Philip.« Sie schnalzte mit der Zunge und schlug die Seite auf. »Phoebe Spring. Die schönste Frau der Welt.«
»Meine Mutter ist die schönste Frau der Welt«, entgegnete er, weil er wußte, daß sie darüber verschämt lächeln und dabei rot werden würde.
»Du bist mir schon so ein Charmeur.« Und sie lachte tatsächlich, laut und herzlich, wie er es an ihr so liebte. »Schau sie doch einmal an. Sie war Schauspielerin, eine wunderbare Schauspielerin, und heiratete dann einen König. Nun lebt sie mit dem Mann ihrer Träume in dessen Märchenpalast in Jaquir. Genau wie im Film. Das hier ist ihre kleine Tochter. Die Prinzessin. Noch keine fünf Jahre alt, die Kleine, und schon eine richtige Schönheit, findest du nicht?«
Philip blickte gelangweilt auf das Bild in der Zeitschrift. »Ich weiß nicht, ein kleines Kind eben.«
»Seltsam. Das arme Mädchen hat so unglaublich traurige Augen.«
»Ach, was du wieder für Geschichten erzählst.« Seine Hand schloß sich um das Päckchen in seiner Hosentasche. Jetzt wollte er seine Mutter ihren Fantasien und Träumen über Hollywood, Prinzessinnen und weiße Limousinen überlassen. Aber er würde schon dafür sorgen, daß sie einmal in einer solchen fahren würde. Zum Teufel, er würde ihr eine kaufen. Heute mußte sie sich noch damit begnügen, über Königinnen zu lesen, aber eines Tages sollte sie wie eine Königin leben, so wahr er Phil Chamberlain hieß. »Ich gehe jetzt.«
4. Kapitel
Adrianne liebte die Suks, den orientalischen Basar mit all seinen Geschäften. Bereits im Alter von acht Jahren kannte sie den Unterschied zwischen echten Brillanten und funkelnden Glassteinen, burmesischen Rubinen und Steinen minderer Qualität. Von Jiddah, ihrer Großmutter, hatte sie gelernt, so präzise wie ein eingefleischter Diamantenhändler die Steine nach Schliff, Reinheit und Farbe zu beurteilen. Mit Jiddah schlenderte sie stundenlang durch die Basare und bewunderte die besten Steine, die dort angeboten wurden.
Juwelen bedeuteten finanzielle Sicherheit für die Frauen, erklärte ihr Jiddah. Was hatten sie schon von Goldbarren oder Papiergeld, die im Banktresor eingeschlossen waren? Diamanten, Smaragde und Saphire konnte man sich anstecken und umlegen und so der Welt ihren Wert demonstrieren.
Nichts machte Adrianne mehr Spaß, als ihre Großmutter beim Feilschen in den Basaren zu beobachten, wo die anschwellende Hitze die stehende Luft zum Flimmern brachte. Oft gingen sie, begleitet von einer Schar schwarzgekleideter Frauen, die wie Raben hinter ihnen hertrippelten, durch die Suks, ließen Gold- und Silberketten durch ihre Hände gleiten, probierten Ringe mit erlesenen Edelsteinen an oder bewunderten einfach nur die kostbaren Juwelen, die hinter staubigen Glasscheiben funkelten. In diesen engen Gassen, wo sich die schwüle Hitze mit dem strengen Geruch von Tieren und Gewürzen mischte, patrouillierten die matawain mit ihren hennarot gefärbten Bärten, bereit, jede Verletzung der religiösen Vorschriften ohne Gnade zu bestrafen. Adrianne fürchtete sich nicht vor den matawain, wenn sie mit Jiddah zusammen war. Die ehemalige Königin genoß in Jaquir höchste Verehrung, hatte sie doch zwölf Kindern das Leben geschenkt. Wenn Adrianne mit ihr einkaufen ging, genoß sie die bunte Vielfalt der Marktgeräusche, das Geplapper der feilschenden Kunden, das Schreien eines Esels, das Klappern der Sandalen auf dem harten Lehmboden.





























