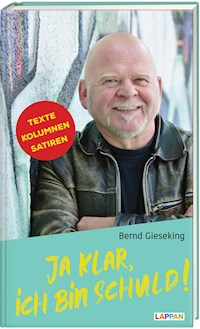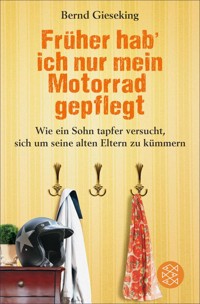8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fischer Paperback
- Sprache: Deutsch
*** 50 ist auch nur 'ne Zahl, Mann … *** »Der einzige wirkliche Nachteil: Ich kann auf dem Lottoschein nicht mehr mein Alter ankreuzen.« »Ich benutze seit einigen Wochen Zahnzwischenraumbürsten. Alles wird weniger, wenn man älter wird, nur die Zahnzwischenräume werden größer. Andererseits ist man froh, dass man überhaupt noch Zahnzwischenräume hat. Das ganze Gerede vom Alter ist Quatsch, und trotzdem ist was dran.« Der Buchautor und Kabarettist Bernd Gieseking weiß, wovon er spricht. Er hat die 50 hinter sich und kennt das Gefühl »Hälfte rum« ganz genau. Aber er weiß auch, dass noch ganz viel kommt. Witzig und mit viel tiefgründigem Humor berichtet er von den Wünschen, Träumen und Zielen der Männer seiner Generation und gibt seinen Leidensgenossen Hoffnung. Denn es kommt letztlich nicht auf die Höhe des Flugs an, sondern darauf, überhaupt losgeflogen zu sein! Ein Buch, das Männern Mut macht, wie ein guter Wein zu reifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bernd Gieseking
Gefühlte Dreißig – Ein Hoffnungsbuch für Männer um die Fünfzig
FISCHER E-Books
Inhalt
Time Is On My Side
The Rolling Stones
1Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt – Barry Ryan (1972)
Wenn Männer fünfzig werden
Als ich fünfzig wurde, habe ich ein größeres Fest gefeiert als sonst. Eingeladen hatte ich unter dem Motto »Hälfte rum«. Ich fand das witzig. Wenn Hundertjährige heutzutage aus dem Fenster steigen und auf Tour gehen, dann ist mit fünfzig erst die Hälfte rum. Auch wenn die Statistiken mir hier widersprechen mögen. Jedenfalls nahmen einige meiner Gäste das Motto wörtlich und schenkten mir Flaschen, die leider nur zur Hälfte mit Rum gefüllt waren. Sehr witzig. Aber letztlich besser als das, was sie mir zehn Jahre zuvor überreicht hatten. Mein Vierzigster stand unter dem Motto »Alles Pfirsich«. Es war erschreckend, was sich alles auf dem Gabentisch fand: Pfirsich-Shampoo und Pfirsich-Likör. Pfirsich-Dosen, mit meinem Konterfei beklebt. Dann schon lieber halbvolle Rumflaschen.
Ich schreibe bewusst halbvolle, nicht halbleere. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir Fünfzigjährigen mitten im Leben stehen. Fünfzig ist weder Schwelle noch Hürde, und danach geht es auch nicht steil bergab. Wir stehen voll im Saft, wir sind keine Oldies, sondern die jüngsten Fünfzigjährigen, die es je gab. Vielleicht sogar die jüngsten, die es jemals geben wird. Genau das wirft man uns manchmal vor. Da heißt es dann, wir würden »auf jugendlich« machen. Von wegen! Wir können es uns einfach leisten, in Chucks und Kapuzenpulli (dem Hoodie!!) herumzulaufen. Wir sehen damit alles andere als alt aus! Wir sehen damit sogar verdammt gut aus! Cool. Viel besser als die achtundzwanzigjährigen Nerds, denen ich manchmal zurufen möchte: »Zieht euch warm an, Jungs. Denn unsere Töchter werden jeden jungen Mann an uns messen!« Und da liegt die Latte verdammt hoch.
Der einzige wirkliche Nachteil an den fünzig ist: Ich kann auf dem Lottoschein mein Alter nicht mehr ankreuzen. Aber sonst? Konfusion, der große ostwestfälische Weise hat völlig richtig formuliert: »Fünfzig ist auch nur eine Zahl!« Außerdem werden seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren Tag für Tag jede Menge Männer fünfzig. Weltweit. Global. Das ist also eher normal als schlimm. Natürlich, die Zeit hinterlässt ihre Spuren, aber die eine oder andere Falte mehr spiegelt doch vor allem unsere Erfahrungen wider. Am deutlichsten sieht man diese Spuren im Personalausweis. Der ist inzwischen aus Plastik und mit einem »biometrischen« Foto versehen. Aber das Gute ist: Auf diesen Bildern sieht jeder irgendwie scheiße aus.
Mag sein, dass der eine oder andere von uns alt aussieht. Na und? Sollten all die Biere umsonst gewesen sein? Es muss sich doch gelohnt haben, dieses Leben! Die Jahre darf man ruhig sehen! Man muss ja nicht gleich ein T-Shirt mit der Aufschrift »Bier formte diesen schönen Körper« tragen.
Vom Zahn der Zeit einmal abgesehen: Was unterscheidet uns denn so grundlegend von den Jungen? Wir wollen geliebt werden, wir wollen Spaß haben, auch Sex. Wir wollen Glück und Erfüllung mit Wein, Weib und Gesang. Was unsere Wünsche angeht, sind wir also keineswegs alt. Wir werden höchstens von der Gesellschaft dazu gemacht. Die Medien sprechen gerne von der »werberelevanten Zielgruppe«, und die umfasst Vierzehn- bis Neunundvierzigjährige. Demnach sind wir ab jetzt irrelevant? Wer, wenn nicht wir, soll die ganzen sauteuren BMWs und Harleys denn kaufen und fahren? Wir sind im Gegensatz zu den jungen Hirschen wenigstens erfahren genug, die vielen PS auch zu bändigen. Uns trägt es nämlich nicht in der vierten Kehre raus aus der Kurve!
Ich finde, »die Gesellschaft« verkennt unser Potential. Sie ist sogar undankbar. Schließlich ist es unserer Generation, unserem Einsatz zu verdanken, dass das Land so gut dasteht. Werden wir deshalb mit Lob überschüttet? Keineswegs. Gregor Gysi sprach an seinem 65. Geburtstag sogar von »Altersrassismus«. Da ist was dran. Als Sebastian Kehl mit fünfunddreißig Borussia Dortmund in die nächste Pokalrunde schoss, titelte der Stern: »Der alte Mann und der Sonntagsschuss!« Wie alt bitte mag ein Reporter sein, der das schon über einen Fünfunddreißigjährigen schreibt?
Barry Ryan sang 1972 fast philosophisch:
Die Zeit, sie trennt nicht nur für immer Tanz und Tänzer
Die Zeit, sie trennt auch jeden Sänger und sein Lied
Die Zeit ist das, was grad geschieht
Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt …
Comedian Bernd Stelter sang dagegen sehr optimistisch schon drei Jahre vor seinem Fünfzigsten: »Männer über fünzig sind das Salz in deiner Suppe, voller Optimismus, dass das Leben noch was bringt.«
Wenn wir zurückblicken auf unser bisheriges Leben, kann man nur sagen: Die erste Hälfte ist doch super gelaufen. Ohne die Dramen der Welt ignorieren zu wollen – wir leben im Glück. Das Leben ist spannend und abwechslungsreich, wenn man vom Fernsehprogramm mal absieht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es überhaupt bis hierhin geschafft haben. Was hätte nicht alles passieren können! Seit fünfzig Jahren sind wir enormen Risikofaktoren ausgesetzt. Das muss uns erst mal einer nachmachen. Krankheiten, Autounfälle, Explosionen. Sobald man im Kino sitzt oder den Fernseher anstellt, merkt man erst, wie gefährlich das Leben ist. Sonntags läuft der Tatort, anschließend kommen schwedische und dänische Thriller, in der Woche folgen diverse Vorabend-Krimis, und diese unzähligen Serien lehren uns doch vor allem, dass es an Wunder grenzt, dass niemand von uns bisher ermordet wurde.
Schon die Geburt, der Einstieg ins Leben, war für Menschen unserer Generation ein Wagnis – gemessen am Stand der damaligen Medizintechnik. Zangengeburt, Steißgeburt, Saugglocke. Der Kaiserschnitt war in meiner Heimat Ostwestfalen lange Jahre genauso unbekannt wie in der Arktis. Spätestens im Kindergarten ging es dann weiter mit Röteln, Mumps, Masern, Windpocken, Keuchhusten … Man macht sich heutzutage gar keine Vorstellung mehr von all dem, was wir überlebt haben. Gezeichnete sind wir! Gegen Kinderlähmung gab es immerhin eine Schluckimpfung (»Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam«), aber von der Pockenimpfung haben wir alle eine Narbe auf dem linken Oberarm. Wir sollten sie mit Stolz tragen, denn sie weist uns aus als Angehörige der Gruppe Ü50. Der Generation Bonanza-Fahrrad auf dem Weg zum Treppenlift.
Unser Alter merken wir eher an den Dingen, die uns umgeben, als an uns selbst. Die Filterkaffeemaschine wurde abgelöst von teuren italienischen Espressomaschinen. Der Handmixer wich der Multifunktionsküchenmaschine. Unsere Klamotten kommen aus der Mode, und kaum haben wir uns neu eingekleidet, ärgern wir uns, dass wir das alte Zeug in die Kleidersammlung gegeben haben. Mal kommt die Röhrenhose zurück, mal die Hose mit Schlag. Wer heute kurze Jacketts mit schmalem Revers trägt, kauft nächstes Jahr lange mit breitem Revers. Das einzig Beständige ist der Wandel. Wir kaufen jetzt bei Manufactum das neu, was wir vor zehn Jahren von Tante Erna geerbt und weggeworfen haben. Gestern waren wir noch Punk, heute sind wir zweimal pro Woche bei der Fußpflege. Früher waren wir Feuer, heute sind wir höchstens noch Flamme. Damals saßen wir am Lagerfeuer, heute entzünden wir Kaminöfen. Ich benutze seit einigen Wochen Zahnzwischenraumbürsten! Alles wird weniger, wenn man älter wird, nur die Zahnzwischenräume werden größer. Und die Zahl der Kerzen auf dem Kuchen.
Ich bin jetzt schon über fünfzig. Sonst hätte ich dieses Buch gar nicht schreiben können. Wie ich mich heute fühle? Ganz ehrlich? Trotz Zahnzwischenraumbürsten: wie dreißig. Und keinen Tag älter!
2Don’t Look Back In Anger – Oasis (1995)
Klassentreffen
»Die sehen aber alt aus«, denke ich, als ich um die Ecke biege. »Die müssen zu einem anderen Jahrgang gehören.«
Wir – meine Freundin und ich – sind auf dem Weg zum Klassentreffen. Zu meinem Klassentreffen, dem ersten überhaupt, zu dem ich gehe. Die meisten anderen haben sich das seit dem zehnjährigen Abitreffen jährlich gegeben. Seit 25 Jahren. Macht zusammen: 35! Ist das alles wirklich schon so lange her mit dem Abi? Ich kann es kaum glauben.
Eigentlich hatte ich gar nicht hingewollt. Dass ich nun doch hier bin, daran ist meine Freundin schuld.
»Ist doch bestimmt interessant«, hatte sie gesagt.
»Pfft. Ich gehe nur, wenn du mitkommst!«
»Zum Klassentreffen? Das ist nicht dein Ernst. Da geht man allein hin.«
»In der Einladung stand ›mit Kind und Kegel‹. Also wenn du mitkämst, dann würde ich vielleicht …«
Tja, da waren wir nun also in der Mindener Altstadt und näherten uns dem Ort des Grauens, einer Kneipe mit dem sinnigen Namen »Zum seriösen Fußgänger«.
»Wenn die da«, ich zeige auf die Gruppe vor dem Eingang, »auch Klassentreffen haben, dann bestimmt das vierzigste,« sage ich zu meiner Freundin.
»Mindestens«, lege ich nach.
Sie mustert mich mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Dann meint sie: »Die sind genauso alt wie du!«
»Bitte!?! Die? Im Leben nicht!«
»Hast du keinen Spiegel?«
Einer aus der Gruppe löst sich, kommt auf uns zu und sagt: »Hallo, Bernd! Mensch, lange nicht gesehen.«
Wer ist das? Ein fremder Mann, der mir seine Hand entgegenstreckt und mich anlächelt. Wer zum Teufel … mein Hirn rattert.
Ich denke nicht gern an meine Schulzeit zurück. Ich habe im zweiten Anlauf Abitur gemacht. Beim ersten Mal war ich zum Halbjahreszeugnis zurückgetreten, weil ich die Schnauze voll hatte von der Paukerei und den Altnazis im Lehrerkollegium. Ich hätte damals doch zur See fahren sollen, schießt es mir durch den Kopf. Dann wäre ich jetzt gar nicht hier. Ich würde in einer Hafenspelunke in Surabaya sitzen, statt vor dem »seriösen Fußgänger« in Minden zu stehen und mir den Kopf zu zermartern, wer der Typ ist, der mir seit einer Ewigkeit seine Hand hinhält.
Damals, als Schüler, schien noch alles möglich. Nichts musste, alles konnte. Theoretisch zumindest. Denn leider sollte auch jede Menge! Vor allem meine Eltern wussten, was ich sollte. In erster Linie es »mal besser haben« als sie. Ich fand, dass es ihnen sehr gut gehe, und wollte es gar nicht besser haben, nur anders. Abenteuerlicher. Ein wildes Leben auf rauer See, das wäre es. Wenn ich heute, mit über fünfzig, an diese Zeit zurückdenke, an meinen Starrsinn und meine »Antihaltung« zu so vielem, Hauptsache, dagegen, möchte ich mich fast bei meinen Eltern entschuldigen.
Meine Freundin reißt mich aus meinen Gedanken. Ich höre sie sagen: »Hallo, freut mich. Ich bin Rita!«
»Stefan«, entgegnet der Unbekannte.
Stefan? Ich kann mich an nichts erinnern. Wir schütteln uns trotzdem die Hände.
»Schön, dass du auch mal kommst«, sagt Stefan.
Ich schweige.
»Früher hast du mehr geredet«, stichelt er, als ich die Zähne immer noch nicht auseinanderkriege.
Wir gehen zu den anderen. Die kennen mich auch. Ich kenne nur meine Freundin. Es dauert, bis die ersten Erinnerungen hochkommen. Ich erspähe einen ehemaligen Lehrer. Herrn Meffert. Chemie.
»Moin, Herr Meffert«, sage ich.
»Herr Gieseking«, sagt er und schüttelt mir die Hand.
»Sie kennen meinen Namen noch?« Ich bin erstaunt.
»Ach, wissen Sie«, sagt er und grinst, »das ist so eine Sache mit den verhaltensauffälligen Schülern!«
Nun grinse ich auch.
Ich treffe Jens, der als Zahnarzt den Beruf seines Vaters ergriffen hat. Jürgen, den Journalisten, der alles organisiert hat, gemeinsam mit Peter, dem Computer-Fachmann. Dieter, Klaus, Lothar, Karl Stefan, Burkhard. Gunnar, der Glaser geworden ist. Und dann kommt sie: Christina. Sie sieht mich, stürzt auf mich zu und umarmt mich. Wir haben uns noch nie umarmt! Als wir noch zur Schule gingen, umarmte man sich nicht. Außer wenn man miteinander »ging«. Ich wäre damals nur zu gern von ihr umarmt worden. Ein unerfüllter Traum. Bis heute. Sie sieht aus, als hätte der Lauf der Zeit einen großen Bogen um sie gemacht.
Die Damen lernen sich kennen. Dann sagt Christina zu mir: »Ich wusste, dass du mal so was machen würdest.«
Ich habe bis heute immer wieder Zweifel an dem, was ich mache.
»Warum?«, frage ich.
»Seit der Geschichte in Deutsch!«
Welche Geschichte in Deutsch, frage ich mich.
»Du erinnerst dich nicht? Wir mussten einen Aufsatz schreiben. Du bist drangekommen und hast deinen vorgelesen. Dann sagte Herr Schlüter, der wäre ja sehr gut, bis auf die eine Stelle. Die solltest du noch mal lesen.«
»Und?«
»Das weißt du nicht mehr, Bernd? Du hast gesagt, das ginge jetzt nicht. Herr Schlüter war irritiert und fragte: Wieso? Und darauf du: Weil hier nichts im Heft steht! Du hattest den ganzen Aufsatz aus dem Stegreif erfunden. Ich habe das nie vergessen! Und wie der Schlüter aus der Wäsche geschaut hat – das war unglaublich.«
Ich kann mich zwar an nichts erinnern, bin aber trotzdem irgendwie ein bisschen stolz auf mich.
Sogar meine Freundin scheint jetzt etwas beeindruckt von mir zu sein. Zumindest ein bisschen.
Der restliche Abend ist ein einziges rauschendes Fest. Als wir gehen, küssen sich zwei aus meiner Klasse, an ein Auto gelehnt. Soweit ich weiß, sind sie anderweitig verbandelt.
»Die haben früher schon geknutscht«, flüstere ich meiner Freundin zu. Ich bin ganz aufgekratzt, dass ich mich endlich auch mal an etwas erinnere.
Ich grinse, als wir an ihnen vorbeigehen.
»Lasst euch nicht stören«, sage ich, als sie erschrocken auseinanderfahren.
»Wie früher!«, rufe ich ihnen über die Schulter noch zu, und sie kichern.
Dann gehen die Meine und ich lächelnd Richtung Hotel.
3Golden Years – David Bowie (1976)
Lauter erste Male
Alles Leben beginnt mit dem Wunder der Geburt. Die meisten von uns haben daran keine konkrete Erinnerung mehr, und nach allem, was man darüber liest, ist das auch besser so. Plötzlich wird man ins Licht der Welt gezerrt, rausgeworfen auf eine Art und Weise, wie es keinem siebenunddreißigjährigen Langzeitstudenten widerfahren würde.
Ich wurde mit zehn Tagen Verspätung geboren. Meine Mutter hält mir das bis heute vor. Kaum draußen, blendet einen das Licht. Monatelang befand man sich im sicheren Dunkel. Deshalb fühlten wir uns später wahrscheinlich in schummrigen Diskotheken und auf Kellerpartys so sicher. Nun aber haute einem die Hochleistungsglühbirne im Kreißsaal so richtig auf die Augen. Nach der ersten Inaugenscheinnahme wurde die alles entscheidende Frage beantwortet: Junge oder Mädchen? Ich war ein Junge, ein männlicher Säugling, der vor der Lebensaufgabe stand, zum Mann zu werden.
Meine Mutter war darauf nicht vorbereitet, sie hatte ein Mädchen erwartet. Das war schon die zweite Erwartung, die ich nicht erfüllte. Das konnte ja heiter werden! Familie wird man bekanntlich nie los. Und deine Mutter ist die Frau in deinem Leben, die du dir nicht aussuchen kannst. Mein Vater wollte angeblich, dass ich als Erstgeborener seinen Namen trage: Hermann. So etwas hat Tradition auf dem Dorf. Meine Mutter war ratlos. Sie hatte sich nun einmal den Namen Peggy Lu in den Kopf gesetzt. Omas Katze hieß so, aber das ging ja nun nicht! Oma traf schließlich eine Entscheidung. Ich sollte nach Bernd Rosemeyer heißen, dem früh verunglückten Motorrad- und Autorennfahrer, Nazi-Liebling und Ehemann der Fliegerin Elly Beinhorn.
Geboren wurde ich in Minden, in der ostwestfälischen Provinz. Auf dem Dorf sprachen wir »Platt«, und fast die Hälfte von uns hatte zu Hause noch Landwirtschaft. Nicht nur die Bauernsöhne halfen selbstverständlich zur Erntezeit mit, auch wir anderen Jungs fuhren Trecker, stakten Strohballen hoch und stapelten sie auf den Anhänger, spießten Runkeln und Rüben mit Forken auf die Ladeflächen. Jeder von uns konnte mit der Sense mähen. Wir klaubten Hunderte, Tausende Kartoffelkäfer von den Pflanzen und verbrannten sie in prasselnden Feuern neben dem Acker. In den Pausen saßen wir auf dem Feld zusammen, tranken gesüßten Kaffee und aßen Streuselkuchen, den wir »Beerdigungskuchen« nannten.
Dann kam die Konfirmation, und die war für die nun folgende Jugendzeit das, was der Führerschein für den Autofahrer ist: die Eintrittskarte zu ersten Vergnügungen und Verlockungen. Nicht nur, dass man nun das Abendmahl empfangen durfte, viel wichtiger war: Man konnte damit zum CVJM. Der Christliche Verein junger Menschen hatte im Gemeindehaus einen Jugendtreff eingerichtet. Dort traf man sich abends einmal pro Woche zu Diskussionen, Spiele-Abenden und – wenn der Pastor mal nicht da war – zum »Flaschendrehen«.
Die Abende beim CVJM waren die Vorstufe zu dem, was im Dorf »das Haus« genannt wurde. In diesem alten, lange ungenutzten Fachwerkbau trafen sich die Älteren, die »Langhaarigen«. Über die wurde im Ort ausgiebig getrascht, obwohl diese »Hippies« erst dafür gesorgt hatten, dass das heruntergekommene Haus nicht zusammenfiel. Heute würde man vielleicht sagen: Das war ein autonomes Jugendzentrum. Dort wurde gefeiert, getrunken und geraucht, und wenn wir Jüngeren uns mal hineintrauten, gaben die Älteren uns das Gefühl, als gehörten wir tatsächlich dazu.
Dabei trennten uns nicht nur drei, vier Jahre Altersunterschied, sondern ganze Welten. »68« und die Revolte an den Universitäten waren unfassbar weit entfernt, auch wenn sich nun selbst in Minden sozialistische und kommunistische Gruppen bildeten und sogar eine selbstorganisierte »Teestube« eröffnete, aus der ein penetranter Geruchsmix aus Räucherstäbchen und Patschulidüften drang. Man schlürfte dort Tee, der aufgegossen wurde. Beutel, wie ich das von zu Hause kannte, waren verpönt. »Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren«, skandierten die Studenten in Marburg, Frankfurt oder Berlin. Talare kannten wir nur vom Pastor und in seltenen Fällen vom Jugendrichter, wenn mal wieder einer von uns ohne Führerschein auf dem Moped des älteren Bruders erwischt worden war.
Die Kommune 1 kannten wir nur von einer Bilderserie im Stern. Da waren die sogar nackt. Ein Skandal! Die Bilder führten dazu, dass wir ab sofort alle hoffnungslos in Uschi Obermeier verliebt waren. Fritz Teufel und Rainer Langhans interessierten uns nur bedingt, und sie allein hätten nie die Strahlkraft für alternative Lebensformen entwickelt, ohne diese Schönheit an ihrer Seite. Selbst die Ideologie der Kommunen brauchte den Sex-Appeal ihrer Frauen, um wahrgenommen zu werden, und unterschied sich so letztlich nicht mal vom Pirelli-Kalender, der seit 1964 mit seiner erotischen Fotografie aus keiner Kfz-Werkstatt mehr wegzudenken ist.
Unser Alltag wurde von der Schule bestimmt. Nach den ersten vier Jahren hatten sich unsere Wege zum ersten Mal getrennt. Einige meiner Freunde besuchten die Hauptschule, andere die »höhere Handelsschule«, manche gingen auf die Realschule, wieder andere auf das Gymnasium. Meine Eltern hatten bei mir die Realschule eventuell für möglich gehalten. Lehrer Kirchner aber empfahl das Gymnasium. Ich versagte in Latein und siegte im Schlagballweitwurf – einer Disziplin, die im Osten des Landes, hinter dem Eisenen Vorhang, »Handgranatenweitwurf« hieß.
Ich war der Erste in meiner Familie, der Abitur machte. Was ich in der Schule an Diskussionskultur lernte – den Austausch von Argumenten –, das galt zu Hause als »Widerworte geben«. Und wenn ich doch einmal ein allerletztes Argument angebracht hatte, hieß es: »Gümmer mösst du datt letzte Wurt häm!« Immer musst du das letzte Wort haben! Argumentierte ich danach »dialektisch«, also mit Logik, wie im Philosophieunterricht (»Ich denke, also bin ich!«) gelernt, indem ich sagte: »Nee, das letzte Wort hattest du ja grad, Mama!«, kam sofort zurück: »Doar, all wier!« Da, schon wieder! Heute würde ich sagen: Wir hatten beide recht!
Abitur hin oder her, ich sehnte mich nach wahren Heldentaten, nicht nur nach solchen auf dem Papier. Im flachen Ostwestfalen zwischen Mittellandkanal und Weser hatte ich schon als Kind davon geträumt, zur See zu fahren. Ich wurde immerhin Ruderer. Zuerst Steuermann, denn ich war klein, aber laut. Dass ich kleiner war als andere, merkte man schon an meinen Spitznamen. Meine Eltern hatten mich als Kind liebevoll »Krümel« genannt. Bei meiner Achtermannschaft hieß ich »Stöpsel«. Der etwas rauere Ton war dann aber schon das Einzige, das bei den Ruderern an die Seefahrt erinnerte.
Aber die reizte mich und lockte mich weiter. Heimlich ließ ich mir, als ich in die »Oberstufe« ging, beim Gesundheitsamt ein »Seediensttauglichkeitszeugnis« ausstellen, denn einfach abhauen, anheuern und zur See fahren wie Wolf Larsen, das war im bürokratischen Deutschland der Siebziger und Achtziger nicht mehr möglich. Das Seemannsgesetz und das Jugendarbeitsschutzgesetz setzten jetzt den Freiheitsträumen eines Jugendlichen enge Grenzen. Später, nach Abitur und Zivildienst, schreckten mich die Realitäten, die nur noch kurzen Liegezeiten der Schiffe im Hafen, die Technisierung der Arbeitsabläufe an Bord, die nichts mehr von meiner früher erträumten Seefahrtsromantik hatten. Meine Zeit an Bord hatte ich um Jahrzehnte verpasst.
Aber irgendwie spürten wir damals: Goldene Jahre lagen vor uns. Das Leben hatte gerade erst richtig begonnen. Ich war 18, ich war volljährig und damit auch auf dem Papier endlich erwachsen. Das war geil! Als ich das erste Mal zu Hause das Wort »geil« sagte, hat mir meine Mutter eine gescheuert. Das war schlimmer als heute »Negerkuss« zu sagen. Geil war damals gleichbedeutend mit extremem sexuellen Verlangen, und so etwas war in unserer Jugend total tabuisiert.
Ich durfte jetzt den Führerschein machen. Und ich durfte wählen. Das war die Reihenfolge der Wichtigkeiten, und der »Lappen« war für uns eindeutig wichtiger als der Wahlzettel. Im Grunde durften wir plötzlich alles. »Alles« wurde zum Ziel unseres Lebens. Wir wollten alles haben. Nicht nur ein Stück vom Glück. Besonders im Privaten. Seitdem ist viel passiert. Wir Jungs von damals wollten in der Liebe nicht nur alles, wir waren auch alles: hoffnungsvolle Anfänger und routinierte Fortgeschrittene. Wir waren Mann, Ehemann und Vater. Wir waren Freund, Geliebter oder hatten eine Geliebte. Wir wurden verlassen und wir verließen, man brach uns das Herz, und wir brachen es anderen. Es war eine abenteuerliche Reise bis hierher, bis zu unserem Fünfzigsten. David Bowie sang: »Look at that sky, life’s begun – nights are warm and the days are young.« Auch wenn nicht jeder Tag, jedes Jahr gleich glänzte: Es waren Golden Years! Und ich möchte rückblickend auf kein einziges davon verzichten.
4It’s My Life (1) – Bon Jovi (2000)
Die Aufklärung
Diese ersten fünfzig Jahre waren ein einziger Rausch an Herrlichkeiten. Die erste Zigarette, das erste Mal betrunken, der erste Kuss und natürlich das erste Mal schlechthin, um das sich allerlei Mythen rankten.
Meine Kumpels und ich, wir waren Jungs vom Dorf und hatten »von Tuten und Blasen« keine Ahnung. Das Thema Aufklärung kannten die meisten von uns nicht mal aus dem Deutschunterricht. Aber natürlich machten wir trotzdem schon Witze darüber. Über ES, wie es vielsagend hieß. An das ES konnte man die verschiedensten Verben anhängen, aber es blieb immer etwas Unbestimmtes, Vages. Wir wussten, eines Tages würden wir »es tun« oder »machen«, mindestens täglich und, wenn es gut laufen würde, vielleicht sogar mehrmals am Tag. Mit unserer Frau, die ungefähr so aussehen würde wie die Filmstars, die wir anhimmelten. Bis wir diese Traumfrau trafen, würde eine gefährlich lange Zeit zu überbrücken sein, und schlimmer noch: Am Anfang dieser langen Zeit war ebendieses eine erste Mal zu bewältigen.
Ich wollte vorbereitet sein. Ich muss ungefähr 14 gewesen sein, als ich meine Eltern fragte: »Wollt ihr mich nicht mal aufklären?« Meine Mutter Ilse sagte mit Blick auf meinen Vater Hermann: »Datt mött hei moaken!« Männersache also. Ich ging mit Hermann ins Badezimmer. Er rasierte sich, ich saß auf dem Wannenrand und wartete. Er schwieg und rasierte weiter.
»Und was ist jetzt mit der Aufklärung?«, fragte ich ungeduldig.
Hermann atmetet ein, Hermann atmete aus: »Weißt du, Bernd, das macht doch dein Doktor Sommer in der Bravo viel besser als ich.«
Ich kippte beinahe in die Wanne.
»Woher kennst du den denn?«, fragte ich.
»Ich les die manchmal«, sagte er.
Mein Vater las also meine Bravo. Und offenbar nicht die Seiten über Smokie, die Bee Gees und John Travolta, sondern die Rubrik von Dr. Sommer.
Zum nächsten Geburtstag bekam ich immerhin das Buch »Wo kommen die kleinen Jungen und Mädchen her«. Am meisten beeindruckte mich dabei, dass man mit einer Nadel ein Loch in eine bestimmte Seite stechen solle. Interessiert las ich, dass das »Ei«, aus dem schließlich ich entstanden war, nicht größer gewesen sei als dieses Loch. Ich holte mir eine Nadel.
»Watt wutt du mit de Noadel?«, fragte meine Mutter.
»Brauch ich mal grad«, nuschelte ich, verschwand in meinem Zimmer, durchstach die Seite und staunte. Viel größer war ich seitdem nicht geworden, meine Sorgen dafür um so mehr: Hatten kleine Jungs auch einen kleineren Penis? Würde ich als »Kleiner«, ich war schon damals kleiner als die meisten Gleichaltrigen, überhaupt eine Frau finden? Würde sie, egal wie klein sie selber war, meinen kleineren Penis groß genug finden? Oder hatten kleinere Frauen auch kleinere Scheiden? Waren »Kleine« also perfekt füreinander geschaffen? Warum waren dann aber so viele kleinere Frauen mit weit größeren Männern zusammen? Und wieso fand man es komisch, wenn ein kleinerer Mann mit einer größeren Frau zusammen war? Sollte ich auf alle Frauen verzichten müssen, die größer waren als ich? Sollte ich klettern lernen? Fragen über Fragen. Es war ein schweres Leben.
Schon allein die Sache mit dem ersten Kuss war schwer. Mein erstes Mal war beim Flaschendrehen, im Jugendtreff des CVJM in der Christuskirche Todtenhausen/Kutenhausen. Wir sangen dort zusammen, beteten, diskutierten, und wenn der Pastor nicht da war, spielten wir Flaschendrehen. Mir brach schon Stunden vorher der Angstschweiß aus. Eine Zeitlang schützte ich einen plötzlichen Anfall von Bauchschmerzen vor, wenn die Flasche hervorgeholt wurde. Aber diese Karte konnte ich natürlich nicht ewig spielen.
Eines Tages dann zeigte die Flasche erst auf mich und dann auf Heidi. Damals meine absolute Traumfrau. Für viele andere leider auch. Eigentlich unerreichbar für mich. Und plötzlich so nah. Mir und nicht all den anderen Jungs, die sie anhimmelten. Sie zog meinen Kopf zu sich und küsste mich. Mit Zunge! Bis hinten an die Backenzähne. Wow. Heidi hat meine Mundhöhle entjungfert. Danke, Heidi. Hinterher fühlte ich mich, als hätte ich gleichzeitig Amerika entdeckt und die Nord-Ost-Passage bewältigt. Seitdem hatte ich nie wieder Bauchschmerzen, wenn wir Flaschendrehen spielten.
Höchste Zeit also für den nächsten Schritt. Meine Kumpels und ich diskutierten Tage und Wochen. Sollten wir zu einer Prostituierten gehen? Wenn ja, würde uns jemand sehen, wenn wir das legendäre »Rampenloch« betraten, einen Puff in einer kleinen Sackgasse in Minden? Wäre es gut, wenn sich die Nachricht verbreitete? Wären wir dann Helden? Oder wäre es peinlich? Wir entschieden uns für die Heldenvariante, plünderten unsere Sparschweine, bestiegen unsere Fahrräder und radelten zum »Rampenloch«. Jeder gab fünf Mark. Dann wurde gelost. »Es« kostete einen Zwanziger, und da wir zu viert waren, bekam nur einer von uns die Chance. Ich war einerseits enttäuscht, gleichzeitig aber auch heilfroh, dass es mich nicht ein einziges Mal erwischte.
Mein erstes Mal verzögerte sich denn auch noch eine ganze Weile. Gudrun machte schon nach zwei Wochen Schluss. Die Sache mit Sabine ging unwesentlich länger. Christiane wollte warten, bis sie sich die Pille verschreiben lassen konnte, und vorher wollte sie nicht. Karin wollte erst, dann aber doch wieder nicht, weil sie von Klaus nicht loskam. Edith wollte nicht mal Petting. Dann traf ich Edeltraut und hoffte, dass es mit ihr endlich klappen würde. Sie war vier Jahre älter als ich und hatte bereits »Erfahrung«. Alles stimmte, Ort, Zeit und Ungestörtheit – aber bei mir ging vor lauter Aufregung gar nichts. Eine schöne Blamage. Aber im zweiten Anlauf zeigte sie mir dann, wie alles ging, wovon ich schon so lange geträumt hatte.
5Yesterday – The Beatles (1965)
Der Quelle-Katalog
Ich erinnere mich noch gut daran, wie schwierig es für mich mit fünfzehn war, überhaupt eine nackte Frau zu Gesicht zu bekommen. Weit und breit kein Internet. Die St. Pauli Nachrichten gab es nur als »Bückware«, also von unter der Theke weg, und ich war gefühlte Lichtjahre entfernt von den achtzehn Jahren, die man alt sein musste, um sie überhaupt kaufen zu dürfen. Falls ich mich denn getraut hätte, danach zu fragen. Heute stehen mindestens zwanzig Sex-Zeitungen an jeder Tankstelle offen im Zeitschriftenständer, und der nächste Pornofilm ist nur einen Mausklick entfernt. Wir mussten uns da noch ganz anders behelfen.
Zum Glück gab es in unserer Jugend noch die Versandhaus-Kataloge. Der aus dem Hause Quelle war die Bibel des Konsumenten seit den Zeiten des Wirtschaftswunders. Ein dickes Heft voller Heilsversprechen. Was hier nicht angeboten wurde, existierte nicht. Quelle hatte einfach alles: Fahrräder, Waschmaschinen, Uhren, Schnuller, Swimmingpools, Staubsauger, Bettbezüge und Kreuzschlitzschraubendreher. Vor allem aber gab es Kleidung: Damenober- und -unterbekleidung!
Junge und alte Männer blätterten im Quelle-Katalog, wenn sie sich sexuell erregen lassen wollten. Der Playboy wäre viel zu teuer gewesen, außerdem: siehe oben. Was für den Literaten damals Henry Miller war oder die »Emanuelle«-Serie bei Rowohlt, das war für uns einfache Handarbeiter der Quelle-Katalog: eine Vorlage für erotische Phantasien. Wir sahen Dinge, die wir noch nie »in echt« gesehen hatten. Wir stellten uns beim Betrachten der Bilder vor, wie wir unsere Hand vorsichtig in Dekolletés steckten, wie wir mit zittrigen Fingern Träger von Schultern schoben. Bei den Seiten, auf denen BHs präsentiert wurden, mussten wir uns gar nichts weiter vorstellen. Allein die Wölbung der Brüste unter den Körbchen zu sehen reichte für unsere Erfüllung. Wobei mir ein Rätsel war, wie die Frauen in manche dieser Konstruktionen hineingeschossen wurden, die man Miederwaren nannte.
Wir rollten beim Blättern durch den Katalog im Geiste Feinstrümpfe herunter und sahen Damen in schwarzen spitzen High Heels vor uns, während unsere Freundinnen zu dieser Zeit ausschließlich in Birkenstock-Schlappen unterwegs waren. In unserer Phantasie trugen unsere Freundinnen weder schlabbrige Latzhosen noch selbstgebatikte Wallewallekleider, sondern das knallenge kleine Schwarze mit den Spaghettiträgern von Seite 27.
Im Grunde war der Quelle-Katalog um Längen besser als der Playboy oder die St. Pauli Nachrichten. Diese Heftchen gingen zu weit, weil sie nur das Nackte zeigten. Für Phantasie war da kaum Platz, nirgendwo fand sich ein Bild, das dieses erregende Verhülltsein auch nur annähernd so zeigte wie der Quelle-Katalog. Mit alldem ist nun leider Schluss. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, dies ist ein Nachruf! Als 2009 das endgültige Aus des gedruckten Katalogs verkündet wurde, startete Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in den Medien eine fast schon rührende und gleichzeitig verzweifelte Rettungsaktion. Zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal habe ich Horst Seehofer bedauert und mit ihm gelitten. Wie er dastand vor den Fernsehkameras, von der Betroffenheit der Kunden sprach und den Katalog mit der Hand trotzig-traurig umklammerte. In seinem Gesicht spiegelten sich all die schönen Erinnerungen wider: »Meine Quelle!« Er hatte sich persönlich der Rettung verschrieben, einerseits aus Selbstzweck mit einer Prise Nostalgie, andererseits liebt er den medienwirksamen Auftritt. Dass der damals amtierende Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Rettungsaktion nicht unterstützte, ist sonnenklar. KT stammt aus einer ganz anderen Generation. Der hatte schon Internet und konnte sich seine Inspirationen anderweitig besorgen. Täglich neu und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir dagegen mussten uns noch in Geduld üben: Zweimal jährlich wurde der Katalog ausgeliefert, die Ausgabe für Frühling und Sommer musste halten, bis die für Herbst und Winter ins Haus kam. Wenn man bedenkt, durch wie viele Hände die Kataloge gingen, wie abgegriffen einzelne Seiten bis zur neuen Lieferung waren – da war höchste Papier- und Druckqualität gefordert. Diese Kataloge waren ein Geschenk in unserer Jugend. Nun sind wir fünfzig, und die Erinnerung daran ist pure Nostalgie. Gott sei Dank finden wir Liebe und Erfüllung heute im realen Leben. Auch wenn uns manche Miederwaren immer noch vor Rätsel stellen.
6Roxanne – ThePolice (1976)
Sehnsucht St. Pauli
Als wir noch Jugendliche waren, gab es, abgesehen vom Erscheinungstermin des Quelle-Katalogs, eine ganz große Sehnsucht – Hamburg und die Reeperbahn. »Reeperbahn, wo früher noch der alte Star-Club war«, sang Udo Lindenberg. Wir kannten den Text auswendig und hätten problemlos dort als Fremdenführer arbeiten können. Die legendären Reime des Panikrockers weckten in uns eine Sehnsucht nach Hafen und Landungsbrücken. Lindenbergs »Andrea Doria« war ein Lebensgefühl. Auf diesem Kahn wollten wir anheuern.
Ich wäre gern auf »Johnny« getauft worden statt auf »Bernd«. Ich wollte ein Seemann sein. Oder wenigstens mal eine Nacht in einer Hafenspelunke zubringen. Die Reeperbahn war für uns ein einziges kitzliges Versprechen. Wir wussten von einem Laden namens »Zur Ritze«, vom »Safari«, vom »Salambo«. Zumindest vom Hörensagen. Sexshows sollte es da geben. Da wurde angeblich live gevögelt. Auf der Bühne! Und es gab die Herbertstraße, wo die schärfsten »Nutten« überhaupt standen. In unserer Phantasie retteten wir wenigstens eine von ihnen aus dem Sumpf. Unsere Liebe würde sie aus den Klauen ihres Zuhälters reißen, und dann würden wir mit ihr alt werden. Mit dankbarem Blick für ihren Retter würde sie sich mit ihren wunderbaren Brüsten an unsere Heldenbrust schmiegen. Unser Leben, ein einziger Rausch aus Lust und Erfüllung. Dass wir kaum oder keinerlei sexuelle Erfahrungen hatten, spielte keine Rolle.
Nachdem die Ersten aus unserer Clique den Führerschein hatten, fuhren wir samstags regelmäßig nach Hamburg. Erst auf die Reeperbahn, dann zum Fischmarkt. Wir wurden »angekobert« und trauten uns doch nicht rein in die Spelunken, Bars und Clubs. Wir standen staunend am Eingang der »Ritze« und wagten es nicht, zwischen den beiden aufgemalten gespreizten Frauenbeinen hindurchzugehen. Wir redeten uns raus, wenn die Prostituierten uns anquatschten, und fühlten uns trotzdem großartig. An manchen Abenden gelang es uns schon mal zu »verhandeln«, doch seltsamerweise konnten wir uns nie für eine entscheiden. Wir waren unübersehbar Provinzler, grün hinter den Ohren, und ich nehme an, die Ladys haben herzlich gelacht über uns Jungs, die den Macker markierten, obwohl ihnen gerade mal die ersten Sackhaare wuchsen.
In späteren Jahren tummelten wir uns in Jörg Immendorfs »La Paloma«. Während aus den Lautsprechern »Roxanne, you don’t have to put on the red light« von Police dröhnte, standen die Damen vom horizontalen Gewerbe neben uns an der Theke, um sich kurz aufzuwärmen oder eine kleine Pause zu gönnen. Ich trug Vollbart und Lederjacke und war überzeugt, wie ein Seemann auszusehen.