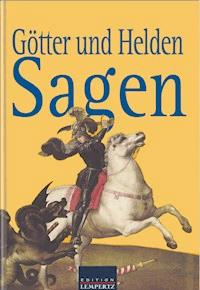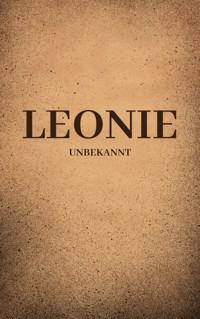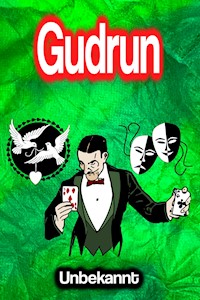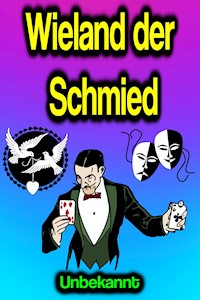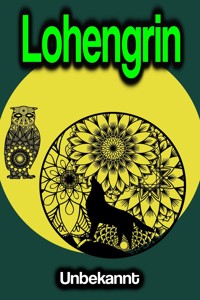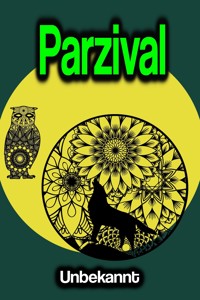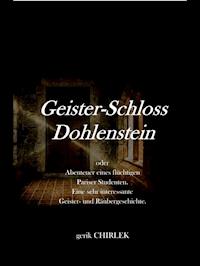
Geister-Schloss Dohlenstein oder Abenteuer eines flüchtigen Pariser Studenten. Eine sehr interessante Geister- und Räubergeschichte. E-Book
. unbekannt
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alte Reihe
- Sprache: Deutsch
= Digitale Neufassung für eBook-Reader = "Theodor, ein munterer und aufgeweckter Kopf, welcher damals auf der Universität in Paris seine Studien durchmachte, hatte das Unglück, sich mit dem Sohne einer vornehmen Familie zu schlagen, und demselben im Duell eine tödliche Wunde zu versetzen. Theodor, welcher wohl überlegte, dass er nicht länger in einem Lande bleiben könne, in dem er jeden Augenblick Gefahr laufe, von den Häschern ergriffen, und seines Lebens verlustig zu werden, konnte nichts eiliger tun, als ungesäumt die Flucht zu ergreifen, um wo möglich seine Heimat zu erreichen, die in einem Dörfchen am Rhein lag. Als Bauer verkleidet, einen Stock in der Hand, hatte er bereits eine Strecke von 40 Stunden größtenteils zur Nachtzeit zurückgelegt. Da kam er am fünften Tage in einen ungeheuren Wald..." Ort der Handlung: Schloss Dohlenstein / Largen am Rhein
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Geister-Schloss Dohlenstein
Technische Anmerkungen
I. Die Flucht.
II. Die Ankunft in der Heimat.
III. Das Gespenst.
IV. Theodor unter der Räuberbande.
V. Die schöne Gefangene.
VI. Die Rettung.
VII. Die letzte Gefahr.
Digitale Neufassungen
Impressum
Geister-Schloss Dohlenstein
oder
Abenteuer eines flüchtigen Pariser Studenten.
Eine sehr interessante Geister- und Räubergeschichte.
-
Burghausen, ca. 1860.
Verlag von J. Lutzenberger
Geister-Schloß Dohlenstein
Digitale Neufassung des altdeutschen Originals
von Gerik Chirlek
Reihe: Alte Reihe / Band 3
Technische Anmerkungen
Die vorliegende digitale Neufassung des altdeutschen Originals erfolgte im Hinblick auf eine möglichst komfortable Verwendbarkeit auf eBook Readern. Dabei wurde versucht, den Schreibstil des Verfassers möglichst unverändert zu übernehmen, um den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu erhalten.
I. Die Flucht.
Theodor, ein munterer und aufgeweckter Kopf, welcher damals auf der Universität in Paris seine Studien durchmachte, hatte das Unglück, sich mit dem Sohne einer vornehmen Familie zu schlagen, und demselben im Duell eine tödliche Wunde zu versetzen. Theodor, welcher wohl überlegte, dass er nicht länger in einem Lande bleiben könne, in dem er jeden Augenblick Gefahr laufe, von den Häschern ergriffen, und seines Lebens verlustig zu werden, konnte nichts eiliger tun, als ungesäumt die Flucht zu ergreifen, um womöglich seine Heimat zu erreichen, die in einem Dörfchen am Rhein lag. Als Bauer verkleidet, einen Stock in der Hand, hatte er bereits eine Strecke von 40 Stunden größtenteils zur Nachtzeit zurückgelegt. Da kam er am fünften Tage in einen ungeheuren Wald. Schon drei Tage irrte er in demselben herum. Die Straße getraute er sich nicht zu verfolgen, und so kam er oft wieder an denselben Ort, von wo er ausgegangen war. Die wenigen Nahrungsmittel, mit denen er sich versehen hatte, waren erschöpft. Jetzt bedeckte sich der Himmel mit dicken schwarzen Gewölke, der Nordwind brauste, und die hereinbrechende Nacht gönnte dem Bedrängten keinen Lichtstrahl, der ihm das Auffinden einer Felsenhöhle möglich machte, um sich vor dem furchtbaren Wetter zu schützen. Nach dem Sturm folgte ein mattes nebliges Licht; nur zuweilen erleuchtete ein Blitzstrahl den Weg. Schon verkündeten starke Tropfen Wasser einen nahen reichen Regenguss. Da bemerkte er ein mattes Licht, das in einiger Entfernung aus einem Baumdickicht leuchtete. Alle seine Leiden, alle seine Furcht schwanden in diesem Augenblicke; er nahm sogleich seinen Weg nach dieser Richtung. Bei jedem Schritt strauchelte sein Fuß an Baumwurzeln und in der dicht verwachsenen Heide, oft verlor er das Licht aus seinen Augen und fand es dann von Neuem wieder. Endlich kam er bei einer Hütte an, welche große und dicht aneinander stehende Bäume allen Blicken von außen entzogen. Der Regen hatte unterdessen angefangen, in Strömen vom Himmel zu fallen, und mit kräftiger Hand klopfte unser Irrender beherzt an die Türe.
„Schon da!“ rief eine kreischende Stimme, „Heute ist die Arbeit von kurzer Dauer gewesen; oder solltest du das schlechte Wetter gescheut haben?“ Bei diesen Worten öffnete eine Frau die Türe, und war nicht wenig erstaunt, vor derselben einen Mensch zu finden, den sie nicht erwartet hatte. „Was wollen Sie hier?“ sagte sie. – „Meine Liebe, Ihr seht, welch ein furchtbares Wetter es ist. Seit drei Tagen irre ich in diesem Walde, ohne dass ich einen Ausweg finden kann; gestattet mir nur ein Nachtlager und gebt mir etwas zu essen. Übrigens seit ohne Sorgen“, setzte er hinzu, als er sah, dass sie Anstand nahm, ihn aufzunehmen, „ich bin im Stande, Euch jeden geringen Dienst, den Ihr mir leisten werdet, zu bezahlen.“ „O! deshalb nehme ich nicht den geringsten Anstand, Sie hereinzulassen; aber bedenken Sie doch, dass man sich in dieser Wildnis nicht jedem anvertrauen darf, der kommt und anpocht; man sieht sich doch von dem Wenigen, was man hat, nicht gern entblößt.“ „Beruhigt Euch, meine Liebe, ich bin nicht im Stande, Euch das geringste Leid zu tun; vielmehr bin ich froh, wenn man mich in Ruhe lässt.“ – „Sie führen doch einige Waffen versteckt bei sich?“ – „Nein; noch einmal gebe ich Euch die Versicherung, dass ich in der friedfertigsten Absicht diese Schwelle betrete.“ „Nun dann, so treten Sie ein; ich will Sie bewirten, so gut ich kann.“ – „Ihr sollt keinen Undank dafür von mir ernten.“
Bei diesen Worten führte ihn die Wirtin in ein ziemlich geräumiges Zimmer, das recht reinlich eingerichtet war und zugleich als Küche und Schlafgemach diente. Der Fremde wurde jetzt mit einem Stücke schwarzem Brote, einem Krug Wein und einem Reste Hasenbraten bedient, welchen Gerichten sein großer Hunger eine köstliche Würze gab. Nachdem er seinen Hunger ein wenig gestillt hatte, dachte er daran, seine Wirtin einmal genauer zu betrachten. Diese stand vor der Tafel und schien ihn schon geraume Zeit mit scharfen Augen betrachtet zu haben.
Sie schien ungefähr fünfundvierzig Jahre alt zu sein. Eine blasse Gesichtsfarbe, trübe und tiefliegende Augen gaben ihr ein finsteres Ansehen, was den Beobachter sehr zurückschreckte. Dabei war sie von großem Wuchs und einem starken Körperbau. Er sammelte sich bald, und fragte: ob sie diese Hütte allein bewohne? „Ich bewohne sie mit meinem Manne, der ein Köhler ist. Diese Waldungen, die nur einige Meilen vom deutschen Gebiete entfernt liegen, gehören dem Marquis von Villaflor, von dem Antonio (dies ist der Name meines Mannes) für einige kleine ihm geleistete Dienste die Erlaubnis erhielt, diese Wohnung zu bauen und in der Umgebung sein Gewerbe zu treiben.“
Diese einfache Erzählung beruhigte den Studenten. Er schämte sich über seinen Argwohn, den er gegen sie geschöpft hatte, und bat sie, ob sie nicht ein Bett für ihn habe, in dem er sich von seinen gehabten Anstrengungen erholen und mit der Rückkehr des Tages das schöne Wetter abwarten könne.
„Ich habe da oben ein Zimmerchen, welches vormals meinem Sohne als Schlafgemach diente. Der gute Junge! er hatte das Unglück, als er mit seinem Vater vor einigen Monaten im Walde arbeitete, sein Leben zu verlieren.“ – „Mein Gott! wie kam das denn?“ – „Ach! erlassen Sie mir diese Erzählung, sie würde nur meinen Schmerz erneuern. Sie haben fertig gegessen, darum kommen Sie nach Ihrem Zimmerchen; Sie werden das Bett neu überzogen finden. Ach! am Tage, da der arme Junge sterben musste, verrichtete ich dies Geschäft.“
Der Student nahm eine Lampe, die ihm seine Wirtin anbot, wünschte dieser gute Nacht, und erstieg eine kleine Treppe, an deren Ende er zwei Türen fand, von denen die eine nach einem kleinen Fruchtboden, die andere aber nach der Kammer führte, in der sein Nachtlager sein sollte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: