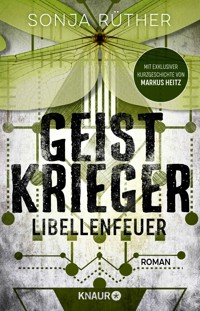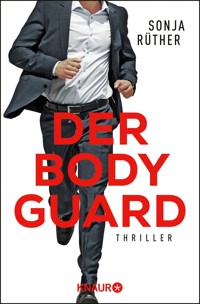9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geistkrieger
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn … Amerika nie erobert worden wäre? Der Fantasy-Thriller »Geistkrieger: Feuertaufe« spielt in einer alternativen Realität, in der die amerikanischen Ureinwohner sich erfolgreich gegen die Eroberer aus Europa zur Wehr gesetzt haben – auch mithilfe der Welt der Geister. Den Kräften der Natur ebenso wie der Welt der Geister verbunden, hat sich die Nation der Powtankaner zur Weltmacht entwickelt. Als dem angesehenen Professor Atius Catori von einer unsichtbaren Macht der Brustkorb regelrecht zerfetzt wird, übernimmt die Sondereinheit der Geistkrieger die Ermittlungen. Ihr neuestes Mitglied, der Schotte Finnley, ist seiner Verlobten in ihre Heimat gefolgt und fühlt sich noch immer fremd im Land der Powtankaner. Doch dass Finnley keiner von ihnen ist, könnte der größte Vorteil der Geistkrieger werden – denn der Mord an Professor Catori ist erst der Anfang von etwas, das sich keiner von ihnen auch nur hätte vorstellen können. Sonja Rüther hat mit ihrer »Geistkrieger«-Dilogie ein erfrischend anderes Fantasy-Setting geschaffen, das mit seiner alternativen Geschichte Amerikas und dem actionreichen Thriller-Plot einfach süchtig macht. Teil 2 erscheint unter dem Titel »Geistkrieger: Libellenfeuer«. Die Neuausgabe des 2018 erstmals erschienenen Fantasy-Thrillers enthält eine exklusive Kurzgeschichte von Markus Heitz. Entdecken Sie als Einstieg in das Geistkrieger-Universum auch die exklusive und kostenlose Kurzgeschichte »Geistkrieger: Neue Wege«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sonja Rüther
Geistkrieger
FEUERTAUFERoman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was wäre, wenn … Amerika nie entdeckt worden wäre?
In einer alternativen Realität, in der die Europäer Amerika nie erobert haben, hat sich die Nation der Powtankaner zur Weltmacht entwickelt – auch mithilfe der Welt der Geister. Als dem angesehenen Professor Atius Catori von einer unsichtbaren Macht der Brustkorb regelrecht zerfetzt wird, übernehmen die Geistkrieger die Ermittlungen. Ihr neuestes Mitglied, der Schotte Finnley, fühlt sich noch immer fremd in seiner neuen Heimat. Doch dass Finnley keiner von ihnen ist, könnte der größte Vorteil der Geistkrieger werden – denn der Mord an Catori ist erst der Anfang von etwas, das sich keiner von ihnen auch nur hätte vorstellen können.
Mit einer exklusiven Kurzgeschichte von Markus Heitz
Aus dem Geistkrieger-Universum ist bisher erschienen:
Feuertaufe (Band 1)
Libellenfeuer (Band 2)
Neue Wege. Die Vorgeschichte zu Geistkrieger.
Inhaltsübersicht
Widmung
Glossar
Einführung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Novelle
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Danksagung
Quellennachweis
Für Tom Petty
Rest in peace among the wildflowers
Glossar
Até Uzuye: Ehrenvolle Anrede, großer Vater
Ina Uzuye: Ehrenvolle Anrede, große Mutter
Hah-ue: Hallo
Kanaston: Hauptstadt an der Ostküste, Sitz des obersten Ältestenrats
Powtanka: Der Name des Landes (USA)
Powtankanin: Einwohnerin Powtankas
Powtankane: Einwohner Powtankas
Seelenspiegel: Ein Talisman, um Schamanen vor der Astralwelt zu schützen
Tunkan wicasa: Steinmann
Wakan Tanka: Der große Geist
Waktana: Kinder mit besonderen Gaben
Wasicun: Mysteriöser Mensch, Ausdruck für Ausländer
Wicapi: Stern
Einführung
Invasoren? Nein danke!
Im Jahre 860 kamen die Wikinger nach Powtanka und verbrachten mehrere Jahre in dem Land, dessen Ureinwohner naturverbundene Stämme waren, die in ihrer Entwicklung weit hinter den Wikingern zurückstanden. Licht traf auf Schatten, als die Männer mit ihren blonden Haaren zwischen den schwarzhaarigen Stammesmitgliedern saßen.
Der wohl bedeutendste Moment in der Geschichte dieser langen Freundschaft war die Nacht des Ältestenrats, die seither am 28. November als Nationalfeiertag zelebriert wird. In jener Nacht erzählten die Wikinger von anderen Ländern und Völkern, die irgendwann Schiffe bauen und ebenfalls über die Meere kommen würden.
Diese Warnung setzte ein Umdenken in Gang, und die benachbarten Stämme begruben das Kriegsbeil und dachten gemeinsam an die Zukunft. Friedensläufer wurden ausgesandt, um weiter ins Landesinnere vorzudringen. Jeder Läufer trug eine Wikingeraxt als Beweis für die Existenz der Fremden bei sich. Der Plan ging auf, und zwischen den Stämmen kehrte Frieden ein. Sie taten sich zusammen, um sich auf die drohenden Invasionen vorzubereiten. Viele Jahrhunderte lang.
Die Zeitzeugen der Begegnung mit den Wikingern waren lange tot, auch die Kinder und Kindeskinder. Einzig die blonden Haare in manchen der neuen Clans und einige weiterentwickelte Gerätschaften erinnerten noch an die Initialzündung, die dem powtankanischen Volk den technischen und taktischen Vorsprung geliefert hatte.
Als dann Christoph Kolumbus im Jahre 1492 dachte, er habe Indien entdeckt, wurden er und seine Männer verjagt, bevor sie auch nur einen Fuß auf das Land setzen konnten. Seine Erzählungen über die Schlagkraft der Indianer verbreitete sich von Italien nach Spanien, Großbritannien und Deutschland, und von dort in alle anderen westlichen Länder.
Auch wenn später Indien in Powtanka korrigiert wurde, hält sich der Ausdruck Indianer in Europa bis heute hartnäckig. Ebenso wie der Ehrgeiz des powtankanischen Volks, immer einen Schritt voraus zu sein. Technologisch wesentlich fortschrittlicher und in Symbiose mit der Natur, passt das powtankanische Volk stets auf seine Landesgrenzen auf und kann das tief verwurzelte Misstrauen gegenüber Fremden nur schwer ablegen.
Jedoch erreichte die Globalisierung auch dieses Land, und ein neuerliches Umdenken musste stattfinden. Neue Friedensläufer wurden ausgesandt, um Friedens- und Handelsabkommen mit den anderen Ländern zu schließen.
Und so ist das heutige Powtanka ein geöffnetes, aber kein offenes Land, in dem zwar jeder Schritt von Fremden bemerkt wird, aber auch eine stetige Annäherung stattfindet.
Kanaston ist die wichtigste Hauptstadt an der Ostküste. Dort befindet sich der Hauptsitz des obersten Ältestenrats, der über die Geschicke des Landes entscheidet. Und dort lebt seit Kurzem auch der Schotte Finnley Whittle.
Kapitel 1
Indianer sagt man hier nicht. Das sagen nur die ungebildeten Europäer mit ihren Geschichtsbüchern voller Lügen.«
»Du wirst die Bräuche lernen müssen, wenn du akzeptiert werden willst.«
»Musstest du wirklich all diesen Schrott mitnehmen?«
»Hör auf, die Spinnen zu erschlagen!«
Finnley lag im Bett und starrte an die Decke – an die runde Decke in dem runden Raum, weil Ecken und Kanten in powtankanischen Häusern bestmöglich vermieden wurden. Dennoch fiel ihm die runde Decke genauso auf den Kopf, wie es eine rechtwinklige getan hätte.
»Du bist schon wach?« Seine Verlobte gab ihm einen Kuss auf die Schulter und legte ihm eine Hand auf die Brust.
Sie drehte sich auf den Bauch, aktivierte mit einer Hand die Lichtader über dem Bett, die daraufhin in einem warmen Orange leuchtete, und sah ihn an. Taima störte sich nicht an den Tätowierungen in seinem Gesicht oder auf seinem Körper, die ihn aussehen ließen wie eine wandelnde Maschine. Ihr Blick wurde immer nur dann kritisch, wenn sie darüber nachdachte, wie andere ihn deswegen bewerteten – so wie jetzt.
»Wir müssen darüber reden, was passiert, wenn ich keinen Job finde.«
Sie verzog das Gesicht und drehte sich zurück auf den Rücken. »Waren wir uns nicht einig, dass wir frühestens in einem Monat anfangen, uns darüber Sorgen zu machen?«
»Da dachte ich ja auch noch, es würde leicht werden, irgendeine Anstellung zu bekommen. Aber ihr Indianer macht aus jeder Kleinigkeit eine große Sache. Nicht mal als Lagerist oder Türsteher bin ich gut genug.«
Dass sie sich hinsetzte und den Rücken durchdrückte, war Aussage genug.
»Entschuldige, ich meine natürlich Powtankaner«, korrigierte sich Finnley.
»Wie willst du einen Job finden, wenn du dir nicht mal die einfachsten Dinge merken kannst?«
»Ich verstehe nicht, warum ihr euch so darüber aufregt, wenn ich es falsch sage.« Ihm war einfach schleierhaft, was daran beleidigend sein sollte.
»Dann kann ich dich jetzt ja den Peruaner nennen.«
»Wie kommst du denn darauf?«
Taima wölbte eine Augenbraue und sah ihn von oben herab an. »Na, wenn ich damals gedacht hätte, ich fliege nach Peru, und wäre aus Versehen in Schottland gelandet, gäbe es mir nach europäischer Sicht wohl die Berechtigung, Schotten fortan Peruaner zu nennen.«
Für ihn war das was anderes. »Aber der Irrtum, von dem du sprichst, ist uralt. Kolumbus konnte nicht auf die nächste Infotafel gucken und seinen Fehler bemerken. Und nun hält sich der Ausdruck eben. Wenn du neunundzwanzig Jahre in Schottland gelebt hättest, könntest du das auch nicht so schnell aus dem Kopf kriegen. Die Schotten sagen nun mal Indianer.«
»Doch«, antwortete sie wütend. »Wenn ich an deiner Stelle wäre und wüsste, dass ich nach sechs Monaten wieder ausgewiesen werde, wenn ich weder einen Job habe noch mit einer Powtankanin verheiratet bin, würde ich eine Menge hinderliche Sachen aus meinem Kopf verbannen und die Lücken mit dem Wissen füllen, das ich hier brauche. Sprache besitzt Macht. Jedes Mal, wenn du ein ganzes Volk falsch benennst, verhältst du dich respektlos.«
Finnley setzte sich ebenfalls auf und rieb sich mit beiden Händen über die kurzen, stoppeligen Haare. »Ich bin aber nun mal nicht du, Taima. Mir fällt das alles nicht leicht. Meine Stärken liegen in anderen Bereichen, und das weißt du auch.«
Er fühlte ihre Hand auf seiner Schulter, dann einen Kuss auf seinem Nacken. »Du hast recht. Tut mir leid. Auch wenn wir wussten, dass meine Eltern es uns nicht leicht machen würden, wird der Druck immer schlimmer. Vielleicht hätten wir doch in Schottland bleiben sollen?«
»Um jeden Tag zu sehen, wie unwohl du dich dort fühlst? Taima, ich bereue keine Sekunde, mit dir hierhergezogen zu sein, und an meiner Begriffsstutzigkeit wird es nicht scheitern, versprochen. Nur lass mich endlich das tun, was ich am besten kann.« Er sah sie über die Schulter an. »Nur so lange, bis ich etwas anderes finde oder wir verheiratet sind. Du weißt, dass es funktionieren wird.«
Aber Taima schüttelte den Kopf. »Ich will nicht, dass du wieder als Personenschützer arbeitest. Du wärst ständig unterwegs, und ich müsste mir die ganze Zeit Sorgen machen. Diese Sache in Schottland geht mir nicht aus dem Sinn.« Dabei strich sie über die Narbe, die an seinem Rücken mitten durch die tätowierten Platinen und Kabel verlief.
»Mein Kunde und ich haben überlebt, weil ich der Beste in diesem Job bin.«
Mit einem ablehnenden Laut verließ sie das Bett und ging Richtung Bad. »Dein Kunde hatte danach Angst vor dir. Egal, wie dankbar er für seine Rettung war, ich werde nie vergessen, wie er dich angesehen hat.«
Finnley auch nicht. Nur dass er sich an den Grund dafür nicht erinnern konnte. Taima wusste nichts von seinen Blackouts, und das wollte er auch nicht ändern. Sie machte sich schon genug Sorgen. Ihr zu sagen, dass er immer wieder unter Panikattacken und Blackouts litt, würde nichts besser machen. Zudem war er seit einem halben Jahr anfallsfrei – vielleicht hatte er diese Störungen ja überstanden?
»Hat die Polizei nicht eine Art Ausländerquote, die bei Einstellungen berücksichtigt werden muss?« Er folgte seiner Verlobten ins Bad. »Ich könnte mich für den Streifendienst bewerben.«
Diese Idee schien ihr schon besser zu gefallen. »Oder den Innendienst. Mein Vater könnte ein gutes Wort für dich einlegen.«
Den Vorschlag abzulehnen, ergab keinen Sinn. Für Taima würde er sogar in den Innendienst gehen, immerhin hatte er für sie auch seine Heimat verlassen. Er stellte sich neben sie. Im Spiegel betrachtete er während des Zähneputzens das Bild, das sie zusammen ergaben. Die Schöne und die Maschine.
Womit auch immer er sich ihre Liebe verdient hatte, sie änderte sein Leben zum Guten – egal, wie umständlich dieser Weg auch verlief.
Das Licht des summenden Projektors flackerte in der rauchgeschwängerten Luft über den Köpfen der Studierenden. Im kreisrunden Hörsaal war außer der Stimme von Professor Atius Catori kaum etwas zu hören. Der Rauch kräuselte sich aus kleinen Kupferschalen zwischen den jungen Männern und Frauen, die im Schneidersitz auf Teppichen auf den kleinen Plateaus der ansteigenden Felswand saßen.
Die Hörsäle der Potomac-Universität profitierten von dem natürlichen Landschaftsbild nahe dem gleichnamigen Fluss, das keine gravierenden Eingriffe für die Errichtung der Lehrstätten notwendig gemacht hatte. In den Fels geschliffene Flächen boten links und rechts neben einer Treppe Platz für zweihundert Studierende.
An diesem Tag waren nur neunundfünfzig junge Frauen und Männer anwesend und lauschten schweigend den Ausführungen über die Historie Powtankas. In diesem Semester befanden sich unter den Studierenden nur sieben Wasicun – Nicht-Powtankaner.
Ganz oben am Aufgang stand ein altmodischer Projektor, der die passenden Bilder zu Catoris Ausführungen an die gegenüberliegende Wand warf. Gerade liefen die nachgestellten Bilder der Wikinger, die als erste Besucher in Powtanka an Land gegangen waren. Wie ein Riss verlief ein kleiner Schatten durchs Bild, weil das Licht des Projektors gegen eine Baumwurzel strahlte, die aus der Decke ragte. Catori unterrichtete am liebsten in diesem Hörsaal, in dem die modernere Technik kaum Einzug gehalten hatte. Keine beschichteten Felsflächen, die die Bilder direkt wiedergeben konnten, nur Lichtadern in traditionellen Runen und Formen an den Wänden und der Projektor, den man über eine kleine Fernbedienung steuern konnte. Mehr brauchte er nicht, um zu unterrichten.
Die erste Vorlesung des Semesters war immer die interessanteste. Er betrachtete die jungen Gesichter, die ihm erwartungsvoll entgegensahen. Manche hatten offenbar schon von seinem Ruf gehört, der strengste Dozent an dieser Uni zu sein. Vereinzelt erblickte er kleine Aufzeichnungsgeräte, die selbst seine Personenvorstellung mitgeschnitten hatten.
»Dies ist der denkwürdigste Moment in der Geschichte unseres Landes«, sagte er mit dunkler Stimme, die bis in den letzten Winkel klar und deutlich zu hören war. Die Mauern schluckten den störenden Hall dank einer dünnen Schicht aus gekalktem Lehm.
»Die Landung der Wikinger im Jahre 860 im Stammesgebiet der Pi’tow’ke. Wer weiß, was sie uns gebracht haben?« Er stellte nur während der ersten Vorlesung Fragen, um die Studierenden besser einzuschätzen. Seine Aufgabe war es, Wissen zu vermitteln, und nicht, sich mit dem Gestammel ungebildeter Kinder aufzuhalten.
Ein paar Hände reckten sich in die Höhe. Sogar ein Wasicun glaubte, die Antwort zu kennen. Catori atmete tief ein, sodass sich der schwarze Anzug über seiner breiten Brust spannte. Blaue Runen, die am Revers aufgestickt waren, zeichneten ihn als hochrangigen Dozenten und Mitglied des Universitätsrats aus. Darunter trug er ein dünnes Lederhemd. Sie sollten ruhig einen Moment ihre Arme in der Luft behalten. Gemächlich trat er hinter dem Pult hervor und ging auf die Treppe zu.
»Eigentlich müssten alle Hände oben sein.« Seine Stimme klang tadelnd, was weitere Studierende zu einer Meldung zwang. Mit einem zufriedenen Grinsen stieg er bis zum ersten Plateau hoch. »Sie da«, er deutete auf eine Powtankanin, die nach den Silberringen im Haar einem bedeutenden Clan angehören musste. Die Prägung konnte er von seiner Position aus nicht erkennen, aber mit der Zeit würde er alles Wissenswerte über die neuen Studierenden erfahren.
»Die Wikinger brachten uns den technischen Fortschritt und die Kunde, dass Krieger eines Tages übers Meer kommen würden, um uns unser Land zu entreißen«, antwortete sie selbstsicher.
Catori nickte und richtete die kleine Fernbedienung auf den Projektor. Mit einem Knopfdruck wechselten die Bilder und zeigten nun Fotos von alten Werkzeugen und den ersten befestigten Bauwerken.
»Das ist korrekt.« Langsam ging er weiter und sah sich um. Erfahrungsgemäß waren es die Wasicun, denen der Sinn für die Relevanz dieses Wissens fehlte. Sie waren auch die einzigen Studierenden, für die Geschichte ein Pflichtfach war, alle anderen belegten es freiwillig. »Ohne den Fortschritt, den sie unserem Volk brachten, wären wir 1492 unmöglich gegen Kolumbus und seine Armee gerüstet gewesen. Es ist erwiesen, dass grundlegende Entwicklungen ohne den Einfluss der Wikinger zu jenem Zeitpunkt niemals stattgefunden hätten. Aber das allein reichte nicht. Erst der Mut zum Frieden zwischen den Stämmen hat uns unsere Freiheit gesichert.«
Er strich sich die langen, von Grau durchzogenen Haare über die Schultern zurück, wobei die Perlenschnüre einer Adlerfeder hörbar aneinanderrieben. Trotz seines hohen Alters wirkte der Powtankane stark und Respekt gebietend, was er gern zu seinem Vorteil nutzte. Respektvolle Studierende waren aufmerksame Zuhörer – mit seiner Strenge tat er ihnen einen Gefallen.
»Man muss nur mal nach Europa blicken, um zu begreifen, welches Schicksal uns dadurch erspart geblieben ist.« Wieder ließ er die Bilder wechseln.
»Die Invasoren hätten sich dieses Land zu eigen gemacht, Wälder gerodet, Tiere ohne Bedarf geschlachtet und ihre nutzlosen Bauten rücksichtslos dicht an dicht zu Städten gedrängt.«
Fotos von europäischen Großstädten flimmerten über die Felswand. Die eng bebauten Stadtbilder ließen jegliche Natur vermissen. Dann folgten Fabriken, Abwasserrohre und tiefe Krater in der Erde. Ein missbilligendes Raunen ging durch den Saal. Die wenigen Wasicun zogen merklich die Köpfe ein, als würden sie im nächsten Moment zur Rede gestellt, warum ihre Völker so rücksichtslos mit ihren Lebensräumen umgingen.
»Die Industrienationen betreiben Raubbau, holen gedankenlos Kohle, Öl und Erz aus den Erdschichten und Gebirgen, reichern Uran für Atomenergie an und ersticken in dem radioaktiven Müll, den sie dadurch produzieren.« Er schweifte mal wieder ab. Jedes Mal nahm er sich vor, bei den Wurzeln der Landesgeschichte zu bleiben, aber der Ausblick, was aus dem Land geworden wäre, wenn die Wikinger nicht gekommen wären, sorgte immer wieder für diesen kleinen Ausflug in die fahrlässigen Lebensweisen der anderen Länder.
»Aber die Indianer haben die Atomenergie viel früher entdeckt«, erklang eine männliche Stimme von weiter oben.
Catori sah auf. Der Projektor blendete ihn ein wenig. Er erkannte einen Schwarzen, der sich mit seiner Körpersprache deutlich zu der eben getroffenen Aussage bekannte. Fast schon trotzig reckte er das Kinn.
»Das ist richtig«, sagte der Professor und stieg noch ein paar Stufen höher, um den jungen Mann besser erkennen zu können. »Und wissen Sie auch, warum die Indianer diese Energie im Gegensatz zu Ihrem Volk nicht mehr nutzen?«
Der Akzent sprach deutlich für eine französische Abstammung, Catori lief also keine Gefahr, versehentlich einen in Powtanka geborenen Schwarzen mit den anderen Wasicun in einen Topf zu werfen. Und dass der Kerl auch noch Indianer sagte, war grauenhaft ausländisch genug.
Der junge Mann zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, wegen des Mülls?«
Ein paar kicherten leise. Verlegen rieb er sich über den Arm. Catori wusste schon jetzt, dass dieser Student keine leichte Zeit an der Uni haben würde. Er sprach schneller, als er zu denken in der Lage war.
»Wegen des Mülls?«, fragte er in die Runde. »Ist das so?«
Diesmal hoben sich sofort fast alle Hände. Er deutete auf den Powtankanen, der neben dem Wasicun saß. »Bitte laut und deutlich, alle wollen etwas davon haben.«
Der Kleidung nach eher ein flippiger Kerl, der sich wahrscheinlich auf die wilde Unizeit freute. Das dunkle Lederhemd stand weit offen, und Catori erkannte einen der Basalttalismane, die ältere Studenten gern mit dem Versprechen verkauften, er würde den Träger für Frauen interessanter machen. Bis zum Ende des ersten Semesters wäre sicher auch das Schwitzhüttendesaster ein fester Bestandteil seiner Erinnerungen, mit dem traditionell ein ausgewählter Frischling vorgeführt wurde. Er war der perfekte Kandidat dafür.
Überheblich machte sich der junge Mann etwas größer, um den Wasicun zu überragen. »Wegen Wakan Tanka.« Er grinste und fügte an seinen Sitznachbarn gerichtet hinzu: »Das ist das powtankanische Wort für den Großen Geist.«
Catori sah, wie der Wasicun die Zähne zusammenbiss. Wieder kicherten die Mitstudierenden, diesmal etwas lauter. Nicht-Einheimische lernten die Landessprache in der Regel sehr schnell. Sie war eine Mischung der unterschiedlichen Stammessprachen und Einflüsse der Eingewanderten, jedoch benutzten die wahren Eingeborenen je nach Region gern Wörter der alten Sprachen. Wer in dieser Region bestehen wollte, setzte sich besser mit den Gebräuchen und Sprachen der Lakota, Mohawk und Seminolen auseinander. Catori selbst verstand die Vorliebe für neue Wörter aus anderen Sprachen nicht. Das Wort »Universität« kam zum Beispiel aus dem Griechischen. Die Umbenennung sollte Weltoffenheit symbolisieren. Für ihn jedoch blieb dieser Ort Navajo Ólta, egal, wie andere ihn nannten.
»Ruhe jetzt«, herrschte er mit noch tieferer Stimme. Niemand sollte denken, dass seine Vorlesungen für kindische Diskriminierungen genutzt werden konnten.
»Fahren Sie fort.«
Der Powtankane wechselte wieder die Position und zeigte sich nicht mehr ganz so selbstsicher. »Der Große Geist sah den Fortschritt mit Skepsis und hat unseren Ahnen gezeigt, dass die Macht des Lebens größer ist als jede Technik. Es wurden Kinder mit besonderen Gaben geboren.«
Catori nickte zufrieden. »Ganz genau.« Er drehte sich wieder um, damit er von den weiter unten Sitzenden gesehen werden konnte. »Wenn die Industrieländer Mutter Natur nicht dermaßen zerstört hätten, wären ihnen ebensolche Kinder geboren worden, aber dafür fehlte ihr die Kraft. Wir konnten trotz des Fortschritts die Balance halten, aber durch die Atomenergie ist alles dramatisch in Gefahr geraten.« Langsam ging er ein paar Stufen hinab. »Die gesegneten Kinder besaßen Mächte, die uns das drohende Ungleichgewicht verdeutlichen sollten. Vielerorts entstand Chaos, weil Säuglinge Feuerhände bekamen, Jugendliche anderen ihren Willen aufzwingen konnten oder später Erwachsene mit diesen Gaben Einfluss auf die Wirtschaft oder Gesellschaft genommen haben.«
Eine blonde Studentin schrieb eifrig mit. Wahrscheinlich eine Mandan-Powtankanin. Er würde sie bevorzugt behandeln, wenn sie halbwegs schlau war, weil er die nordisch geprägten Völker sehr respektierte. Es freute ihn, eine von ihnen in seiner Vorlesung zu haben. »Wie heißen Sie?«, fragte er sie und blieb kurz stehen.
»Noya, Professor.«
Er nickte zufrieden. »Können Sie meinen Gedanken weiterführen, Noya?«
Selbstbewusst stand sie auf, damit alle sie sehen konnten. »Die Schamanen haben verstanden, was Wakan Tanka uns damit sagen wollte, und das große Umdenken fing an. Fotosynthese-Energie, Polymer- und Biopolymerwissenschaften, Solarenergie – das sind nur einige Beispiele dafür, womit wir das Gleichgewicht wiederhergestellt und die Technik der Natur untergeordnet haben. Und die verhängnisvollen Gaben sind aus den Kinderzimmern verschwunden.«
Mit einer Hand berührte er das Gestein eines Plateaus und strich leicht darüber. Überall an den Wänden glommen Lichtadern auf und leuchteten beständig. Die gewundenen, hellen Formen zeigten Runen und Schutzsymbole, die den Lichtquellen ein besonderes Aussehen verliehen. Dadurch entstand gerade genug Helligkeit, um die Gesichter der weiter hinten sitzenden Studierenden besser erkennen zu können, ohne dass die Bilder auf der Leinwand nicht mehr zu sehen waren.
»Sehr gut. Sie können sich wieder setzen.«
Er suchte nach den Wasicun, die in der Regel mit ihrem fremdländischen Aussehen sofort auffielen. Als sein Blick auf eine Chinesin traf, drückte er wieder auf die Fernbedienung, und das nächste Bild erschien. »Wir mussten uns einige Male gegen Besatzungsversuche durch kriegstreibende Länder zur Wehr setzen, und es war immer unser technologischer Vorsprung, der uns siegreich sein ließ. Das Blatt der Geschichte wendete sich, als die Ältestenräte beschlossen, Botschafter auszusenden, die Handelsabkommen mit den potenziellen Feinden aufbauen sollten. Ähnlich wie die Friedensläufer, die damals für eine Einigung zwischen den Stämmen gesorgt haben, sollten die Botschafter für Frieden zwischen den Ländern sorgen.« Er deutete auf die Aufnahme von Körben voller Gewürze und Stoffe. »Unsere Ahnen sind das Wagnis eingegangen, die Tore zu unserem Land für Fremde zu öffnen. Mit China wurden die ersten Handelsverträge und Friedensabkommen geschlossen.«
Noya wollte eine Hand heben, aber Catori winkte ab. Dies war nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Detail zu gehen. »Im Laufe dieses Semesters werden wir jedes geschichtliche Ereignis genau unter die Lupe nehmen, und zu diesem kommen wir noch ganz ausführlich.«
Er vollführte eine schwungvolle Geste, die seine Studierenden in den Fokus nahm. »An dieser Stelle möchte ich Ihnen nur sagen, dass dieses Vorhaben gelungen ist und jene Entscheidung uns mit kulturellem Reichtum beschenkt hat.« Er drückte auf den Knopf, damit das Foto mit den Orangenbäumen erschien. »Neue Pflanzen, Gewürze und andere Waren kamen zusammen mit den Fremden zu uns. Und wie wir tagtäglich feststellen, auch ihre unterschiedlichen Sprachen. Selbst heute noch werden Begriffe gegen ausländische Wörter ausgetauscht, weil sie sich sprachgebräuchlich durchgesetzt haben. Auch das ist Fortschritt.«
Keiner, den er schätzte, aber seine persönliche Meinung hatte hier nichts zu suchen.
Er ging wieder zum Pult zurück, der Teppich dämpfte seine Schritte, und nahm eine Friedenspfeife aus einem kleinen Fach.
Er hielt sie kurz hoch, damit alle sie sehen konnten. Es war eine kleine Variante mit kunstvollen Schnitzereien im hellen Holz und kleinen Adlerfedern, die knapp vor dem Pfeifenkopf an dünnen roten Lederbändern hingen. »Sie alle wissen, was das symbolisiert.« Vorsichtig legte er sie auf das Pult und trat ein paar Schritte vor. »Ich möchte, dass jeder von Ihnen –« Ein stechender Schmerz in der rechten Hand ließ ihn jäh verstummen. Die Fernbedienung entglitt ihm und traf neben der Teppichkante auf den nackten Fels. Ein Splitter sprang aus dem Gehäuse und rutschte bis zum ersten Plateau. Catori sah einen kleinen Blutstropfen aus einem winzigen Loch in seiner Hand dringen, dann noch einen dicht daneben aus einer weiteren Wunde.
»Was …?«
Die Blicke waren auf ihn gerichtet, die Studierenden warteten darauf, dass er weitersprach. Der Professor sah sich um. Kein Tier, kein Insekt war zu sehen – nichts, was diese kleinen Stiche hätte verursachen können.
Die Stellen begannen zu brennen. Schweiß rann ihm aus den Poren, ihm wurde kalt, dann wieder heiß, als füllten sich seine Adern mit scheuerndem Sand, der bis in seinen Kopf gedrückt wurde.
»Professor?«
Die ersten Studierenden erhoben sich unschlüssig.
»Ich möchte, dass Sie …«, wollte er wieder ansetzen, als sich brutal ein Riss quer durch sein Gesicht grub. Blut spritzte aus einer klaffenden Wunde, und Catori wurde mit Wucht gegen das Pult geschleudert. Instinktiv fasste er sich ins Gesicht, die Schmerzen waren unerträglich, sein linkes Auge platzte auf, und er brüllte entsetzt, als der gallertartige Glaskörper durch seine Finger rann.
Er hörte die Studierenden panisch durcheinanderschreien.
Dann riss ihm ein weiterer Hieb Knochen und Fleischstücke samt Teilen seines Anzugs vom Brustkorb. Er versuchte zu schreien, aber das Blut erstickte seine Stimme und floss unaufhaltsam in die verletzte Lunge. Das verbliebene Auge aufreißend, versuchte er, seinen Angreifer zu erkennen. Er konnte kaum die Fäuste heben.
Würgend und hustend rang er verzweifelt um Atem, stolperte rückwärts gegen das Pult, der nächste Hieb warf ihn zu Boden. Da war niemand, gegen den er sich wehren konnte.
Aus weiter Entfernung hörte er die jungen Leute schreiend weglaufen.
Die Bewegungen des Professors erstarben, als ein mörderischer Druck auf seinem Brustkorb entstand. Weitere Rippen brachen unter der Last, dann schlug etwas in seinen Torso ein und riss ihm das Leben aus dem Leib. Übrig blieb ein großes Loch, wo zuvor das Zentrum seiner Stärke gesessen hatte: sein Herz.
Kapitel 2
Die Idee, Finnley durch seinen Einfluss eine Stelle bei der Polizei zu verschaffen, hatte Taimas Vater schon besser gefallen als alle anderen Bemühungen, für den Schotten eine Anstellung zu bekommen. Finnley wusste, dass er bei Erfolg nicht nur in Tatoke Inyankes Schuld stehen würde, er wäre auch ein weiteres Zahnrädchen in der Maschinerie des nach Macht strebenden Clans. Aber in diesen sauren Apfel musste er beißen. Taimas Vater war ein mächtiger Mann, der seine Augen und Ohren überall in der Stadt, wenn nicht sogar in ganz Powtanka hatte. Es würde Finnley nicht wundern, wenn er irgendwann vom Streifendienst in eine Position versetzt werden würde, die Tatoke noch mehr nützen würde.
Am Morgen hatte Taima unaufhörlich geredet, während sie an seiner Kleidung herumgezupft und noch nervöser gewirkt hatte als er. Sein Kopf war voll mit ihrem tu dies und lass das. So unsicher hatte er sich seit seiner Schulzeit nicht mehr gefühlt. Nun stand er bereits zehn Minuten vor dem Gebäude, ließ immer wieder die Schultern kreisen und versuchte, innerlich ruhiger zu werden.
Wird schon schiefgehen.
Zwei Minuten vor dem vereinbarten Termin betrat er das Polizeipräsidium und kam sich unter den Blicken der Anwesenden wie ein Verbrecher vor. Der dunkelblaue Anzug mit dem hellblauen Hemd war das seriöseste Outfit, das er besaß, aber nichts konnte von den Tätowierungen ablenken, die sein Gesicht aussehen ließen wie das Innenleben eines Computers. Er hätte gedacht, dass gerade in diesem Land niemand Anstoß daran nehmen würde, weil Tätowierungen und die Verschmelzung von Technik und Natur hier große Rollen spielten. Taima hatte dazu nur gesagt: »Sieh dich doch mal um. Wir lassen Technik natürlich aussehen, nicht andersherum.«
Seine Bewerbungsunterlagen bekamen leichte Knicke, weil er die dünne Mappe immer wieder zwischen den Fingern knautschte.
Bis auf die durchscheinenden Außenwände und die Lichtadern an den innen liegenden Mauern sah das große, runde Gebäude fast aus wie ein Revier in seiner alten Heimat. Hinter dem Tresen standen Tische und Stühle, an denen sich Diensthabende mit Leuten unterhielten, und am Tresen wartete eine Polizistin, die ihm freundlich entgegenlächelte. Nicht-Einheimische waren hier sicher keine Seltenheit, aber er hoffte, dass sie dieses Gebäude nicht nur in Handschellen betraten.
Mit unsicheren Schritten ging er zu ihr und vollführte zur Begrüßung die traditionelle Geste mit einer Hand vom Herzen in Richtung der Frau. Die entsprechenden Worte vergaß er dabei komplett.
»Ja, hi«, sagte er typisch schottisch, legte die Mappe auf den Tresen und strich die Ecken glatt. »Mein Name ist Finnley Whittle, ich bin hier zum Bewerbungsgespräch.«
Sie nahm die Mappe entgegen und gab ihm mit einem Wink zu verstehen, dass er warten solle.
So weit, so gut. Er beobachtete, wie sie mit den Unterlagen zu zwei Männern hinüberging, die weiter hinten mit Kaffeebechern in den Händen zusammenstanden und redeten.
Die Mappe wurde ihr abgenommen, alle drei Gesichter wandten sich ihm zu, dann sagte einer etwas, die Frau nickte kurz und kam zurück.
Das wird nie was.
Selbst in einer Uniform würde er noch wie ein Fehler im Bild aussehen.
»Kommen Sie«, sagte sie auf halbem Weg und deutete auf einen Stuhl neben einem der Tische.
Finnley umrundete den Tresen und ging nervös auf sie zu. Alle sahen kurz von ihrer Arbeit auf. Niemand musste etwas sagen, die Blicke brachten bestens zum Ausdruck, dass jeder ihn für einen Verbrecher hielt. Und mit diesen Menschen sollte er zukünftig zusammenarbeiten.
»Setzen Sie sich bitte.«
»Danke.« Er war froh, nicht länger so prominent im Raum stehen zu müssen.
»Möchten Sie einen Kaffee?«
Mit einem Kopfschütteln lehnte er ab. Bei seinem Glück würde er sich den Kaffee noch übers Hemd kippen.
Sie schenkte ihm ein letztes, geschäftiges Lächeln und ging dann zurück zum Tresen. Um niemanden direkt ansehen zu müssen, betrachtete er die Sachen auf dem Schreibtisch.
Die Technik war anders als in Schottland. Gern hätte er sich die Computer genauer angesehen, aber jede seiner Bewegungen wurde beobachtet, dessen war er sich sicher. Wo er saß, war der Platz für Verbrecher oder Augenzeugen, und in diesem Moment fühlte er sich wie eine Mischung aus beidem.
Sag bloß nicht Indianer!
Er zog das Pad aus der Jackentasche und legte es sich so unauffällig wie möglich auf den linken Oberschenkel. Das Gerät übersetzte jedes Wort der alten Sprachen. Wenn er also etwas nicht verstand, musste er nur kurz den Blick senken. Hier an der Ostküste war die Landessprache traditioneller. An der Westküste hätte Finnley es wesentlich leichter gehabt, aber hier benutzten die Menschen gern Wörter der alten Sprachen, die schwerfällige Einwanderer wie er nur schleppend lernten. Taimas Eltern und der Familienrat verfielen meist gänzlich in Lakota, wenn Finnley anwesend war.
»Es sind Powtankaner«, sagte er nahezu lautlos. »Denk an die höfliche Anrede und die Gesten und sag nicht mehr als nötig.«
Nach Aktivierung des Displays sah er nach, ob der Akku noch ausreichend geladen war. Seit dieses Gerät sein überlebenswichtiger Begleiter war, wurde es fast schon zur Zwangshandlung, den Energiestand mehrmals die Stunde zu prüfen.
Danach fiel sein Blick auf einen Hund, der neben den Füßen eines Beamten schlief. Inzwischen gewöhnte er sich an die Tatsache, dass sich überall dort, wo Menschen waren, auch Tiere frei bewegten. Trotzdem musste er sich beherrschen, Nager, Spinnen und Schlangen nicht mit schweren Gegenständen zu erschlagen, wenn sie sich in seines und Taimas Haus verirrten. Seine anfängliche Eigeninitiative in vielen Bereichen war dem folgsamen Lernen gewichen, damit Taima nicht ständig aufschrie. Inzwischen wuchs auch das Grünzeug wieder an, das er vom Dach über dem Küchenfenster hatte entfernen wollen. Als Streifenpolizist hätte er die Gelegenheit, mehr über die Gebräuche zu lernen und gleichzeitig etwas zu tun, das ihm lag.
Aus dem Augenwinkel sah er einen der Männer von den Bewerbungsunterlagen zu ihm aufschauen. Er war blond, sah aber ansonsten aus wie ein Powtankaner. Die Art, wie sie die Unterlagen durchblätterten, gefiel Finnley nicht.
Schnell neigte er den Kopf und tippte mit dem Finger nervös auf das Gehäuse des Pads. Wahrscheinlich würde er sich nie daran gewöhnen, ständig angestarrt zu werden. In seiner Heimat waren auffällige Tätowierungen nicht selten. Die Hälfte seiner Freunde hatte welche und dazu noch Piercings oder ungewöhnliche Frisuren, die nichts mit Traditionen oder Kultur zu tun hatten. Er fand es gut, dass nicht alles eine allgemeingültige Bedeutung haben musste. Wichtig war, was man selbst damit verband.
Mit diesem Gedanken setzte er sich aufrechter hin und ließ die Schultern kreisen.
Der Blonde beobachtete ihn noch immer. Finnley wagte einen Blick in seine Richtung. Die schwarzen Federn in den langen Haaren schimmerten bläulich und passten zu der schwarzen Uniform, die er trug. Nur das braune Lederhemd störte das förmliche Bild.
Wohl eher nicht von der Streife, mutmaßte er. Allerdings konnte er auf Anhieb keine Stickerei erkennen, die mehr über den Stand des Mannes verraten hätte. Der andere Polizist dagegen war einer, wie sie auch in Schottland zu finden waren: nachtblaue Uniform mit deutlichen Kennzeichen, Waffengurt mit einer Pistole, einem Taser, Handschellen und einer Tasche für Kleinkram wie Handschuhe oder einen Notizblock.
Der Streifenpolizist nickte, dann gingen beide auf ihn zu.
»Na super«, raunte Finnley und stand mit dem Pad in der Hand auf. »Jetzt geht das Verhör los.«
»Finnley Whittle?«, fragte der in Blau und hob zur Begrüßung eine Hand, wobei Ring- und kleiner Finger angewinkelt waren.
Finnley nickte und erwiderte die Geste. Er war verunsichert, weil er eine andere Begrüßung gelernt hatte.
»Das ist mein Kollege Thure Ragnason, er möchte bei diesem Gespräch dabei sein. Haben Sie etwas dagegen?«
Ein unsicheres Grinsen ging der Zustimmung voraus, aber sein Einverständnis schien ohnehin nur eine Formalität zu sein, weil sich beide Männer bereits setzten.
»Dann wollen wir doch mal sehen«, sagte der Mann, der seinem Namensschild nach Richard Delsy hieß. Während er las, legte der andere die Fingerspitzen aneinander und musterte Finnley eindringlich. »Setzen Sie sich doch«, forderte er ihn freundlich auf.
Finnley biss sich auf die Unterlippe, um nichts Unbedachtes zu sagen, aber der Blonde brachte ihn aus dem Konzept.
»Gefällt es Ihnen hier in Powtanka?«, fragte Delsy, ohne aufzublicken, und blätterte eine Seite um.
Mit einer Hand kratzte sich Finnley am Hinterkopf. »Ja, ich lebe mich langsam ein.«
Die letzten Vorstellungsgespräche, die mit dieser Frage begonnen hatten, hatten keine zehn Minuten gedauert. Seinen Fähigkeiten nach müssten sie sehr an ihm interessiert sein, leider schien sein Aussehen mehr ins Gewicht zu fallen.
Ihm stand der Sinn nach Flucht nach vorn, aber auch diese Strategie hatte ihn bislang nicht weitergebracht, also wartete er geduldig und riss sich zusammen. So nervös, wie er war, lief er Gefahr, etwas Unbedachtes zu sagen, und dann könnte schon wieder alles vorbei sein.
»Sehen in Schottland alle Polizisten so aus?«, fragte der andere und betrachtete eingehend die Tätowierungen in Finnleys Gesicht. Dabei kniff er die Augen zusammen, als versuchte er, hinter die Bilder zu blicken.
»Nein. Aber ich dachte ehrlich gesagt auch, alle Indianer wären dunkelhaarig«, rutschte es ihm heraus.
Er bekam mit, wie alle in Hörweite einen Augenblick ihre Arbeit niederlegten, und spürte ihre Blicke auf sich. »Entschuldigung«, fügte er schnell hinzu. »Ich meinte Powtankaner.«
Delsy legte die Unterlagen auf den Tisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Ein sicheres Zeichen, dass sich Finnley bereits ins Abseits katapultiert hatte.
Aber der Blonde grinste nur und nahm die Mappe an sich. »Warum haben Sie die Polizeiakademie so früh verlassen?«
Auf diese Frage hatte er sich vorbereitet. »Meine Mutter ist damals krank geworden, und ich musste mehr Geld für ihre Medikamente verdienen. Als Personenschützer –«
Sein Gegenüber winkte ab. »Verstehe. Nun, Ihre Referenzen sind beeindruckend. Wie ich gehört habe, wurden Sie uns von Tatoke Inyanke empfohlen.«
Finnley war nicht ganz klar, was die richtige Erwiderung auf diese Aussage war. Schmälerte er die Gewichtung der Empfehlung, wenn er von der Verlobung erzählte?
»In Schottland habe ich seine Tochter beschützt«, erklärte er deshalb nur einen Teil der Hintergründe.
»Sie sind im Nahkampf und im Umgang mit Schusswaffen ausgebildet worden. Wie trainieren Sie Ihre Fähigkeiten hier in Powtanka?«
Sein letzter Besuch eines Schießstands lag fünf Monate zurück. »Ich gehe jeden Tag laufen und habe ein festes Fitnessprogramm. Geben Sie mir eine Waffe und eine Zielscheibe, und ich zeige Ihnen, wie gut ich im Training bin.«
Der Blonde grinste. »Wie stehen Sie zu den spirituellen Möglichkeiten in unserem Land?«
Finnley fühlte, wie Muskeln in seinem Gesicht zuckten und seine weniger schmeichelhaften Gedanken verrieten. »Um ehrlich zu sein, habe ich keinen wirklichen Zugang zu diesen Dingen.«
»Hätte mich auch gewundert«, mischte sich Delsy ein. »Warum sehen Sie wie eine Maschine aus?«
Finnley atmete einmal tief durch und ballte unauffällig die Hand zur Faust. »Aus keinem bestimmten Grund. Ich wollte es einfach so haben.«
»Ich glaube nicht, dass ich hier Verwendung für Sie habe. Die Menschen sollen uns um Hilfe bitten, nicht vor uns weglaufen.«
Unbehaglich setzte sich Finnley gerader hin. Er brauchte diesen Job mehr als alles andere, und er würde dafür jede Wertung, jeden Kommentar und jede Auflage auf sich nehmen. »Setzen Sie mich ein, wo Sie wollen. Ich bin belastbar, fleißig und diszipliniert. Wenn ich wegen meines Aussehens nicht für die Streife tauge, dann geben Sie mir eine andere Stelle. Bitte, ich will arbeiten, und alles, was ich brauche, ist eine Chance.«
Ragnason strich sich nachdenklich über das Kinn und hörte nicht auf, Finnley zu mustern, als sähe er irgendwas, das sein Kollege nicht bemerkte. »Wo haben Sie sich bislang beworben?«
»Unterschiedlich.« Er änderte erneut die Sitzposition, was sich nicht angenehmer anfühlte. »Hauptsächlich habe ich mich auf Stellen in Lagern oder auf Baustellen beworben. Ich kann gut zupacken, körperliche Arbeit macht mir nichts aus, aber wirklich gut bin ich im Personenschutz.« Ihm wäre auch der Hausmeisterposten recht gewesen.
»Erlaubst du?«, fragte Ragnason seinen Kollegen und nahm ein Pad vom Tisch, kaum mehr als eine dünne schwarze Scheibe. Sein Kollege nickte nur.
Mit schweißnassen Händen rieb sich Finnley über die Oberschenkel und sah dem Mann zu, wie er darauf herumtippte, wahrscheinlich, um Informationen über ihn zu sichten. Er wusste, was Ragnason finden würde. Eigentlich konnte er auch gleich aufstehen und gehen. In seiner schottischen Polizeiakte stand alles, was er in seinen Bewerbungsunterlagen ausgelassen hatte. Natürlich hatten die Powtankaner aufgrund des Einwanderungsabkommens mit Schottland Zugriff darauf. Deswegen wollte er auf dem Bau oder als Personenschützer arbeiten, um mit seiner Vergangenheit nicht mehr konfrontiert zu werden. Jetzt wusste Ragnason, dass er gelogen hatte. Dass nicht seine kranke Mutter der Grund für den Abbruch seiner Polizeiausbildung gewesen war, sondern der Rauswurf aus der Akademie. Zum Glück stand nicht dabei, dass er seine Eltern nie richtig kennengelernt hatte.
Schon hörte er den Sound eines Videos, das er selbst nur einmal angesehen und am liebsten von allen Internetservern gelöscht hätte. Auch wenn er nicht gut zu erkennen war, gab es eindeutige Einträge zu diesem Vorfall.
»Haben Sie dazu etwas zu sagen?« Ragnason drehte das Display kurz zu ihm und Delsy, aber Finnley schüttelte, ohne hinzusehen, den Kopf.
»Diese Demonstranten wollten uns umbringen, da ist bei mir irgendwie die Sicherung durchgebrannt.« Er wusste, dass es wie eine lahme Ausrede klang, aber genauso war es gewesen. Sein erster schwerwiegender Blackout.
»Passiert Ihnen das öfter?«
Es fiel Finnley schwer, seine Enttäuschung über den Verlauf des Gesprächs nicht offen zu zeigen. Auch wenn sie ihm keinen Job gaben, würden sie Taimas Vater danach Bericht erstatten. Der Alte kritisierte ihn schon genug, und mit diesem Video bekäme er einen Grund mehr, ihn abzulehnen. »Nein, ich habe eine Aggressionsbewältigungstherapie gemacht und habe mich jetzt vollkommen unter Kontrolle.« Letzteres war zwar gelogen, aber das würden sie nun auch nicht mehr rausfinden.
»Aggressionsbewältigungstherapie«, echote Ragnason mit abfälligem Unterton. Er schaltete das Pad aus und sagte auf Lakota etwas zu seinem Kollegen.
Unauffällig sah Finnley auf sein Pad, das die Worte übersetzte. »Wenn du nichts dagegen hast, nehme ich ihn vorerst in meine Einheit?«
Um seine Verwunderung nicht zu offen zu zeigen, legte Finnley eine Hand über seinen Mund und strich mit dem Zeigefinger über die Oberlippe.
Delsy zuckte mit einer Schulter und verzog missbilligend das Gesicht. »Du wirst schon wissen, was du tust.« Mehr sagte er nicht dazu.
Vielleicht brauchte Ragnason jemanden, der zuschlagen konnte. Was auch immer das für eine Einheit war, Finnley würde sich verdient machen und dafür sorgen, dass sein Vorgesetzter diese Entscheidung nicht bereute.
Delsy wandte sich seinem Computer zu und schaltete ihn über einen Daumenabdruckscanner ein. »Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Werden Sie diese fürchterlichen Tätowierungen los.«
Es fiel Finnley leicht, diese Aussage kommentarlos stehen zu lassen, weil es Wichtigeres gab. Ich habe einen Job!
»Nun dann«, sagte Thure Ragnason freundlich und stand auf. »Willkommen in meiner Einheit.« Er ging voran, die Sache war entschieden.
Mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Misstrauen folgte Finnley ihm. In seinem Anzug und dem blauen Hemd sah er zwar nicht gerade wie ein Polizist aus, aber innerlich wuchs die Freude mit jedem Schritt. Dieser Mann gab ihm tatsächlich einen Job. Ab jetzt konnte er beweisen, dass er zu etwas zu gebrauchen war. Seine Fähigkeiten würden schon für sich sprechen, mehr als sein Aussehen.
Sie umrundeten gerade den Empfangstresen, als ihnen eine zierliche Powtankanin entgegenkam. Genau wie Thure trug sie einen schwarzen Anzug, allerdings kein Lederhemd darunter, sondern ein schwarzes Shirt. Dadurch wirkte sie für eine Einheimische ungewöhnlich blass und zerbrechlich. Ihr Blick blieb sofort an ihm hängen. Die Augenbrauen zogen sich zusammen, die Nase brachte gerümpft zum Ausdruck, was sie dachte. Aber Finnleys Laune konnte das nicht trüben. Alle hier würden sich an ihn gewöhnen müssen.
Sie strich die langen schwarzen Haare zurück und reckte stolz das Kinn. »Hah-ue«, grüßte sie Thure und versuchte, mit einem Nicken Finnley etwas Höflichkeit entgegenzubringen.
»Es gab einen Vorfall in einem der Hörsäle der Universität«, sagte sie eindringlich und sah kurz zu Finnley. Mit diesem Blick wollte sie Thure offensichtlich signalisieren, er möge ihn wegschicken, damit sie offen reden könne.
»Chenoa Yakesha, das ist …« Er sah kurz auf die Unterlagen. »… Finnley Whittle. Er wird ab heute unser Team unterstützen. Du kannst offen reden.«
»Ist das dein Ernst?«, rutschte es ihr heraus.
Finnley musste grinsen. Er konnte nichts dagegen tun.
Als Thure nichts erwiderte, sammelte sie sich und erstattete kurz Bericht. »Ein Dozent wurde vor den Augen seiner Studierenden ermordet, aber niemand konnte erkennen, wie es passiert ist. Kein Angreifer, keine Schüsse. Die Kollegen haben uns angefordert, weil sie sich den Tathergang nicht erklären können.«
»Na, wenn das nicht der perfekte Sprung ins kalte Wasser ist.« Er klopfte Finnley einmal auf die Schulter und deutete dann auf den Ausgang. »Dein neues Team wird dich in alles einweisen. Dann zeig mal, was du kannst.«
Auch wenn Chenoa Yakesha nickte, entging Finnley nicht das Zucken ihrer Mundwinkel. Er hätte zu gern gewusst, was sie dazu sagen wollte. »Dann komm.« Sie drehte sich um und ging voraus.
»Sieh es als die Chance, die du haben wolltest«, sagte Thure und machte eine einladende Geste auf den Ausgang zu. »Wenn du dieses Team überzeugen kannst, musst du dir um die Probezeit keine Sorgen machen.«
Mit diesen Worten ging er Richtung Flur, und Finnley folgte der neuen Kollegin, der in diesem Moment wahrscheinlich Worte wie Kindermädchen und warum immer ich durch den Kopf gingen.
»Du wirst am Anfang nur zusehen«, sagte sie geschäftig, als er zu ihr aufschloss. »Du fasst nichts an und überlässt uns das Reden.«
Die Sonne schien blendend hell, als sie ins Freie hinaustraten. Auf dem Parkplatz sah er zwei Wasicun in den gleichen Uniformen vor einem schwarzen Blú Controverse stehen. Die Frau war Schwarz, der Mann weiß, und Finnley hätte mit seinen roten Haaren das andersartige Trio perfekt gemacht, wenn sie nicht so kurz gewesen wären.
Er mochte diese strombetriebenen, geländefähigen Fahrzeuge, allerdings würde er so einen Wagen lieber fahren, als den Autopiloten alles machen zu lassen. Aber in diesem Land steuerte kein Mensch mehr ein Fahrzeug.
Die Aussicht, mit anderen Nicht-Powtankanern zusammenzuarbeiten, gefiel ihm. Wobei er kaum mit Entgegenkommen rechnete. Wer ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft war, übernahm den Argwohn der Powtankaner. Ich nicht, sollte ich es je so weit schaffen!
Die Frau sah in ihrem schwarzen Anzug sehr autoritär aus. Sie trug ihre schwarzen Haare in einem strengen Zopf und verzichtete auf jeglichen Schmuck, was die Wirkung zusätzlich verstärkte. Als sie ihn in Begleitung der Kollegin erblickten, verschränkten beide wie abgesprochen die Arme vor der Brust, und Finnley fühlte sich förmlich abgescannt. Wenn Gedanken eine Anzeige hätten, würde dort jetzt in leuchtenden roten Lettern das Wort Fremdkörper blinken.
Die Vorstellung fiel eher nüchtern aus. »Deidra Onheira und Tate, das ist Finnley Whittle«, sagte Chenoa. »Er gehört jetzt zu unserem Team.«
»Man könnte meinen, Thure weiß die Arbeit von Nicht-Powtankanern inzwischen mehr zu schätzen«, sagte Deidra und vollführte eine Begrüßungsgeste mit der rechten Hand. »Was bist du? Ire?«
Tate zuckte die Achseln und reichte Finnley die Hand. »Ich würde sagen, Schotte, oder?«
Froh über dieses Entgegenkommen ergriff er die ausgestreckte Hand. »Das ist richtig. Ich bin vor zwei Monaten aus Paisley gekommen.«
»Das hört man«, kommentierte Deidra und öffnete die Wagentür. »Den Rest müssen wir auf der Fahrt besprechen.«
Chenoa sagte etwas auf Lakota, und Finnley sah auf sein Pad und grinste sie an. »Der Spinner sitzt gern ganz hinten.«
Ertappt biss sie sich auf die Lippen, und nacheinander stiegen sie in das Fahrzeug.
Deidra stieg als Letzte in den Blú Controverse, der im Innern einem mobilen Besprechungszimmer glich. »Potomac-Universität, Gebäude 4.1«, gab sie die Sprachanweisung. Das System bestätigte, und nach dem Schließen der Tür setzte sich das Fahrzeug in Bewegung.
»Irgendwie angenehm, dass hier niemand mehr selbst fährt«, sagte Finnley, um irgendetwas Unverfängliches zu äußern, und setzte sich ans hinterste Ende auf die gepolsterte Bank. »In Schottland steuern die Leute ihre Autos gern selbst.«
Chenoa rümpfte erneut die Nase. »Meines Wissens haben sie auch keine andere Wahl, oder?«
Gut, dann eben keinen Small Talk, dachte er und sah sich in der Kabine um.
In der schmalen, milchigen Tischplatte flimmerten genau vor den Ermittlern vier Projektionen auf, die erste Zeugenaussagen vom Tatort wiedergaben. Der Ton war ausgeschaltet.
»Hat Thure dir gesagt, was deine Aufgabe bei uns sein wird?«, fragte Deidra sachlich.
Immer wieder blieben die Blicke an seinen Tätowierungen hängen. Vor allem die junge Powtankanin drückte mit ihrer Mimik überdeutlich ihre Abneigung aus. Aber darüber konnte er hinweglächeln, weil er hier war – hier in diesem Fahrzeug, mit seinem neuen Team, das er für sich gewinnen würde, egal, was er dafür tun musste.
Er legte das Pad neben sich auf den Sitz und betrachtete die Aufnahmen, die sich unter dem Glas zeigten. »Technische Unterstützung oder Schutz«, sagte er unverbindlich, weil er selbst keine Ahnung hatte, was er hier sollte. Bislang wusste er nicht mal, was dies überhaupt für eine Einheit war, in die er ungefragt gesteckt worden war.
Deidra deutete mit dem Zeigefinger auf seine Tätowierungen. »Bist du so ein Technik-Freak?«
»Ich mag Technik, und die Technik mag mich.« Er berührte das Bild auf der Tischplatte, wodurch eine Statistik aktiviert wurde, die neben der Zeugin erschien. Unterhalb des Gesichts verliefen unterschiedliche Wellen, die Aufschluss über den Zustand der sprechenden Person gaben und ob sich eventuell Lügen in den Aussagen versteckten. Der Stresspegel war sehr hoch. Das Wort Schock stand blinkend neben der Statistik.
Was zur Hölle … »Allerdings werde ich mich mit eurer Technik erst mal vertraut machen müssen.«
Deidra war mit seiner Antwort anscheinend nicht zufrieden. »Hat Thure dir wenigstens gesagt, was wir hier tun?«
Zögerlich löste er den Blick von der Aufzeichnung. »Nicht so ganz. Er sagte, Sie würden das übernehmen.«
»Wir sind hier per Du«, mischte sich Tate ein. »Damit könnten wir ja anfangen.«
»Es läuft wie folgt«, sagte Deidra. »Die Kollegen sind als Erstes am Tatort, sperren alles ab und befragen die Zeugen. Wenn irgendetwas auf spirituellen Missbrauch hinweist, kommen wir ins Spiel – die Geistkrieger.«
»Geistkrieger?« Das Grinsen ließ sich nicht unterdrücken. Er wusste, dass diese spirituellen Dinge den Einheimischen heilig waren und sie großes Tamtam darum machten, aber dass es tatsächlich eine Sondereinheit gab, die sich Geistkrieger nannte, kam ihm lächerlich vor. Leider war ihm das auch deutlich anzusehen.
Durch ein kurzes Antippen der Oberfläche ließ Deidra ein Menü auf dem Tisch erscheinen und aktivierte die Sprachwiedergabe. Die blonde Zeugin war schwer zu verstehen, weil sie in ihrem Schockzustand viel zu schnell und unzusammenhängend sprach.
Deidra erweckte nicht den Eindruck, viel Zeit für Erklärungen aufwenden zu wollen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen sah sie sich die Aufnahme an und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe.
Finnley verzichtete darauf, auf seinem Pad nachzulesen, was die Frau gesagt hatte, und hoffte, dass er es in verständlichen Häppchen erklärt bekäme.
Nach einer Weile stoppte Deidra die Wiedergabe. »Wenn ich die Zeugin richtig verstanden habe, wurde das Opfer von etwas Unsichtbarem angegriffen und getötet.« Sie ließ den Mitschnitt nochmals laufen, dann rief sie eine andere Aufzeichnung auf, die einen jungen Mann zeigte.
»Ich saß ganz vorne«, sagte der Powtankane in der besser verständlichen Landessprache. Er überreichte dem Beamten ein Aufzeichnungsgerät. »Ich habe die Kamera die ganze Zeit laufen lassen. Da ist alles drauf. Ehrlich, ich wollte ihm helfen, aber ich wusste nicht, wie.« Die Wellen zeigten an, wie aufgeregt er war, auch bei ihm blinkte das Wort Schock.
Erneut ließ Deidra das Menü anzeigen, und auf dem Tisch entstand eine Auswahl der Zeugenaussagen, die abgerufen werden konnten.
»Die Aufnahme vom Mord ist noch nicht verfügbar.«
Finnley wagte einen Blick aus dem Fenster. Offensichtlich wollten die neuen Kollegen ihm den Einstieg nicht einfach machen, aber so was kannte er schon. Nichts Bedeutendes in seinem Leben war bislang einfach gewesen. Deswegen passte es auch perfekt ins Bild, dass er sich ausgerechnet in Taima verliebt hatte. Bis dahin hatte er noch geglaubt, in Paisley bis zum Ende seiner Tage ein raues Singleleben zu führen. Ab und an einen trinken gehen, unverbindliche Liebschaften und arbeiten, bis nichts mehr ging – so hätte seine Zukunft aussehen sollen. Aber als er sie damals vom Flughafen abgeholt und nach Paisley gefahren hatte, war alles hinfällig geworden. Es war wie in einem kitschigen Liebesfilm gewesen, in dem der harte Kerl einer Frau in die Augen blickt und augenblicklich zum Softie wird. Dieser Moment, in dem er sich hoffnungslos in Taima verliebt hatte, würde für immer seine absolute Lieblingserinnerung bleiben.
Er sah sich die Umgebung an.
Eigentlich ein wunderschönes Land. Wenn nur die Menschen nicht wären.
Er unterdrückte ein Seufzen und dachte über den Fall nach.
Wenn er es richtig verstand, war jemand ermordet worden, und die Indizien wiesen auf spirituellen Missbrauch hin. Er schob ein paar Finger über die Lippen, um durch die Berührung ein erneutes Grinsen zu unterbinden.
Er war froh, dass seine neuen Kollegen weitestgehend auf die alten Dialekte verzichteten, denn er hasste es, ständig wie ein dummer Außenseiter auf sein Pad glotzen zu müssen. Sie besprachen die Zeugenaussagen, ließen weitere abspielen und machten auf Eingabefeldern Notizen. Er wusste, dass er besser daran täte, sich in diesen Prozess einzubringen, aber seine Aufmerksamkeit verweilte kurz auf einem Haus, das aussah, als wäre es mit einer mächtigen Eiche verwachsen.
In seinen Augen waren die Städte gar nicht so viel anders als die in seiner Heimat, nur eben wesentlich begrünter und mit viel mehr Liebe zum Detail gestaltet. Taima empörte sich jedes Mal, wenn er so etwas sagte, weil in ihren Augen die Unterschiede nicht eklatanter sein konnten.
Besonders die Solarzellen hatten es ihm angetan. Die Powtankaner hatten einen Weg gefunden, die Sonnenkollektoren so weiterzuentwickeln, dass sie in die urbanen Muster auf den Dächern und Hauswänden integriert werden konnten, ohne den Anschein zu erwecken, für die gesamte Stromversorgung eines Hauses zuständig zu sein. Größere Gebäude wurden mit einem leitenden Material beschichtet, das die Energie direkt nach innen zu den Stromabnehmern weitergeben konnte, ohne dass man einen Schlag bekam, wenn man das Mauerwerk berührte.
Powtanka machte ein wohlgehütetes Geheimnis aus seinem Fortschritt. Wie aus so vielen anderen Dingen auch, die für den Schotten nicht begreifbar waren.
»Bist du noch bei uns?« Deidras Stimmlage war Tadel und Wertung zugleich.
»Sicher.« Er schluckte trocken. »Sie haben gesagt, dass wir als Erstes die spirituelle Sichtung vornehmen, wenn wir den Hörsaal betreten.«
Ihm fiel auf, dass er die Anrede falsch gewählt hatte. Verlegen rieb er sich über den Nacken. »Also, wenn Menschen von unsichtbaren Tätern angegriffen werden, spricht man von spirituellem Missbrauch?«
Chenoa verdrehte die Augen. »Mal ehrlich. Was soll er bei uns, wenn er von diesen Dingen keine Ahnung hat?« Dann sagte sie in seine Richtung: »Nichts für ungut, aber die powtankanische Geschichte und spirituellen Besonderheiten lernt man nicht mal eben als Mitläufer.«
»Wie gut, dass wir zur Uni fahren«, warf Tate amüsiert ein und verschränkte die Hände hinterm Kopf.
Mit einem wütenden Schnauben schickte die junge Kollegin einen Fluch in seine Richtung, der augenblicklich von Finnleys Pad mit Kreuzbuckeliger Bisontreiber übersetzt wurde.
Durch den Elektroantrieb machte das Fahrzeug kaum Geräusche und fuhr wie auf Schienen. Dinge wie Ampeln oder Verkehrsschilder gab es nicht mehr. Lediglich Straßennamen und Ortsgrenzen wurden angezeigt, damit Fußgänger sich orientieren konnten.
Der Blú Controverse bog rechts auf eine Hauptstraße, die parallel zum Potomac verlief. Das Wasser stand heute hoch.
»Die Geier kreisen«, bemerkte Chenoa und deutete auf sechs große Vögel mit eingezogenen Hälsen, die über dem nahen Ufer flogen. »Wir sollten eine Einheit dort hinschicken. Wenn es mehr als zwei sind, wird es sich nicht um ein verendendes Kleintier handeln.«
Deidra tippte auf die Tischfläche, wo augenblicklich eine Tastatur entstand. »Ich übermittle die GPS-Daten an die Zentrale.«
»Was soll denn da sein?«, fragte Finnley und drehte sich zu der Stelle um, die durch die wachsende Entfernung immer schlechter zu sehen war.
»Das werden wir wissen, wenn jemand nachgesehen hat.« Chenoa strich mit einer Hand über das laufende Video, das verschwand und Platz für Fotos machte.
»Etwas, das solche Wunden verursacht, muss man doch gesehen haben«, sagte sie und betrachtete den Leichnam des Professors und seinen zerstörten Brustkorb.
Auch die anderen wischten die Videos fort, um die Fotos zu betrachten.
Finnley kratzte sich erneut am Hinterkopf. Die Verbrechen, mit denen er bislang zu tun gehabt hatte, kamen in der Regel ohne Leichen aus. Drei Erhängte, eine Person mit einem zerschmetterten Körper und eine Stichwunde zählten zu der Bilanz der miterlebten tödlichen Personenschäden, die allerdings nicht mit seinem Job in Verbindung gestanden hatten. Doch diese Bilder übertrafen alles, was er je hatte sehen müssen.
»Es ist abzuklären, ob sich der Brustkorb von innen geöffnet hat oder von außen aufgerissen wurde. Gleiches gilt für das Gesicht«, referierte Deidra ungerührt.
Eine schwarze Strähne rutschte hinter dem Ohr der jungen Kollegin hervor und fiel ihr ins Gesicht, während sie nickte. Mit einer eleganten Bewegung zwang sie die langen Haare zurück. Für eine Polizistin wirkte sie recht fragil. Finnley war sich sicher, ihre schlanke Taille spielend umfassen zu können. Als sie vor ihm gestanden hatte, hatte sie ihm gerade mal bis zum Kinn gereicht, und mit seinen 1,76 Metern zählte er nicht unbedingt zu den großen Männern. Bei ihr hatte er die größten Bedenken, ob sie je miteinander klarkämen. In ihrer Nähe fühlte er sich unzulänglich und irgendwie grob. Dafür hatte sie keine fünf Sekunden gebraucht, und er glaubte nicht, dass sich das mit der Zeit verlieren könnte. Es würde ihn nicht wundern, wenn sie mit Taimas Eltern bestens befreundet wäre.
»Chenoa, du kümmerst dich sofort um die Spur«, wies Deidra sie an.
»In Ordnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist.«
Finnley tippte unauffällig auf seinem Pad, um nicht erneut etwas fragen zu müssen, das seine Unwissenheit deutlich zeigte.
Grinsend lehnte sich Tate zu ihm rüber und flüsterte: »Die Spur ist wie eine Art permanenter Fellwechsel der Totems, also der Schutzgeister der Powtankaner. Schamaninnen und Schamanen haben Zugang zu dieser feinstofflichen Welt, die sie Astralwelt nennen. Wenn ein Totem zugegen war, als der Mord verübt wurde, findet man überall kleine, flockige Haarbüschel – metaphorisch gesprochen.«
Er bekam einen Tritt gegen das linke Schienbein.
»Ich vergaß«, sagte er und hob grinsend eine Hand vor den Mund. »Wir Nicht-Powtankaner machen keine Witze darüber.«
Chenoa überging die letzten Worte und warf Finnley einen mahnenden Blick zu – offensichtlich sollte er sich kein Beispiel am Verhalten des Kollegen nehmen.
»Mein Pad sagt, dass Chenoa Taube bedeutet«, warf er ein.
Tate musste lachen, und auch Deidra sah von den Fotos auf und beobachtete die Situation mit einem leichten Lächeln auf den Lippen.
Chenoa setzte sich aufrecht hin und sah Finnley streng an. »Wage es niemals, mich Täubchen zu nennen, Anspielungen aufs Vögeln zu machen oder Metaphern mit Federn zu benutzen.«
So unauffällig er konnte, tippte er auf seinem Pad das Lexikon an. »Entschuldige, meine Verlobte erwähnte schon, dass ich mich mit solchen Sachen zurückhalten soll.«
»Ist sie Powtankanin?« Chenoa wölbte skeptisch eine feine, dunkle Braue.
»O ja«, sagte er, als wäre es ganz selbstverständlich. »Sie nennt mich Tunkan wicasa.«
Stein Mann, übersetzte sein Pad.
Das brachte Deidra zum Lachen. »Nun dann, Tunkan.« Mit beiden Händen bewegte sie das Foto vor sich in die Tischmitte und zog es groß, sodass alle kleineren Abbildungen verschwanden. »Zeig mal, was du kannst!« Ganz offensichtlich duldete sie keine Ablenkungen, was Finnley mehr als recht war.
Auf den ersten Blick sah er nur Blut und klaffende Wunden. Er legte das Pad mit der tiefer gehenden Namensbedeutung beiseite und konzentrierte sich auf das Foto.
»Auch wenn vom Gesicht nicht mehr allzu viel zu erkennen ist, handelt es sich um einen Indianer, ungefähr sechzig Jahre.«
»Professor Atius Catori, einundsiebzig Jahre, Powtankaner«, korrigierte ihn Deidra, die das letzte Wort betont scharf aussprach.
»Powtankaner«, wiederholte er entschuldigend und sah sich das Foto genauer an.
Er spürte Chenoas Wut, aber es würde sicher nicht der letzte Fauxpas sein; es nützte nichts, sich lange damit aufzuhalten. Wenn er es schaffte, bei den Geistkriegern zu bleiben, würden sie sich an seine schottische Art gewöhnen müssen. Und Tates Art stimmte ihn zuversichtlich, dass das möglich war.
Finnley deutete auf die Stickerei am Revers des Toten. »Ein Ratsmitglied.«
Deidra nickte und fasste kurz die übermittelten Informationen zusammen. »Und Dozent für Geschichte und Entwicklung. Seit dem Tod seiner Eltern, eines Pawnee-Clanoberhaupts und einer angesehenen Hopi, war er im obersten Clanrat und im Universitätsrat ein wichtiges Mitglied.«
»Die Wundränder sehen nicht kauterisiert aus. Ich nehme mal an, dass es keinen Sinn ergibt, die Studierenden nach Gerüchen zu befragen?« Er sah kurz in die Gesichter. »Ich meine, weil ihr doch überall dieses qualmende Zeug abfackelt?«
Statt sofort eine Antwort zu geben, griff Chenoa behutsam unter das schwarze Shirt und holte einen Anhänger an einem Lederband hervor. Sie drehte den Talisman zwischen den Fingern. Finnley fiel der geschliffene schwarze Kristall auf, der von Silber kreisrund eingefasst war.
»Qualmendes Zeug?«, fragte sie ruhig.
»Na, Sie wissen schon.« Er wurde vorsichtiger. »Dieses Räucherwerk, das ständig angezündet wird.«
Mit einer anmutigen Bewegung ließ sie den Talisman los, lehnte sich mit ineinander verschränkten Fingern auf die Tischplatte und fixierte ihn. »Sicher wissen Sie auch, warum wir das ständig abfackeln?«
Finnley sah zu seinem Pad, das aus Mangel an powtankanischen Dialekten nichts anzeigte. »Nun, ich nehme mal an, damit es angenehmer riecht?«
Tate gluckste vergnügt.
Der Blú Controverse bog auf das Unigelände ab, was von Deidra mit »Macht euch bereit« kommentiert wurde. »Da du es offensichtlich nicht besser weißt, rate ich dir, grundsätzlich nicht mehr als nötig zu sprechen, wenn du kein Fall für andere Geistkrieger werden willst.«
»Da hätte ich noch eine Frage«, sagte er abgelenkt, als wären ihre Worte nicht zu ihm durchgedrungen. »Warum heißt diese Einheit Geistkrieger? Ich meine, die anderen werden für jedermann verständlich Polizisten genannt, warum heißt es nicht Spezialeinheit für spirituellen Missbrauch?«
Chenoa fluchte irgendwas, das Finnley sich nicht auf dem Pad durchlesen wollte. In seinen Augen war es eine berechtigte Frage.
Der Wagen fuhr auf eine Menschenmenge vor einem Gebäude zu. Ihm fiel die besondere Bauweise auf, die den Eindruck erweckte, die Natur hätte diesem Haus seinen Segen gegeben. Auf dem Dach wuchsen Bäume und Sträucher, Fels und Mauerwerk gingen fließend ineinander über. Deidra war sichtlich angespannt, dennoch bemühte sie sich, auf seine Frage einzugehen.
»Je mehr Einwanderer und auch Touristen nach Powtanka kamen, desto notwendiger wurde eine Sprachreform, um einen Weg zu finden, die Sprachbarriere etwas zu mildern. Wichtige Institutionen haben neue Namen bekommen. Aus Akicita«, das Pad übersetzte das Wort mit Friedensbringer, »wurde Polizei. Aber wir agieren auf anderen Ebenen, und es ist nicht notwendig, dass die Allgemeinheit weiß, wer wir sind. Den Rest siehst du gleich.«
Der Wagen hielt an, und Deidra legte eine Hand auf den Griff. »Tunkan, du bleibst immer in meiner Nähe«, wies sie ihn an.
Er griff nach seinem Pad. »Ich heiße Finnley.«
»Jetzt wohl nicht mehr«, sagte Tate grinsend und klopfte ihm auf die Schulter. »Aber sieh’s mal so: Ein Stein ist hart und schwer zu brechen.«
Vor dem Gebäude befanden sich ungefähr zweihundert Lehrkräfte und Studierende.
Der Eingangsbereich war sehr gepflegt und frei von wilden Gewächsen. Runen und Solarzellapplikationen verschönerten die weiße Fassade. Die Elemente rechts neben der Tür zeigten stilisierte Menschen, die einander mit erhobenen Händen begrüßten. Über der Tür stand die Gebäudeziffer 4.1.
Beamte sicherten den Eingang, auf dem Gehweg in etwa zehn Metern Entfernung stand ein Einsatzfahrzeug, um das sich die Augenzeugen versammelt hatten, die von Rettungskräften versorgt wurden.
»Du sagst absolut nichts«, befahl Deidra eindringlich und ging voran.
Finnley kratzte sich im Nacken und folgte ihr. Er hatte nicht vor, irgendwas zu sagen. Zusehen, lernen und so lange in dieser Einheit bleiben, bis er sich versetzen lassen konnte. Es war eher unwahrscheinlich, dass er für das Gebiet spirituellen Missbrauch etwas taugte.
Die Schaulustigen machten Platz, ließen mit fragenden Blicken die Männer und Frauen in ihren dunklen Anzügen passieren und tuschelten miteinander. Ohne Uniform fiel Finnley neben seinen neuen Kollegen gleich doppelt auf. Manche zeigten auf ihn, er hörte Fragmente von Aussprüchen, die seinen Tätowierungen gewidmet waren.
Er fasste das Pad fester und folgte Deidra schnellen Schritts, dicht gefolgt von Chenoa und Tate.
Als sich die Glastür hinter ihnen schloss, nahm Deidra die Geschwindigkeit etwas raus.
»Tate, sieh dir jedes Detail an«, sagte sie.