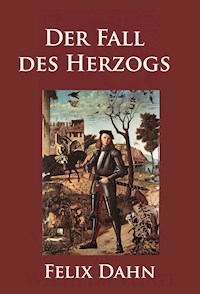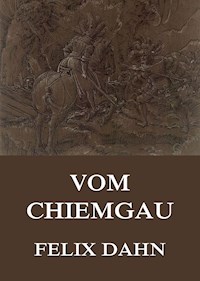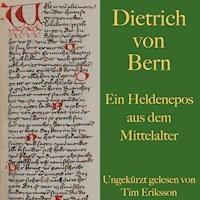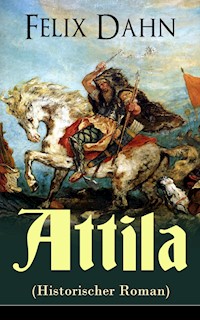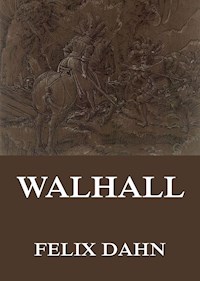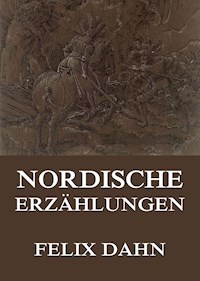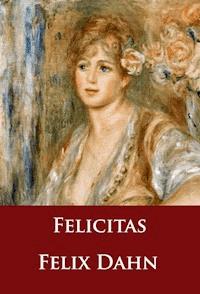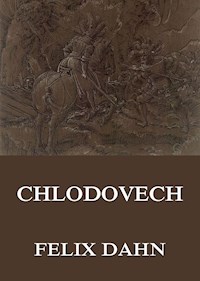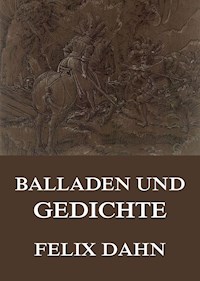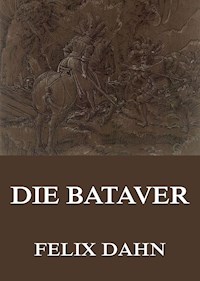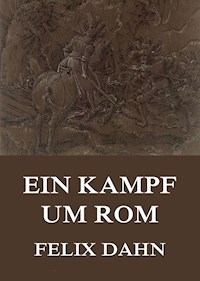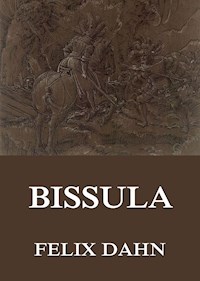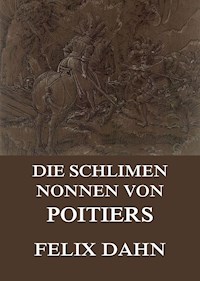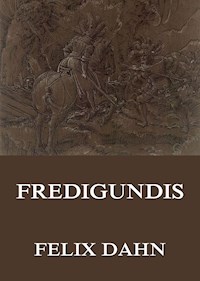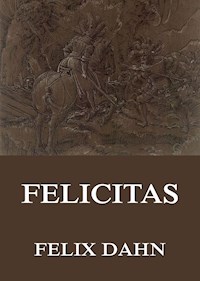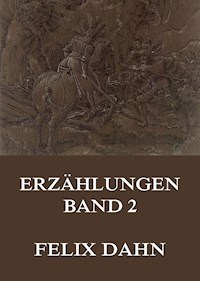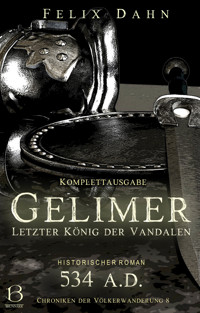
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
“GELIMER” Hundert Jahre lang haben sich die Vandalen in Nordafrika, der reichsten Provinz des ehemals weströmischen Reiches, niedergelassen und ein eigenes Reich errichtet. Sogar Rom selbst ist von ihnen zwischenzeitlich mit Hilfe ihrer schlagkräftigen Flotte erobert worden. Nun herrschen Thronstreitigkeiten im Vandalenreich. Im Jahr 530 reißt Gelimer die Macht an sich und besteigt unrechtmäßig den Thron. Damit zieht er den Zorn Justinians I., des Kaisers von Byzanz, auf sich. Als dieser seinen ehrgeizigen Heerführer Belisar auf eine Strafexpedition aussendet, um in die vandalischen Thronstreitigkeiten einzugreifen, befindet sich Gelimer auf der Höhe seiner Macht. Doch durch eine Verkettung unglücklicher Umstände nehmen die Dinge einen völlig unerwarteten Verlauf, und das Volk der Vandalen geht seinem Schicksal entgegen. “CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG” Wer “Herr der Ringe” oder “Game of Thrones” mag, sich aber mehr Realismus wünscht, der findet in den “Chroniken der Völkerwanderung” von Felix Dahn womöglich eine Offenbarung. In altertümlicher und poetischer Sprache lässt Dahn die Spätantike und das Frühmittelalter wiederauferstehen. Helden, Könige und Könniginnen begegnen uns hier mit zaubervollen Namen und phantastischen Taten. Und doch sind viele Teile der erzählten Geschichten und viele der Figuren echt. Wer braucht Elben, Zwerge und Orks, wenn es Goten, Hunnen und Vandalen gibt? Wer braucht Legolas, Gimli und Aragorn, wenn es Gelimer, Leovigild und Ebroin gibt? – Nichts ist so spannend und nichts ist so groß, wie die wirkliche Geschichte. Lass dich ein auf eine archaische Welt der Schwerter, des Glaubens und des Aberglaubens. Es sind Kämpfe um die Herrschaft und um schöne Frauen, die hier die Schicksale einzelner Menschen und ganzer Völker bestimmen. Erlebe die Geschichte unserer germanischen Vorfahren, meisterhaft in Szene gesetzt und in perfekter Verbindung von dramatischer Spannung und historischer Genauigkeit. Jeder der 13 Bände der “Chroniken der Völkerwanderung” ist eine in sich geschlossene Geschichte und lässt sich unabhängig von den übrigen Teilen der Reihe lesen. Zugleich bilden die einzelnen Teile eine chronologische Abfolge und sind aufgrund der historischen Zusammenhänge miteinander verknüpft. “Gelimer” ist der achte Band der Reihe “Chroniken der Völkerwanderung”. Der Umfang des achten Bandes entspricht ca. 330 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
FELIX DAHN
GELIMER
LETZTER KÖNIG DER VANDALEN
KOMPLETTAUSGABE
HISTORISCHER ROMAN
534 A.D.
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG 8
Dieses Buch ist Teil der BRUNNAKR Edition: Fantasy, Historische Romane, Legenden & Mythen.
BRUNNAKR ist ein Imprint des apebook Verlags.
Nähere Informationen am Ende des Buches oder auf:
www.apebook.de
1. Auflage 2020
V 1.0
ISBN 978-3-96130-331-1
Buchgestaltung/Coverdesign: SKRIPTART
www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© BRUNNAKR/apebook 2020
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG
DIE BATAVER: Der Aufstand der Verbündeten (69 A.D.)
JULIAN: Der Abtrünnige (337 A.D.)
BISSULA: Die geliebte Sklavin (378 A.D.)
STILICHO: Der römische Heermeister (390 A.D.)
ATTILA: Der Hunnenkönig (453 A.D.)
FELICITAS: Der Zug der Germanen (476 A.D.)
CHLODOVECH: Der König der Franken (481 A.D.)
GELIMER: Letzter König der Vandalen (534 A.D.)
FREDEGUNDIS: Die kaltblütige Königin (570 A.D.)
LEOVIGILD: Der Vater und die Söhne (579 A.D.)
DAS KLOSTER: Die schlimmen Nonnen von Poitiers (589 A.D.)
DIE BAJUWAREN: Die Siedler vom Chiemgau (596 A.D.)
EBROIN: Herrscher der Franken (638 A.D.)
Inhaltsverzeichnis
GELIMER
Impressum
Karte
ERSTES BUCH
Vor dem Krieg
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
ZWEITES BUCH
Im Krieg
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Eine kleine Bitte
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG
BRUNNAKR Edition
Buchtipps für dich
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
KARTE
von
»GERMANIEN«
ERSTES BUCH
VOR DEM KRIEG
I
An Cornelius Cethegus Cäsarius ein Freund.
»Lieber an dich denn an alle anderen Menschen schicke ich diese Aufzeichnungen. Warum? Vor allem, weil ich nicht weiß, wo du weilest, die Sendung also recht wahrscheinlich verloren geht. Und das wäre wohl das Beste! Zumal für diejenigen, welchen dann erspart bliebe, diese Blätter zu lesen! Aber auch für mich ist es gut, wenn diese Zeilen irgendwo anders liegen – oder irgendwo anders verloren werden – als hier. Denn fallen sie hier, zu Byzanz, in gewisse kleine, zierliche, sehr beflissen gepflegte Hände, so winken diese Hände vielleicht anmutvoll, mir den Kopf abzuschlagen; oder sonst etwas Wertvolles, woran ich seit der Geburt gewöhnt bin.
Schicke ich aber diese Wahrheiten von hier in das Abendland, so werden sie nicht so leicht erhascht von jenen gefährlichen Fingerlein, die alles, was in der Hauptstadt verheimlicht wird, finden, wenn sie ernstlich suchen.
Ob du in deinem Haus, am Fuß des Kapitols, ob bei der Regentin zu Ravenna weilst, – ich weiß es nicht: aber ich sende dies nach Rom: denn nach Rom fliegen meine Gedanken, suchen sie Cethegus. – Du spottest: weshalb ich schreibe, was zu schreiben so gefährlich ist? Weil ich muß! Ich preise – furchtgezwungen – laut mit dem Munde so viele Menschen und Dinge, die ich im Herzen tadle, daß ich die Wahrheit wenigstens schriftlich und leise bekennen muß. Nun könnte ich es ja ärgerlich niederschreiben, lesen, mich nochmal ärgern und dann die Blätter in das Meer werfen, – meinst du. Aber sieh' – und das ist der andere Grund dieser Sendung – eitel bin ich auch.
Der gescheiteste Mann, den ich kenne, soll lesen, soll loben, was ich schreibe, soll wissen, daß ich nicht so thöricht war, alles rühmenswert zu finden, was ich rühme. Später aber kann ich die Aufzeichnungen – wenn sie nicht verloren – vielleicht noch brauchen, wann ich einmal die wahre Geschichte schreiben werde der merkwürdigen Dinge, die ich erlebt habe und – demnächst – erleben werde. Bewahre sie also auf, diese Blätter, falls sie an dich gelangen: es sind nicht so fast Briefe: es ist etwas wie ein Tagebuch, was ich dir da sende.
Antwort erwarte ich nicht von dir. Cethegus bedarf meiner nicht – dermalen: – wie sollte mir Cethegus schreiben –: dermalen? Vielleicht aber erfahre ich dein Urteil bald aus deinem Munde. Du staunst?
Freilich haben wir uns nicht mehr gesehen seit den gemeinsamen Studien zu Athen. Aber vielleicht such' ich Dich bald auf in Deinem Italien. Denn es will mich bedünken: er ist nur das Vorspiel zu dem Kampfe mit euren Zwingherren, den Ostgoten, dieser jetzt – heute! – beschlossene Krieg mit den Vandalen.
Da hab' ich es hingeschrieben, das schicksalschwere Wort, das große Geheimnis, um welches erst so wenige wissen.
Es ist doch ein eigen Ding, in scharfen Buchstaben verzeichnet vor sich zu sehen ein furchtbar Geschick, blut- und thränenreich, das noch kein anderer ahnt: dann fühlt sich der Staatsmann wohl dem Gotte nah, welcher den Blitz rüstet, der demnächst herabsausen wird auf fröhliche Menschen.
Jämmerlicher, schwacher, sterblicher Gott! Wirst du treffen? Wird nicht der Strahl abprallen und auf dich zurückfahren? Der Halbgott Justinian und die Vollgöttin Theodora haben diesen Blitz gezückt: der Adler Belisarius wird ihn tragen: wir brechen auf nach Afrika: Krieg mit den Vandalen!
Nun weißt du zwar viel, o Cethegus. Aber du weißt doch wohl nicht alles: wenigstens nicht alles von den Vandalen. Lerne es also von mir. Ich weiß es. Denn ich werde dafür bezahlt: ich habe in den letzten Monaten den beiden Göttern – und dem Adler – Vorträge halten müssen über diese blondhaarigen Thoren. Wem aber der Himmel Vorträge auferlegt, dem giebt er auch den für dieselbigen erforderlichen Verstand. Blick' auf die Professoren zu Athen: seit Justinian ihnen die Hörsäle geschlossen –, wer hält sie noch für weise?
Also vernimm: die Vandalen sind Vettern eurer lieben Herren, der Ostgoten. Vor hundert Jahren etwa kamen sie – zusammen, Männer, Weiber, Kinder, ungefähr fünfzigtausend Köpfe – aus Hispanien nach Afrika. Ein fürchterlicher König führte sie: Geiserich hieß er und war des Hunnen Attila würdiger Genoß. Er schlug die Römer in schweren Feldschlachten, nahm Karthago, plünderte Rom. Er ward nie besiegt. Die Krone vererbt in seinem Geschlecht, den Asdingen, die als von den Heidengöttern der Germanen entsprossen gelten: stets der Älteste des ganzen Mannesstammes besteigt den Thron.
Aber Geiserichs Nachkommen haben nur sein Scepter geerbt, nicht seine Größe. Die Katholiken in ihrem Reich – die Vandalen sind Ketzer, Arianer – haben sie auf das grausamste verfolgt: das war noch dümmer als es ungerecht war. So ungerecht war es gerade nicht: sie wandten nur wider die Katholiken, die Römer, in ihrem Reiche genau dieselben Gesetze an, welche die Kaiser im Römerreiche vorher wider die Arianer erlassen hatten und anwandten. Aber dumm war es, sehr. Was können uns im Römerreiche die wenigen Arianer schaden? Aber die vielen Katholiken im Vandalenreich, die könnten dieses Reich umwerfen, wenn sie sich nur rührten. Freilich: von selbst rühren sie sich nicht. Aber wir kommen, um sie aufzurühren.
Werden wir siegen? Viel spricht dafür. König Hilderich hat lang in Byzanz gelebt und soll hier heimlich zu dem katholischen Glauben übergetreten sein: er ist Justinians Freund: dieser Urenkel Geiserichs verabscheut den Krieg. Er hat gegen sein eigenes Reich den schwersten Schlag geführt, indem er dessen beste Stütze, die Freundschaft mit den Ostgoten in Italien, in tödliche Feindschaft verwandelte. Der weise König Theoderich zu Ravenna hatte mit dem vorletzten Vandalenkönig, Thrasamund, Hilderichs Vorgänger, Freundschaft und Schwägerschaft geschlossen, ihm seine schöne geistvolle Schwester Amalafrida vermählt und dieser als Mitgift außer vielen Schätzen das Vorgebirge Lilybäum auf Sicilien, für das Vandalenreich sehr wichtig, Karthago gerade gegenüber, geschenkt: dazu aber als dauernde Waffenhilfe wider die Mauren – und wohl auch gegen uns! – eine Gefolgschaft von tausend erlesenen gotischen Kriegern, von denen jeder wieder je fünf tapfere Leute zur Begleitung hatte. Kaum war Hilderich König, als die Witwe Amalafrida des Hochverrats wider ihn bezichtigt und mit dem Tode bedroht ward.
Wenn diesen Hochverrat nicht Justinianus und Theodora ersonnen haben, kenn' ich meine angebeteten Herrscher schlecht: ich sah das Lächeln, mit welchem sie die Nachricht aus Karthago aufnahmen: es war der Triumph des Vogelstellers, der sein Schlaggarn über dem gefangenen Vögelein zusammenklappen läßt!
Es gelang Amalafridas Goten, sie aus der Haft zu befreien und ihre Flucht zu begleiten: sie wollte bei befreundeten Mauren Schutz suchen: aber auf der Flucht wurden sie von des Königs beiden Neffen mit Übermacht eingeholt und angegriffen: die treuen Goten fochten und fielen, alle sechstausend beinahe, Mann für Mann, die Fürstin ward gefangen und im Kerker ermordet. Seither grimmer Haß zwischen beiden Völkern: die Goten nahmen Lilybäum zurück und werfen von da aus Blicke der Rachsucht auf Karthago. Das ist König Hilderichs einzige Regierungsthat! – Seitdem hat er vollends erkannt, daß es für sein Volk das allerbeste ist, sich uns zu unterwerfen. Aber er ist fast ein Greis und sein Vetter – leider der allein berechtigte Thronfolger – ist unser schlimmster Feind.
Er heißt Gelimer.
Nie darf er König zu Karthago werden! Er gilt als Hort und Held, ja als die Seele der Volkskraft der Vandalen. Er zuerst hat wieder die Eingebornen geschlagen, die Mauren, jene Söhne der Wüste, die den schwachen Nachfolgern Geiserichs sich stets überlegen erwiesen hatten!
Allein dieser Gelimer ... – es ist mir nicht möglich, aus den widerstreitenden Berichten ein Bild von ihm zu gewinnen. Oder könnte wirklich ein Germane solche Widersprüche in Geist und Wesen tragen? Sind ja doch alle nur Kinder, wenn auch siebentehalb Schuh hoch aufgeschossene: Riesen – mit Knabenseelen. Einen einzigen Inhalt haben sie – fast alle – nur, sonder Zwiespalt oder Gegensatz: Raufen und Saufen. Dieser Gelimer aber – nun, wir werden sehen.
Auch über das ganze Volk der Vandalen sind scharf widersprechende Würdigungen im Umlauf hier.
Nach den einen sind sie furchtbare Gegner im Kampfe – wie alle Germanen – und wie Geiserichs Vandalen ohne Zweifel gewesen sind. Nach anderen Berichten aber sind sie im Laufe von drei Menschenaltern unter der heißen Sonne Afrikas und zumal im Zusammenleben mit unseren dortigen Provinzialen – wie du weißt dem liederlichsten und kernfaulsten Gesindel, das je den Römernamen geschändet hat, – verweichlicht, selber angefault, entartet. Held Belisar natürlich verachtet diesen Feind: wie jeden andern, den er kennt und – nicht kennt.
Mir haben die Götter den geheimen Briefwechsel übertragen, der das Gelingen vorbereiten soll.
Ich erwarte nun wichtige Nachrichten: von vielen Häuptlingen der Mauren – von dem vandalischen Statthalter auf Sardinien – von euren ostgotischen Grafen auf Sicilien – von dem reichsten, einflußgewaltigsten Senator in Tripolis: ja sogar von einem der höchsten Geistlichen – es ist schwer zu glauben! – der ketzerischen Kirche selbst. Letzteres wäre ein Meisterstück.– Freilich ist er nicht Vandale, sondern Römer! – Gleichwohl! Ein arianischer Priester mit uns im Bunde! Ich traue es doch beinahe unsern Herrschern zu! Du weißt, wie scharf ich ihr Walten im Innern unseres Reiches verwerfe, – aber wo es höchste »Staatskunst« gilt, das heißt: Verräter zu gewinnen in dem vertrautesten Rat anderer Herrscher und so die Listigsten zu überlisten, – da beug' ich bewundernd meine Knie vor diesen beiden Göttern der Arglist. Wenn nur – –.
Ein Brief Belisars ruft mich in das goldne Haus: »Schlimme Nachrichten aus Afrika! Der Krieg ist wieder höchst zweifelhaft. Die scheinbaren Verräter dort drüben haben nicht die Vandalen, sondern Justinian verraten. Das kommt von solchen falschen Listen. Hilf, rate! Belisarius.«
Wie? Ich glaube doch, die geheimen Briefe aus Karthago kämen – durch den verkleideten Boten – nur an mich? Und erst durch mich an den Kaiser? So befahl er ausdrücklich: ich hab's selbst gelesen. Und doch noch geheimere, – von denen ich nur zufällig, hinterdrein, erfahre? – Das ist dein Gewebe, o Dämonodora!«
II
Das Karthago der Vandalen war noch immer eine stolze, prangende Stadt, noch immer die glänzende »Colonia Julia Carthago«, die Augustus nach des großen Cäsars Plan am Platze der alten, von Scipio zerstörten Stadt wieder aufgebaut hatte.
Zwar war sie nicht mehr – wie noch vor einem Jahrhundert – nach Rom und nach Byzanz die volkreichste Stadt des Reiches: aber sie hatte in ihren Gebäuden, in ihrem äußeren Ansehen wenig gelitten; nur die Wälle, mit welchen man sie zuletzt gegen Geiserich umgürtet hatte, waren bei der Erstürmung durch die Vandalen vielfach zerstört und nicht genügend wiederhergestellt worden: ein Zeichen hochmütiger Sicherheit oder schlaffer Trägheit.
Noch immer blickte die alte Hochburg, die phönikische »Birtha«, jetzt Kapitolium genannt, auf die blaue See, auf die zwiefachen, durch Türme und Eisenketten geschützten und gesperrten Häfen. Und auf den Plätzen, den breiten Straßen der »oberen Stadt« wogte oder lungerte und lagerte eine müßige Menge auf den Stufen christlicher Basiliken, die oft aus Heidentempeln umgebaut waren, um die Amphitheater, die Säulenhallen, die Bäder mit ihren Blumenbeeten, Gartenanlagen, Palmengruppen, welche die aus weiter Ferne auf stolzen Bogen hergeführte Wasserleitung grün und lebendig erhielt. Die »untere Stadt«, gegen die See hin gelegen, war von den ärmeren Leuten, meist von Hafenarbeitern, bewohnt, von Magazinen erfüllt und von Läden für den Bedarf der Schiffe und der Matrosen: sie zeigte fast nur schmale Gassen, die sämtlich von Süd nach Nord, von der Innenstadt gegen den Hafen hin führten: ähnlich wie heute die schmalen Gäßlein in Genua.
Der umfangreichste Platz der unteren Stadt war das Forum des heiligen Cyprian: benannt nach der ihn schmückenden prachtvollen Basilika dieses größten Heiligen von Afrika. Die Kirche füllte die ganze Südseite des Platzes, an dessen Nordseite man auf vielen Marmorstufen in den Hafen hinabstieg – noch heute ragen melancholisch aus der Verödung, aus der Einsamkeit der stillen Stätte, welche einst das lärmende Karthago trug, die mächtigen Trümmer des alten »Seethors« – während eine breite Straße nach Westen, nach der Vorstadt Aklas und dem »numidischen Thore« leitete und eine ziemlich steil aufsteigende im Südosten zu der Oberstadt und dem Kapitol emporführte.
Auf jenen großen Platz hin strömte und wogte an einem heißen Juniabend buntgemischtes Volk vom Westthor, von der Porta Numidika her: Römer und Provinzialen, Kleinbürger von Karthago, Handwerker und Krämer, auch viele Freigelassene und Sklaven, welche die Neugier, die Freude am Müßiggang als mächtigste Triebfedern bewegten und die jedes glänzende und lärmende Schauspiel anzog. Auch Vandalen waren darunter: Männer, Weiber, Kinder, von jenen grell abstechend in ihrem blonden oder roten Haar, in ihrer weißen Hautfarbe: obzwar diese schon bei gar manchen sich gebräunt hatte unter der afrikanischen Sonne. In der Tracht waren sie nur sehr wenig – viele gar nicht – mehr von den Römern unterschieden. Unter diesen niedern Ständen fehlte es auch nicht an Mischlingen, deren Väter dann meist Vandalen, deren Mütter geringe Karthagerinnen waren. Hier und da besah sich den Zusammenlauf auch wohl ein Maure, der von dem Saum der Wüste in die Hauptstadt gekommen war, Elfenbein oder Straußenfedern, Löwen- und Tigerfelle oder Antilopenhörner feilzubieten: die üppigen Frauen und Männer der germanischen Adelsgeschlechter waren bessere, das will sagen: gierigere, reichere und verschwenderischere Käufer als die vielfach verarmten römischen »Senatorischen Familien«, denen der Staat ihre alten unermeßlichen Reichtümer meist konfisciert hatte zur Strafe für wirklichen oder angeblichen Hochverrat, auch wohl nur wegen beharrlicher Festhaltung des katholischen Bekenntnisses. Unter der lärmenden jubelnden Menge war auch nicht Ein Römer der besseren Stände zu sehen; ein rechtgläubiger Priester, der auf seinem Wege zu einem Sterbenden diesen Platz nicht hatte meiden können, huschte scheu in die erste erreichbare Seitengasse, auf dem bleichen Antlitz Furcht, Abscheu und Unmut.
Denn die lärmende Menge feierte einen Sieg der Vandalen.
Voraus den heimkehrenden Scharen wogten die dichten Haufen karthagischen Pöbels, lärmend, oft zurückschauend oder Halt machend mit lautem Geschrei; viele drängten sich bettelnd, Gaben heischend, an die vandalischen Krieger. Diese waren sämtlich beritten: und zwar auf trefflichen, zum Teil sehr edeln Rossen: Mischlingen des aus Spanien mitgebrachten, hochberühmten Schlages und der vorgefundenen einheimischen Zucht.
Die Abendsonne flutete durch das weitgeöffnete »Westthor« herein und die »numidische« Straße entlang: hell glitzerten und gleißten in diesem grellen Licht, das der weiße Sandboden und die weißen Häuser blendend zurückwarfen, blitzend funkelten die stolzen Geschwader. Denn reich, überreich, bis zur Überladung, glänzten Gold und Silber an den Helmen und Schilden, an den Brünnen, an den nackten Armen in breiten Ringen, an den Schwertgriffen und Schwertscheiden, sogar an den Beschlägen, welche die Lanzenspitzen an die Schäfte befestigten, und, in eingelegter Arbeit, an den Schäften selbst. An Gewandung, Ausrüstung, Schmuck der Reiter und der Rosse waren überall die schreiendsten Farben sichtlich die meist beliebten: Scharlach, die Stammfarbe der Vandalen, herrschte vor: überall war dies brennende Hellrot angebracht: an den langflatternden Mänteln, an den seidenen Helmtüchern, welche, zum Schutz gegen die Wüstensonne, von den Sturmhauben nach rückwärts auf Nacken und Schultern fielen, an den buntbemalten reichvergoldeten Köchern, aber auch an Sattelzeug, Decken und dem Aufgezäum der Pferde. Unter dem Pelzwerk, welches die Tiere der Wüste in reicher Auswahl boten, war bevorzugt die gesprenkelte Antilope, der gescheckte Leopard, der gestreifte Tiger und von den Helmspitzen nickten und wogten des Flamingo dunkelrosa, des Straußen weiß Gefieder. Den Schluß des Zuges bildeten einige erbeutete Kamele, mit erbeuteten Waffen hochbeladen, und etwa hundert gefangene Mauren, Männer und Weiber: die schritten, die Hände auf den Rücken gebunden, nur von braun- und weißgestreiften Mänteln verhüllt, barhäuptig und barfüßig, einher neben den hochragenden Tieren, gleich diesen manchmal vorwärts getrieben mit Speerschaftschlägen von ihren blondhaarigen Wächtern hoch zu Roß.
Auf den Stufen der Basilika und auf den breiten Mauergesimsen der Hafentreppen drängten sich die Schaulustigen besonders dicht: von hier konnte man den glänzenden Aufzug bequem überblicken, ohne Gefährdung durch die feurigen Rosse. »Wer ist der Jüngling da, der Blonde, Gastfreund?« So fragte, über die Mauerbrüstung deutend, ein Mann mittlerer Jahre, in Tracht und Ansehn eines Seefahrers, einen grauhaarigen Alten an seiner Seite. »Welchen meinst du, Freund Hegelochos? Blond sind sie ja fast alle.« – »So? Nun, ich bin zum erstenmal bei den Vandalen! Ging doch erst vor wenigen Stunden mein Schiff vor Anker. Du mußt mir alles zeigen und erklären. Ich meine den dort, auf dem weißen Hengst, – der die schmale rote Fahne trägt mit dem goldnen Drachen.« – »Ah, das ist Gibamund, ›der schönste der Vandalen‹, wie ihn die Weiber nennen. – Siehst du, wie er hinaufspäht nach den Fensterbogen des Prinzenhauses da oben auf dem Kapitol? Unter all' den vielen Gestalten, die von dort herniederschauen, sucht er nur Eine.« – »Aber« – und der Frager fuhr wie betroffen zusammen – »wer ist jener – zu seiner Rechten – der auf dem Falben? Ich erschrak fast, da mich sein Auge plötzlich traf – er sieht dem Jüngling ähnlich: – nur viel älter ist er.« – »Das ist sein Bruder: das ist Gelimer! Gott segne sein edles Haupt.« – »Ei, dieser also ist der Held des Tages? Ich habe seinen Namen schon daheim in Syrakus oft gehört. Der also ist der Besieger der Mauren?« – »Ja, er hat sie wieder einmal geschlagen, diese Plagegeister, wie schon oft. – Hörst du, wie ihm die Karthager zujauchzen? Auch wir Bürger haben ihm zu danken, daß er jene Räuber von unsern Villen und Feldern hinweg in ihre Wüste scheucht.« – »Er ist wohl fünfzig Jahre? – Sein Haar ist schon stark grau.« – »Noch nicht vierzig ist er!« – »Schau doch, Eugenes! Plötzlich springt er ab – was thut er?« – »Sahst du es nicht? Ein Kind, ein römischer Knabe, der vor seinem Pferd vorüberlaufen wollte, ist gefallen: – er hebt ihn auf: hoch hält er ihn in den Armen.« – »Er prüft, ob er verletzt.« – »Es ist unversehrt, das Kind: es lächelt ihn an: es greift nach seiner glänzenden Halskette.« – »Und wahrhaftig! Er löst sich die Kette ab: er giebt sie dem Kleinen in die Hände.« – »Er küßt ihn – er reicht ihn der Mutter in die Arme.« – »Horch, wie ihm das Volk zujauchzt! Nun springt er wieder in den Sattel.« – »Der versteht sich drauf um Gunst zu buhlen.« – »Da thust du ihm Unrecht. So ist sein Herz geartet. Nicht anders hätt' er all' das gethan, wo ihn kein Auge sah. Und er hat's nicht nötig, um die Gunst des Volks zu buhlen: er hat sie längst.« – »Bei den Vandalen.« – »Auch bei den Römern! Das heißt: bei uns mittleren und bei den geringen Leuten. Die Senatoren freilich! Sofern noch welche leben in Afrika, hassen sie alles, was Vandale heißt: haben auch allen Grund dazu! Aber Gelimer hat ein Herz für uns: er hilft, wo er kann, und wehrt gar oft seinen Volksgenossen, die fast alle üppig, gewaltthätig, heißzornig und dann, im Zorn, auch wildgrausam sind. – Und ich vor andern habe Grund, ihm heiß zu danken.« – »Du? Warum?« – »Du sahest bereits, ehe wir mein Haus verließen, Eugenia, meine Tochter?« – »Gewiß! Wie hold ist das zarte, fast allzu zarte Kind, seit du es mit nach Syrakus gebracht vor Jahren, zum Mädchen aufgeblüht.« – »Gelimer dank' ich ihr Leben, ihre Ehre. Schon hatte sie Thrasarich, der Riese, der unbändigste dieser Edelinge, der der Scheuen lange nachgestellt, hier auf offener Straße, am hellen Mittag, von meiner Seite gerissen und lachend auf seinen Armen die Schreiende davongetragen: – ich vermochte nicht, so rasch zu folgen als er rannte, – da eilte Gelimer, durch unser Geschrei gerufen, herzu: da der Wilde nicht losließ, streckte er ihn nieder mit einem Faustschlag und gab mir mein schreckbetäubtes Kind zurück.« – »Und der Entführer?« – »Der stand auf, schüttelte sich, lachte, sprach zu Gelimer: ›Recht hast du gethan, Asdinge. Und stark ist deine Faust.‹ – Und dann, seither –« – »Nun? – Du stockst.« – »Ja, denke nur: seither wirbt der Vandale, da er sie mit Gewalt nicht gewinnen konnte, ganz bescheidentlich um meiner Tochter Hand. – Er, der reichste Edeling seines Volkes, will mein Eidam werden.« – »Höre, das ist keine schlechte Versorgung.« – »Fürstin Hilde, meiner Kleinen hohe Gönnerin: – gar oft bescheidet sie mein Kind zu sich aufs Kapitol und reich bezahlt sie der Kleinen kunstvolle Stickereien – Frau Hilde selber redet ihm das Wort. Ich aber – ich schwanke; – keinesfalls will ich mein Kind zwingen und Eugenia ... –« – »Nun, was sagt die Kleine?« – »Ei, der Barbar ist bildhübsch! Ich glaube fast – ich fürchte – er gefällt ihr. Aber irgend etwas hält sie ab – wer kennt ein Mädchenherz? – Sieh, da steigen die Führer der Reiter ab – auch Gelimer – vor der Basilika.« – »Seltsam. Er ist doch der Gefeierte – es widerhallt der weite Platz von seinem Namen – und er – er sieht so ernst – ja traurig drein.« – »Ja, jetzt wieder! Aber sahest du, wie freundlich sein Antlitz strahlte, da er das erschrockene Kind beschwichtigte?« – »Wohl sah ich's. Und nun« – »Ja, er hat das an sich: plötzlich fällt's wie schwarz Gewölk auf ihn. Im Volke gehn deshalb allerlei Reden. Er hat einen Dämon in sich, sagen die einen. Er ist manchmal gestört, meinen die andern. Und unsre Priester flüstern: es sind Gewissensqualen wegen geheimer Frevelthaten. Aber das glaub' ich nie und nimmer von Gelimer.« – »War er von jeher so?« – »Es ist schlimmer geworden vor ein paar Jahren. Da soll ihm, in der Einsamkeit der Wüste – beschirme uns der heilige Cyprian! – Satanas erschienen sein. Seither ist er noch frömmer als zuvor. Siehe, da begrüßt ihn an der Basilika sein nächster Freund.« – »Der Priester dort? 's ist ein arianischer: – ich kenn' es an der schmalen, länglichen Tonsur.« »Ja,« zürnte der Karthager, »Verus ist's, der Archidiakon! Fluch ihm, dem Verräter!« Und er ballte beide Fäuste, »Verräter! Weshalb?«– »Nun, oder doch: Abtrünniger. Er stammt ja aus einer alten römischen Senatorenfamilie, die der Kirche schon gar manchen Bischof gegeben hat. Sein Großoheim war der Bischof Laetus von Nepte, der den Martyrtod gestorben ist. Aber auch sein Vater, seine Mutter, sieben Geschwister sind unter einem früheren König unter den furchtbarsten Foltern lieber gestorben, als daß sie ihren heiligen katholischen Glauben verleugnet hätten. – Auch dieser dort – er war damals etwa zwanzig Jahre – ward gefoltert, bis er für tot hinfiel. Als er wieder zu sich kam, da – schwur er den rechten Glauben ab: er ward Arianer, ward Priester – der Elende! – das Leben zu erkaufen! Und bald – denn der Satan hat ihm hohe Geistesgaben verliehen – stieg er von Stufe zu Stufe – ward der Asdingen, des Hofes Günstling, plötzlich sogar Freund des edeln Gelimer, der ihn lange kühl und verächtlich sich ferngehalten hatte. Und der Hof gab ihm diese Basilika, unser höchstes Heiligtum – des großen Cyprianus Weihtum, das, wie fast alle Kirchen in Karthago, die Ketzer uns entrissen haben.«
»Aber sieh – der Gefeierte – was beginnt er da? Er kniet nieder auf der obersten Stufe der Kirche. Er nimmt den Helm ab.« – »Er streut den Staub der Marmortreppe auf sein Haupt.« – »Was küßt er da? Des Priesters Hand?« – »Nein, die Kapsel mit der Asche des großen Schutzheiligen. Er ist gar fromm. Und sehr demütig. Oder – wie soll ich sagen? – sich selbst demütigend. Er sperrt sich tagelang zu den Büßermönchen, sich zu kasteien.« – »Ein seltsamer Kriegsheld barbarischen Bluts!« – »Das Heldenblut zeigt sich gleich darauf wieder in heißer Schlacht. – Er steht auf. – Siehst du, wie sein Helm – jetzt setzt er ihn wieder auf – zerhackt ist von frischen Hieben? Und der eine der beiden schwarzen Geierflügel auf dem Helmkamm ist durchhauen. – Aber das sonderbarste ist: dieser Kriegsmann ist zugleich ein Bücherwurm, ein Grübler in mystischer Weisheit: die Philosophen zu Athen hat er gehört. Er ist ein Theolog und –« – »Ein Lyraschläger, wie es scheint, dazu! Schau, ein Vandale hat ihm eine kleine Lyra gereicht.« – »Das ist eine Harfe, wie sie's nennen.« – »Horch, er greift in die Saiten! Er singt: ich kann es nicht verstehn.« – »Es ist vandalisch.« – »Er ist zu Ende. Wie sie jauchzen, seine Germanen! Sie schlagen die Speere an die Schilde. – Er steigt die Stufen wieder hinab. Wie? Ohne in die Kirche zu gehen, wie doch die andern thaten?« – »Richtig, ich erinnere mich! Er hat gelobt, wann er Blut vergossen, drei Tage lang die Schwelle der Heiligen zu meiden. – Nun steigen sie alle wieder auf, die Reiter.« – »Aber wo bleibt das Fußvolk?« – »Ja, das ist schlimm – das heißt für sie. Sie haben keines. Oder fast gar keines: sie sind so stolz nicht nur, so faul und weichlich sind sie geworden, daß sie den Dienst zu Fuß verschmähen. Nur die allerärmsten, geringsten geben sich dazu her. Die Masse des Fußvolks besteht aus maurischen Söldnern, die sie für jeden einzelnen Feldzug anwerben bei befreundeten maurischen Stämmen.« – »Ah ja, da seh ich auch Mauren unter den Kriegern.« – »Das sind die Leute vom Papuagebirge. Gelimer hat sie gewonnen. Lange plünderten auch sie unsere Grenzen. Gelimer überfiel ihr Lager und nahm dabei die drei Töchter ihres Häuptlings Antallas gefangen: unversehrt, ohne Lösegeld gab er sie zurück. Da lud Antallas den Asdingen, ihm zu danken, zu sich in sein Zelt: sie schlossen Gastfreundschaft – den Mauren das heiligste Band – und seither leisten sie treue Waffenhilfe, auch gegen andere Mauren. – Der Aufzug ist nun zu Ende. Sieh, die Reihen lösen sich. Die Führer begeben sich aufs Kapitol, König Hilderich den Bericht und die Beute des Sieges zu überbringen. Schau, das Volk verläuft sich. Laß auch uns nun gehen. Komm in mein Haus zurück. Eugenia wartet auf uns mit dem Abendschmause. Komm, Hegelochos.« – »Ich folge, wirtlichster der Gastfreunde. Ich werde dir sehr lange zur Last fallen, fürcht' ich! Die Geschäfte mit den Kornverkäufern fordern Zeit.« – »Was bleibst du stehn? Was schaust du um!« – »Ich komme schon! – Nur einmal noch mußte ich das Antlitz dieses Gelimer betrachten. – Muß immer an diese wundersamen Züge denken! Und an all' das Seltsame, Widerstreitende, das du von ihm erzählt.« – »Es geht den meisten so mit ihm. Er ist rätselhaft, unfaßlich – »daimonios«, wie der Grieche sagt. – Gehn wir nun! Hierher! Links – die Stufen hinab.«
III
Hoch oben, auf dem Kapitolium der Stadt, ragte das Palatium, der Königspalast der Asdingen: nicht ein einzelnes Haus, vielmehr ein ganzer Inbegriff von Gebäuden.
Ursprünglich angelegt als »Akropolis«, als Hochstadt, Hochfeste, zur Beherrschung der Unterstadt und zur Ausschau über die beiden Häfen hin über die See, war das umfassende Bauwerk von Geiserich und dessen Nachfolgern nur wenig verändert worden: der Palast sollte Burg bleiben und geeignet, die Karthager im Zaum zu halten. Ein schmaler Aufstieg führte von dem Hafenquai empor: er mündete in einem engen, festgemauerten, von einem Turm überhöhten Festungsthor. Aus diesem Thore gelangte man in den viereckigen, einem weiten Hofe vergleichbaren Platz, der auf allen Seiten von den zum Palast gehörigen Bauten umschlossen war: die Nordseite, nach dem Meere zu, füllte das »Königshaus«, in welchem der Herrscher selbst mit seiner Sippe wohnte: die Keller desselben führten tief in die Burgfelsen hinunter: oft und oft hatten sie als Kerker, zumal für Staatsverbrecher, gedient. Auf der Ostseite des Königshauses, nur durch einen schmalen Zwischenraum von ihm getrennt, lag das »Prinzenhaus«, diesem gegenüber das Zeughaus; die nach der Stadt geneigte Südseite war durch die Festungsmauer, deren Thor und Turm gesperrt.
Im Erdgeschosse des Prinzenhauses bildete den stattlichsten Raum eine reichgeschmückte, säulengetragene Halle. In ihrer Mitte, auf einem Citrustische, prangte ein hoher, eherner, reichvergoldeter Henkelkrug und mehrere Becher verschiedener Formen: stark duftete daraus der dunkelrote Wein. Ein Ruhebett, mit einem Zebrafell bespreitet, stand daneben.
Auf demselben saßen, in traulichster Umschlingung dicht aneinander geschmiegt, »der Schönste der Vandalen« und ein wahrlich nicht minder schönes junges Weib. Den Helm, geschmückt mit den silberglänzenden Schwungfedern des weißen Reihers, hatte der Jüngling abgelegt: frei flutete das dunkelblonde Gelock in langen Ringen auf seine Schultern: es mischte sich dabei mit dem ganz hellgelben, fast weißen, frei vom Wirbel fallenden Haar der jungen Frau, die eifrig bemüht war, ihm die schwere Brünne zu lösen: sie ließ nun die klirrende zu Helm und Schwertgurt niedergleiten auf den Marmor-Estrich des Saales. Sie strich ihm jetzt, den liebevollen Blick an seinem edeln Antlitz weidend, mit beiden weichen Händen die vordrängenden Locken aus den Schläfen und sah ihm dann freudestrahlend in die fröhlichen, lachenden Augen.
»Hab' ich dich wieder? Halt' ich dich in meinen Armen?« sprach sie leise, verhalten, innig, beide Arme auf seine Schultern legend und die Hände auf seinem Nacken faltend. »O du viel Süße!« rief er entgegen, riß sie an das hochklopfende Herz und bedeckte ihr Augen und Wangen und die schwellenden Lippen mit brennenden Küssen. »O Hilde, mein Glück, mein Weib! Wie hat mich dein verlangt! Wie sehnte ich mich nach dir – Nacht und Tag – immerdar!« »Es sind fast vierzig Tage,« seufzte sie. »Volle vierzig. – Ach, wie ward mir's lange!« – »O du, du hattest es viel leichter! Mit dem Bruder, mit den Genossen, dich tummeln, lustig reiten und fröhlich streiten in Feindesland! – Ich aber! – Ich mußte hier sitzen – im Frauengemach! – Sitzen und weben und harren – thatenlos. Ach hätt' ich dabei sein dürfen! – An deiner Seite dahinjagen auf feurigem Roß, neben dir reiten und fechten und endlich – zugleich mit dir – fallen. Nach Heldenleben – ein Heldentod!« Sie sprang auf: die graublauen Augen blitzten wundersam: sie warf das wogende Haar in den Nacken und hob beide Arme begeistert empor.
Zärtlich zog sie der Gatte wieder zu sich nieder. »Mein hochgemutes Weib, meine Hilde,« lächelte er. »Mit weissagendem Sinn hat dein Ahn dir den Namen gekoren nach der Walküren herrlicher Führerin. Wie dank ich ihm so viel, des großen Gotenkönigs Waffenmeister, dem alten Hildebrand! Mit dem Namen ging die Artung auf dich über. Und seine Zucht und Lehre that wohl das Beste.« Hilde nickte: »Die frühverstorbenen Eltern hab' ich kaum gekannt. Solang ich denken konnte, wußte ich mich in des weißbärtigen Helden Schutz und Pflege: in dem Palast zu Ravenna schloß er mich in seinen Gemächern eifrig, eifersüchtig ab von den frommen Schwestern, den Religiösen, und von den Priestern, welche meine Jugendgenossinnen – so die schöne Mataswintha – erzogen. Mit seinem andern Pflegling, dem frühverwaisten, dunkellockigen Teja, zusammen wuchs ich auf. Freund Teja lehrte mich Harfe schlagen, aber auch Speere werfen und Speere fangen mit dem Schild. Und später, da der König und mehr noch seine Tochter Antalaswintha, die hochgelehrte Frau, darauf bestanden, daß ich bei Frauen und bei Priestern lerne, – wie mürrisch doch« – sie lächelte bei der Erinnerung – »wie brummig dazwischen durch scheltend der Urgroßvater mir abends abfragte, was mich den Tag über die Nonnen gelehrt! Hatte ich die Sprüche und lateinischen Lieder aufgesagt – etwa das »Deus pater ingenite« oder – von Sedulius – »Salve sancta parens« – mehr als die Anfänge weiß ich kaum mehr!« – lachte sie fröhlich – »dann schüttelte er wohl das mächtige Haupt, schalt leise in den langen, weißen Rauschebart und rief: »Komm, Hilde! Ins Freie! Komm ans Meer! Dort erzähl' ich dir von den alten Göttern und den alten Helden unsres Volkes!« Dann führte er mich weit, weit von dem volkreichen Hafen in die Einsamkeit eines öden, wilden Werders, wo die Möwen kreischten und der Wildschwan nistete im Meerschilf: – da setzten wir uns auf den Sand und während die weißschäumigen Wellen bis dicht an unsere Füße rollten, erzählte er! Und wie erzählte er, der alte Hildebrand! Daß mein Auge nur an seinen Lippen hängen konnte, wie ich, beide Ellbogen auf seine Kniee gestützt, zu ihm emporschaute. Wie blitzte dann sein meergraues Auge, wie flog sein weißes Haar im Abendwind! Seine Stimme bebte in Begeisterung: – er wußte gar nicht mehr, wo er weilte: er sah das alles, was er sprach, oft – abgerissen – sang. Und war er dann zu Ende, so erwachte er wie aus einem Traumgesicht, sprang auf und lachte dann wohl vergnüglich, mir über das Haupt streichend: »So! so! Nun Hab' ich sie dir wieder aus der Seele geblasen, die Heiligen, mit ihrer dumpfen, süßlichen Sanftheit, wie der Nordwind durchs offene Kirchenfenster den Weihrauchqualm verbläst.« Aber sie hatten schon vorher nicht recht gehaftet,« lächelte sie.
»Und so wuchsest du auf,« sprach er, den Finger drohend erhebend, »als halbe Heidin, wie Gelimer dich schilt. Aber als ganze Heldin, die an nichts so völlig glaubt als an ihres Volkes Herrlichkeit.« »Und an die deine – und an deine Liebe!« hauchte sie innig und küßte ihn auf die Stirne, – »Doch wahr ist es,« fuhr sie fort: – »Wäret ihr Vandalen nicht meiner Goten nächste Stammgenossen, – ich weiß nicht, ob ich dich hätte lieben können – ach nein: lieben müssen! – als du, von Schwager Gelimer gesendet, kamst um mich zu werben. So aber: dich sehen und dich lieben, das war eins! Gelimer dank' ich den Geliebten und all' mein Glück! – Stets will ich daran denken: das soll mich an ihn binden, wenn sonst,« fügte sie langsam, sinnend bei, »mich manches beinah heftig abstoßen will von ihm.«
»Der Bruder wollte durch diesen Ehebund die Verfeindung lösen, die Kluft überbrücken, welche seit – seit jener blutigen That Hilderichs beide Reiche trennt. Es ist nicht gelungen! Nur uns, nicht unsre Völker hat er einen können. – Er ist voll schwerer Sorgen, voll finsterer Gedanken.« »Ja: oft mein' ich: er ist siech,« sprach sie kopfschüttelnd. »Er? – Der stärkste Held unsres Heeres! Nur er – kaum Bruder Zazo noch – biegt mir den ausgestreckten Schwertarm.« – »Nicht krank am Leib –, siech an der Seele. – Aber still: da kommt er. Sieh, wie traurig, wie düster! – Ist das die Stirn, das Antlitz eines Siegers?«
IV
In dem Säulengange, der aus dem Inneren des Hauses zu dem offenen Thürbogen der Halle führte, ward nun sichtbar eine hohe Gestalt, die langsam näher kam.
Der Mann, ohne Helm, ohne Brünne und Schwertgurt, trug ein anliegendes, dunkelgraues Gewand, sonder Farbenzier, sonder allen Schmuck. Er blieb in dem zögernden Vorschreiten manchmal stehen, wie in grübelndes Sinnen versunken, die beiden Hände auf dem Rücken gekreuzt; das Haupt hing, wie von schweren Gedanken belastet, leise vornüber – die hohe Stirn war tief gefurcht; in das lichte Braun von Haar und Bart hatte sich reichlich Grau gemischt in seltsamem Widerspruch zu der sonst noch jugendlichen Erscheinung. Die Augen waren fest auf den Boden geheftet, ihre Farbe, ihr Ausdruck war so noch unerkennbar; unter dem Säulenbogen des Eingangs blieb er wieder stehen; er seufzte.
»Heil dir, Gelimer, siegreicher Held!« rief ihm die junge Frau freudig entgegen. »Nimm, was ich für dich bereit gelegt, seit euere Heimkehr für heute verkündet ward.« Sie griff nach einem reichen Kranze frisch gepflückter Lorbeern, der vor ihr auf dem Tische lag, und hob ihn ungestüm empor. Eine Handbewegung, leise, aber sehr ausdrucksvoll, wies sie zurück. »Nicht Kränze gehören auf das Haupt des Sünders,« sprach der Eintretende mit gedämpfter Stimme: – »Asche, Asche!«
Traurig, gekränkt, legte Hilde den Kranz nieder. »Sünder?« rief ihr Gatte unwillig. »Nun ja: wir sind es alle – vor den Heiligen. Aber du wahrlich am wenigsten. Sollen wir uns deshalb nie mehr freuen?« – »Freue sich, wer sich freuen kann.«
»O Bruder, du kannst es auch! Wenn der Heldengeist über dich kommt, wenn dich der fröhliche Reiterkampf umwirbelt, – mit Jauchzen – ich hab' es wohl gehört und mein Herz frohlockte über deine Freude! – mit lautem Jubel sprengtest du, uns allen voran, in der maurischen Lanzenreiter dichtesten Knäuel. Und hellauf schriest du vor Lust, da du dem gestürzten Bannerträger die Fahne rissest aus der Hand: – du hattest ihn niedergeritten nur durch deines Rosses Anprall!« »Hei ja, das war schön!« rief Gelimer, plötzlich das Haupt emporschnellend. Und nun schossen aus dunkeln langen Wimpern hervor zwei mächtige gelbbraune Augen leuchtende Blitze. »Nicht wahr, der Falb' ist prächtig? Er rennt alles über den Haufen. Er trägt den Sieg!« »Ja, wenn er Gelimer trägt!« scholl da von seitwärts eine helle Stimme: und ein Knabe, – noch war er kein Jüngling zu nennen: noch sproßte kaum der erste Flaum auf den mädchenhaft zarten, rosig angehauchten Wangen, – ein Knabe, Gibamund wie Gelimer sehr ähnlich, in weißem Seidengewand und lichtblauem flatternden Mantel, hüpfte über die Schwelle und eilte auf Gelimer zu mit ausgebreiteten Armen. »O Bruder, wie ich dich lieb habe! Und wie ich dich beneide! Aber auf die nächste Maurenjagd mußt du, – du mußt! – mich mitnehmen! Sonst geh ich gegen deinen Willen mit!« Und er umschloß mit beiden Armen des hochragenden Bruders Brust.
»Ammata, mein Liebling, mein Herzenskleinod!« rief dieser weich und warm und streichelte zärtlich des Knaben langes, goldblondes Gelock. – »Ich habe dir ein milchweiß Rößlein mitgebracht – ein windschnelles – aus der Beute. Gleich hab' ich dein gedacht, da es mir vorgeführt ward. Und du, holde Schwägerin, vergieb mir. – Ich war unfreundlich, als ich eintrat. Ich war voll düsterer Sorgen. Denn ich kam...« »Vom König,« rief eine tiefe dröhnende Stimme von dem Säulengange her und in vollen klirrenden Waffen stürmte herein ein Mann, den die große Ähnlichkeit sofort als den vierten Bruder verriet. Sehr langgestreckte, edle Züge, eine scharf, aber feingebogene Nase, eine freie Stirn und, unter hochgeschwungenen Brauen fast allzutief geborgen, gelbbraune, feurig funkelnde Augen waren ihnen allen eigen, diesen königlichen, dem Sonnengotte Freir entstammten Asdingen.
Nur Gelimers Blick war – regelmäßig – gedämpft, wie umflort, verträumt, wie ins Ungewisse verloren; aber flackerte dieser Blick dann plötzlich auf im Feuer der Begeisterung oder des Zornes, dann erschreckte seine gewaltige Glut; und das schmale Oval des Antlitzes, das bei allen von Fülle weit entfernt war, schien bei Gelimer fast allzuhager geraten.
Der eben Eingetretene war etwas kleiner als dieser, aber viel breiter an Brust und Gliedern; auf dem starken Nacken ruhte ein hoch aufrecht getragenes Haupt, von kurzem, braunem Kraushaar dicht umgeben; die Wangen waren von Gesundheit, von Lebensfreude, jetzt von heftigem Zorn gerötet: obwohl nur ein Jahr jünger als Gelimer, erschien er doch noch als ein feuriger Jüngling gegenüber dem weit über seine Jahre hinaus Gealterten. In hellem Unmut warf er die schwere Sturmhaube, von der die krummen Hörner des afrikanischen Büffelstiers herabdräuten, auf den Tisch, daß der Wein aus den Bechern spritzte. »Von Hilderich,« wiederholte er, »dem Undankbarsten der Menschen! Was war des Helden Lohn für den neuen Sieg? Mißtrauen! Furcht, Eifersucht zu wecken in Byzanz. Der Feigling! Schöne Schwägerin, du hast mehr Heldentum in deiner kleinen Zehe, als dieser König der Vandalen im Herzen und in der Schwerthand. Gieb mir einen Becher Grassiker, den Zorn hinunterzuspülen.« Hilde sprang hurtig auf, schenkte ein und bot ihm den greifengehenkelten Becher: »Trink, tapferer Zazo! Heil dir und allen Helden und ... –« »In die Hölle mit Hilderich,« schrie der Grimmige und stürzte den tiefen Becher hinab auf einen Zug.
»Still, Bruder! Welcher Frevel!« mahnte Gelimer, dessen Stirn sich umwölkte. »Nun, meinetwegen in den Himmel mit ihm! Dahin taugt er viel besser als auf Meerkönig Geiserichs Thron.« »Du sagst ihm da ein hohes Lob,« erwiderte Gelimer. »Nicht meine Absicht! – Als ich daneben stand, wie er dir Bescheid gab, so mißgnädig, ich hätte ihm ... –! Allein das Schelten auf ihn thut's nicht mehr. Es muß gehandelt werden! – Aus guten Gründen blieb ich diesmal zu Hause: ward mir schwer genug, dich allein siegen zu lassen! Aber ich hab' ihn im geheimen scharf überwacht, diesen Fuchs im Purpur, und ich bin hinter seine Schliche gekommen. Schick' dieses verliebte Ehepaar fort – ich glaube, sie haben sich viel allein zu sagen: sind ja erst ein Jahr beisammen! – auch Ammata, das Kind: und höre meinen Bericht, meinen Verdacht, meine Anklage: nicht nur gegen den König, – auch gegen andere.«
Gibamund schlang zärtlich den Arm um sein schlankes Gemahl: der Knabe sprang den Gatten voraus aus der Halle.
V
Gelimer ließ sich auf das Ruhebett gleiten; Zazo trat vor ihn, stützte sich auf sein Langschwert und hob an: »Also! – Bald nachdem du ins Feld gezogen, traf Pudentius aus Tripolis in Karthago ein.« – »Schon wieder?« – »Ja, der steckt jetzt gar oft im Königsbau! Stundenlang verhandelt er – allein – mit dem König, Oder mit Euages und Hoamer, des Königs übermütigen Neffen, unsern lieben Vettern. Der letztere, der hochfahrende Tollkopf, kann nicht schweigen nach dem Wein. Im Rausch hat er ausgeplaudert.« – »Aber doch gewiß nicht – dir.« – »Nein! Aber dem roten Thrasarich.« – »Dem Wildling!« »Ich lobe seine Sitten nicht,« lachte der andre. »Obwohl er viel zahmer geworden, seit er ganz sittsam wirbt um die zierliche Eugenia. Aber gelogen hat der noch nie. Und er läßt sich totschlagen für sein Vandalenvolk. Und zumal für dich, den er seinen Erzieher nennt! Du fingst die Erziehung mit dem Hauen an! – Im Hain der Venus ... –« »Der heiligen Jungfrau, willst du sagen,« verwies Gelimer. »Wenn es dir Vergnügen macht – gern! Aber sie erlebt wenig Ehre dran, solang der Ort die alten Sitten beibehält. – Also: bei einem Gelag in der Muschelgrotte jenes Hains, da Thrasarich dich lobte und meinte, du werdest den Kriegsruhm der Vandalen erneuen, sobald du König geworden, da schrie Hoamer wütig: ›Nie! Niemals wird das geschehen! Byzanz hat es verboten. Gelimer ist ein Feind des Kaisers. Stirbt mein Ohm, so werd' ich König. Oder der Kaiser bestellt Pudentius zum Reichsverweser. So ist es zwischen uns beredet und beschlossen‹.« – »Das war im Rausch gesprochen.« – »Im Wein – und in dem ist Wahrheit, sagen die Römer. Da kam Pudentius des Weges in die Grotte: ›Ha,‹ rief der Trunkene ihn an, ›dein letzter Brief – vom Kaiser – war wieder goldwert. Warte nur, bin ich erst König, will ich dir's lohnen – du wirst Exarch des Kaisers in Tripolis.‹ Pudentius erschrak gar sehr und winkte ihm mit den Augen, zu schweigen: aber der fuhr fort: ›Nein, nein! das ist dein wohlverdienter Lohn!‹ Und all' das erzählte mir Thrasarich, von dem Gelage hinwegstürmend, in frischem Zorn. Aber warte nur: es kommt noch besser! Dieser Pudentius: – hältst du ihn für unsern Freund?«
»O nein,« seufzte Gelimer. »Seine Großeltern, seine Eltern, wurden von unsern Königen grausam getötet, weil sie ihrem Glauben treu blieben. Wie sollte der Enkel, der Sohn uns lieben?«