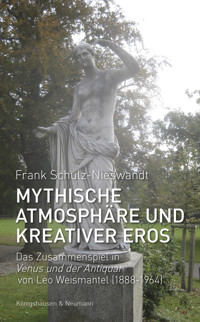Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zahlreiche Bundesförderprogramme erklären bürgerschaftliches Engagement zum zentralen gesellschaftspolitischen Thema. So ist Hilfe zur Selbsthilfe ein aktuelleres Thema denn je. Mit der politischen Idee der Seniorengenossenschaft werden traditionelle Formen der Solidarität wiederentdeckt. Bürgerinnen und Bürger organisieren auf der Basis von Zeitgutscheinen gegenseitige Hilfen im Alltag und Gesellungsveranstaltungen. Anhand von Biographien von in Seniorengenossenschaften aktiven Menschen werden Verlaufsformen und Sinnorientierung des Engagements gezeigt. Ergänzend wird der Entscheidungsprozess, wie aus Engagementpotenzial tatsächliches Engagement wird, offengelegt. Das Buch richtet sich gleichsam an Experten wie Praktiker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zahlreiche Bundesförderprogramme erklären bürgerschaftliches Engagement zum zentralen gesellschaftspolitischen Thema. So ist Hilfe zur Selbsthilfe ein aktuelleres Thema denn je. Mit der politischen Idee der Seniorengenossenschaft werden traditionelle Formen der Solidarität wiederentdeckt. Bürgerinnen und Bürger organisieren auf der Basis von Zeitgutscheinen gegenseitige Hilfen im Alltag und Gesellungsveranstaltungen. Anhand von Biographien von in Seniorengenossenschaften aktiven Menschen werden Verlaufsformen und Sinnorientierung des Engagements gezeigt. Ergänzend wird der Entscheidungsprozess, wie aus Engagementpotenzial tatsächliches Engagement wird, offengelegt. Das Buch richtet sich gleichsam an Experten wie Praktiker.
Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt ist Professor für Sozialpolitik und Direktor des Seminars für Sozialpolitik an der Universität zu Köln, Dr. Ursula Köstler ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Ursula Köstler Frank Schulz-Nieswandt
Genossenschaftliche Selbsthilfe von Senioren
Motive und Handlungsmuster bürgerschaftlichen Engagements
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten © 2010 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-021040-0
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028158-5
mobi:
978-3-17-028159-2
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Netzwerke zur Lösung sozialer Probleme
1.1 Netzwerke als Form und als Norm
1.1.1 Zwei idealtypische Formen von Netzwerkbeziehungen
1.1.2 Realtypische Formen von Netzwerkbeziehungen
1.1.3 Motivik des Gebens und die Qualität von Netzwerkbeziehungen
1.1.4 Reziprozität und Gabe
1.2 Hilfe zur Selbsthilfe
1.2.1 Bürgerschaftliches Engagement
1.2.2 Die Idee Seniorengenossenschaft
2 Vorgehen des Forschungsvorhabens
2.1 Forschungsfragestellung
2.2 Ziel und Verwendungszusammenhang
2.3 Forschungsdesign
2.4 Ablaufplan des Forschungsprozesses
2.5 Keine Seniorengenossenschaften in Ostdeutschland
2.6 Qualitative Erhebung
2.6.1 Herangehensweise
2.6.2 Interviewleitfaden
2.6.3 Ergänzender Fragebogen
2.7 Die Befragung
2.7.1 Seniorenhilfe Langen
2.7.2 Erweiterte Befragung ehrenamtlich Tätiger
3 Beschreibung der Untersuchungseinheit der Befragung der Mitglieder der Seniorengenossenschaft
3.1 Engagementfelder bis zum Eintritt in die Seniorengenossenschaft
3.2 Zeitpunkt des Eintritts in die Seniorengenossenschaft
3.3 Altersstruktur der Interviewpartner
3.4 Einige Lebenslagedimensionen der Befragten
3.4.1 Finanzielle Situation
3.4.2 Wohnen
3.4.3 Familiale Netzwerke
3.4.4 Außerfamiliale Netzwerke
3.5 Besonderheiten des Interviewmaterials
3.6 Zusammenhang zwischen Zufriedenheit, Gesundheit und Engagement
4 Entscheidungsprozess für den Eintritt in eine Seniorengenossenschaft und die dortige Aufnahme eines Engagements anhand von Entscheidungsbäumen
4.1 Der Entscheidungsprozess aus der Sicht des Individuums
4.2 Entscheidung: Eintritt in die Seniorengenossenschaft
4.2.1 Ereignisse
4.2.2 Statuspassagen
4.3 Entscheidung: Engagement oder kein Engagement
4.3.1 Intrinsische Motivation
4.3.2 Extrinsische Motivation
4.3.3 Crowding-in der Motivation
5 Handlungslogiken der Seniorengenossenschaftler
5.1 Einbettung des Entscheidungsprozesses in erworbene Handlungsmuster
5.2 Vorgehen bei der Auswertung der Handlungslogiken
5.3 Arbeitshypothese
5.4 Einzelfallrekonstruktionen des Typus sinnsuchender Idealist
5.4.1 Suchen und Finden der Heimat: Herr Kempf
5.4.2 Suchen und Finden von Erfolgserlebnissen: Herr Breitenstein
5.4.3 Strukturierung des Rentnerlebens: Herr Belz
5.4.4 Zusammenfassende Übersicht des Typus sinnsuchender Idealist
5.5 Einzelfallrekonstruktionen des Typus Krisen-Manager
5.5.1 Suche nach Abwechslung: Frau Reindl
5.5.2 Ablenkung in einer krisenbehafteten Lebenslage: Frau Holst
5.5.3 Suchen und Finden von Kontakten/einer Bezugsperson: Frau Talheim
5.5.4 Suchen und Finden eines Familienersatzes: Frau Gerlach
5.5.5 Zusammenfassende Übersicht des Typus Krisen-Manager
5.6 Einzelfallrekonstruktionen des Typus Option zur Gegenleistung
5.6.1 Option auf zukünftige Hilfe: Herr Lenz
5.6.2 Option auf Gegenseitigkeit: Frau Münch
5.6.3 Passungsgerechte finanzielle Rahmenbedingungen: Herr Küster
5.6.4 Zusammenfassende Übersicht des Typus Option zur Gegenleistung
5.7 Einzelfallrekonstruktionen des Typus randständiges, freizeitorientiertes Gelegenheitsengagement
5.7.1 Mobilisierung externen Engagementpotenzials: Herr Herrmann
5.7.2 Mobilisierung internen Engagementpotenzials: Herr Lambert
5.7.3 Suche nach Lösungen der Neuorientierung: Frau Cramer
5.7.4 Suchen und Finden von Netzwerken: Frau Lumer
5.7.5 Zusammenfassende Übersicht des Typus randständiges freizeitorientiertes Gelegenheitsengagement
6 Sichtweise zu Zeitgutschriften bei ehrenamtlich Tätigen
6.1 Sichtweise zu Zeitgutschriften der Mitglieder eines Seniorenbüros in Westdeutschland
6.2 Sichtweise zu Zeitgutschriften engagierter Bürger in einer Freiwilligenagentur in Ostdeutschland
6.3 Kurzer Vergleich
7 Lebenszyklus von Seniorengenossenschaften
7.1 Gründungsphase
7.2 Etablierungsphase
7.3 Stabilisierungsphase
7.4 Umbruchphase
7.5 Langfristige Stabilität von Seniorengenossenschaften
8 Anreizstrukturen und kulturelle Entfaltungskontexte für die Förderung seniorengenossenschaftlichen Engagements
8.1 Seniorengenossenschaften als solidarfähige Gegenseitigkeitsgebilde im Lichte der Netzwerkforschung
8.2 Der morphologische Blick
8.3 Die zentrale Funktion des Social Support
8.4 Das Präventionspotenzial der gesundheitsbezogenen sozialen Selbsthilfe
8.5 Gesundheitspolitik als Gesellschaftspolitik – wer zahlt?
8.6 Öffentliche Förderung und soziale Kontrolle
8.7 Das anthropologische Gleichgewicht wahren!
8.8 Selbsthilfebewegung und die Wiedergewinnung der Kommunalität
Literatur
Anhang
Stichwortverzeichnis
Geleitwort
Gegenseitiges Helfen und gegenseitige Unterstützung sind wichtige Bestandteile einer lebendigen und vitalen Gesellschaft. Dies gilt gleichermaßen für die soziale und gesellschaftliche Teilhabe und für die Mitwirkung älterer Menschen, die nicht nur einen immer größeren Anteil unserer Bevölkerung ausmachen, sondern häufig bis ins hohe Alter tatkräftig und aktiv sind.
Der Trend zum aktiven Alter, das mit Schaffenskraft und gesellschaftlichem Engagement einhergeht, manifestiert sich auch im Rahmen von Seniorengenossenschaften. Die Mitglieder, die in diesen Initiativen zusammengeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig – im Haushalt, bei den alltäglichen Erledigungen, aber auch bei der Freizeitgestaltung. Dabei zeigen die Seniorengenossenschaften in eindrücklicher Weise, dass Eigeninitiative und gelebte Solidarität von älteren Menschen für beide Seiten viel bewegen können. Insofern sind Seniorengenossenschaften ein gutes Beispiel für die gesellschaftlichen Chancen und Potenziale, die der Lebensabschnitt Alter bietet.
Ältere Menschen in ihrem Engagement zu unterstützen und zu bestärken ist ein zentrales Anliegen der Robert Bosch Stiftung. Um eine zielgenaue Förderung entsprechender Initiativen zu ermöglichen, sind wir daran interessiert zu erfahren, warum und in welchen Bereichen sich Senioren engagieren und welche Handlungsmuster ihrem Engagement zugrunde liegen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die vorliegende Studie und wünschen uns, dass sie dazu beitragen wird, die Idee der Seniorengenossenschaften und der gegenseitigen Unterstützung von Senioren durch Senioren in Deutschland weiter voranzubringen.
Wir sind davon überzeugt, dass es die konkreten Erfahrungen im lokalen Umfeld sind, die dazu führen, dass sich das in der Gesellschaft vorherrschende Bild vom Alter zum Besseren wandelt und langfristig wahrgenommen wird, dass der Lebensabschnitt Alter neben Entwicklungsgrenzen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten beinhaltet.
Stuttgart, im Frühjahr 2010 Robert Bosch Stiftung
Vorwort
Das Forschungsprojekt Motive und Handlungsmuster von Bürgerinnen1und Bürgern in Seniorengenossenschaften ist eine explorative Studie zu Initiativen des Dritten Sektors, die auf Grundlage der Gegenseitigkeitsökonomik arbeiten. Das Forschungsprojekt wurde von der Robert Bosch Stiftung wissenschaftlich begleitet und finanziert. Das Seminar für Sozialpolitik der Universität zu Köln ist der Robert Bosch Stiftung zu großem Dank verpflichtet, denn gerade die nahe wissenschaftliche Anbindung hat wesentlich zum Erfolg des Forschungsvorhabens beigetragen. Weiterhin bedanken wir uns bei Dr. Petra Huck von der Technischen Universität München für zahlreiche wissenschaftliche Anregungen und Diskussionsbeiträge, denen auch die Funktion einer Supervision zukam, die bei einem qualitativen Forschungsvorhaben wie diesem zum erfolgreichem Abschluss zwingend notwendig ist.
Hilfe zur Selbsthilfe ist ein aktuell diskutiertes Thema. Mit der politischen Idee der Seniorengenossenschaft werden traditionelle Formen der Solidarität wiederentdeckt. Die Basis bilden langfristige generalisierte Reziprozität, soziales Vertrauen und zwischenmenschliche, gabeorientierte Kooperation innerhalb des Beziehungsnetzes Seniorengenossenschaft. Bürgerinnen und Bürger leisten bürgerschaftliches Engagement in der genossenschaftlichen Form der Hilfe auf Gegenseitigkeit. Anhand von Biographieverläufen in Seniorengenossenschaften aktiver Bürger zeigt das Forschungsprojekt Motive und Handlungsmuster von Bürgern in Seniorengenossenschaften Verlaufsformen und Sinnorientierungen des Engagements auf. Das fallrekonstruktive Vorgehen ermöglicht die Erarbeitung einer Typologie seniorengenossenschaftlichen Engagements. Die Typologie legt die individuellen Faktoren, kontextuale Faktoren und konstituierende Rahmenbedingungen offen, die seniorengenossenschaftliches Engagement begünstigen, aber auch solche, die seniorengenossenschaftliches Engagement be- und verhindern. Übergeordnetes Ziel ist es, Anreizstrukturen für die Förderung seniorengenossenschaftlichen Handelns auf kommunaler und gemeindeorientierter Ebene aufzuzeigen. Das Forschungsprojekt wählt eine halbstandardisierte Interviewführung. Die narrativ-biographische Interviewführung wird durch einen leitfadengeführten Nachfrageteil ergänzt.
Der explorative Charakter des Projekts bestimmte die Dynamik des Forschungsprozesses. Wegbahnend für den Forschungsverlauf waren ein am Seminar für Sozialpolitik der Universität zu Köln abgehaltener Workshop (April 2007) und ein in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung durchgeführter Expertenworkshop (November 2007), gerade Letzterer gab wegweisende Hilfen im methodischen Bereich. Da es derzeit im Osten Deutschlands keine Seniorengenossenschaften gibt, wurde das Forschungsprojekt um eine Befragung ehrenamtlich Tätiger in einem westdeutschen Seniorenbüro und einer ostdeutsch en Freiwilligenagentur erweitert.
Die Wegführung unseres Forschungsberichts ist wie folgt: Kapitel 1 beginnt mit theoretischen Überlegung en, die das Forschungsfeld abstecken und die Idee Seniorengenossenschaft skizzieren. Den explorativen Charakter des dynamischen Forschungsprozesses verdeutlichend zeichnet Kapitel 2 das Vorgehen des Forschungsvorhabens nach. In Kapitel 3 schließt sich eine ausführliche Beschreibung der Untersuchungseinheit der Befragung an. Entscheidungsbäume legen in Kapitel 4 den Entscheidungsprozess für den Eintritt in eine Seniorengenossenschaft und die dortige Aufnahme eines Engagements offen. Anschließend beschreibt Kapitel 5 anhand von interpretativen Einzelfallkonstruktionen die Handlungslogiken der Seniorengenossenschaftler; ergänzend erfolgt eine Typologisierung. Daran reiht sich in Kapitel 6 die Analyse der Sichtweise zu Zeitkontensystemen als Anreizstruktur für ehrenamtliches Engagement an, basierend auf der zusätzlichen Befragung ehrenamtlich Tätiger in einem westdeutschen Seniorenbüro und einer ostdeutschen Freiwilligenagentur. Die Darstellung des Lebenszyklus von Seniorengenossenschaften in Kapitel 7 erfolgt unter Bezugnahme auf die Typologisierung. Abschließend diskutiert Kapitel 8 Anreizstrukturen und kulturelle Entfaltungskontexte für die Förderung seniorengenossenschaftlichen Engagements.
Insgesamt wurden 27 Bürgerinnen und Bürger interviewt. Die zitierten Interviewpassagen sind vollständig anonymisiert. In den Befragungen, die von eineinhalb Stunden bis zu vier Stunden dauerten, erzählten die Menschen von ihrem Leben. Kindheitserlebnisse wurden geschildert, Begebenheiten in der Familie berichtet, Situationen der Trauer und solche des von Freude getragenen Wiederanfangs. Die Motive zum Engagement in der Seniorengenossenschaft und in anderen Vereinen bildeten bei der Befragung einen zweiten Schwerpunkt. Im Rahmen des Engagements in der Seniorengenossenschaft wurde von der Gewinnung neuer, das Leben begleitender Freude berichtet, aber auch Enttäuschungen wurden geschildert. Ohne diese 27 Lebensgeschichten, die geäußerten Gedanken, das Lachen und auch manches Mal das Weinen, das die Gespräche begleitete, wäre dieses Forschungsprojekt nicht zustande gekommen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den 27 Bürgerinnen und Bürgern, die uns vertrauensvoll vieles aus ihrem Leben offenlegten und vor deren geglückten Lebensentwürfen wir großen Respekt haben.
Köln, im Frühjahr 2010Ursula Köstler und Frank Schulz-Nieswandt
1 Wir bitten die weiblichen Leser, sich auch dann angesprochen zu fühlen, wenn wir uns aus Gründen des Textflusses auf die männliche Form beschränken.
1 Netzwerke zur Lösung sozialer Probleme
Wir interpretieren Seniorengenossenschaften als Netzwerke (Köstler, 2007b), als Orte der Rollenorientierung, Identitätsstiftung und sinngebenden Personenwerdung, ohne außer Acht zu lassen, dass auch strategische Überlegungen zum Eintritt in eine Seniorengenossenschaft sowie zum Engagement dort grundlegend sein können. Beginnen wollen wir mit einigen theoretischen Überlegungen, die den Rahmen zeichnen, innerhalb dessen sich das Forschungsfeld zentriert, die aber auch deutlich machen, wie vieldimensional ein Forschungsvorhaben ist, das den Menschen und seine Netzwerke in den Mittelpunkt stellt.
1.1 Netzwerke als Form und als Norm
Netzwerke sind ein universelles Phänomen des Menschen. Der Mensch lebt nur in Wechselwirkung zum Mitmenschen, und seine soziale Welt ist eine solche der sozialen Beziehungen. Zugleich lebt der Mensch in den Netzwerken als personalisierte Individualität. Dies bedeutet, dass er einerseits seine Identität in den Rollenorientierungen findet, die mit den sozialen Beziehungen verbunden sind. Denn er ist so gesehen nur als Mitmensch selbst eine Person. Auf der anderen Seite kann er aufgrund seiner Besonderheit als personales Selbst, eben seines Ich-Bewusstseins, Distanz schaffen zu den Netzwerken. Eingebunden in Netzwerke gewinnt der Mensch relative Autonomiespielräume. Diese machen dann das Verhältnis des eigenen Selbst zu den sozialen Bindungen zum Thema eigenständiger Reflexionen. Der Mensch hat die Seinseigenschaft, eine „exzentrische Positionalität“ einzugehen, wie Helmuth Plessner (Plessner, 2003) als philosophischer Anthropologe dies nannte.
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass das Verhältnis des Menschen zu den Netzwerken seiner sozialen Beziehungen recht unterschiedliche Gestalt, verschiedene Formen und auch verschiedene Qualitäten annehmen kann. So kann der Mensch in einen Konflikt mit seinen Netzwerken geraten. Er kann sich von seinen sozialen Beziehungswelten entfremden. Er kann dort aber auch völlig aufgehen und unkritisch sich selbst und seine Autonomiemöglichkeiten verlieren.
Dabei müssen Netzwerke nicht unbedingt gesellschaftlich wertgeschätzt, akzeptiert oder gar rechtlich erlaubt sein. Es können Netzwerke abweichenden Verhaltens sein, im Sinne von kriminellen Vereinigungen oder politisch problematisierten Organisationen. Offensichtlich ist, dass im sozialpolitischen Kontext (Schulz-Nieswandt, 2010) in der Regel solche Netzwerke diskutiert werden, die individuell wie gesellschaftlich und somit auch politisch positiv geschätzt werden. Dies sind Netzwerke, die Gemeinwohlverpflichtungen aufweisen oder zumindest positive externe Effekte produzieren. Rahmengebend sind dann gewollte rechtliche Fördermaßnahmen und politische Anerkennungskulturen.
Die soziale Tatsache, um mit dem klassischen französischen Soziologen Èmile Durkheim (Durkheim, 2007) zu sprechen, dass die menschliche Existenz immer „Wechselwirkungen“ unterworfen ist, wie es der klassische deutsche Soziologe Georg Simmel (Simmel, 2006) nannte, ändert nichts daran, dass die normative Debatte, welche Netzwerke aus welchen Gründen wie geschätzt, geschützt, gefördert und entwickelt werden sollen, getrennt von den empirischen Tatsachen geführt werden muss.
1.1.1 Zwei idealtypische Formen von Netzwerkbeziehungen
Individualisierte Personen haben die Möglichkeit, unterschiedliche Blickwinkel auf ihre persönlichen Netzwerke einzunehmen und sich in unterschiedliche Handlungslagen zu den Netzwerken zu begeben. Voraussetzung sind ihre einerseits seinsmäßigen, andererseits immer auch aktivierungsbedürftigen Fähigkeiten, sowohl über sich selbst reflektieren zu können als auch die eigene Einbindung in soziale Rollenkreise und somit ihre Integration in die Gruppe reflektieren zu können. In der Sozialkapital-Forschung, die sich mit den Netzwerken der verschiedenen Formen beschäftigt, werden hierzu wichtige Unterscheidungen getroffen.
Idealtypus der strategischen Klugheit
Idealtypisch gesprochen, können Netzwerke zu einem reinen Instrument individuellen Handelns werden. Dann funktionalisiert der rationale Akteur, der seinen individuellen, eigensinn-orientierten Nutzen maximiert, die Netzwerke aus strategischen Gründen. Der Akteur geht aus Gründen der strategischen Verkettung (connectedness) aus Klugheit (prudence) eine mehr oder weniger vertragliche Partnerschaft ein. Damit bleibt das kooperative Verhalten gebunden an die erwartete Aussicht auf eine ökonomische Win-win-Situation; nach dem so genannten Pareto-Prinzip. Das Netzwerk ist dann weit davon entfernt, Selbstzweck zu sein. Es ist auch kein identitätsstiftender Ort des Akteurs als Person, im Sinne der existenziellen Perspektive des Selbst-Seins im Modus des sozialen Mitseins. Das verweist bereits auf den zweiten zu behandelnden Idealtypus des Netzwerkes. Netzwerke können an menschlicher Qualität gewinnen und den ökonomistischen Boden verlassen. Lange Zeithorizonte können sich bei den Akteuren herausbilden. Vertrauenskapital kann entstehen, wodurch sich auch Transaktions- und Regulationskosten der strategischen Verkettungen reduzieren lassen. Auch kann, wie es in der neueren experimentellen Spieltheorieforschung geschieht, von vornherein ein gewisses Maß an Fairness-Orientierungen auch bei eigensinnig orientierten Akteuren unterstellt werden. Je nach Handlungsfeld und Themenkreis ist dies unterschiedlich und hängt generell mit unterschiedlichen Sozialisationserfolgen hinsichtlich der erworbenen Empathie-Kompetenzen der Menschen zusammen oder weist vielleicht auch Gender-Effekte auf. Von einer Moral (der Klugheit) kann hier die Rede sein, weil sich Ego durchaus für Alter Ego interessiert, aber eben nicht unmittelbar, sondern im wohlverstandenen Eigeninteresse. Denn die Chancen des Erfolgs des eigenen Handelns müssen die Reaktionen des anderen Akteurs (Alter Ego), mit dem der Akteur (Ego) interdependent ist, einkalkulieren – und umgekehrt; eventuell sogar im Rahmen einer längeren Handlungskette.
Die neuere Sozialkapital-Forschung nennt dies weak ties. Wir entnehmen dem klassischen deutschen Soziologen Max Weber die Definition, Idealtypen (auch Gerhardt, 2001) seien als theoretische Konstrukte zu verstehen, die wesentliche Aspekte der sozialen Wirklichkeit absichtlich und gezielt überzeichnen, um Ausschnitte dieser sozialen Wirklichkeit gedanklich ordnen und entsprechend erfassen zu können. Dann wird wiederum deutlich, dass es sich zunächst nicht um eine Abbildung eines konkreten empirischen Sozialgebildes handelt. Auch meint Ideal-Typus nicht normativ einen sozial oder gar moralisch erwünschten Typus. Dagegen sind Realtypen nicht Kunstkonstrukte der gewollt-gezielten Übersteigerung eines Merkmals, sondern es geht, ungeachtet der Häufigkeitsverteilung ihres Auftretens, um reale Fälle. In empirisch fundierter Weise vereinigen diese realen Fälle dann nach kontrollierten Zuordnungskriterien festgehaltene Merkmalsausprägungen so verdichtend auf sich, dass diese realen Typen von anderen realen Typen faktisch zu unterscheiden sind.
Das bedeutet, dass der Idealtypus des strategischen Verkettungsmotivs des homo oeconomicus durchaus mit anderen Motiven gemischt vorliegen kann. Dieser Idealtypus kann als eine Dimension in einen Realtypus eingehen, so dass es zu einer empirischen Typologie kommen kann. Der Übergang von Ideal- zu Realtypen-Bildungen wird deutlich, wenn wir uns den zweiten Idealtypus der netzwerkbezogenen personalen Haltung anschauen.
Idealtypus des Selbst-Seins im sozialen Mitsein
Im Fall der Netzwerke, die von strong(er) ties gekennzeichnet sind, geht es mehr als um Nutzenmaximierung und Strategien. Und unsere Analyse wird offenlegen, Seniorengenossenschaften sind derartige Netzwerke. Dort geht es um Daseinsweisen und Existenzmodi des Menschen als Person, während es in Weak-ties-Netzwerken viele Flexibilitäten durch Brückenbildungen (bridging) zwischen Individuen gibt und wenig feste Bindungen (bounding).
Es geht in Strong-ties-Netzwerken psychologisch um die Möglichkeit, dass Individuen sich in Netzwerken als strong ties personalisieren können und zu einer reifen, bindungsfähigen Autonomie gelangen. Eben, weil sie sich aufgaben- und rollenorientiert gerade durch die liebende Sorgearbeit in Bindungen kulturell einbetten – im Unterschied zur strategisch-opportunistischen Verkettung. Individuen gelangen zu einem Identitätskonzept dergestalt, dass im Gegensatz zum Idealtypus der strategischen Klugheit des mit dem Alter Ego interdependenten homo oeconomicus eine gleichgewichtige Balance in einer Ich-Du-Wir-Figuration ermöglicht wird. Dies bedeutet, dass das Person-Sein in der Balance zwischen Ich-bezogener Selbstsorge, Du-bezogener Mitsorge und Wir-bezogener Fremdsorge eine identitätsstiftende Verankerung im Netzwerk der sozialen Beziehungen findet. Mit diesem Denken in der sozialen Figuration, dem Konzept des homo figurationis, lehnen wir uns einerseits an die Soziologie von Norbert Elias (Elias, 2006) an, andererseits sozial- und individualpsychologisch an George Herbert Mead (Mead, 2008) und Erik K. Erikson (Erikson, 2005).
Vielleicht wirkt dieser Idealtypus auch normativ idealer auf uns, da sich eine Parallele zu Immanuel Kants Ethik ziehen lässt. Gemäß Kant (Kant, 1984) soll der Mensch immer nur Selbstzweck, nicht Mittel zum Zweck sein. Und der Mensch solle so handeln, dass er sein Handeln auch dann noch als verallgemeinerungsfähig und gültig anerkennen kann, wenn er sich in die Lage der Menschen versetzt, die von seinem Handeln betroffen sind. Wir rezipieren hier die Ethik von Kant bereits sehr soziologisch und psychologisch. Diese Überprüfung der eigenen Handlungsgrundsätze setzt Empathiefähigkeiten voraus. Der Mensch wird diskutiert als Rollenspieler, der auf die externen Effekte seines Handelns achtet. Auch Adam Smith (Smith, 1979) hat dies so gesehen, indem er die sittlichen Grundlagen ökonomischer Transaktionen in eben einer solchen Sympathie verwurzelt sah. Bei Smith war Ökonomie noch nicht völlig getrennt von der Moralphilosophie, und die entstehenden modernen Marktbeziehungen wurden noch als eingebettet in die menschlichen Beziehungen des Gemeinwesens verstanden. Heute ist die Debatte um diesen Idealtypus des personalen Selbst-Seins im Modus des sozialen Mitseins im Lichte einer langen, variantenreichen Geschichte des Personalismus in Philosophie und Theologie des 20. Jahrhunderts als Philosophie der Liebe und der Gabe von andauernd heftiger Intensität geprägt; vor allem in der (Rezeption der) modernen französischen Philosophie und (theologischen) Anthropologie.2
1.1.2 Realtypische Formen von Netzwerkbeziehungen
Die breite Debatte um die Möglichkeiten eines rationalen Altruismus hat die empirischen Mischungschancen darlegt. Menschen können ihre eigenen Nutzenfunktionen mit den Nutzenfunktionen anderer Menschen verschachteln und sich für das Nutzenniveau der anderen Menschen interessieren. Sie geben freiwillig Ressourcen an andere Menschen ab, weil sie sich dann gemeinsam mit den anderen Menschen besserstellen. Allerdings peilen sie ein Gleichgewicht zwischen dem Nutzenverlust durch den Ressourcentransfer einerseits und ihrem Nutzengewinn durch die Besserstellung des transfer- oder hilfeempfangenden anderen Menschen an. Für beide ist es eine nach dem Pareto-Prinzip definierte gemeinsame Besserstellung, definiert als Win-win-Situation (Hochman & Rodgers, 1969). In vielen ökonomischen Transaktionen und Netzwerkbildungen gilt diese Pareto-Lösung als notwendige Voraussetzung und muss durch rechtliche Rahmenbedingungen ermöglicht werden.
1.1.3 Motivik des Gebens und die Qualität von Netzwerkbeziehungen
Die Motive des Gebens und Nehmens sind vielschichtig, eingebettet in den komplizierten gesellschaftlichen Kontext der konkreten Handlungssituation. Deutlich wird, dass die Qualität der Gabe nicht frei ist von Bedingt- und Begrenztheit, von Obligationen und kalkulierender Logik. Ebenso fundamental ist, dass die so entstehende, wenn auch oft nur flüchtige Netzwerkbeziehung von der Art der Motive abhängt.
Es gibt viele Motive der Gabe und des sich entwickelnden Systems des Gebens und Nehmens in sozialen Beziehungen und Netzwerken: Liebe, Respekt, gegenseitige Anerkennung, erwartete/kalkulierte Dankbarkeit oder Suche nach öffentlichem Ansehen, Gnade und Barmherzigkeit, Mitleid, Freundschaft, Freigiebigkeit oder Großzügigkeit, Angst, Schuld, Pflicht, Scham und Ekel, Herrschafts- und Machtinteressen, Dominanzstreben etc. Phänomenologisch ist das Feld der Möglichkeiten groß. Es dürfte aber sehr schnell evident sein, dass die Selektion der Motive oder ihre Mischung bzw. die akzentuierte Dominanz eines der Motive überaus mitentscheidend für die Qualität der Systeme des Gebens und Nehmens in Netzwerken ist. Auch dies werden wir zeigen, denn unsere interpretatorische Analyse wird sowohl die Motivfacetten als auch die bei manchem Mitglied zutage tretende individuelle Dominanz eines Motivs offenlegen – und damit auch Dimensionen der Qualität des Unterstützungsnetzwerkes Seniorengenossenschaft.
1.1.4 Reziprozität und Gabe
Der Definition von Robert Putnam folgend setzt sich das Sozialkapital aus drei Dimensionen zusammen: dem Klima des Vertrauens, dem sozialen Engagement der Bürger sowie den Reziprozitätserfahrungen. Unter dem Prinzip der Reziprozität verstehen wir das Gegenseitigkeitsprinzip des Gebens und Nehmens. Dieses Verständnis des Sozial kapitals kann auf ganz verschiedene Forschungsfelder übertragen werden: auf zivilgesellschaftliche Zusammenhänge der Demokratieentwicklung, auf die soziale Wohlfahrtsproduktion des bürgerschaftlichen Engagements und des Dritten Sektors sowie auf regionalökonomisch relevante Netzwerkbildungen etc.
Die ältere, klassische Forschung zur Reziprozität (Polanyi, 2007; Sahlins, 1994; Mauss, 2007, aber auch neuere Autoren wie Godelier, 1999 u. a.) hat verschiedene Formen der Reziprozität unterschieden. Die ökonomische Theorie, auch unter Fairness-Aspekten, orientiert sich meist an dem Typus der ausbalancierten Gegenseitigkeit. Vermieden werden soll vor allem die negative Reziprozität der Trittbrettfahrer und minimiert werden sollen die Wohlfahrtsverluste, die durch moral hazard in kollektiven Güter-Situationen entstehen. Dieses Denken ist ganz utilitäts-zentriert und orientiert sich am Modell des markttausch-orientierten Vertrages. Es geht um Pareto-Lösungen. Entsprechend wichtige Situationseigenschaften werden daher in der Asymmetrie der Informationsverteilung zwischen den Netzwerkpartnern gesehen. Auch können Qualitätsprobleme, insbesondere bei Dienstleistungen, durch Schwierigkeiten einer hinreichend vollständigen Spezifizierung des Vertrages entstehen. Die ökonomische Theorie entdeckt hier die Bildung von Vertrauenskapital als Strategie der Reduktion von Unsicherheit. Das Problem der Transformation kurzer in längere Zeithorizonte (Nachhaltigkeitsprobleme) wird erkannt; auch die soziale Tatsache, dass Gabe und Gegengabe homomorph, aber auch heteromorph sein können (Gouldner, 1960).
Die angeführten Klassiker, alle aus einer fachlich breit und daher offen interessierten Ethnologie und Soziologie kommend, haben aber vor allem den Typus der generalisierten Norm der Reziprozität darlegen können. Generalisierte Reziprozität ist nicht am ausgeglichenen Nutzen orientiert, sondern fundiert einen Gabe-Überschuss. Diese Forschungstradition ist deutlich anti- oder trans-utilitaristisch orientiert (Caillé, 2008, aber auch Debatten hinsichtlich der Beiträge etwa von Bataillé, Lévinas und Derrida). Auch Marcel Mauss, der Klassiker, muss differenzierter eingeschätzt werden, als dies oft der Fall ist. Mauss zeigt in der Gabe zugleich die Schaffung von Obligationen zur Gegengabe. Zusätzlich hat Mauss destruktive Gabe-Mechanismen, so das berühmte Potlatsch-Phänomen, mitunter ins Zentrum gerückt. Mauss hat aber die Gabe nicht ökonomisiert und in ihr nur einen verkannten Markttausch gesehen. Zentral ist ein symbolischer Überschuss der Gabe. Die Gabe als fait social total stiftet Gemeinschaft, zugrunde gelegt in der Mahlgemeinschaft als Tischgenossenschaft. Kennzeichnend ist ihre Mehrdimensionalität, da ihr rechtliche, religiöse, moralische, politische und ökonomische Dimensionen innewohnen. Und weiterhin personalisiert sie die Mitglieder dieser Gemeinschaft. So ist es kein Zufall, dass diese Gabe-Debatte breiten Eingang in die neuere theologische und philosophische Anthropologie gefunden hat.
Wir haben zuvor auf die Problematik von Ideal- und Realtypen-Bildungen hingewiesen. Bei Realtypen der Netzwerk-Haltung der Menschen ist sicherlich immer auch eine ökonomische Dimension enthalten. Sozialer Fortschritt benötigt auch dynamische Effizienz, um veraltete Pfade zu verlassen, strong ties zu überwinden und Netzwerke mit ihrer Vertrauens(kapital)eigenschaft als Transaktionskosten senkend zu verstehen. Dennoch beobachten wir oftmals, dass die Motivmischungen komplexer sind. Vor allem weisen die Netzwerk-Orientierungen der Menschen ausgeprägte gemeinsinnbezogene Haltungen und empathiefundierte Solidareinstellungen auf. Mutualitätsgebilde sind daher oftmals von Solidarorientierungen im Sinne eines Gabe-Überschusses gegenüber einer reinen Orientierung an einer ausbalancierten Bilanz von Geben und Nehmen ausgerichtet. Und eben diesen das Netzwerk Seniorengenossenschaft fundierenden Gabe-Überschuss erachten wir als zentral für die lebendige Umsetzung der Idee Seniorengenossenschaft sowie für deren mittel- und langfristige Stabilität.
Verlassen wir nun den rahmensetzenden Boden der theoretischen Überlegungen und kommen zu unserem Forschungsvorhaben, das intensive Einblicke in das Wirken von Seniorengenossenschaften als soziale Netzwerke der Hilfe auf Gegenseitigkeit bietet. Es zeigt sich ein buntes Bild an Realtypen. Offengelegt wird ein hohes Maß an Solidarbereitschaft der Mitglieder untereinander innerhalb des Unterstützungsnetzes Seniorengenossenschaft, aber auch über den Verein hinaus. Aufgabenorientiert suchen und finden die Mitglieder in ihrem Geben für andere einen Sinn. Dabei leben die Realtypen zahlreiche Dimension des Gebens auf der Skala von Ego-zentriert bis Alter Egozentriert.
1.2 Hilfe zur Selbsthilfe
Seit Anfang der 1990er Jahre gründen sich in Deutschland Initiativen der Hilfe auf Gegenseitigkeit, die unter den Begriff Seniorengenossenschaft gefasst werden können. In einer Zeit, die der kommunitaristischen Diskussion3 folgend durch einen Wertewandel in Richtung zunehmender Individualisierung und starker Tendenzen des An-sich-Denkens beschrieben wird, erfolgt mit dem Konzept der Seniorengenossenschaft eine Neukomposition traditioneller Formen der Solidarität. Bürgerinnen und Bürger unterstützen sich gegenseitig, leben eine Art Zugehörigkeit zu der erfahrenen Gemeinschaft Seniorengenossenschaft, und es entsteht – entgegen Putnams Declining-social-capital-These (Putnam, 1995, S. 73) – Sozialkapital4.
In Seniorengenossenschaften wird in Vereinsform eine ursprüngliche Hilfeform der gegenseitigen Unterstützung gewährt, gleichzeitig werden unterschiedliche Formen der Gesellung erfahren. Zeitkonten dienen als Verrechungssystem für geleistete und erhaltene Hilfen.5 Es wird ein Geben, Nehmen und Erwidern gelebt (dazu: Adloff & Mau, 2005). So wie es Marcel Mauss (Mauss, 1975) in seiner Theorie der Gabe fundierte.6 Bei den Seniorengenossenschaften ist die Gegengabe eine Option, die, in der Zukunft eingelöst, dann Reziprozität bedingt. Die Ausgangsthese für das hier vorgestellte Forschungsvorhaben ist: Das Handeln der Mitglieder von Seniorengenossenschaften ist in einer gabe-basierten Motivation fundiert, die die in Seniorengenossenschaften gelebte generalisierte Reziprozität stabilisiert (Köstler, 2006b; Köstler, 2007a). Darauf aufbauend interessiert die Frage: Was ist es, das Menschen dazu motiviert, sich auf die Idee Seniorengenossenschaft einzulassen, an die Idee Seniorengenossenschaft zu glauben und diese aktiv mit Leben zu füllen? Die Mitglieder der Seniorengenossenschaften bewirken etwas, und es macht für die Gesellschaft einen Unterschied, ob diese Menschen da sind oder nicht. Etwas für andere zu tun setzt eine bestimmte Einstellung gegenüber den Mitmenschen voraus. Das Leben wird interessanter, wenn man sich mit anderen Menschen befasst; auch gewinnt das Leben an Qualität, wenn man etwas bewirkt und nicht nur die eigenen Interessen verfolgt. Genau diesen Spuren folgt das explorative Forschungsprojekt mit seiner zentralen Forschungsfrage: Was hat lebensgeschichtlich bewirkt, dass sich Bürger in Seniorengenossenschaften engagieren und für andere und mit anderen etwas entstehen lassen?
1.2.1 Bürgerschaftliches Engagement
Bekannt unter dem Konzept des Welfare Mix erfolgen seit Ende der 1980er Jahre politische Umorientierungen der wohlfahrtsstaatlichen Agenda. Der Staat entdeckt den Leitgedanken Hilfe zur Selbsthilfe, gleichzeitig wird die Vision einer aktiven Bürgergesellschaft als gesellschaftliche Lebensform des bürgerschaftlichen Engagements entwickelt. Durch den Umbau von Dienstleistungen im sozialen Bereich wird versucht, die Rolle der freien Träger und der informellen Hilfesysteme zu stärken. Die Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements 2002 fordert die Stärkung einer aktiven Bürgergesellschaft. Einer Bürgergesellschaft, die ein Netzwerk von selbst organisierten, freiwilligen Zusammenschlüssen bildet und die neben Staat, Wirtschaft und Familie eine tragende Rolle bekommt. Dabei definiert die Enquete-Kommission Bürgergesellschaft als „ein Gemeinwesen, in dem die Bürgerinnen und Bürger auf der Basis gesicherter Grundrechte und im Rahmen einer politisch verfassten Demokratie durch das Engagement in selbstorganisierten Vereinigungen und durch die Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten die Geschicke des Gemeinwesens wesentlich prägen können“ (Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements, 2002, S. 59). Bürgerschaftliches Engagement ist „freiwillig, nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet, gemeinwohlorientiert, […] findet im öffentlichen Raum statt und wird in der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt“ (Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements, 2002, S. 86 f.). Dabei bedarf es der Anerkennung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements unter der Vorsicht der Überschätzung der Wirkungskreise bürgerschaftlichen Engagements (Schulz-Nieswandt & Köstler, 2009).
Die Bürger beteiligen sich an den öffentlichen Aktivitäten. Der zweite Freiwilligensurvey konstatiert eine bedeutende Zunahme sowohl der Quote als auch der Intensität des freiwilligen Engagements im Zeitraum von 1999 bis 2004. Gestiegen sind das externe Engagementpotenzial, das das Engagementpotenzial derjenigen erfasst, die bisher nicht engagiert sind. Aber auch das interne Engagementpotenzial ist gestiegen, das Potenzial derjenigen, die bereits engagiert sind und bereit sind, ihr freiwilliges Potenzial auszudehnen. Im Jahre 2004 engagierten sich 36 % der Bevölkerung freiwillig, 12 % waren zum freiwilligen Engagement bestimmt bereit, 20 % waren zum Engagement eventuell bereit, und 32 % engagierten sich nicht (BMFSFJ, 2005, S. 18). Schon jetzt liegt bei den Menschen ab 60 Jahren die Engagementquote bei 30 % (BMFSFJ, 2005, S. 313). Hervorzuheben ist, dass im Jahre 2004 das externe Engagementpotenzial bei den 60-Jährigen und Älteren bei 19 % lag und das interne Engagementpotenzial bei 13 % (BMFSFJ, 2005, S. 323 und 326).
Das Engagementpotenzial der Menschen des dritten Lebensalters erkennend sind in den letzten Jahren vielfältige Angebote für ältere Menschen entstanden: Das vom Bundesministerium für Familie und Senioren von 1992 bis 1997 geförderte Modellprogramm Seniorenbüro hatte zum Ziel „die soziale Einbindung älterer Menschen zu stärken, indem ihre eigene Aktivität in den Bereichen gefördert wird, die sie in Kontakt mit anderen Menschen bringen und ihre soziale Kompetenz herausfordern.“7 Das Modellprogramm Erfahrungswissen für Initiativen (EFI), von 2002 bis 2006 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiert, wollte neue Verantwortungsrollen für Ältere unter der Bezeichnung Seniortrainerin bzw. Seniortrainer schaffen.8 Auch etablieren sich im Bundesgebiet in den letzten Jahren zahlreiche Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen und Initiativen der Hilfe auf Gegenseitigkeit, wie dies die Seniorengenossenschaften sind. Alle diese Angebote haben gemeinsam, dass sie durch geeignete Anreizstrukturen in der Übergangsphase des Eintritts in den Ruhestand die Bürger zu freiwilligem Engagement mobilisieren wollen.
1.2.2 Die Idee Seniorengenossenschaft
Die Sicherung bei Pflegebedürftigkeit im Alter wurde in Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren stetig diskutiert, führte zu einer Reihe von Reformvorschlägen, zu denen auch die Idee der Seniorengenossenschaften zählt, und mündete in der 1995 für die ambulante und 1996 für die stationäre Pflege eingeführten sozialen Pflegeversicherung9. Anfang der 1990er Jahre etablierten sich in Baden-Württemberg die ersten Seniorengenossenschaften.10 Angetreten wurde mit der Idee, die Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen auf der Grundlage der gegenseitigen Hilfe im Alter zu realisieren. Diese utopische Zielsetzung wurde schnell aufgegeben zugunsten der realistischen Idee, Unterstützungsnetze für ältere Menschen aufzubauen, um diesen ein möglichst langes Verweilen in ihrer häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Es folgten Seniorengenossenschaften in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg wurden die Seniorengenossenschaften landespolitisch, im hessischen Kreis Offenbach kommunal im Rahmen von Modellprogrammen unterstützt. Das Modellprogramm Seniorengenossenschaften wurde in den Jahren 1991 bis 1993 vom baden-württembergischen Sozialministerium initiiert, finanziell unterstützt und wissenschaftlich begleitet. Die baden-württembergischen Initiativen haben sich als stabil erwiesen und finanzieren sich seit 1994 selbstständig, teilweise gewähren die Kommunen Unterstützung im Rahmen der mietfreien Raumüberlassung. Das Konzept für das Förderprogramm zur Unterstützung derSeniorengenossenschaften des Kreises Offenbach, das von 1994 bis 2004 durchgeführt wurde, bestand aus einer Anschubfinanzierung pro Initiative, der mietfreien Überlassung von Räumlichkeiten seitens der Kommune oder der Städte sowie der Fortbildung, Begleitung und Beratung durch eine kommunale Anlaufstelle. Das Förderprogramm zur Unterstützung der Seniorengenossenschaften des Kreises Offenbach hat eine bedeutende regionale Multiplikatorwirkung, so wurden an über 20 weiteren Standorten im Kreis Offenbach weitere Seniorengenossenschaften gegründet.11 Auch im Bundesgebiet erfolgten nach dem Vorbild des Kreises Offenbach weitere Gründungen von Seniorengenossenschaften. In Südhessen existieren schon flächendeckend Seniorengenossenschaften, und derzeit gibt es konkrete Maßnahmen seitens des hessischen Sozialministeriums und der Ehrenamtsagentur des Kreises Offenbach, in weiteren Regionen Hessens Seniorengenossenschaften zu gründen.
Bundesweit gibt es derzeit etwa 50 Initiativen, die nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit arbeiten und unter dem Begriff Seniorengenossenschaft zusammengefasst werden können, auch wenn sich diese Initiativen Bürgerhilfe, Nachbarschaftshilfe oder Seniorenhilfe nennen. Alle Initiativen finanzieren sich nach Auslaufen der Modellprogramme selbst und wirtschaften bis auf die mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten in einer städtischen Einrichtung unabhängig von städtischen, kommunalen und staatlichen Zuschüssen.
Seniorengenossenschaften sind ein neues Konzept der Selbsthilfe, in dem bürgerschaftliches Engagement in genossenschaftlicher Form der Hilfe auf Gegenseitigkeit gelebt wird. „Selbsthilfe umfasst alle individuellen und gemeinschaftlichen Handlungsformen, die sich auf die Bewältigung eines gesundheitlichen oder sozialen Problems […] durch die jeweils Betroffenen beziehen“ (Borgetto, 2004, S. 80). Diese Selbsthilfe kann als Teil des Dritten Sektors (Schulz-Nieswandt, 2008) gesehen werden, wenn sie nicht in natürlichen sondern innerhalb künstlicher Gebilde stattfindet. Natürliche Handlungsspielräume stellen hierbei vorwiegend Familie, Freunde und Verwandtschaft dar. Künstliche Gebilde werden dagegen eigens zum Zweck der Selbsthilfe errichtet.
In ihren Vereinszielsetzungen schreiben die Seniorengenossenschaften fest, Dienstleistungen anzubieten, die weder der Staat noch der Markt bereitstellt. Die Ziele der Initiativen sind: die Verbesserung der Lebensqualität im Alter und die Erhaltung der Selbstständigkeit im Alter. Zur Umsetzung der Ziele bieten die Initiativen drei Arten von Angeboten an: gegenseitige Hilfen von Mensch zu Mensch (Haushaltshilfen, handwerkliche Hilfen, Kinderbetreuung, Beratung, krankheitsbezogene Dienste, Hospizdienste, Begleitdienste zu Ärzten, zu Behörden und bei Besorgungen), Gruppenangebote zur Freizeitgestaltung, die schwerpunktmäßig einen Gesellungsaspekt haben (Sportgruppen, Erzählgruppen, gemeinsame Unternehmungen) und Projekte über spezielle Themen oder Projekte zusammen mit anderen Initiativen vor Ort. Die Vereinsmitgliedschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Veranstaltungen sowie für das Erbringen und Erhalten von Leistungen. Betont werden muss, dass Pflegeleistungen nicht erbracht werden.
Neu an der Idee Seniorengenossenschaft ist, dass hier neben das Engagement der Bürger der Gedanke der Hilfe auf Gegenseitigkeit tritt. Im Unterschied zur traditionellen Tätigkeit im Ehrenamt, die unbezahlt ist oder nur mit einer Aufwandsentschädigung abgegolten wird, beruht der Gedanke der Seniorengenossenschaft auf einer Art Tauschsystem. Mitglieder, die Dienstleistungen für andere Mitglieder erbringen, erwerben Ansprüche auf Versorgungsleistungen. Anlehnend an das bei Tauschringen12 praktizierte Lokal Exchange Trading System dienen bei den Seniorengenossenschaften Zeitkonten13 als Verrechungssystem für geleistete und erhaltene Hilfen. Die aktive Umsetzung des Zeittauschsystems, das eine Vertrauensbasis herstellt und Ansprüche auf Gegenleistung dokumentiert, schafft Stabilität für die Initiativen. Die Basis für die Deckung des Bedarfs auf Gegenseitigkeit bildet eine bindende Solidarhaltung der Mitglieder untereinander, gekoppelt mit fairer Reziprozität.
Die unter dem Begriff Seniorengenossenschaft zu fassenden Initiativen der Hilfe auf Gegenseitigkeit sind ein qualitativ neuer Ansatz in der offenen Altenhilfepolitik, der die Strukturen der Selbsthilfeform Genossenschaft nutzt, allerdings nicht in der Rechtsform des § 1 GenG, denn als Rechtsform haben die Initiativen den e. V. und nicht die eG gewählt.14 So sind die Initiativen nicht der Rechtsform nach genossenschaftliche Gebilde, die Genossenschaftsartigkeit wird vielmehr in soziologischer Sicht in der gegenseitig praktizierten sozialen Selbsthilfe gelebt. Die Initiativen bieten Unterstützungsaktivitäten und Gesellung für ältere Menschen an, arbeiten mit Zeitkonten und verlagern nach dem Prinzip der langfristigen Reziprozität den Zeittausch in die Zukunft. Menschen organisieren sich verbindlich und auf Gegenseitigkeit, setzen eigene Ideen um, indem sie Leistungen für sich und für andere erbringen. Der Grundgedanke der Seniorengenossenschaften ist, in aktiven Zeiten Leistungen zu erbringen, für die Zeitpunkte gutgeschrieben werden, und diese Zeitpunkte für den Bedarfsfall anzusparen, wenn bei Krankheit oder im Alter Hilfe nötig wird.
Das am Seminar für Sozialpolitik der Universität zu Köln von 2003 bis 2006 durchgeführte Forschungsprojekt Seniorengenossenschaften – Stabilitätseigenschaften und Entwicklungschancen befragte die 50 im Bundesgebiet tätigen Seniorengenossenschaften (Köstler, 2006; Köstler, 2006a). Dieses als explorative Feldstudie durchgeführte Forschungsprojekt analysierte anhand einer postalischen Befragung der Initiativen deren Voraussetzungen für ein erfolgreiches dauerhaftes Bestehen. Die zusätzlich ebenfalls postalisch durchgeführte Mitgliederbefragung zeigte den Umfang des Engagements in Seniorengenossenschaften und gab erste Einblicke in die Motivationshintergründe der sich Engagierenden.
Der Charakter des Systems Seniorengenossenschaft ist zweigeteilt (Schulz-Nieswandt, 2006a, S. 59). Einerseits sind die Seniorengenossenschaften dem Prinzip Leistung–Gegenleistung folgend quasi wirtschaftliche Zweckgebilde des Gebens und Nehmens, andererseits ist dieses System stark geprägt von einer systemimmanent gelebten Gesellungsform. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts Seniorengenossenschaften – Stabilitätseigenschaften und Entwicklungschancen zeigen, dass das Engagement in Seniorengenossenschaften geprägt ist vom Vertrauenskapital – im Sinne des Systemtheoretikers Niklas Luhmann (Luhmann, 1973) – und von der Gabe-Bereitschaft der einzelnen Mitglieder – fußend auf der Theorie der Gabe (Osteen, 2002), die auf den Religionsanthropologen und -soziologen Marcel Mauss zurückgeht. Seniorengenossenschaften leben eine langfristige, generalisierte Reziprozitätsbeziehung im Sinne des Sozialanthropologen Marshall Sahlins (Sahlins, 1974), in der Hilfe auf Gegenseitigkeit in genossenschaftlicher Form praktiziert wird. Außerdem sind Seniorengenossenschaften eine Ressource von sozialem Kapital – im Sinne des Politikwissenschaftlers Robert D. Putnam15 –, das den Mitgliedern neben ökonomischen und familiären Ressourcen ein tragendes Netzwerk bietet.
2 Angesichts der breiten Diskussion sei nur heraushebend verwiesen auf Ricoeur (2006) sowie auf Caillé (2008). Zur Orientierung dient u. a. Pulcini (2004).
3 Der Kommunitarismus, ursprünglich aus den USA kommend, betont die Eigenverantwortung des Einzelnen, fundierend auf Gemeinschaft und Gemeinsinn. Auch in Deutschland setzte Mitte der 1990er Jahre eine bis heute andauernde Diskussion über Werte und über ein neues Verständnis des Zusammenspiels von Staat und Bürgergesellschaft sowie deren neu zu interpretierenden Rollen ein; dazu Kaiser (2007). Kaiser gibt eine umfassende Einführung in die Idee des Kommunitarismus, die er dann im zweiten Teil seines Buches um eine Rezeption des Kommunitarismus in Deutschland erweitert.
4 Vgl. Helmbrecht (2005). Helmbrecht diskutiert die von Putnam aufgestellte These des Verfalls von Sozialkapital und entwickelt als Gegenstück die These einer Transformation der solidarischen Grundlagen in modernen Gesellschaften.
5 Zum konstitutiven Doppelcharakter des Sozialgebildes Seniorengenossenschaft: Schulz-Nieswandt (2006).
6 Marcel Mauss’ bekannter Aufsatz Essai sur le don aus dem Jahre 1924 wird in den letzten zwei Jahrzehnten in zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen unterschiedlicher Disziplinen diskutiert. Einen sehr gut strukturierten Überblick geben Adloff & Mau (2005). Eine interessante Diskussion bekannter Spiele der Wirtschaftstheorie im Licht der Theorie der Gabe bietet Huck (2008).
7 Bundesministerium für Familie und Senioren (1994, S. 6 und 7). Es sollen „neue Formen freiwilliger Gemeinschaft“ entstehen, die zu einer „Kultur der Mitmenschlichkeit“ beitragen.
8 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006). Seniortrainerinnen und Seniortrainer unterstützen Freiwilligen-Organisationen und Initiativen mit fachlichem Wissen, stellen Kontakte her und sind im Gemeinwesen unterstützend tätig; dabei sind die Engagementbereiche breit gefächert und reichen von sozialen, kulturellen, politischen, religiösen Bereichen bis hin zu Freizeit- und Geselligkeitsbereichen.
9 SGB XI – Soziale Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I, S. 1014).
10 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Frauen Baden-Württemberg (1991); Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1994). Dazu auch Otto (1995).
11 Vgl. Seniorenhilfe Dietzenbach (2004).
12 Zur Abgrenzung von Seniorengenossenschaften zu Tauschringen: Köstler (2007).
13 Ein auf Zeitgutschriften basierendes Pflegeversorgungssystem ist das in Japan existierende Fureai-Kippu-System. Soziale Dienstleistungen, insbesondere die Pflege älterer Menschen, werden durch Zeitgutschriften honoriert, die dann im eigenen Alter mit selbst in Anspruch genommenen Leistungen verrechnet werden können; dabei sind auch Transfers z. B. zu Eltern möglich. Vgl. Lietaer (2004); Kennedy (2005).
14 Einige Initiativen haben zwar in der Vereinssatzung die Umwandlung des Vereins in die Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft als zukünftiges Ziel festgesetzt, dies jedoch bis dato nicht umgesetzt. Das zum 18. August 2006 in Kraft getretene novellierte Genossenschaftsgesetz verbessert die Rahmenbedingungen für kleine Genossenschaften in zweierlei Hinsicht: Durch die Erleichterungen der Gründung von Genossenschaften – indem die Gründungsmitgliederzahl von sieben auf drei abgesenkt wird – und die Ausnahmeregelungen von der Prüfung des Jahresabschlusses für kleine Genossenschaften gewinnt die Rechtsform der Genossenschaft für Bereiche des bürgerschaftlichen Engagements durchaus an Interesse. Bleibt abzuwarten, ob dadurch die Attraktivität der genossenschaftlichen Rechtsform gestärkt wird.
15 Vgl. Putnam (2001, S. 20). Die Beitragssammlung des Buches gibt einen Überblick über die Veränderungen des Sozialkapitals in acht wirtschaftlich fortgeschrittenen Demokratien in den letzten 50 Jahren. Sozialkapital wird dabei als Wesensmerkmal der Bürgergesellschaft angenommen, das im Zeitablauf variiert.
2 Vorgehen des Forschungsvorhabens
2.1 Forschungsfragestellung
Auf das quantitative Forschungsprojekt Seniorengenossenschaften – Stabilitätseigenschaften und Entwicklungschancen aufbauend geht das Forschungsprojekt Motive und Handlungsmuster von Bürgern in Seniorengenossenschaften mit seinem qualitativen Ansatz einen Schritt weiter. Ziel ist es, die Motive der Bürger, sich in Seniorengenossenschaften zu engagieren, aus deren Lebensgeschichte heraus zu dokumentieren. Zusammengetragen werden Informationen über die Lebensbedingungen und Lebensauffassungen der Mitglieder von Seniorengenossenschaften, um so die Erfahrungen der Mitglieder zu rekonstruieren, deren Lebenswünsche und Verarbeitungswege kennen zu lernen und Sinnressourcen für ein seniorengenossenschaftliches Engagement darzulegen. Das Engagement der Mitglieder wird so aus deren lebensgeschichtlichen Sinnzusammenhängen sichtbar gemacht, und die Ausführung der Aktivitäten in einer Seniorengenossenschaft erscheinen als Ergebnis der lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Dazu werden die Abläufe und Entwicklungsprozesse erfasst, die sich im Verlauf der seniorengenossenschaftlichen Tätigkeit vollziehen. Zieldeterminierend soll dann versucht werden, die Handlungsmotivation aus der Lebenslage der Person zu verstehen. Lebenslagen werden definiert als „Handlungsspielräume, die Personen zur Realisierung ihrer Lebensentwürfe, Zielsetzungen und Wertvorstellungen zur Verfügung stehen“ (Schulz-Nieswandt, 2002, S. 194). Diese Handlungsspielräume eröffnen Wechselwirkungen zwischen Person und Welt und sind ressourcentheoretisch geprägt. Die Person verfügt über personale Ressourcen, ebenso über situative und kontextuelle Ressourcen, die zusätzlich in Rahmenbedingungen des individuellen Wohnumfelds und der personenbezogenen Gesundheit eingebettet sind. Die Wechselwirkung von Person und Welt ist fundiert im Transaktionalismus (Schulz-Nieswandt, 2006, S. 33 f.). Hierbei ist das Verhältnis zwischen Person und Außenwelt nicht statisch, sondern prozesshaft. Es wird nach der Beziehung zwischen der Person und der Welt gefragt, ebenso nach der Position der Person innerhalb dieser Beziehung. Dabei ist die Beziehung kreislauftechnisch zu sehen, als ein gegenseitiges Einwirken von Person und Außenwelt. Zu differenzieren ist zwischen der Merkwelt – als dem Strukturraum des Sozialen, in dem die darin eingebettete Person agiert – und der Wirkwelt – als dem Raum der Außenwelt, auf den die Person einwirkt.
Das Zusammenspiel von Person und Außenwelt generiert Sinnkonzepte, teilweise vom Menschen bewusst konstruiert, größtenteils aber unbewusst gelebt. Mithilfe des leitfadengestützten narrativen Interviews wird – quasi die Position eines außen stehenden Beobachters einnehmend – aus den Berichten und Verhalten der Befragten auf die Auseinandersetzung der Befragten mit sich und ihrer Mit- und Umwelt geschlossen. Dabei ist dem Befragten sein eigenes Sinnkonzept – da unbewusst – nicht unbedingt hinreichend formulierbar. Das individuumseigene Sinnkonzept soll daher aufgedeckt werden durch die Analyse der sozialen Wirklichkeit, wie sie von den Befragten in unhintergehbar ablaufenden Interpretationsprozessen hergestellt wird (Bohnsack, 2006, S. 22; Bohnsack, 2007). Es geht demnach um ein Handlungsgeflecht aus individuellen Lebens vorstellungen und -handhabungen, die unterschiedlichen Zielsetzungen folgen und die geprägt sind von individuellen Wertvorstellungen; die subjektiv gelebten Werte werden wiederum beeinflusst von den in der Gesellschaft vorherrschenden Normen.
Ob sich jemand gerade in einer Seniorengenossenschaft engagiert, ist geprägt durch seine gegenwärtige biographische Situation, seine vergangenen Erfahrungen und seine zukunftsgerichteten Erwartungen. Die Biographie ist eingebettet in die soziale Wirklichkeit. Und so lauten die Forschungsfragen: Was hat lebensgeschichtlich bewirkt, dass sich Bürger in genossenschaftsartigen Sozialgebilden engagieren und für und mit anderen etwas entstehen lassen? Welche lebensgeschichtlichen Erfahrungen liegen den Mitgliedern der Seniorengenossenschaften zugrunde? Wie ist das seniorengenossenschaftliche Engagement in den biographischen Ablauf eingebettet? Wie entwickelt sich dann die Fähigkeit der Bürger, im Lebenskreis und im Gemeinwesen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen?
2.2 Ziel und Verwendungszusammenhang
Die Untersuchungsergebnisse sollen vor dem Hintergrund des Lebenslagenkonzepts (Schulz-Nieswandt, 2006, S. 14) die Faktoren darlegen, die das eigenverantwortliche, auf Gegenseitigkeit beruhende Engagement älterer Menschen begünstigen. Die Person verfügt über Kompetenzen, die als personale Ressourcen bezeichnet werden, zusätzlich stehen der Person aber auch kontextuelle Ressourcen zur Verfügung. Personale Ressourcen umfassen Alltagskompetenzen, kognitive Kompetenzen und psychische Kompetenzen, dabei geht der Kompetenzbegriff über Wissenserfahrung und Informationsbeschaffung hinaus und schließt die emotionalen Verarbeitungskapazitäten der Person mit ein. Kontextressourcen sind Ressourcen wie Berufsbiographie, Einkommen und Vermögen, Transferleistungen und soziale Netzwerkressourcen.16 Insgesamt ist das Wechselspiel von Person und Umwelt eingebettet in Rahmenbedingungen, die einerseits personaler Natur sind, wie z. B. der Gesundheitszustand, und andererseits umwelttechnischer Natur sind, wie das Wohnumfeld, die vorhandenen Verkehrssysteme und Siedlungsstrukturen.
Die biographisch orientierte Analyse des Forschungsvorhabens eruiert die aus den personalen Kompetenzen fundierenden Sinnressourcen, die dem Engagement zugrunde liegen. Wichtig für die Fragestellung, was Bürger lebenslagenorientiert motiviert, sich in seniorengenossenschaftsartigen Sozialgebilden zu engagieren, ist die biographische Fundierung der Sinnressourcen. Die Entstehung von Sinnquellen für seniorengenossenschaftliches Engagement kann dabei bereits in der Kindheit und Jugend durch Vorleben oder Abverlangen von Engagement für andere entwickelt werden. Traditionelle ehrenamtliche Tätigkeiten in christlichen Rahmenbedingungen stellen den christlichen Glauben als Sinnressource in den Mittelpunkt und leben Altruismus aus Überzeugung und Pflichtbewusstsein.17 Auch kann das Engagement als Instrument des sozialen Aufstiegs, verbunden mit der Erlangung von sozialer Anerkennung erfolgen. Ein Engagement mit dem Ziel des beruflichen Aufstiegs ist für in Seniorengenossenschaften Engagierte unwahrscheinlich, da die Mitglieder der Seniorengenossenschaften größtenteils im dritten und vierten Lebensalter sind. Im Zusammenhang mit seniorengenossenschaftlichem Engagement ist zu fragen, in welchem Umfang die Sinnquelle Facetten des Selbstbezugs aufweist. Dann ist eine Sinnquelle des Engagements darin zu sehen, dass eine biographische Neuorientierung erfolgt und die psychische Persönlichkeit gestärkt wird, indem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gesteigert und Ängste abgebaut werden. Der Selbstbezug kann aber auch mit dem Ziel der Kompetenzerweiterung und Selbstentfaltung erfolgen, dann ist die Sinnressource gekoppelt an die Suche nach neuen Erfahrungshorizonten. Auch die direkte Auseinandersetzung mit dem Prinzip Leistung–Gegenleistung oder die Befürwortung des Prinzips Geben–Nehmen kann als Orientierungsmuster fungieren.
Die Frage nach den Sinnquellen ist eng verknüpft mit der Frage nach Sinnkrisen. Denn erst mit der Erfahrung einer Sinnleere oder der Infragestellung der Sinnressource wird das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit des Lebenskonzepts angestoßen. Dann wird das Engagement genutzt zur biographischen Neuorientierung oder gar zur Einleitung eines biographischen Wandlungsprozesses, der an frühere Lebensentwürfe anknüpft. Da die Angebotspalette der Seniorengenossenschaften von den Mitgliedern selbst gestaltet wird, sind die Facetten des Selbstbezugs näher und differenzierter zu betrachten. Die engagierten Mitglieder schaffen sich selbst die Rahmenbedingungen und die Aufgabenfelder ihres Engagements. Gerade wenn der Zugang zum Engagement mit oder nach dem Eintritt in den Ruhestand erfolgt, ist der Zugang durch eine Suche nach Tätigkeitsfeldern geprägt. Zu fragen ist, inwieweit die Sinnhaftigkeit des Engagements in der damit vollzogenen Fortsetzung der Berufstätigkeit zu suchen ist und ob die sinnhafte Gestaltung des Alters und Alterns als handlungsorientierend erkannt werden kann.
Das übergeordnet angestrebte Ziel ist, allgemein gültige Aussagen abzuleiten, die die Motive des Engagements in genossenschaftsartigen Sozialgebilden darlegen. Gerade das fallrekonstruktive Forschungsvorgehen mit seiner Fragestellung nach den Verlaufsformen und Sinnorientierungen seniorengenossenschaftlichen Engagements bietet eine Basis für die Erarbeitung sozialpolitischer Maßnahmen zur Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Handeln. Ein weiterer Aspekt liegt im Aufzeigen, wie seniorengenossenschaftliches Handeln gemeinwesenorientiert gefördert werden kann. Somit sind die Forschungsergebnisse von großem Interesse für Gemeinden und kommunale Träger.
2.3 Forschungsdesign
Die Robert Bosch Stiftung Stuttgart finanzierte das Forschungsprojekt und war in die inhaltliche Planung und Durchführung aktiv eingebunden.
Das in Abbildung 2.1 dargestellte Forschungsdesign zeigt, dass der Forschungsauftrag mehrstufig ist. Motive und Handlungsmotivationen von Bürgern in Seniorengenossenschaften sollten aus deren Lebenslage dokumentiert werden. Zentrales Element ist die biographische Befragung aktiver Mitglieder von Seniorengenossenschaften im Rahmen von leitfadengestützten narrativen Interviews. Ergänzend erfragte ein Fragebogen validierte Skalen zu den Motiven des Engagements, weiterhin wurden auch Wertorientierungen und soziodemographische Merkmale abgefragt.
Für die Konstruktion des Interviewleitfadens und die Auswahl der validierten Items wurden Ergebnisse des Forschungsprojekts Seniorengenossenschaften – Stabilitätseigenschaften und Entwicklungschancen genutzt. Außerdem erfolgte eine ausführliche Recherche der neueren Literatur zum Themenfeld