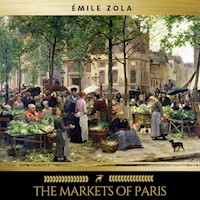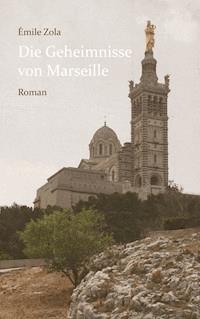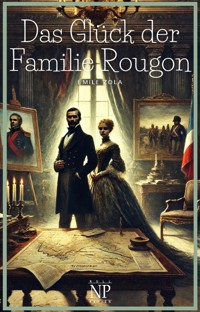0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rougon-Macquart
- Sprache: Deutsch
Germinal Das Hauptwerk von Émile Zolas zwanzigbändigem Werk »Das Leben der Familie Rougon-Macquart« beschreibt die unmenschlichen Verhältnisse in französischen Bergwerken des 19. Jahrhunderts. Konflikte, zwischen Reich und Arm, Mann und Frau, Unterdrückern und Unterdrückten brechen sich Bahn. Der Maschinist Etienne Lantier kommt auf der Suche nach Arbeit in die Bergarbeiter-Siedlung des Schachtes »Le Voreux«. Hier findet er bei der Familie Maheu, in deren älteste Tochter Katharina er sich verliebt, Unterkunft und neue Arbeit. Von den unwürdigen Lebensumständen entsetzt und von der Idee des Sozialismus begeistert, stachelt er die Bergarbeiterfamilien zum Aufstand auf. Es kommt zum Streik. Die Lebensbedingungen der Arbeiter verschlechtern sich, da sie nun überhaupt nicht mehr bezahlt werden. Schließlich muss es in einer Gewaltentladung zur Katastrophe kommen, das Militär greift ein. Zola, der Chronist der Französischen Industrialisierung beschreibt detailliert und mit viel schriftstellerischer Liebe zu den Charakteren - den Bösen wie den Guten - Ausbeutung und unmenschliche Lebensumstände: Ganze Arbeitergenerationen erniedrigt und ausgenutzt von den Herrschenden. Der Germinal (deutsch auch »Keimmonat«) ist der siebte Monat des Republikanischen Kalenders der Französischen Revolution. Der Roman wurde mehrfach verfilmt, unter anderem im Jahre 1993 mit Gérard Depardieu Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Émile Zola
Germinal
Émile Zola
Germinal
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Armin Schwarz EV: Universum-Bücherei für Alle, Berlin, 1930 3. Auflage, ISBN 978-3-954182-28-2
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Autor
Germinal
Teil 1
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Teil 2
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Teil 3
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Teil 4
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Teil 5
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Teil 6
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Teil 7
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor
Émile François Zola (✳ 2. April 1840 in Paris; † 29. September 1902 ebenda) war ein französischer Schriftsteller und Journalist.
Zola gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Leitfigur und Begründer der gesamteuropäischen literarischen Strömung des Naturalismus. Zugleich war er ein sehr aktiver Journalist, der sich auf einer gemäßigt linken Position am politischen Leben beteiligte.
Sein »Artikel J’accuse …!« (Ich klage an …!) anlässlich der Dreyfus-Affäre war ein wichtiges Element bei der schließlichen Rehabilitierung des fälschlich wegen Landesverrats verurteilten Offiziers Alfred Dreyfus.
Émile Zola wurde in Paris als Sohn des italienisch-österreichischen Eisenbahningenieurs Francesco Zola (eigtl. Zolla) geboren. Seine Mutter, Émilie Aurélie Aubert (1819–1880), war Französin.
Zola wuchs in Aix-en-Provence auf. In Aix war Zola mit dem späteren großen Maler Paul Cézanne und dem späteren Bildhauer Philippe Solari befreundet.
Sein Durchbruch wurde 1867 der Roman »Thérèse Raquin«, der eine spannende Handlung um die zur Ehebrecherin und Mörderin werdende Titelheldin mit einer ungeschönten Schilderung des Pariser Kleinbürgertums verbindet. Das Vorwort zur zweiten Auflage 1868, in dem Zola sich gegen seine gutbürgerlichen Kritiker und ihren Vorwurf der Geschmacklosigkeit verteidigt, wurde zum Manifest der jungen naturalistischen Schule, zu deren Oberhaupt Zola nach und nach avancierte.
Zu Zolas Lebzeiten am erfolgreichsten war »La Débâcle« (Der Zusammenbruch, 1892), dessen Handlung vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 und der blutig unterdrückten Pariser Commune spielt.
Heute noch gelesen werden vor allem die beiden Romane »L’Assommoir« (Der Totschläger, 1877), wo am Schicksal einer Wäscherin und ihrer Familie sehr eingängig die Auswirkungen des Alkoholismus im beengten und tristen Pariser Unterschichtenmilieu beschrieben werden, und »Germinal« (1885), das die dramatische Geschichte eines Bergarbeiterstreiks im Kräftefeld der wirtschaftlichen und ideologischen Antagonismen der Zeit darstellt.
Mehrere der Romane, unter anderem »Thérèse Raquin«, »Nana«, »L’Assommoir« und »Germinal«, wurden bald nach ihrem Erscheinen zu erfolgreichen Theaterstücken verarbeitet und später auch verfilmt.
Zola starb zu Beginn der Heizperiode im Herbst 1902 durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in seiner Pariser Wohnung. Je nach politischem Standpunkt wurden Gerüchte über einen Selbstmord oder Mord geschürt. Eine Untersuchungskommission machte Experimente mit dem Ofen und kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfall handelte. 50 Jahre später wurde berichtet, dass ein Schornsteinfeger, der Mitglied der nationalistischen »Ligue des Patriotes« war, einem Gleichgesinnten gegenüber angegeben habe, den Kamin verstopft zu haben.
Werksauszug
Das Glück der Familie Rougon (La fortune des Rougon 1871)
Der Bauch von Paris (Le ventre de Paris 1873)
Die Eroberung von Plassans (La conquête de Plassans 1874)
Seine Exzellenz Eugene Rougon (Son excellence Eugène Rougon 1876)
Der Totschläger (L’Assommoir 1877)
Nana (Nana 1880)
Das Paradies der Damen (Au bonheur des dames 1883)
Germinal (Germinal 1885)
Die Erde (La terre 1887)
Die Bestie im Menschen / Das Tier im Menschen (La bête humaine 1890)
Der Zusammenbruch (La débâcle 1892)
Doktor Pascal (Le docteur Pascal 1893)
Germinal
Der Germinal (deutsch auch »Keimmonat«) ist der siebte Monat des Republikanischen Kalenders der Französischen Revolution.
Teil 1
Erstes Kapitel
In sternenloser, finsterer, rabenschwarzer Nacht schritt ein einzelner Mann durch die flache Ebene auf der Heerstraße dahin, die von Marchiennes nach Montsou führt und sich zehn Kilometer lang geradeaus durch Rübenfelder hinzieht. Er vermochte selbst den schwarzen Boden vor sich nicht zu unterscheiden und hatte das Gefühl des ungeheuren, flachen Horizontes nur durch das Wehen des Märzwindes, der in breiten Stößen eisig kalt dahinfuhr, nachdem er meilenweite Strecken von Sümpfen und kahlen Feldern bestrichen hatte. Kein Baumschatten hob sich vom Nachthimmel ab; die Straße zog sich mit der Regelmäßigkeit eines Dammes durch die stockfinstere Nacht hin, in der das Auge wie geblendet war.
Der Mann war gegen zwei Uhr von Marchiennes aufgebrochen. Er machte lange Schritte, denn er fröstelte in seiner Jacke von dünnem Wollenzeug und in seinem Beinkleid von Samtstoff. Sein Päckchen, das in ein karriertes Taschentuch gewickelt war, belästigte ihn sehr; er drückte es bald mit dem einen, bald mit dem anderen Ellenbogen an sich, um beide Hände zugleich in die Taschen stecken zu können, seine erstarrten Hände, die der eisige Ostwind wundgeblasen hatte. Ein einziger Gedanke beschäftigte seinen hohlen Kopf eines arbeits- und obdachlosen Arbeiters: die Hoffnung, dass nach Sonnenaufgang die Kälte weniger empfindlich sein werde. Er mochte eine Stunde so dahingeschritten sein, als er zur Linken zwei Kilometer von Montsou rote Feuer wahrnahm, drei Gluthaufen im freien Felde, die gleichsam in der Luft schwebten. Zuerst zögerte er, von Furcht ergriffen; dann konnte er dem schmerzlichen Bedürfnisse nicht widerstehen, einen Augenblick seine Hände zu wärmen.
Der Mann betrat einen Hohlweg, der dahin führte. Alles um ihn her verschwand. Zur Linken hatte er eine Plankenwand, die einen Schienenweg abschloss, während rechts eine grasbestandene Böschung sich erhob, gekrönt von Häusergiebeln, die in der nächtlichen Finsternis verschwammen; es war das Schattenbild eines Dorfes mit niedrigen, gleichförmigen Hausdächern. Er machte ungefähr zweihundert Schritte. Plötzlich tauchten bei einer Biegung des Weges die Feuer ganz nahe wieder auf, und er begriff jetzt so wenig wie früher, wie es komme, dass sie so hoch unter dem toten Himmel brannten, rauchenden Monden gleichend. Doch am Boden zog ein anderer Anblick seine Aufmerksamkeit auf sich. Es war dies eine schwerfällige Masse, eine Gruppe niedriger Gebäude, aus deren Mitte der Schattenriss eines Fabrikschlotes aufstieg; ein Lichtschein drang aus den wenigen schmutzigen Fenstern hervor; außen hingen am Balken fünf oder sechs trübselige Laternen, deren geschwärzte Hölzer sich zu riesigen Gerüsten aneinanderreihten; von dieser fantastischen, in Nacht und Rauch getauchten Erscheinung stieg eine einzige Stimme auf: der laute und lange Atem einer Dampfausströmung, die man nicht sah.
Da erkannte der Mann, dass er sich bei einem Bergwerk befand. Abermals ward er von Scham ergriffen: was nützte es? Er bekam doch keine Arbeit. Anstatt seine Schritte nach den Gebäuden zu lenken, entschloss er sich endlich, den Hügel zu ersteigen, auf dem die drei Kohlenfeuer in großen, gusseisernen Körben brannten, um Licht und Wärme zur Arbeit zu liefern. Die bei dem Abbau beschäftigten Arbeiter mussten bis in die späte Nacht am Werke gewesen sein, denn es wurde noch immer Schutt herausgeführt. Er hörte jetzt die Abführer die Züge über die Gerüste schieben und unterschied lebende Schatten, die bei jedem Feuer ihre Hunde leerten.
»Guten Morgen«, sagte er, als er sich einem der Feuerkörbe näherte.
Der Kärrner stand mit dem Rücken dem Feuer zugewendet; es war ein alter Mann in einer Trikotjacke von blauem Wollenzeug und mit einer Mütze von Kaninchenfell; sein Pferd, ein großer, gelber Gaul, wartete unbeweglich, als sei es von Stein, bis man die sechs Karren, die es heraufgeführt, geleert hatte. Der bei der Ausleerungsvorrichtung angestellte Handlanger, ein roter, magerer Bursche, beeilte sich nicht; mit schläfriger Hand drückte er auf den Hebel. Da oben wehte der Wind noch stärker, ein eisiger Nordost, dessen breite, regelmäßige Stöße gleich Sensenstrichen vorüberzogen.
»Guten Morgen«, erwiderte der Alte.
Dann trat wieder Stille ein. Der Fremdling, der sich mit misstrauischen Blicken betrachtet wusste, sagte sogleich seinen Namen.
»Ich heiße Etienne Lantier und bin Maschinist. Gibt es hier keine Arbeit?«
Die Flammen beleuchteten ihn; er mochte einundzwanzig Jahre zählen, war sehr braun, ein hübscher Mann von kräftigem Aussehen trotz seiner kleinen Gestalt.
Der Kärrner schüttelte den Kopf; er schien jetzt beruhigt.
»Arbeit für einen Maschinisten?« sagte er. »Nein, nein … Gestern waren auch zwei da. Es gibt keine Arbeit.«
Ein Windstoß schnitt ihm das Wort ab. Dann fragte Etienne, indem er auf die dunkle Gruppe von Gebäuden am Fuße des Hügels zeigte:
»Das ist ein Bergwerk, nicht wahr?«
Der Alte konnte nicht sogleich antworten. Ein heftiger Hustenanfall drohte ihn zu ersticken. Endlich spie er aus, und sein Speichel bildete einen schwarzen Fleck am roten Erdboden.
»Ja, das Bergwerk le Voreux … Der Ort liegt ganz nahe.«
Er wies mit ausgestrecktem Arme nach dem im Dunkel der Nacht daliegenden Dorfe, dessen Hausdächer der junge Mensch mehr erraten als gesehen hatte. Doch die sechs Hunde waren jetzt leer; der Alte folgte ihnen ohne einen Peitschenknall mit seinen gichtsteifen Beinen, während der große, gelbe Gaul von selbst seinen Gang wieder antrat und zwischen den Schienen mühsam seine Last schleppte, von einem neuen Windstoße gepeitscht, der ihm die Haare sträubte.
Die Grube le Voreux schien aus dem Nachtschlafe zu erwachen. Etienne, der seine armen, blutenden Hände am Kohlenfeuer wärmte, verlor sich völlig in seinen Betrachtungen und erkannte allmählich sämtliche Teile des Bergwerkes, den geteerten Schuppen des Sichtungswerkes, den Glockenstuhl des Schachtes, die geräumige Halle der Fördermaschine, den viereckigen Turm der Schöpfpumpe. Dieses Bergwerk, das in der Tiefe einer Schlucht lag, schien ihm mit seinen niedrigen Ziegelbauten, seinem wie ein drohendes Horn in die Höhe ragenden Schlot das unheilkündende Aussehen eines gierigen Raubtieres zu haben, das dahockte, um die Welt zu verschlingen. Während er es betrachtete, dachte er an sich selbst, an sein Vagabundenleben, das er seit acht Tagen auf der Suche nach einem Platze führte. Er sah sich in seiner Eisenbahnwerkstätte wieder, wo er seinen Vorgesetzten geohrfeigt hatte, dann aus Lille verjagt und von überall vertrieben. Am Samstag war er in Marchiennes angekommen, wo er in den Eisenhütten angeblich Arbeit finden sollte; aber es war nichts, weder in den Eisenhütten, noch in den Fabriken Sonnevilles; er hatte den Sonntag unter den Hölzern einer Wagnerei verborgen zugebracht, deren Aufseher ihn um zwei Uhr nachts weggejagt hatte. Er hatte nichts mehr, keinen Sou und keinen Bissen Brot; was sollte er anfangen? Ziellos irrte er auf den Heerstraßen und wusste nicht, wohin vor den Unbilden des Wetters flüchten? Ja, es war ein Bergwerk, die wenigen Laternen beleuchteten das Pflaster des Vorhofes; eine plötzlich geöffnete Tür gestattete ihm, die Feuerung der Dampferzeuger in hellem Lichte zu sehen. Er erklärte sich jetzt alles, selbst die Dampfausströmung der Pumpe, dieses laute, lange, unablässige Atmen, das gleichsam der verschleimte Atem des Ungeheuers war.
Der Handlanger bei der Kohlenlöschhalde stand mit gekrümmtem Rücken da und warf keinen Blick auf Etienne. Dieser wollte eben sein kleines Bündel vom Boden wieder aufheben, als ein Hustenanfall die Rückkehr des Kärrners ankündigte. Man sah ihn langsam aus dem Dunkel auftauchen, gefolgt von dem gelben Gaul, der sechs volle Hunde schleppte.
»Gibt es in Montsou Fabriken?« fragte der junge Mann.
Der Alte warf wieder schwarzen Speichel aus und erwiderte dann:
»Oh, an Fabriken ist kein Mangel. Man müsste es noch vor drei, vier Jahren sehen! Es summte und brummte ringsumher; man konnte nicht genug Leute finden; nie hatte man einen so guten Erwerb. Jetzt aber sind wieder magere Jahre gekommen. Ein rechtes Elend ist ins Land eingezogen; man entlässt die Leute, die Werkstätten werden geschlossen, eine nach der anderen … Es ist vielleicht nicht die Schuld des Kaisers; aber warum geht er nach Amerika, sich herumschlagen? Dazu kommt noch, dass das Vieh an der Cholera zugrunde geht geradeso wie die Menschen.«
In kurzen Sätzen mit stockendem Atem beklagten sich die beiden weiter. Etienne erzählte, wie er seit einer Woche vergebens Arbeit suche. Müsse man denn wirklich vor Hunger umkommen? Bald würden die Landstraßen sich mit Bettlern füllen. »Ja, ja,« meinte der Alte, »das wird bös enden. Gott kann unmöglich wollen, dass so viele Christenmenschen auf die Straße geworfen werden.«
»Man hat nicht alle Tage seinen Bissen Fleisch.«
»Wenn man nur alle Tage Brot hätte!«
»Das ist wahr; wenn man nur alle Tage Brot hätte!«
Ihre Stimmen verloren sich; die Windstöße entführten ihre Worte mit trübem Geheul.
»Seht, dort liegt Montsou!« sagte jetzt der Kärrner laut und wandte sich nach Süden.
Wieder streckte er die Hand aus und zeigte im Dunkel auf unsichtbare Punkte in dem Maße, wie er sie nannte. Fauvelles Zuckerfabrik in Montsou halte sich noch, Hotons Zuckerfabrik jedoch verringere ihre Arbeiter; nur Dutilleuls Müllerei und Bleuzes Seilerei hätten noch zu tun. Dann zeigte er mit einer weiten Handbewegung den halben Horizont im Norden; die Bauwerkstätten Sonnevilles hätten dieses Jahr nicht zwei Drittel ihrer sonstigen Aufträge bekommen; von den drei Hochöfen der Eisenwerke zu Marchiennes seien bloß zwei angeblasen; in der Glasfabrik Gagebois endlich drohe ein Ausstand, weil man von einer Herabsetzung der Arbeitslöhne spreche.
»Ich weiß, ich weiß«, wiederholte der junge Mann bei jeder dieser Auskünfte. »Ich komme von dort.«
»Bei uns ist es bisher noch erträglich«, fügte der Kärrner hinzu. »Und doch haben die Kohlengruben überall ihren Betrieb eingeschränkt. Da drüben auf dem Siegeswerk brennen auch nur mehr zwei Koksöfen.«
Er spie und ging wieder hinter seinem schlummernden Gaul her, den er von Neuem vor die leeren Hunde gespannt hatte.
Jetzt konnte Etienne mit seinem Blick die ganze Gegend umfassen. Es herrschte noch immer eine tiefe Finsternis; aber die Hand des Alten hatte sie gleichsam mit einem großen Elend angefüllt, das der junge Mann jetzt unwillkürlich überall ringsumher in der ganzen unermesslichen Ausdehnung fühlte. War’s nicht ein Schrei des Hungers, den der Märzwind durch diese kahle Landschaft trug? Die Windstöße waren stärker geworden; sie schienen den Tod der Arbeit mit sich zu führen, eine Hungersnot, die viele Menschen zu töten drohte. Seine irrenden Augen strengten sich an, die Finsternis zu durchdringen, gepeinigt von dem Verlangen und der Furcht zu sehen. Alles verlor sich in der Tiefe der nächtlichen Finsternis; er sah nichts als in weiter Ferne die Hochöfen und die Koksöfen. Die letzteren, Batterien zu hundert schief sitzender Schlote, dehnten ihre Rampen von roten Flammen dahin, während die beiden mehr nach links gelegenen Hochöfen unter freiem Himmel mit blauen Flammen brannten gleich Riesenfackeln. Es war traurig wie auf einer Brandstätte; keine anderen Lichter waren zu sehen an diesem drohenden Horizont als diese nächtlichen Feuer der Eisen und Kohle erzeugenden Länder.
»Sind Sie vielleicht aus Belgien?« fragte jetzt hinter Etienne der Kärrner, der zurückgekehrt war.
Diesmal brachte er nur drei Hunde; man konnte sie immerhin ausleeren. Im Aufzugsschachte war eine Schraubenmutter gebrochen, und dieser Unfall störte die Arbeit eine gute Viertelstunde. Am Fuße des Hügels war es still geworden. Die Männer an der Winde hatten aufgehört, mit ihrer Arbeit die Gerüste in unaufhörlicher Erschütterung zu erhalten. Nur aus der Grube tönte das ferne Geräusch eines Hammers herauf, der auf Blech losschlug.
»Nein, ich bin aus dem Süden«, antwortete der junge Mann.
Der Handlanger hatte die Hunde ausgeleert und sich dann auf die Erde gesetzt, ganz froh über den Unfall, der ihm eine kurze Ruhe gestattete. Er bewahrte seine stille Scheu und erhob die matten Augen ganz erstaunt zu dem Kärrner, gleichsam verdrossen über so viele Worte. Der letztere hatte in der Tat nicht die Gewohnheit, so viel zu reden. Das Gesicht des Fremden musste ihm gefallen, und er wurde augenscheinlich von jenem Drang nach Vertraulichkeit erfasst, der zuweilen bewirkt, dass alte Leute von selbst und ganz laut zu plaudern beginnen.
»Ich bin von Montsou,« sagte er, »und heiße Bonnemort.«1
»Das ist wohl ein Spitzname?« fragte Etienne erstaunt.
Der Alte grinste vergnügt und sagte, nach dem Voreuxschachte zeigend:
»Ja, ja … Man hat mich dreimal in Stücken von dort herausgezogen. Das erste Mal war mir alles Haar weggesengt, das zweite Mal steckte ich in der Erde bis an den Kropf; das dritte Mal war der Bauch von Wasser angeschwollen wie der eines Frosches … Da sahen die Leute, dass ich nicht hin werden wollte, und nannten mich Bonnemort, freilich nur so zum Spaß.«
Er begann dabei zu kichern; es klang wie das Kreischen eines eingerosteten Brunnenschwengels und artete schließlich in einen furchtbaren Hustenanfall aus. Der Feuerkorb beleuchtete jetzt vollständig seinen dicken Kopf mit den weißen, schütteren Haaren und dem flachen, bleichen, bläulich gefleckten Gesichte. Er war klein von Gestalt, hatte einen furchtbar dicken Hals, die Waden und Fersen nach außen gekehrt, lange Arme, deren vierschrötige Hände auf seinen Knien ruhten. Er schien übrigens von Stein zu sein wie sein Pferd, das unbeweglich auf den Beinen stand, völlig unbekümmert um den Wind; die Kälte und der Wind, der ihn um die Ohren pfiff, ließen ihn unberührt. Wenn er gehustet hatte – wobei ein tiefes Röcheln seinen Hals zu zerreißen schien – spie er am Fuße des Feuerkorbes aus, und die Erde färbte sich schwarz.
Etienne betrachtete ihn und dann den Boden, auf den der Alte in solcher Weise schwarze Flecke warf.
»Ist’s schon lange her, dass Ihr in der Grube arbeitet?« hub Etienne wieder an.
Bonnemort tat die beiden Arme weit auseinander und erwiderte:
»Lange? Ach, ja … Ich war noch nicht acht Jahre alt, als ich in den Voreuxschacht einfuhr; jetzt zähle ich achtundfünfzig. Rechnen Sie einmal … Ich habe da drinnen alles gemacht, war zuerst Schlepper, dann Eggenmann, als ich stark genug dazu war, hernach Schaufler achtzehn Jahre lang. Und später, als die vertrackten Beine schlecht wurden, taten sie mich zum Abbau als Füller und Flicker bis zu dem Tage, da sie mich heraufholen mussten, weil der Arzt sagte, dass ich die Knochen da lassen müsse. Jetzt bin ich Kärrner seit fünf Jahren schon … Fünfzig Jahre Bergwerksarbeit, das ist hübsch, wie? Davon fünfundvierzig in der Grube …«
Während er so sprach, warfen einzelne brennende Kohlenstücke, die aus dem Korbe gefallen waren, einen blutroten Schein auf sein fahles Gesicht.
»Sie raten mir, in den Ruhestand zu gehen«, fuhr er fort. »Aber ich will nicht; ich bin nicht so dumm! … Ich werde wohl noch zwei Jahre aushalten, bis die Sechzig voll sind, um meine Pension von hundertachtzig Franken zu bekommen. Wenn ich heute meinen Abschied nehme, würden sie mir nur hundertfünfzig bewilligen. Es sind gar pfiffige Kerle! … Ich bin übrigens noch kräftig, von den Beinen abgesehen. Das Wasser ist mir unter die Haut gedrungen, weil ich in den Stollen gar so sehr nass geworden bin. Es gibt Tage, an denen ich kein Glied rühren kann, ohne vor Schmerz aufzuschreien.«
Ein Hustenanfall unterbrach ihn wieder.
»Ihr habt auch den Husten davon?« fragte Etienne.
Er schüttelte heftig den Kopf. Als er wieder reden konnte, sagte er:
»Nein, nein; ich habe mich im vorigen Monat erkältet. Niemals habe ich gehustet, jetzt aber kann ich den Husten nicht los werden. Und das Komische dabei ist, dass ich speie …«
Ein Röcheln stieg wieder in seiner Kehle auf, und er spie.
»Ist das Blut?« wagte Etienne endlich zu fragen.
Bonnemort wischte sich mit dem Handrücken langsam den Mund ab.
»Das ist Kohle«, sagte er. »Ich habe in meinem Leichnam genug davon, um mich bis an das Ende meiner Tage zu wärmen. Und doch habe ich seit fünf Jahren keinen Fuß mehr in die Gruben gesetzt. Wie es scheint, habe ich die Kohle aufgespeichert, ohne es zu wissen. Bah! Das hält die Knochen zusammen!«
Es trat wieder ein Schweigen ein; der Hammer in der Ferne führte regelmäßige Schläge; der Wind fuhr klagend dahin wie ein Schrei des Hungers und der Ermüdung, der aus den Tiefen der Nacht gekommen. Vor dem Kohlenfeuer sitzend, das im Winde aufflackerte, fuhr der Alte mit leiserer Stimme in seinen Erinnerungen fort. Ach ja, es war lange her, dass er und die Seinen in den Minengängen arbeiten. Die Familie stand im Dienste der Bergwerksgesellschaft von Montsou seit der Gründung des Unternehmens. Das war lang her, schon hundert Jahre. Sein Großvater, Wilhelm Maheu, hatte als fünfzehnjähriger Bursche die Steinkohle in Réquillart entdeckt; es war die erste Grube der Gesellschaft; sie liegt dort unten in der Nähe der Zuckerfabrik Fauvelle und ist jetzt längst aufgelassen. So wusste es das ganze Land; zum Beweise dessen hieß das entdeckte Kohlenlager »Wilhelmsschacht« nach dem Vornamen seines Großvaters. Er hatte ihn nicht gekannt; es war, wie man erzählte, ein großer, sehr starker Mensch, der mit sechzig Jahren an Altersschwäche gestorben war. Sein Vater, Nikolaus Maheu, genannt der Rote, war mit kaum vierzig Jahren im Voreuxschachte geblieben, der zu jener Zeit gegraben wurde; es fand ein Einsturz statt, eine vollständige Verschüttung; die Felsen verschlangen Blut und Knochen. Später hatten zwei seiner Oheime und seine drei Brüder gleichfalls ihre Haut dagelassen. Er selbst, Vinzent Maheu, der fast ganz, nur mit geschwächten Beinen aus der Grube hervorgegangen war, galt deshalb für einen Schlaumeier. Was war übrigens zu machen? Man musste doch arbeiten und tat es vom Vater auf den Sohn, wie man etwas anderes getan hätte. Sein Sohn Toussaint Maheu schund sich jetzt dort ab, und auch seine Enkel, seine ganze Familie, die da drüben im Dorfe wohnte. Hundert Jahre Frone, nach den Alten die Jungen, immer für den nämlichen Herrn: ist das schön? Nicht viele Spießbürger könnten so leicht ihre Geschichte hersagen.
»Wenn man wenigstens zu essen hat«, murmelte Etienne wieder.
»Das sage ich auch; solarige man Brot hat, kann man leben.«
Bonnemort schwieg und wandte die Augen nach dem Dorfe, wo jetzt Lichter angezündet wurden, eines nach dem anderen. Im Kirchturm zu Montsou schlug es vier Uhr; die Kälte wurde noch empfindlicher.
»Ist eure Gesellschaft reich?« fragte Etienne weiter. Der Greis zog die Schultern in die Höhe und ließ sie wieder sinken, gleichsam erdrückt durch einen Berg von Talern.
»O ja, o ja … Vielleicht nicht so reich wie ihre Nachbarin, die Gesellschaft von Anzin. Aber doch Millionen und Millionen; es ist gar nicht zu zählen … Neunzehn Schächte, davon dreizehn zur Ausbeutung, le Voreux, der Siegesschacht, Crèvecoeur, Mirou, Sankt-Thomas, der Magdalenenschacht, Feutry-Cantel und noch andere; sechs für die Förderung und die Lüftung, wie Réquillart … Zehntausend Arbeiter; Bodenrechte, die sich auf siebenundsechzig Gemeinden erstrecken, eine Förderung von täglich fünftausend Tonnen; eine Eisenbahn, die sämtliche Gruben verbindet; und Werkstätten und Fabriken! … O ja, Geld ist da! …«
Ein Rollen von Hunden über die Gerüste ließ den großen, gelben Gaul die Ohren spitzen. Der Aufzugskasten unten schien inzwischen ausgebessert zu sein; die Männer an der Winde hatten ihre Arbeit wiederaufgenommen. Während der Kärrner seinen Gaul anspannte, um wieder hinabzufahren, sagte er zu dem Tiere in sanftem Tone:
»Vertrackter Faulpelz, du sollst dich nicht ans Schwatzen gewöhnen! … Wenn Herr Hennebeau wüsste, wie du die Zeit vergeudest!«
Etienne schaute nachdenklich in die Nacht hinaus und fragte:
»Das Bergwerk gehört also Herrn Hennebeau?«
»Nein,« erklärte der Alte, »Herr Hennebeau ist nur der Generaldirektor; er wird ebenso bezahlt wie wir.«
Der junge Mann wies mit einer Handbewegung in die unermessliche, dunkle Ferne hinaus und fragte weiter:
»Wem gehört denn all dies?«
Doch Bonnemort ward jetzt von einem neuen, dermaßen heftigen Anfall ergriffen, dass er nicht zu Atem kommen konnte. Als er endlich ausgespien und den schwarzen Schaum von seinen Lippen weggewischt hatte, sprach er in den wieder schärfer gewordenen Wind hinaus:
»Wie? Wem all dies gehört? Man weiß es nicht; es gehört Leuten.«
Er wies in der Dunkelheit nach einem unbestimmten Punkte, nach einem unbekannten, fernen Orte, bevölkert von den Leuten, für welche die Maheu seit hundert Jahren in den Bergwerken arbeiteten. Seine Stimme hatte eine andächtige Scheu angenommen; es war, als spreche er von einem unnahbaren Heiligtum, wo der gesättigte Gott im Verborgenen weilte, dem sie Leib und Leben hingaben, und den sie noch niemals gesehen hatten.
»Wenn man sich doch wenigstens mit Brot sattessen könnte«, sagte Etienne zum dritten Male, ohne scheinbaren Übergang.
»Ach ja, wenn man immer Brot zu essen hätte, es wäre zu schön! …«
Das Pferd hatte sich in Gang gesetzt, auch der Kärrner verschwand mit dem schleppenden Gang eines Invaliden. Der Handlanger bei der Entleerungsvorrichtung hatte sich nicht gerührt; er saß zu einer Kugel zusammengerollt da, das Kinn zwischen den Knien, und starrte mit den großen, matten Augen ins Leere.
Etienne hatte sein Bündel wieder an sich genommen, entfernte sich aber noch nicht. Er fühlte, wie ihm der Rücken in dem eisigen Winde erstarrte, während seine Brust vor dem großen Kohlenfeuer briet. Vielleicht würde er doch gut tun, sich an die Bergwerksverwaltung zu wenden; der Alte war vielleicht nicht recht unterrichtet; überdies fügte er sich in sein Schicksal und war bereit, jegliche Arbeit anzunehmen. Wohin sollte er gehen, und was sollte aus ihm werden in dieser durch den Arbeitsmangel ausgehungerten Gegend? Sollte er hinter einer Mauer verrecken wie ein verlaufener Hund? Doch, hielt ein Zögern ihn zurück, eine Angst vor dem Voreuxschachte inmitten dieser kahlen, in tiefe Nacht getauchten Ebene. Der Wind schien mit jedem Stoße stärker zu werden, als blase er von einem immer mehr sich erweiternden Horizonte her. An dem nachttoten Himmel wollte noch immer kein Morgendämmer sich zeigen; nur die Hochöfen und die Koksöfen flammten in der Finsternis mit blutrotem Schein, ohne die Ferne zu erhellen. Der Voreuxschacht, in seinem Loche hockend wie ein bösartiges Tier, duckte sich noch mehr und atmete tiefer und länger, gleichsam bedrückt durch seine mühsame Verdauung von Menschenfleisch.
Gutertod <<<
Zweites Kapitel
Inmitten der Getreide- und Rübenfelder schlief das Grubendorf der Zweihundertundvierzig in der finsteren Nacht. Man unterschied nur undeutlich die vier Blöcke von kleinen, Rücken an Rücken stehenden Häuschen, gleich den Kasernen oder Spitälern geometrisch genau und parallel angelegte Blöcke, durch drei breite Zwischenräume getrennt, die in gleich große Gärtchen abgeteilt waren. Auf der verlassenen Hochebene hörte man nichts als das Heulen des Windes, der in den abgerissenen Drähten der Einfriedigungen sich verfing.
In der Familie Maheu, die das Häuschen Nummer 16 im zweiten Block bewohnte, rührte sich noch nichts. Die einzige Stube des ersten Stockwerkes lag in tiefe Finsternis gehüllt, die gleichsam mit ihrem Gewichte den Schlaf der Wesen niederhielt, die man zuhauf, offenen Mundes, von Müdigkeit erdrückt meinte daliegen zu sehen. Trotz der schneidenden Kälte, die draußen herrschte, lag hier in der schweren Luft eine lebendige Wärme, jene erstickende Schwüle, die man selbst in den sorgfältigst gereinigten Stuben antrifft, wenn sie nach Menschenfleisch riechen.
Auf der Kuckucksuhr der im Erdgeschoss gelegenen Wohnstube schlug es die vierte Morgenstunde. Nichts rührte sich noch, man konnte zartes Atemholen vernehmen, begleitet von dem geräuschvolleren Atemholen zweier Schnarcher. Plötzlich richtete Katharina sich auf. In ihrer Schlaftrunkenheit hatte sie gleichsam aus Gewohnheit die durch den Fußboden herauftönenden vier Schläge der Uhr gezählt, ohne die Kraft zu finden, vollends zu erwachen. Dann zog sie die Beine unter der Bettdecke hervor, tastete einen Augenblick herum, rieb endlich, ein Zündhölzchen an und machte Licht. Doch blieb sie sitzen; ihr Kopf war so schwer, dass er zwischen den Schultern zurückfiel in einem unüberwindlichen Bedürfnisse, den Schlaf fortzusetzen.
Jetzt beleuchtete die Kerze die viereckige, mit zwei Fenstern versehene Stube, die von drei Betton fast ganz angefüllt war. Es standen da außerdem ein Spind, ein Tisch und zwei Stühle von altem Nussholz, deren dunkler, angerauchter Ton sich scharf von den hellgelb getünchten Mauern abhob. Kein weiteres Einrichtungsstück; die Kleider hingen an Nägeln. Auf den Fliesen stand ein Krug neben einer roten irdenen Schüssel, die als Waschbecken diente. In dem Bette zur Linken schlief Zacharias, der älteste Sohn, ein Bursche von einundzwanzig Jahren, mit seinem Bruder Johannes, der eben sein elftes Jahr vollendete. In dem Bette zur Rechten schliefen zwei kleinere Kinder, Leonore und Heinrich, die erstere sechs, der letztere vier Jahre alt; einander in den Armen haltend, lagen sie da. Katharina teilte das dritte Bett mit ihrer Schwester Alzire, die für ihre neun Jahre so schwächlich war, dass Katherina sie neben sich kaum gefühlt hätte, wäre nicht der Höcker der Kleinen gewesen, den diese ihr in die Seite stieß. Die mit Glasscheiben versehene Tür stand offen; man bemerkte den Flurgang, eine Art Schlauch, wo Vater und Mutter ein viertes Bett einnahmen, vor dem die Wiege der jüngsten Tochter stand, die Estelle hieß und erst drei Monate zählte.
Katharina machte inzwischen eine verzweifelte Anstrengung. Sie streckte sich und krümmte beide Hände in ihren roten Haaren, die struppig auf ihre Stirn und ihren Nacken niederfielen. Schmächtig für ihre fünfzehn Jahre, zeigte sie von ihren Gliedern außerhalb der engen Hülle, die ihr Hemd bildete, nur bläuliche Füße, die von der Kohle gleichsam tätowiert waren, und zarte Arme, deren Milchweiße sich lebhaft von der bleichen Farbe des Gesichtes abhob, das von dem fortwährenden Waschen mit schwarzer Seife schon verdorben war. Ein letztes Gähnen öffnete ihren etwas groß geratenen Mund mit prächtigen Zähnen, die in einem blutleer bleichen Zahnfleische saßen; in ihren grauen Augen lag noch der verhaltene Schlaf, und sie zeigte einen Ausdruck des Schmerzes und der Erschöpfung, der ihre ganze nackte Gestalt zu schwellen schien.
Doch jetzt ward ein Gebrumme aus dem Flur hörbar; Maheu stammelte mit müder Stimme:
»Alle Wetter, es ist Zeit aufzustehen! … Hast du Licht gemacht, Katharina?«
»Ja, Vater; es hat unten vier Uhr geschlagen.«
»Spute dich doch, Nichtsnutz! Hättest du gestern am Sonntag weniger getanzt, dann hättest du uns früher wecken können. Ist das ein Faulenzerleben!«
Er brummte weiter; doch der Schlaf übermannte ihn; seine Vorwürfe verwirrten sich und gingen schließlich in einem neuen Schnarchen unter.
Im Hemde und mit nackten Füßen ging das Mädchen in der Stube hin und her. Als sie am Bette Heinrichs und Leonores vorbeikam, warf sie die herabgeglittene Decke über sie; sie erwachten nicht aus ihrem festen Kinderschlafe. Alzire, die mit offenen Augen dalag, hatte sich wortlos umgewendet, um den noch warmen Platz ihrer älteren Schwester einzunehmen.
»Los, Zacharias! Und du auch, Johannes!« rief Katharina und blieb vor ihren Brüdern stehen, die mit der Nase im Kopfkissen weiter schliefen.
Sie musste den Großen bei der Schulter fassen und schütteln; als er vor sich hin fluchte, entschloss sie sich, ihnen die Decke wegzuziehen. Sie fand es drollig und begann zu lachen, als sie die beiden Jungen mit den nackten Beinen strampeln sah.
»Das ist blöd, lass mich in Frieden!« brummte Zacharias mürrisch, nachdem er sich aufgesetzt hatte. »Ich mag mag solche Spaße nicht … Herrgott, dass man schon wieder aufstehen soll.«
Er war ein magerer, schlotteriger Kerl mit einem langen Gesichte, in dem einige spärliche Bartstoppeln saßen, und hatte die gelben Haare und die blutleere Blässe, die der ganzen Familie eigen waren. Sein Hemd hatte sich bis zum Bauche hinauf verschoben, er zog es herab nicht aus Schamhaftigkeit, sondern weil er fror.
»Es hat unten vier Uhr geschlagen«, wiederholte Katharina. »Auf, auf! Der Vater wird bös.«
»Scher’ dich zum Teufel! Ich will schlafen«, sagte Johannes, zog die Beine an und schloss die Augen.
Sie lachte wieder gutmütig. Er war so klein und seine Glieder so schwächlich mit ihren von den Skrofeln angeschwollenen Gelenken, dass sie ihn mit leichter Mühe in ihre Arme nahm. Allein er zappelte mit den Beinen; seine bleiche, faltige Affenfratze mit den grünen Augen, die durch seine großen Ohren noch breiter wurde, ward ganz bleich in ohnmächtiger Wut. Er sagte nichts, biss sie aber in die rechte Brust.
»Böser Bube!« brummte sie, einen Schrei unterdrückend und den Jungen auf die Erde setzend.
Alzire war nicht wieder eingeschlafen; sie hatte die Decke bis zum Kinn hinaufgezogen und lag stillschweigend da. Mit den klugen Augen eines Krüppels folgte sie den Bewegungen ihrer Schwester und ihrer Brüder, die sich ankleideten. Doch jetzt brach, ein neuer Streit an der Waschschüssel aus; die Jungen stießen das Mädchen weg, weil sie sich zu lange wusch. Die Hemden flogen über die Köpfe, während sie noch schlaftrunken sich wuschen, ohne jede Scham, mit dem ruhigen Behagen einer Tracht junger Hunde, die zusammen aufwachsen. Katharina war übrigens zuerst fertig. Sie schlüpfte in die Bergmannshose, legte die Leinwandjacke an, knüpfte die blaue Haube um den Haarknoten und glich in dieser sauberen Werktagsgewandung einem kleinen Mann. Nichts war von ihrem Geschlecht übriggeblieben, als ein leichtes Wiegen der Hüften.
»Wenn der Alte heimkommt, wird er sich freuen, wenn er das Bett so zerworfen antrifft«, sagte Zacharias boshaft. »Ich werde ihm erzählen, dass du es getan hast.«
Der Alte war der Großvater, Bonnemort, der bei Nacht arbeitete und bei Tage schlief. Das Bett kühlte denn auch nie aus; es schlief immer jemand darin.
Ohne zu antworten, hatte sich Katharina daran gemacht, das Bett in Ordnung zu bringen. Doch seit einer Weile wurden hinter der Mauer aus der Nachbarschaft Geräusche vernehmbar. Diese Ziegelbauten, von der Gesellschaft aufs sparsamste hergestellt, waren so dünn, dass man jeden Laut hindurch hörte. Man lebte eng zusammengedrängt von einem Ende des Ortes bis zum anderen; nichts von dem intimen Leben blieb verborgen, selbst vor den Kindern nicht. Ein schwerer Tritt hatte eine Treppe in Erschütterung gebracht; dann hörte man einen weichen Fall, dem ein Seufzer der Erleichterung folgte.
»Schön«, sagte Katharina. »Levaque geht zur Grube, und Bouteloup geht zur Frau Levaque.«
Johannes kicherte, und auch Alzires Augen funkelten lebhafter. Jeden Morgen belustigten sie sich in dieser Weise über die benachbarte Ehe zu dreien; es war ein Häuer, der einem Erdarbeiter Unterkunft gab; in dieser Weise hatte die Frau zwei Männer, den einen bei Nacht, den ändern bei Tag.
»Philomene hustet«, begann Katharina wieder und spitzte die Ohren.
Sie sprach von der Ältesten der Eheleute Levaque, einem großen Mädchen von neunzehn Jahren, der Geliebten Zacharias’, von dem sie schon zwei Kinder hatte. Sie war übrigens so schwach auf der Brust, dass man sie am Sichtungswerk beschäftigte, weil sie zur Arbeit in der Grube nicht taugte.
»Freilich, Philomene!« antwortete Zacharias. »Die schläft jetzt. Es ist doch eine Schweinerei, bis sechs Uhr zu schlafen.«
Er schlüpfte in seine Hose; da schien ihm ein Einfall zu kommen, und er öffnete ein Fenster. Draußen herrschte noch immer tiefe Dunkelheit, und das Dorf erwachte allmählich; zwischen den Brettchen der Rolladen sah man nacheinander die Lichter aufblitzen. Da gab es einen neuen Zank; Zacharias neigte sich hinaus, um zu spähen, ob er nicht aus dem gegenübergelegenen Hause der Eheleute Pierron den Oberaufseher des Voreuxschachtes weggehen sehe, den man im Verdachte hatte, dass er bei der Frau Pierron schlafe; während Katharina ihm zurief, dass der Mann gestern seinen Tagesdienst in der Grube gehabt habe, und dass folglich Herr Dansaert diese Nacht nicht da geschlafen haben könne. Die Luft drang eiskalt herein; die beiden ereiferten sich; jeder trat für die Richtigkeit seiner Erkundigungen ein, als plötzlich ein heftiges Weinen losbrach. Es war Estelle, die in ihrer Wiege fror.
Maheu erwachte augenblicklich wieder. Was hatte er denn in den Knochen, dass er wieder eingeschlafen war wie ein Taugenichts? Er fluchte so wild, dass die Kinder nebenan keinen Laut mehr wagten. Zacharias und Johannes beendeten mit müden Händen das Waschen. Alzire schaute noch immer mit weit offenen Augen. Die beiden Kleinen, Leonore und Heinrich, hatten trotz des Lärmens sich nicht gerührt, sondern schliefen, einander in den Armen liegend, mit demselben leisen Atem weiter.
»Katharina, gib mir die Kerze!« rief Maheu.
Sie war eben mit dem Zuknöpfen ihrer Jacke fertig geworden und trug die Kerze nach dem Flur, während ihre Brüder bei dem wenigen Lichte, das durch die Glastür fiel, ihre Kleider zusammensuchten. Ihr Vater stieg aus dem Bette. Doch sie hielt sich nicht länger auf; mit dicken Wollstrümpfen an den Füßen stieg sie tastend hinunter, um den Kaffee zu bereiten. Die Holzschuhe der ganzen Familie standen dort unter dem Essschrank.
»Wirst du schweigen, elender Wurm?« rief Maheu, den das fortwährende Geschrei Estelles erbitterte.
Er war klein wie der alte Bonnemort und glich ihm ins Fette übertragen mit seinem starken Kopfe, seinem platten und fahlen Gesichte unter gelben, kurzgeschnittenen Haaren. Das Kind heulte jetzt noch ärger, erschreckt durch die großen, kräftigen Arme, die über seinem Kopfe fuchtelten.
»Lass sie in Frieden; du weißt doch, dass sie nicht still sein will«, sagte seine Frau und streckte sich mitten im Bette aus.
Auch sie war eben erwacht und beklagte sich; es sei doch zu dumm, dass man niemals die volle Nacht durchschlafen könne. Konnten sie denn nicht mit weniger Geräusch weggehen? In die Bettdecke eingewickelt, zeigte sie nichts als ihr langes Gesicht mit den groben Zügen einer etwas schwerfälligen Schönheit, mit neununddreißig Jahren schon verunstaltet durch ihr Leben voll Müh’ und Not und durch die sieben Kinder, die sie geboren. Die Augen auf die Zimmerdecke gerichtet, sprach sie mit gedehnter Stimme, während ihr Mann sich ankleidete. Weder er noch sie achtete auf die Kleine, die sich schier den Hals ausschrie.
»Ich muss dir sagen, dass ich keinen Sou im Hause habe, und es ist heut’ erst Montag; sechs Tage dauert es noch bis zum Fünfzehnten des Monats. Ich weiß nicht, wie wir uns durchschlagen sollen. Ihr bringt alle miteinander neun Franken; wie soll ich da auskommen? Wir sind unser zehn im Hause.«
»Oho, neun Franken?« wandte Maheu ein. »Ich und Zacharias je drei, das macht sechs; Katharina und der Vater je zwei, das macht vier; sechs und vier sind zehn; Johannes bringt einen, macht elf Franken.«
»Ja, elf; aber du rechnest die Sonntage nicht und die Tage, an denen es keine Arbeit gibt. Nie mehr als neun, hörst du?«
Er suchte seinen Ledergurt am Boden und schwieg. Dann richtete er sich auf und sagte:
»Beklage dich nicht, Weib; ich bin noch stark genug. Schon mehr als einer musste mit zweiundvierzig Jahren schon aus der Grube herauf.«
»Das ist möglich, Alter, aber damit haben wir noch kein Brot. Was fange ich an? Hast du nichts?«
»Ich habe zwei Sous.«
»Behalte sie, um einen Schoppen zu trinken … Mein Gott, was fange ich an? Sechs Tage, eine Ewigkeit! … Wir schulden Maigrat sechzig Franken; er hat mir vorgestern die Tür gewiesen. Das soll mich aber nicht hindern, wieder zu ihm zu gehen. Wenn er sich jedoch weigert, uns zu pumpen …«
So fuhr die Maheu fort mit bekümmerter Stimme und unbeweglichem Kopfe; vor dem schwachen Lichte der Kerze schloss sie von Zeit zu Zeit die Augen. Der Schrank sei leer, sagte sie, und die Kleinen verlangten Brotschnitten zum Kaffee, der ebenfalls ausgegangen. Das leere Wasser mache nur Bauchzwicken. Dann erzählte sie von den langen Tagen, die man damit zubringe, dass man mit gekochten Kohlblättern den Hunger täusche. Allmählich hatte sie die Stimme erhöhen müssen, weil Estelles Geheul ihre Worte übertönte. Das Geschrei der Kleinen ward unerträglich. Maheu schien es plötzlich zu hören; außer sich vor Wut nahm er das Kind aus der Wiege und schleuderte es auf das Bett der Mutter mit den Worten:
»Da, nimm sie, denn ich würde sie zertreten … Donner Gottes über den Balg! Das sauft an der Mutterbrust, dem geht nichts ab, und es gröhlt ärger als die anderen!«
Estelle hatte in der Tat zu saugen begonnen; sie war unter der Decke verschwunden und in der Bettwärme still geworden; man hörte nichts mehr als das gierige Lutschen ihrer Lippen.
»Haben die Bürgersleute von Piolaine dir nicht gesagt, dass du sie besuchen sollst?« fragte der Mann nach einer Weile.
Die Frau spitzte die Lippen mit einer Miene mutlosen Zweifels.
»Ja, sie sind mir begegnet«, antwortete sie. »Sie bringen den armen Kindern Kleider … Ich werde heut’ morgen Leonore und Heinrich hinführen. Vielleicht geben sie mir hundert Sous.«
Wieder trat ein Schweigen ein. Maheu war fertig. Er blieb einen Augenblick unbeweglich, dann schloss er mit seiner dumpfen Stimme:
»Was willst du? Es ist einmal so: bringe, wie du kannst, die Abendsuppe fertig. Das Schwatzen führt zu nichts; es wird besser sein, wenn ich zur Arbeit gehe.«
»Gewiss«, sagte die Maheu. »Blase das Licht aus; ich kann mir auch, im Finstern den Kopf zerbrechen.« Er blies die Kerze aus. Zacharias und Johannes stiegen schon hinunter, er folgte ihnen; die hölzerne Treppe krachte unter seinen schweren, mit wollenen Strümpfen bekleideten Füßen. Die Stube und der Flurgang hinter ihnen lagen jetzt wieder in Finsternis. Die Kinder schliefen; Auch Alzire hatte wieder die Augen geschlossen. Nur die Mutter schaute mit offenen Augen in die Finsternis, während an ihrer hängenden Brust eines erschöpften Weibes Estelle brummte wie ein junges Kätzchen.
In der Wohnstube im Erdgeschoss beschäftigte sich Katharina zunächst mit dem Feuer. Es stand ein Kamin aus Gußeisen da mit einem Rost in der Mitte und einem Backofen auf jeder Seite. In diesem Kamin brannte unaufhörlich ein Kohlenfeuer. Die Gesellschaft verteilte monatlich acht Hektoliter Abfallkohle an jede Familie. Dieser auf den Straßen zusammengelesene Staub entzündete sich nur schwer. Darum deckte das Mädchen jeden Abend das Feuer mit Asche zu; am Morgen brauchte sie nur umzurühren und einige aus dem Schmutz sorgfältig herausgesuchte Kohlenstückchen aufzulegen. Dann setzte sie einen Kochtopf auf den Rost und hockte vor dem Speiseschrank nieder.
Es war eine ziemlich geräumige Stube, die das ganze Erdgeschoss einnahm; sie war apfelgrün gestrichen und von holländischer Sauberkeit mit den blank gescheuerten und mit feinem weißen Sande bestreuten Fliesen. Außer dem Speiseschrank von gefirnistem Tannenholze bestand die Einrichtung aus einem Tische und Sesseln von demselben Holze. An den Mauern hingen grell gemalte Bilder, von der Gesellschaft geschenkt, sie stellten den Kaiser und die Kaiserin dar, weiterhin Soldaten und Heilige in goldenen Gewändern, die von der hellen Kahlheit der Mauern abstachen. Anderer Zierrat fand sich nicht in der Stube als eine Schachtel von rosafarbenem Kartonpapier auf dem Speiseschrank und die Kuckucksuhr in buntbemaltem Kasten, deren helles Ticktack die Leere der hohen Stube auszufüllen schien. Neben der Tür, die sich auf die Treppe öffnete, war noch eine zweite Tür, die in den Keller führte. Trotz der Reinlichkeit verdarb ein seit dem Abend eingeschlossener Geruch von verbrannten Zwiebeln die Luft, diese heiße, schwere, stets von einem scharfen Kohlengeruch gesättigte Luft.
Katharina hockte sinnend vor dem offenen Speiseschrank. Es war nichts geblieben als ein Stück Brot, weißer Käse zur Genüge, aber kaum ein Krümchen Butter; und es galt, vier Butterbrote zurechtzumachen. Endlich entschloss sie sich, schnitt die Brotstücke, bedeckte eines mit Käse, bestrich ein zweites mit Butter und legte die beiden zusammen. Das war der »Ziegel«, die Doppelschnitte, die jeden Morgen in die Grube mitgenommen wurde. Bald lagen die vier »Ziegel« nebeneinander auf dem Tische, mit größter Genauigkeit aufgeteilt, von dem größten, der für den Vater bestimmt war, bis zu dem kleinsten, den Johannes bekam.
Katharina, scheinbar ganz bei ihrer Arbeit, dachte über die Geschichten nach, die Zacharias von dem Oberaufseher und der Frau Pierron erzählte. Sie öffnete die Haustür zur Hälfte und warf einen Blick hinaus. Der Wind blies noch immer; an den niedrigen Häuserreihen des Dorfes flammten immer mehr Lichter auf, und das undeutliche Getümmel der erwachenden Bevölkerung machte sich vernehmbar. Türen wurden geöffnet und geschlossen; einzelne dunkle Reihen von Arbeitern zogen durch die Nacht dahin. Sie war doch recht dumm, sich einer Erkältung auszusetzen, da ja der Häuer gewiss zu Hause schlief, bis er um sechs Uhr seine Arbeit aufnehmen musste. Aber sie verharrte dennoch in ihrer hockenden Stellung und beobachtete das Haus, das auf der anderen Seite hinter den Gärten lag. Jetzt ging die Türe auf, und ihre Neugierde ward wieder rege. Doch das konnte nur Lydia sein, die Tochter der Pierronschen Eheleute, die zur Grube ging.
Ein zischendes Geräusch veranlasste sie, den Kopf zu wenden. Sie schloss die Tür und eilte zum Herde: das Wasser kochte, floss über und drohte das Feuer zu verlöschen.
Es war kein Kaffee mehr da: sie musste sich begnügen, Wasser auf den Satz von gestern zu schütten. Dann süßte sie den Inhalt der Kaffeekanne mit Farinzucker. Eben kamen ihr Vater und ihre beiden Brüder herunter.
»Alle Wetter!« sagte Zacharias, als er die Nase in den Napf gesteckt hatte, »der Trank wird uns nicht zu Kopf steigen.«
Maheu zuckte resigniert die Achseln.
»Bah!« sagte er; »man hat wenigstens etwas Warmes im Leibe, und das tut wohl.«
Johannes hatte die Brosamen neben den Schnitten zusammengescharrt und in seinen Napf geworfen. Nachdem sie getrunken, goss Katharina den Rest des Kaffees in die blechernen Feldflaschen. Alle vier standen in dem fahlen Lichte der rauchigen Kerze und stürzten in aller Hast den Trunk hinunter.
»Sind wir endlich fertig?« fragte der Vater. »Man möchte glauben, dass wir von unseren Renten leben.«
Doch jetzt wurde von der Treppe her, deren Tür sie offen gelassen hatten, eine Stimme vernehmbar. Frau Maheu rief:
»Nehmt alles Brot; ich habe noch einen Rest Nudeln für die Kinder übrig.«
»Ja, ja«, antwortete Katharina.
Sie hatte das Feuer wieder zugedeckt und in einer Ecke des Rostes einen Rest Suppe warmgestellt, den der Großvater, der um sechs Uhr kam, vorfinden sollte. Jeder holte unter dem Essschrank seine Holzschuhe hervor, hängte die Feldflasche um und schob die Butterschnitte in den Rücken zwischen Hemd und Jacke. Dann brachen sie auf, die Männer voraus, das Mädchen hinterdrein, nachdem es die Kerze ausgelöscht und den Schlüssel umgedreht. Das Haus verfiel wieder in Stille und Dunkelheit.
»Wir gehen zusammen«, sagte ein Mann, der die Türe des Nachbarhauses schloss.
Es war Levaque mit seinem Sohn Bebert, einem Jungen von zwölf Jahren, der mit Johannes eng befreundet war. Katharina war erstaunt, unterdrückte ein Lächeln und flüsterte Zacharias ins Ohr: »Wie? Bouteloup wartete nicht einmal, bis der Mann fort war?«
Die Lichter im Dorfe erloschen jetzt nacheinander. Eine letzte Tür fiel ins Schloss, dann ward alles wieder still; die Frauen und Kinder setzten in den bequemer gewordenen Betten ihren Schlaf fort. Vom Dorfe bis zu dem pustenden Voreux-Schachte bewegte sich ein langsamer Zug von Schatten, es war der Aufbruch der Kohlenarbeiter zum Werke, die ihre Schultern dahinschoben und ihre Arme, mit denen sie nichts anzufangen wussten, über die Brust kreuzten, während der Brotvorrat auf dem Rücken eines jeden einen kleinen Höcker bildete. Bloß mit dünner Leinwand bekleidet, zitterten sie in der Kälte, ohne sich deshalb mehr zu beeilen; in regelloser Weise zogen sie mit dem Getrappel einer Herde längs des Weges hin.
Drittes Kapitel
Etienne war von dem Hügel endlich hinabgestiegen und in den Voreuxschacht getreten. Die Männer, an die er sich mit der Frage wandte, ob es keine Arbeit gebe, schüttelten den Kopf und sagten ihm alle, er solle den Oberaufseher abwarten. Man ließ ihm freie Bewegung inmitten der schlecht beleuchteten Gebäude, die voll finsterer Löcher waren und beängstigend wirkten mit ihrem Wirrsal von Sälen und Stockwerken. Nachdem er eine dunkle, halb zerstörte Treppe emporgestiegen, befand er sich auf einem schwankenden Brückensteg; dann durchschritt er den Schuppen des Sichtungswerkes, der in so tiefer Finsternis lag, dass er mit den Händen vorausgreifen musste, um nicht anzustoßen. Plötzlich sah er vor sich zwei riesige, gelbe Augen die Nacht durchbrechen. Er befand sich unter dem Glockenstuhl im Aufnahmesaale an der Mündung des Schachtes.
Ein Aufseher, der Vater Richomme, ein Dicker mit dem Gesichte eines gutmütigen Gendarmen, das ein grauer Schnurrbart zierte, begab sich eben ins Büro des Aufnahmebeamten.
»Braucht man hier nicht einen Arbeiter für irgendeine Beschäftigung?« fragte Etienne abermals.
Richomme wollte nein sagen; doch er ward anderen Sinnes und sagte wie die übrigen, während er sich entfernte:
»Erwarten Sie Herrn Dansaert, den Oberaufseher.«
Vier Laternen waren hier angebracht und die Reflektoren, die das ganze Licht auf den Schacht warfen, beleuchteten hell die eisernen Geländer, die Hebel der Signale und Verschlüsse, die Pfosten der Seile, an denen die beiden Aufstiegkästen hinabglitten. Der Rest, der einem Kirchenschiffe gleichende geräumige Saal, lag im Dunkel und war mit großen, schwebenden Schatten bevölkert. Bloß die Laternenkammer flammte im Hintergrunde, während das Lämpchen im Büro des Aufnahmebeamten einem erlöschenden Stern glich. Die Kohlenförderung war wiederaufgenommen worden. Es ertönte ein unaufhörliches Dröhnen auf den gusseisernen Platten, die Kohlenhunde rollten unablässig, und man sah die gebeugten Gestalten der an der Winde beschäftigten Männer inmitten des Getümmels all dieser in Bewegung befindlichen dunklen und geräuschvollen Gegenstände.
Einen Augenblick stand Etienne unbeweglich da, betäubt und geblendet. Er fror, denn es zog von allen Seiten. Dann trat er einige Schritte vorwärts, angezogen durch die Maschine, deren stählerne und kupferne Bestandteile er glänzen sah. Sie stand etwa fünfundzwanzig Meter hinter der Schachtmündung in einem höher gelegenen Saale, so fest auf ihrem Unterbau gelagert, dass sie mit ganzem Dampfe arbeitete, mit ihren vollen vierhundert Pferdekräften, ohne dass die Bewegung ihrer riesigen Treibstange, die, weil gut geölt, leicht und glatt auf und ab stieg, die Mauern im Geringsten erschüttert hätte. Der Maschinist, der am Verschlusskolben stand, lauschte dem Geklingel der Signale und wandte kein Auge von der Nachweistafel, auf welcher der Schacht mit seinen verschiedenen Stockwerken durch eine senkrechte Fuge dargestellt war, in der an Schnüren befestigte Bleistücke, die Aufzugskästen darstellend, auf und nieder liefen. Wenn bei jedem Abstieg die Maschine sich in Bewegung setzte, drehten sich die Wellen, die beiden Riesenräder von fünf Meter Durchmesser, auf deren Nahen die Stahlseile sich in entgegengesetzter Richtung auf und ab rollten, mit solcher Schnelligkeit, dass sie einem grauem Staube glichen.
»Aufgepasst!« riefen drei Arbeiter, die eine Riesenleiter schleppten.
Er fehlte nicht viel, und Etienne wäre von der Leiter erschlagen worden. Seine Augen gewöhnten sich allmählich an die Dunkelheit; er sah das Getriebe der Seile in der Luft, mehr als dreißig Meter stählerner Bänder, die in einem Schwung im Glockenstuhle emporstiegen, wo sie über Räder gelegt waren, um senkrecht in den Schacht abzufallen, wo sie an den Aufzugskästen befestigt waren. Ein eisernes Gerüst, dem Gebälk eines Glockenturmes gleichend, trug die Räder. Es war wie der Flug eines Vogels ohne Geräusch, ohne Anstoß; der reißend schnelle Lauf, das unaufhörliche Auf und Nieder eines Fadens von ungeheurem Gewichte, der zwölftausend Kilogramm mit einer Geschwindigkeit von zehn Metern in der Sekunde zu heben vermochte.
»Aufgepasst!« riefen noch einmal die Arbeiter, welche die Leiter nach der anderen Seite schafften, um das linksseitige Rad zu untersuchen.
Etienne kehrte langsam in den Aufnahmesaal zurück. Dieser Riesenflug über seinem Haupte verblüffte ihn völlig. In dem von allen Seiten auf ihn eindringenden Luftzug fröstelnd, betrachtete er die Handhabung der Schalen, fast betäubt durch das Rollen der Hunde. Neben dem Schachte arbeitete das Signal, ein Hebelhammer, den eine in der Tiefe angezogene Schnur auf einen Block niederfallen ließ. Ein Schlag für das Anhalten, zwei Schläge für den Abstieg, drei Schläge für den Aufstieg; es war eine unaufhörliche Folge von Keulenschlägen, die den Tumult beherrschten, begleitet von einem hellen Geklingel, während der Arbeiter, der die Vorrichtung leitete, das Getöse noch vergrößerte, indem er dem Maschinisten durch ein Sprachrohr Weisungen zurief. Inmitten all dieses Getümmels tauchten die Schalen auf und versanken wieder, leerten sich und füllten sich, ohne dass Etienne etwas von dieser komplizierten Arbeit begriff.
Er begriff nur eins: der Schacht verschlang Menschen in Bissen zu zwanzig und dreißig und mit einem so leichten Schlucken, als fühle er gar nicht ihren Durchgang. Um vier Uhr begann der Abstieg der Arbeiter. Sie kamen aus der Baracke, barfüßig, mit der Laterne in der Hand, in kleinen Gruppen wartend, bis sie in genügender Anzahl waren. Geräuschlos, gleich dem stillen Auftauchen eines Nachttieres erschien der Eisenkäfig aus der finsteren Tiefe und setzte sich auf die Riegel mit seinen vier Stockwerken, deren jedes zwei mit Kohlen gefüllte Hunde enthielt. Auf den verschiedenen Absätzen holten Arbeiter die Hunde heraus und ersetzten sie durch andere, entweder leere oder mit Grubenholz beladene. In den leeren Hunden nahmen die Arbeiter Platz zu fünf und fünf bis zu vierzig auf einmal, wenn sie alle Abteilungen einnahmen. Eine Weisung erging durch das Sprachrohr, darauf folgte ein dumpfes, undeutliches Brüllen, während man viermal an dem Seil des unteren Signals zog, um die Ankunft dieser Ladung von menschlichem Fleisch anzukündigen. Nach einem leichten Emporschnellen sank die Schale geräuschlos hinab, fiel wie ein Stein und ließ nichts hinter sich zurück als den zitternden Lauf des Seiles.
»Ist es tief?« fragte Etienne einen Grubenarbeiter, der neben ihm stand und mit schläfriger Miene wartete, bis die Reihe an ihn kam.
»Fünfhundertvierundfünfzig Meter«, sagte der Mann. »Aber es sind vier Absätze, den ersten in einer Tiefe von dreihundertundzwanzig Meter.«
Beide schwiegen und richteten die Augen auf das Seil, das jetzt emporstieg. Etienne fragte wieder:
»Und wenn es reißt?«
»Wenn es reißt …«
Der Grubenarbeiter beendete den Satz mit einer Gebärde. Er war an der Reihe, die Schale war mit ihrer leichten, mühelosen Bewegung wieder erschienen. Er hockte darin nieder in Gesellschaft von Kameraden, und die Schale versank; nach kaum vier Minuten tauchte sie wieder auf, um eine neue Ladung von Männern zu verschlingen. Eine halbe Stunde lang fraß der Schacht in dieser Weise Menschen mit einem mehr oder minder gierigen Schlund, je nach der Tiefe des Absatzes, wohin sie abstiegen, aber unaufhörlich, immer hungrig, ein Riesendarm, der ein Volk zu verdauen vermochte. Es füllte sich wieder und immer wieder, und die finstere Tiefe blieb stumm, die Schale stieg mit der nämlichen gefräßigen Stille aus der Leere auf.
Etienne wurde schließlich von demselben Unbehagen ergriffen, das er schon auf dem Hügel gefühlt hatte. Was nützte seine Hartnäckigkeit? Der Oberaufseher verabschiedete ihn ebenso wie die anderen. Eine unbestimmte Angst brachte ihn plötzlich zu einem Entschlusse: er ging fort und machte draußen erst vor dem Gebäude der Dampferzeuger halt. Das weit offene Tor ließ sieben Kessel mit je zwei Herden sehen. Inmitten des weißen Dunstes und des unter lautem Pfeifen entweichenden Dampfes war ein Heizer damit beschäftigt, einen der Feuerherde frisch zu füllen, dessen sengende Glut man bis zur Schwelle fühlte. Dieser Wärme sich freuend, trat der junge Mann näher, als er einem neuen Trupp von Kohlenarbeitern begegnete, die eben bei der Grube eintrafen. Es waren die Maheu und die Levaque. Als er an der Spitze des Trupps Katharina mit ihrem gutmütigen Knabenantlitz erblickte, kam ihm der abergläubische Gedanke, noch eine letzte Frage zu wagen.
»Sagen Sie, Kamerad, braucht man hier nicht einen Arbeiter für irgendwelche Arbeit?«
Sie sah ihn überrascht an, ein wenig erschreckt über diese plötzlich aus dem Dunkel auftauchende Stimme. Doch Maheu, der hinter ihr kam, hatte die Frage gehört und beantwortete sie, indem er sich einen Augenblick zum Plaudern gönnte. Nein, man bedürfe keines Arbeiters, sagte er. Dieser arme Teufel, dieser herumirrende Arbeiter interessierte ihn. Als er ihn verließ, sagte er zu den anderen:
»Schaut, so könnte es auch uns ergehen! … Man muss nicht allzu viel klagen. Nicht alle haben Arbeit bis über den Kopf.«
Der Trupp trat ein und begab sich geradeswegs zur Baracke, einem weiten Saal mit grobem Kalkbewurfe, ringsum mit Schränken angefüllt, die mit Vorlegeschlössern verschlossen waren. In der Mitte stand ein eiserner Kamin, eine Art Ofen ohne Tür, feuerrot, dermaßen vollgestopft mit glühender Kohle, dass einzelne Stücke platzten und auf den gestampften Boden herausfielen. Der Saal war nur durch diesen Ofen erhellt, dessen blutroter Widerschein an dem schmutzigen Gebälke tanzte bis hinauf zu der mit schwarzem Staube belegten Decke.
Als die Maheu ankamen, herrschte ein lautes Gelächter in dem heißen Saale. Etwa dreißig Arbeiter standen mit dem Rücken zum Feuer gewandt, mit einer Miene des Behagens sich röstend. Vor dem Abstieg kamen alle hierher und nahmen in ihrer Haut ein Stück Wärme mit, um der Feuchtigkeit des Schachtes Trotz bieten zu können. An diesem Morgen gab es einen Spaß; man scherzte mit der Mouquette, einer Schlepperin von achtzehn Jahren, einer gutmütigen Dirne, deren riesiger Busen und Hinterteil Jacke und Hose zu sprengen drohten. Sie wohnte zu Requillart mit ihrem Vater, dem alten Mouque, der als Stallknecht diente, und ihrem Bruder Mouquet, der bei der Winde beschäftigt war; da die Arbeitsstunden nicht für alle die nämlichen waren, ging sie allein zur Grube. Zur Sommerszeit im Getreide, zur Winterszeit an eine Mauer gelehnt, gab sie sich dem Vergnügen hin in Gesellschaft des für die Woche erkorenen Schatzes. Das ganze Bergwerk kam an die Reihe, sämtliche Kameraden in einer bestimmten Reihenfolge, ohne dass die Sache weitere Folgen hatte. Als man eines Tages sie mit einem Nagelschmied von Marchiennes aufzog, barst sie schier vor Zorn und schrie, dass sie zu viel Selbstachtung habe und sich einen Arm abhacken werde, wenn jemand sie mit einem anderen als mit einem Kohlenarbeiter gesehen habe.
»Ist’s denn nicht mehr der lange Chaval?« fragte ein Arbeiter spöttisch. »Du hast diesen Kleinen genommen? Aber der braucht ja eine Leiter! … Ich sah euch neulich hinter Réquillart. Er war auf einen Eckstein gestiegen …«
»Was weiter?« erwiderte die Mouquette wohlgelaunt. »Was hat es dich zu kümmern? Man hat dich nicht gerufen, um nachzuhelfen.«
Diese gutmütige Derbheit erregte neue Heiterkeitsausbrüche der Männer, die ihre halb gebrannten Schultern blähten, während sie selbst vom Lachen geschüttelt in ihrem schamlosen Kostüm unter ihnen herumging, das mit den bis zur Ungesundheit angeschwollenen Fleischklumpen komisch und beängstigend zugleich war.
Doch bald ließ die Heiterkeit nach. Die Mouquette erzählte Maheu, dass die lange Fleurance nicht mehr kommen werde; man habe sie gestern tot und starr in ihrem Bette gefunden. Die einen redeten von einem Herzübel, die anderen von einer allzu hastig geleerten Schnapsflasche. Maheu war verzweifelt über diese Nachricht; es sei nun wieder ein Unglück, er verliere eine seiner Hilfsarbeiterinnen, ohne sie sogleich ersetzen zu können. Er arbeitete im Akkord; sie waren ihrer vier Häuer in seinem Schlag; er, Zacharias, Levaque und Chaval; wenn sie nur mehr Katharina als Schlepperin hätten, werde die Arbeit sicherlich leiden. Plötzlich rief er aus:
»Halt! Und der Mann, der vorhin Arbeit suchte?«
Eben kam Dansaert an der Baracke vorüber. Maheu erzählte ihm die Geschichte und bat um die Ermächtigung, den Mann anzuwerben; dabei betonte er das Bestreben der Gesellschaft, die Hilfsarbeiterinnen durch Burschen zu ersetzen wie in Anzin. Der Oberaufseher lächelte zuerst, denn der Vorschlag, die Frauen von der Grubenarbeit auszuschließen, missfiel gewöhnlich den Bergleuten, die um die Anstellung ihrer Töchter besorgt waren, wenig berührt durch die Frage der Sittlichkeit und der Gesundheit. Nach kurzem Zögern gab er endlich seine Einwilligung mit dem Vorbehalte, die Genehmigung seiner Entscheidung bei Herrn Negrel, dem Ingenieur, einzuholen.
»Der Mann muss schon weit sein, wenn er seither immer geht«, sagte Zacharias.
»Nein,« sagte Katharina, »ich habe ihn bei den Dampfkesseln stehen bleiben sehen.«
»Lauf ihm nach, Maulaffe!« rief Maheu.
Das Mädchen setzte sich in Lauf, während ein Trupp Arbeiter zum Schachte hinaufging und anderen das Feuer überließ. Auch Johannes holte seine Laterne, ohne den Vater abzuwarten, mit ihm Bebert, ein dicker, kindlicher Junge, und Lydia, ein schwächliches Mädchen von zehn Jahren. Die Mouquette, die vor ihnen aufgebrochen war, brach in dem dunklen Treppengang in ein Geschrei aus, nannte sie schmutzige Rangen und drohte ihnen mit Maulschellen, wenn sie sie wieder in die Beine kniffen.
Etienne plauderte in der Tat bei den Kesseln mit dem Heizer, der die Öfen frisch füllte. Es überlief ihn eiskalt bei dem Gedanken, dass er wieder in die finstere Nacht hinaustreten solle. Indes entschloss er sich zum Aufbruch, als er eine Hand auf seiner Schulter fühlte.
»Kommt,« sagte Katharina, »es ist etwas da für euch.«
Er begriff nicht sogleich; dann wallte die Freude in ihm auf, und er drückte dem Mädchen kräftig die Hände.
»Dank, Kamerad … Ihr seid ein guter Junge, wahrhaftig!«
Sie begann zu lachen, während sie ihn in dem roten Lichte der Feuerherde betrachtete. Es machte ihr Spaß, dass er sie für einen Jungen hielt, weil sie noch so schmächtig und ihr Haarknoten unter der Haube verborgen war. Auch er lachte zufrieden, und sie standen einen Augenblick mit frohen Gesichtern einander gegenüber. Maheu hockte in der Baracke vor seiner Kiste und zog seine Holzschuhe und Wollstrümpfe aus. Als Etienne kam, ward alles in vier Worten geregelt: dreißig Sous Tagelohn für eine anstrengende Arbeit, die er bald erlernen werde. Der Häuer riet ihm, seine Schuhe an den Füßen zu behalten, und lieh ihm einen alten ledernen Hut zum Schutze für seinen Schädel, eine Vorsicht, die der Vater und seine Kinder verschmähten. Man holte das Arbeitsgerät aus einer Kiste, wo sich zufällig auch die Schaufel der Fleurance vorfand. Als Maheu die Holzschuhe und die Strümpfe aller, sowie das Bündel Etiennes in der Kiste verschlossen hatte, verlor er plötzlich die Geduld.
»Was macht denn dieser Tölpel von Chaval?« rief er. »Sicher hat er wieder eine Dirne auf einen Steinhaufen hingeworfen. Wir haben uns heute um eine halbe Stunde verspätet.«
Zacharias und Levaque brieten sich ruhig die Schultern. Ersterer sagte schließlich:
»Du wartest auf Chaval? Er ist vor uns gekommen und sogleich angefahren.«
»Wie, du weißt das und sagst mir nichts davon? Vorwärts schnell!«