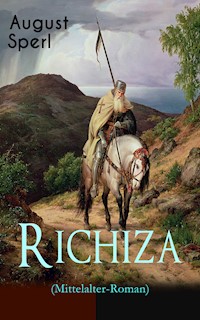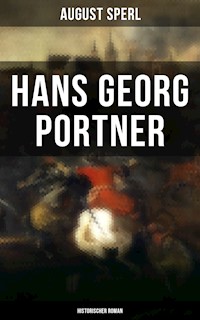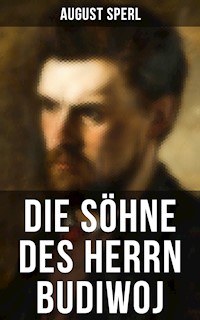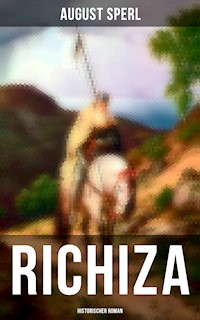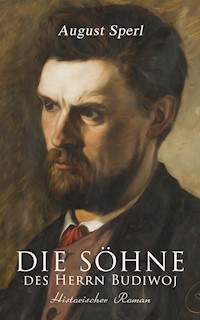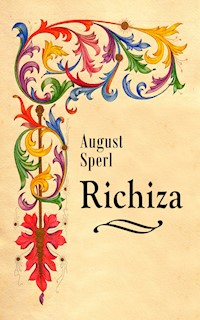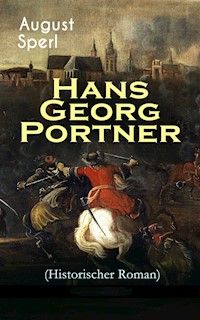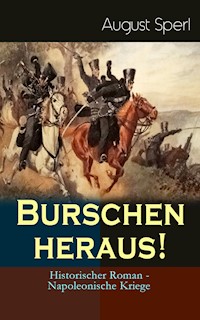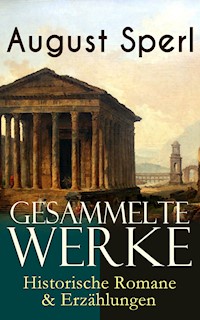
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gesammelte Werke: Historische Romane & Erzählungen" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. August Sperl (1862-1926) war ein deutscher Archivar, Historiker und Schriftsteller. Sein Hauptwerk besteht aus historischen Romanen und Novellen, die meist auf der Grundlage realer historischer Gegebenheiten oder Personen entstanden, zum Beispiel dem Dreißigjährigen Krieg in Hans Georg Portner und die ersten Kreuzzüge in Richiza. 1925 erschien zum 400. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges der Roman Der Bildschnitzer von Würzburg, in dem das Leben des fränkischen Holzschnitzers Tilman Riemenschneider literarisch verarbeitet wurde. Sein eher gemütlicher Schreibstil steht in der Tradition Gustav Freytags. Inhalt: Romane: Die Fahrt nach der alten Urkunde Hans Georg Portner Burschen heraus! Richiza Der Bildschnitzer von Würzburg Die Söhne des Herrn Budiwoj Herzkrank Der Archivar Erzählungen: Kinder ihrer Zeit: Der Obrist Die beiden Heiligen Der Mitläufer Narro Hochpreisliche Dekrete Der Faquin Das Hexenkind
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3835
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Werke: Historische Romane & Erzählungen
Die Fahrt nach der alten Urkunde + Hans Georg Portner + Burschen heraus! + Richiza + Der Bildschnitzer von Würzburg + Die Söhne des Herrn Budiwoj + Herzkrank + Der Archivar + Kinder ihrer Zeit...
Inhaltsverzeichnis
Historische Romane
Die Fahrt nach der alten Urkunde
Das Kerdernhaus war einsam gelegen; denn es stand mitten auf der Heide. Nur wenn ich auf den kleinen, dicken Turm stieg, der an seiner Südostseite Wache hielt, dann sah ich weit hinten über dem dunkeln Föhrenwald, ganz draußen am Horizont, die Kirche vom nächsten Ort.
Ob es heute noch so steht, wie damals, ich weiß es nicht. In zehn Jahren kann sich viel verändern; und seit zehn Jahren habe ich es nicht mehr gesehen – seit Kerderns frühem Tode.
Dies Heidehaus war mir lieb. Ich freute mich, so oft ich wieder auf der breiten Landstraße heranfuhr, ich freute mich, wie es so ruhig mit seinen grauen Mauern und Türmchen, seinen grünen Fensterläden und seinem roten Giebeldache dalag vor den rauschenden, vielhundertjährigen Lindenbäumen. Ich habe schöne Zeiten verlebt in dem Heidehause.
Dorthin sollst Du mit mir im Geiste gehen, lieber Leser! Denke Dir, Du kämest mit mir an einem Sommerabend auf der Straße über die braune Heide hergegangen. Denke Dir, wir wären alte Freunde und wollten ihn besuchen in seiner Einsamkeit. Wir bögen von der Straße ab in sein kühles Haus, unter seine kühlen Linden. Magst Du Dir das alles so recht lebendig vorstellen in Deinem Sinn?
Gut. Dann denke weiter: Es kommt der Abend; wir sitzen mit ihm hoch oben im Wipfel der größten Linde, in der lustigen Laube, die er in das Geäste zimmern ließ – unter uns liegt das Haus, vor uns, so weit wir schauen, dehnt sich die Heide, rotglühend im Abendsonnenschein. Und denke Dir: Es ist ein heißer Tag, der draußen zur Rüste gehen will, so heiß, daß nicht einmal die Heidelerche mehr singen mag. Wir aber sitzen im Schatten, und ein kühles Lüftlein spielt mit den Blättern über uns, um uns und unter uns. Jetzt wird es allmählich dunkel, und man bringt uns Licht in einer schönen, weißen Ampel. Das Licht kämpft mit den Schatten, die immer mächtiger von der Heide herübergreifen, es leuchtet flackernd hinauf in das grüne Dach und läßt den Wein in unsern Gläsern erglühen.
Wir aber reden von diesem und von jenem, vom heißen Wetter und von der kommenden Ernte, von den Menschen draußen im Lande und von den Tieren auf der Heide. Du fragst ihn, wie alt wohl das Heideschlößlein sei, und er sagt Dir, daß es vor zweihundert Jahren gebaut worden ist, daß aber der eine von den dicken Türmen noch um ein gut Stück älter ist. »Türme und Schlösser«, setzt er leise hinzu, »sind fest und bleiben immer auf ihrem Platze, bis sie zerfallen; aber die Geschlechter der Menschen werden umhergeworfen.« Dann steht er auf, steigt die gewundene Holztreppe hinab und holt aus dem Hause eine kleine, alte Truhe, trägt sie herauf und erschließt sie, und das Licht der hängenden Ampel fällt auf graue Papiere. Er nimmt eine Rolle heraus und öffnet sie; es ist ein großer Stammbaum mit vielen Namen und Schilden. Jetzt flackert das Licht über uns, und ein Teil des alten Papiers liegt im Dunkeln da, ein anderer ist hell beleuchtet, je nachdem sich die Blätter unter der Ampel bewegen.
Er fängt an und erzählt uns eine Reihe von Geschichten.
Hast Du die Stimmung? Gut; halte sie fest! Saitenspiel sei mein Erzählen – Dein Herz der Resonanzboden.
So höre denn, was mir Hans Georg Kerdern oft erzählt hat in dem Geäste der alten Linde.
Entweder – oder.
Es war ein freundliches, großes Gemach mit blankem Fußboden, mit schweren Büchergestellen und gebräunten Ölbildern an den hohen Wänden; die Decke war kunstvoll getäfelt, die Thüren waren reich geschnitzt, und an jeder zeigte sich ein geistliches Wappen mit Krummstab und Bischofshut. Alle diese prächtigen Dinge waren sehr sauber gehalten, aber es schien doch, als ob sie vergrämt und mißgünstig aus weiter Vergangenheit hereinschauten in eine Zeit, die sie nicht mehr verstanden und auch nicht mehr verstehen mochten, und die nüchternen, hellen, geschweiften Geräte des Gemaches nahmen sich aus auf diesem Hintergrunde wie kindisches Gekritzel in dem Buche eines alten Weisen.
Das Gemach hatte drei hohe Fenster, von denen zwei verhüllt waren; das dritte stand offen und ließ die warme Sommerluft hereinströmen.
Die Sonne war schon tief gegen die Waldberge geneigt, aber das unverhüllte Fenster wurde nicht von ihren Strahlen getroffen; denn sie war schon hinter dem westlichen Turm des alten Klostergebäudes verschwunden.
An dieses Fenster hatte man einen Ruhesessel gerückt, und in ihm lehnte ein Mann mit silberweißem Haupthaar, mit vielen Falten im ehrwürdigen Antlitz und mit mageren Händen, an denen die blauen Adern zu sehen waren.
Der Greis hatte seine Augen geschlossen und seine Hände gefaltet, sein Haupt war ihm in das weiche Kissen zurückgesunken.
Sie hatten ihn vor einer Weile gefragt, ob er nicht wolle, daß man ihn auf ein Ruhebett lege. Er aber hatte befohlen, man solle ihm vielmehr das Fenster öffnen, und hatte gesagt, er wolle hier sitzen, wo er seit vierzig Jahren jeden Morgen und jeden Abend gesessen sei, er wolle hier sitzen, wo er die Berge und die Wälder zu sehen vermöchte und das Kreuz seiner Kirche drunten im Dorf. Man hatte seinen Willen geehrt und seine Glieder gestützt, so gut es ging.
Jetzt war er müde geworden und schlummerte und hörte es nicht, wie ein Wagen vorfuhr, wie sich leise Tritte seinem Gemache näherten, wie das ernste Mädchen von seiner Seite, an der es gesessen war, aufstand, die Thüre öffnete und mit stummem Gruße drei junge Männer bewillkommnete.
Diese Drei gingen an den Greis heran, und das Mädchen setzte sich wieder auf ihren Schemel dicht neben den Ruhesessel. Die sinkende Sonne draußen war schön, und ihre Strahlen fielen auf die Wälder und Felder. Aber wärmer waren ihre Strahlen nicht als die Strahlen, die aus den umflorten Augen seiner Kinder auf den schlummernden weißhaarigen Alten in der stillen Stube fielen.
Nun schlug er die Lider auf, und ein Lächeln ging über sein ernstes Gesicht. Dann hob er seine Hand, und die Söhne traten nach einander herzu, beugten sich herab, küßten sie und traten wieder zurück. Dem Mädchen aber rannen perlende Thränen aus den Augen, schossen die Wangen herab und fielen in ihren Schoß und auf ihre gefalteten Hände.
Da hub der Vater mit gut vernehmbarer Stimme an: »Ich habe euch rufen lassen, meine Söhne, weil ich sterben werde, und möchte noch einmal mit euch reden, ehe wir von einander gehen. Und du, meine gute Martha, gib mir deine Hand, denn ich will auch mit dir reden.« Dem Mädchen flossen die Thränen stärker, und es legte seine warmen Hände in die zitternden Hände des Vaters.
Jetzt trat der Älteste von den drei Söhnen, ein hochgewachsener Mann, vor seine Brüder, und seine leuchtenden Augen sahen traurig auf den Vater hernieder, während er mit stockender Stimme sagte:
»Vater! Wir alle wünschten, daß Sie Gott noch eine Zeit hier ließe; denn wir können uns nicht vorstellen, wie es uns hernach zu Mute sein wird. Ich weiß ja, daß wir alle sterben müssen, daß wir aus Kindern heranwachsen und zu Jahren kommen, nur damit wir sterben müssen – und Sie haben uns immer gelehrt, daß der Tod nicht das Ende sei, sondern der Anfang. Aber jetzt, wo Sie von uns gehen wollen, erscheint es mir eben doch als das bittere Ende einer friedlichen Zeit. O Vater, noch nicht gehen!«
Der Greis schüttelte leise das Haupt und erwiderte ruhig: »Was thust du mit deinem Korn, mein Hans, wenn es reif geworden ist und schwer die Ähren ihre Häupter neigen?«
Hans schwieg.
»Nun, du sammelst es in deine Scheune,« sagte der Vater gütig. »Darum laß dich's nicht anfechten, wenn auch mich der himmlische Hausvater in seine Scheune nehmen will, und sei gesegnet von mir.«
Da beugte Hans die Kniee, der alte Mann legte die Hände auf sein Haupt und bewegte leise die Lippen. Dann sagte er mit lauter Stimme:
»Baue deine Äcker, und der Herr segne deine Arbeit; baue aber vor allen andern Dingen dein Herz – denn es hülfe dir nichts, wenn du die ganze Welt gewönnest und nähmest Schaden an deiner Seele. Gott führe dich und dein Geschlecht nach dir. Amen.«
Haus stand auf und ging zu seinen Brüdern.
Da trat der zweite von den jungen Männern heran und ließ sich vor dem Vater nieder. Der segnete ihn und sprach:
»Du trägst, mein lieber Georg, für einen guten Fürsten den Degen – trage ihn zur Ehre deiner Ahnen; aber vergiß über dem guten Fürsten nie den großen Fürsten des Lichts, und vergiß nie in den Kämpfen dieser Zeit den großen Kampf, den Licht und Finsternis mit einander kämpfen bis ans Ende der Tage. Und der Friede des Herrn sei mit dir im Kriege wie im Frieden.«
Der junge Offizier küßte die faltige Hand und erhob sich.
Als der Dritte seiner Söhne vor ihm kniete, da konnte man sehen, daß er des Vaters Ebenbild war. Der sprach zu ihm: »Ich segne dich, Friedrich. Vergiß niemals, daß du ein Diener des Worts bist, und lasse dir nie dünken, daß du sein Herr seiest; dein heiliges Amt ist, Menschen zum Lichte emporzuführen – denke immer daran, daß auch du im Finstern tappest, sowie die Leuchte in deinen Händen verlischt.«
Nun wandte der Vater das Haupt und sah in das schöne Antlitz an seiner Seite, das von Thränen überströmt war. Dann sagte er:
»Weine nur immerhin, mein gutes Kind, wenn es dir dadurch leichter im Herzen wird. Lebe wohl, meine Martha; du warst das Licht meines Alters, und ich segne dich, wie ich deine Brüder segne. Ihr aber, meine Söhne, waret immer gut gegen Martha, und sie war immer gut gegen euch. Jetzt übergebe ich euch die Martha; schützt sie als eure Schwester, so lange sie dieses Schutzes bedarf. Reichet ihr die Hände, wenn ihr das alles erfüllen wollt.«
Da traten die Söhne herzu und nahmen die Hand des Mädchens, das sein Haupt auf den Schoß des Vaters gelegt hatte. Der alte Mann strich mit den zitternden Händen immer wieder über ihr lichtes Haar, und sie weinte bitterlich. –
»Meine Söhne,« sagte nun der alte Mann, »die Zeit ist gar kurz, und ich habe noch wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Martha, schließe das Pult auf und gib mir den Brief mit dem großen Siegel, der neulich gekommen ist.«
Martha erhob sich, schloß das Pult auf und brachte dem Vater einen großen Brief mit einem erbrochenen Siegel. Der gab ihn seinem jüngsten Sohn und sagte: »Lies ihn, Friedrich, deinen Brüdern und deiner Schwester vor; denn er geht euch an. Er ist, wie du siehst, in lateinischer Sprache abgefaßt, und so wirst du ihn am besten sehr langsam lesen und gleich übersetzen, damit auch deine Schwester den Inhalt kennen lerne.«
Und Friedrich las:
»Edelgeborener Freiherr von Kerdern, ehrwürdiger Herr Pfarrer! Nach langwierigen Bemühungen ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen, und jetzt will ich eine heilige Pflicht erfüllen. Sie haben die Ihnen zustehenden Adelsprädikate fallen lassen und führen nur den einfachen Geschlechtsnamen. So habe ich erst nach vielen Mühseligkeiten und ziemlichem Kostenaufwande alles ausfindig gemacht und trage Ihnen nunmehr folgendes an:
Im Jahre 1430 haben, wie Ihnen wohl bekannt ist, die Hussiten Ihren Vorfahren Hans von seinen Gütern verjagt, weil er deutschen Herkommens war und sich unbeugsam weigerte, seinen katholischen Glauben abzulegen. Die eingezogenen Güter aber bestanden einerseits aus königlichen Lehen, anderseits aus Eigengütern. Die königlichen Lehen verfielen und wurden an Fremde verliehen, die Eigengüter aber kamen an einen Agnaten, der es verstanden hatte, sich in die Zeit zu schicken, und ohnedem durch seine Mutter czechischen Ursprungs war.
Dieser – mein Vorfahr – hat nun kurz vor seinem im Jahre 1471 erfolgten Tode ein Testament gemacht, in dem er sich mit harten Worten der Schwachheit und noch schlimmerer Dinge beschuldigte und seinen Sohn beschwor, auf irgend eine Weise den Nachkommen des Vertriebenen wieder zu ihren Gütern zu verhelfen. Ob dieser sein Sohn bestrebt war, den Willen des Vaters zu thun, kann ich nicht wissen. Aber auch sein Testament enthält den Befehl, nach den Verwandten zu suchen, die er trotz vieler Mühe nicht habe finden können. »Der größte Teil unserer Güter,« heißt es dort, »gehört dem verjagten Geschlechte, und meine Erben sind verpflichtet, ihn sofort zurückzuerstatten, sowie sich jemand von ihnen zeigt.« Das war im Jahre 1530, und seit dieser Zeit, also seit 190 Jahren, ist diese Bestimmung in allen Testamenten meiner Vorfahren enthalten.
Schwere Unglücksfälle in meinem Geschlechte haben mich mit ernstem Winke an die alte Schuld gemahnt. Ich teile Ihnen mit, daß ich nach dem frühzeitigen Hintritt meiner zwei Söhne der Letzte meines Stammes bin. Unser Besitz ist derzeit ein sehr großer in Böhmen und Ungarn; denn zu jenen alten Gütern sind allmählich noch bedeutende Erwerbungen gekommen. Diese werden nach meinem Tode an meine Töchter übergehen, die alten Güter aber sollen nach meinem festen Willen noch zu meinen Lebzeiten in Ihre Hände gelangen, oder – in die Hand der Gesellschaft Jesu.
Nach vielen Bemühungen also und nicht zum mindesten durch den Eifer der patres societatis Jesu in Prag, denen aber meine letzten Absichten noch nicht bekannt sind, und durch die Beziehungen, die sie in allen Ländern besitzen, habe ich Sie gefunden, habe mich über Ihre Verhältnisse unterrichtet und die Überzeugung gewonnen, daß Sie meines Geschlechtes sind. Hierauf bat ich den Gesandten des Kaisers am Hofe des Königs von Frankreichs, daß er Ihnen diesen Brief zustelle. Ich glaube nicht, daß Sie, ein Pfarrer, die Güter selbst in Besitz nehmen wollen; denn ich füge eine feste Bedingung bei: Weil ich der katholischen Kirche treu ergeben bin und überdies jener Vertriebene auch ein Katholik war, so ist es mein Wille, daß nur ein Katholik diese Güter antreten soll. Teilen Sie aber mein Anerbieten Ihren Söhnen mit und geben Sie mir innerhalb dreier Monate Antwort. Ich weiß, daß Sie zuweilen Ihren Bekannten von den alten Dokumenten erzählten, die Sie besitzen, und so hoffe ich, daß Sie die sehr notwendigen Zeugnisse Ihrer Abstammung in Händen haben.
Meine Linie hat von alten Zeiten her einen andern Namen und ein anderes Wappen als die Ihre geführt, ich kann mich aber, wie Sie einsehen werden, vor Ihrer Zusage nicht zu erkennen geben. Ihre Stammburg ist längst zerfallen, und nur wenige Menschen kennen die Ruinen, die keinen Namen mehr haben. Wohlan, ich besitze die Macht, Ihr Geschlecht wieder emporzuheben an den Ort, der ihm zusteht. Aber die Bedingung in dem Punkte der Religion ist eine feste und kann niemals geändert werden. Man hat mir gesagt, daß Sie rechtschaffen sind. Deshalb will ich nicht besonders aussprechen, daß Sie ohne Hinterhalt auf meine Bedingung eingehen müßten. –
Das auf diesen Brief gedrückte Siegel des Gesandten am französischen Hofe wird Ihnen für die Wahrheit meiner Worte genügenden Beweis geben.«
Friedrich faltete das Schreiben zusammen und besah sich das Siegel. Dann gab er es seinen Brüdern. Die besahen sich auch Schrift und Siegel, und keiner sagte ein Wort. Es war ganz stille in dem Gemach.
Da richtete der alte Mann im Ruhesessel das Haupt in die Höhe, schaute seine Söhne nach der Reihe an und fragte: »Was haben wir hier zu thun, Hans?«
Der kreuzte seine Arme über der Brust und sprach: »Die Güter sind reich und sind gewiß größer als mein kleines Pachtgut, und die Worte in dem Briefe sind sehr glänzend. Ich glaube nicht, daß der Brief ein unwahres Wort enthält. Aber der Kaufpreis ist zu hoch; mir brächte es, so schätze ich, wenig Gewinn, um des Geldes willen unsern lutherischen Glauben abzuschwören und danach ohne Ehre in einem Schlosse zu wohnen. Und so bleibe ich auf meinem Pachthofe.«
»Und was sagt ihr, Georg und Friedrich?« fragte der Greis.
Da besann sich der Offizier eine kurze Zeit; dann aber sah er den Vater an und erwiderte ihm mit fester Stimme:
»Das nämliche wie mein Bruder.«
»Und ich,« sagte Friedrich, »denke wie meine Brüder.«
Da faltete der Greis die Hände und schaute lange hinaus über die Strohdächer des Dorfes, über das abendliche Thal, hinüber zu den Waldhügeln, die im Glanze der untergehenden Sonne schwammen. Dann sprach er:
»Ihr habt gewählt, meine Söhne, ihr habt so gewählt, wie ich es von euch gedacht habe, als ich den Brief gelesen hatte, – nicht anders als ich mir gedacht habe. Und es ist gut so. Es ist mir nicht bekannt, daß noch irgendwo Leute unseres Geschlechtes wohnen, und so haben wir nur für uns zu sorgen. Schreibe daher, Hans, in der nächsten Zeit mit kurzen Worten an den Gesandten und teile ihm unsern Entschluß mit. Jetzt aber bitte ich euch, daß ihr das Werk mit mir vollendet. Tragt mir doch die kleine, braune Truhe aus meinem Schlafgemach, ihr kennt sie, die mit den Eisenbeschlägen.«
Hans ging und stellte die braune Truhe auf einen Sessel neben den Vater. Der Greis löste einen Schlüssel von seinem Halse und hieß Martha das kunstvolle Schloß öffnen. Sie that es, und er fuhr in seiner Rede fort:
»Diese Truhe, meine Kinder, enthält alle die Dokumente, die von jenem böhmischen Herrn gefordert werden. Es sind sowohl Urkunden auf Pergament und Papier, als auch sonstige Nachrichten, die von euch zurückreichen bis zu dem, der um seines Glaubens willen vertrieben worden ist. Alles befindet sich in bester Ordnung, so wie ich es von meinem Vater überkommen habe und wie ich es einst dir, Hans, zu hinterlassen gedachte.
»Nun aber ist es besser, wenn ich dir diese Dinge nicht hinterlasse; denn ehedem waren in der Truhe nichts als unschuldige Pergamente und Papiere, die uns alte Geschichten von unsern Vorfahren zu erzählen vermochten. Jetzt aber sind es keine unschuldigen Dokumente mehr, weil aus ihnen für die Zukunft schwere Versuchungen entstehen können.
»Es geht eine alte Sage in unserm Geschlechte, daß die Jesuiten vor Zeiten einen der Unsern bethört hätten; niemand konnte mir etwas Genaues darüber mitteilen, nicht mein Vater, nicht mein Großvater. Nur das wußten sie, daß dieser Eine von den Unsern hernach in großes Unglück geraten ist.
»Auch hier haben diese Menschen wieder die Hände in der Sache, und das ist's, was mich sehr ängstigt. Ihr seht aus dem seltsamen Briefe, daß sie uns und unsere Geschicke wohl kennen, daß sie Verbindungen haben, die bis in meine nächste Umgebung reichen. Ihr habt euch ja ohne Zögern entschieden, was uns auf dieses lockende Anerbieten zu thun obliegt – aber mir graut nun dennoch vor den Pergamenten und Papieren in der Truhe; denn sie sind der Steg, auf dem zu euch, zu euern Kindern, ja vielleicht noch zu euern Kindeskindern die Versuchung heranzukommen vermöchte.
»Deshalb habe ich euch gebeten, das Werk mit mir zu vollenden und als entschlossene Leute diesen Steg hinter euch abzubrechen. Es ist das aber nur eine Bitte; ihr sollt völlig frei entscheiden.«
Da sagte der Älteste unter den Brüdern:
»Ich denke, Vater, wir verbrennen diese Dokumente noch jetzt zur Stunde.«
Und der Jüngste setzte hinzu: »Vater, ich denke auch so.«
»Und du, Georg?« fragte der Greis. »Sage frei alles, wie du es meinst.«
Der sprach langsam: »Ja, Vater, mir wird es sehr lieb sein, wenn diese Urkunden verbrannt werden; denn die Güter sind groß, und die Worte in dem Briefe sind glänzend.« – – »Die Güter sind sehr groß,« setzte er leise hinzu.
Martha stand auf und holte das Feuerzeug. Die Söhne aber trugen den Vater auf dem Ruhesessel behutsam in den Hintergrund des Gemaches und setzten ihn neben dem Ofen vor einem großen Kamin nieder, der noch aus den Zeiten des Klosters stammte und längst nicht mehr benutzt wurde.
Martha breitete ein Tuch vor den Kamin und kniete darauf. Das Feuerzeug stand neben ihr.
Der Greis aber nahm das erste Pergament aus der Truhe, entfaltete es und gab es ihr; sie legte es offen in den Kamin. Dann gab er ihr das zweite, an dem viele Siegel hingen, hernach das dritte und so fort, bis ein ziemliches Häufchen beisammenlag. Die Söhne standen hinter dem alten Manne, schauten über seine Schultern in jedes Pergament und sprachen leise über die alten Schriften.
Jetzt sah man nur noch eine starke Rolle auf dem Boden der Truhe. Der Vater befahl seinen Söhnen, sie herauszunehmen und zu öffnen. Es geschah, und Haus hielt sie mit seinem Bruder Georg ausgespannt in den Händen.
Ein schöngemalter Stammbaum war auf dem alten, festen Papier zu sehen. Im Vordergrund ruhte ein Ritter in voller Rüstung, und aus seiner Brust wuchs der Baum empor. Im Hintergrunde breitete sich eine Landschaft mit grünen Hügeln und dunklen Wäldern; auf dem höchsten Hügel aber stand eine brennende Burg. An dem mächtigen Stamme hing Schild an Schild, an den Ästen und Zweigen hing auch Schild an Schild, wie Äpfel in den Blättern eines Baumes, und auf jedem waren Namen und Jahreszahlen geschrieben, und der ganze Stammbaum von seinen Wurzeln bis in seine höchsten Äste trug auf diese Weise die Namen derer, die zu dem verjagten Geschlechte des alten Mannes und seiner Kinder gehört hatten. Auf der Rückseite dieses Kunstwerkes aber sah man große und kleine Siegel aufgedrückt, und daneben hatten Amtspersonen zum Zeugnis der Wahrheit ihre eigenhändigen Unterschriften gesetzt.
Da befahl der Vater, das untere Drittel des Bogens wegzuschneiden. Sie spannten das große Papier straff aus, und Friedrich führte den Schnitt, der allen ins Herz ging. Es fiel auf den Boden des Gemachs der ruhende Ritter mit dem Falkenschild, es fielen die grünen Hügel der fremden Landschaft samt der brennenden Burg, und es fielen die vier untersten Schilde, auf denen die Namen des Vertriebenen, seines Sohnes, seines Enkels und seines Urenkels zu lesen waren.
Alle schwiegen. Martha nahm den Streifen und legte ihn unter die Pergamente. Dann schlichtete sie rings umher viele harzige Späne und dürre Scheiter und griff zum Feuerzeug.
Der Greis ließ das größere Stück des zerschnittenen Stammbaums zusammenrollen und in die Truhe legen. Dann aber bat er Martha, sie möchte ihm doch die zuletzt in den Kamin geworfene Pergamenturkunde, an der drei Siegel hingen, heraufreichen. Sie gehorchte, und er barg das Stück wieder in der leeren Truhe neben dem Stammbaum, indem er sagte: »Das kann als eine Erinnerung bleiben; es ist zwar auch ein altes Kerdern-Dokument, ohne die andern aber hat es keine Beweiskraft. Und nun, mein Kind, entzünde das Ganze in Gottes Namen.«
Martha schlug Feuer, entzündete am glostenden Zunder einen Schwefelspan und hielt ihn mit den zarten Fingern an den Stammbaumstreifen, der zu unterst lag. Eine kleine Flamme schlug aus dem alten Papier, und der Widerschein erglühte auf ihrem Antlitz. Dann begannen die dürren Späne zu knistern und zu krachen, Funken sprühten, immer weiter leckten die Flammen, aus den Scheitern schlug prasselnd das rote Feuer, und zuletzt ging das feindselige Element an die Pergamente und fraß die vergilbten Zeugnisse mit ihrer geheimnisvollen Schrift und fraß die ehrwürdigen Siegel, daß ihr Wachs zerfloß, und die große Glut spiegelte sich jetzt auch auf dem faltigen Gesichte des alten Mannes, der sich in seinem Stuhle vorgebeugt hatte und sinnend auf die Zerstörung herabschaute.
Nach einiger Zeit wurde das Feuer kleiner und kleiner, der Haufe sank zusammen, die Flammen sanken herab, und zuletzt lagen schwarzgraue Aschenblätter da, über deren gerollte Flächen eilig die letzten Fünklein hinwegliefen. –
Jetzt war die Sonne untergegangen, und aus den Stubenecken kam die Dämmerung hervor. Draußen lag eine warme Luft über dem Dorf und über den Feldern und über den Waldhügeln. Pfeifend strichen die Schwalben an den Mauern des Klosters auf und nieder, drunten in den Gassen des Dorfes spielten die Kinder, und ihr Jauchzen klang zuweilen herauf – in der dämmerigen Stube aber war es ganz stille.
Kinder und Kindeskinder.
Der weißhaarige Mann war der Großvater meines Urgroßvaters, und es ist fast merkwürdig, daß wir die alte Geschichte noch so gut wissen. Aber Friedrich hatte sie Wort für Wort auf die letzten Blätter seiner Bibel geschrieben, danach hatte sie einer dem andern erzählt, und so ist sie mit allen Einzelheiten herabgewandert bis auf unsere Tage.
Von den drei Söhnen des greisen Pfarrherrn war in drei Ästen eine große Nachkommenschaft erblüht. Auch Martha hatte sich einige Zeit nach des Vaters Tode an einen geliebten Mann verheiratet und einen andern Namen angenommen. Es kann wohl sein, daß auch von ihr noch Urenkel vorhanden sind; aber wir kennen sie nicht.
Es ging mit unserm Geschlechte jahraus jahrein wie es mit allen andern Geschlechtern auf Erden zu gehen pflegt: die Kindlein wurden geboren, sie wuchsen heran, und ihre Väter und Mütter alterten. Die Knaben wurden Jünglinge, die Jünglinge Männer, sie nahmen sich Frauen wie ihre Väter und Urväter, lebten ihrem Berufe, verjüngten den alten Stamm und fielen ab gleich dürren Blättern im Herbste, wenn ihre Pflicht gethan und ihre Zeit aus war. Viele von den Mädchen aber haben wie Martha unser Blut mit seinen guten und bösen Eigenschaften in fremde Geschlechter getragen, und wenn dort das Gute vorherrschte, dann ging ihre gute Mitgift auf, wenn aber das Böse stärker war, dann schlug wohl auch ihre böse Mitgift durch; denn es folgt so vieles auf Erden dem Unfreien, Argen, es folgt, wie unsere Altvordern sagten, »der böseren Hand«.
An den Zweigen aber, die aus den drei Ästen trieben, konnte man noch lange die Sinnesart jener drei jungen Männer erkennen.
Von dem Ältesten ging ein schaffensfreudiges Geschlecht aus. Er selbst vermochte sein kleines Pachtgut nach wenigen Jahren zu kaufen, baute sich in der abgelegenen Gegend ein festes Haus mit Wall und Graben, rings herum fiel der dunkle Wald, Saatfeld an Saatfeld breitete sich aus in dem großen, fruchtbaren, bergumschlossenen Thale, und auf ächzenden Wägen schickte er sein Korn in die Welt.
Weithin im Lande sprach man von dem reichen Herrn, man sprach von ihm im nächsten Städtlein, man sprach von ihm auf allen Straßen, auf denen seine Güter fuhren, man sprach zuletzt auch am Hofe des Kurfürsten von ihm, und die Räte des Kurfürsten traten zusammen.
Und bald brachte der Postreiter in das entlegene Waldthal ein großes Diplom auf Pergament, und in dieser Urkunde stand zu lesen, daß der Landesvater des Gutsherrn Fleiß, Biederkeit und Ehrbarkeit angesehen habe und ihn deshalb von nun an für einen Edelmann und seine vier Ahnen im Grabe für Edelgeborene erkläre. In der Mitte des Pergaments aber war ein Wappen gemalt, an seidenen Schnüren hing das Staatssiegel herab – und der Neugeadelte, der einst die Rückkehr in die Heimat seiner Väter und in die alte, glanzvolle Stellung seines Geschlechtes verschmäht hatte, – der durfte fortan drei Buchstaben vor seinen alten Namen schreiben.
Als aber auch seine Stunde kam, da standen vier Söhne an seinem Sterbebett, und jedem von ihnen konnte er ein großes Erbe geben und starb im Frieden. –
Von diesen vier Söhnen ging das Geschlecht aus, das bald das angesehenste in der Waldgegend wurde, das im Munde des Volks bald nur schlechthin den Namen »die Herren vom Walde« führte. –
Andere Wege machte Georg und seine Nachkommen. Als ein armer Offizier war er vom Vater gegangen, hatte bald darauf ein blühendes Weib heimgeführt, hatte sich in ein großes Unternehmen eingelassen und war zuletzt im Unglück gestorben. Viel hatte man sich von diesem seinem Unglück erzählt in unserem Geschlechte. Es hatte einen tiefen Eindruck auf alle gemacht.
Seine Nachkommen aber nahmen auch den Degen und wurden Soldaten wie der Vater. Sie gingen in fremde Dienste nach dem Norden des Reiches, brachten es dort zu hohen Ehren, und es kam durch ihre eigene Tüchtigkeit und durch ihre glücklichen Heiraten in angesehene Geschlechter dahin, daß auch dieser Zweig wieder in Schlösser einzog, ja sogar von dem Fürsten des Landes die Erlaubnis erhielt, das alte Wappen und die alten Auszeichnungen aufs neue zu führen. –
Von dem jüngsten Sohne des alten Mannes aber, von jenem Friedrich, stammt das Geschlecht meines Vaters. Es hat wieder ganz andere Wege gemacht, als die Nachkommen der beiden älteren Brüder, es ist niemals in Schlössern zu wohnen gekommen, es hat niemals Überfluß an irdischen Gütern gehabt, und wenn auch in manchem seiner Glieder das alte Kriegerblut wieder durchgebrochen ist, so hat es doch zu allen Zeiten mehr mit der Feder geleistet als mit dem Schwert, es hat niemals sein altes Wappen und seine alten Titel vor der Welt zur Geltung gebracht, sich niemals neue Titel erworben, aber seine Söhne haben als Staatsbeamte, als Geistliche, als Professoren ehrenvolle Plätze unter ihren Mitmenschen eingenommen, und wenn auch keiner von ihnen Wälder gerodet, Schlösser gebaut, Regimenter gegen den Feind geführt hat, so haben sie doch im stillen ebensoviel geleistet als ihre reichen Vettern im Walde und ihre stolzen Vettern im Ausland. Denn es besteht einmal die Einrichtung auf dieser Erde, daß nicht einem jeden Stamm gegeben ist, Schlösser zu bauen, Wälder zu roden und Regimenter zu führen. Und wenn ich's recht bedenke, so freue ich mich darüber, daß wir niemals in Schlössern gewohnt haben; denn die Schlösser haben weite Thore, und es flutet viel durch diese Thore, was an den Thüren kleiner Häuser vorübergeht.
Mit den beiden andern Ästen hatte vordem unser Ast noch lange Fühlung behalten. Seit einem halben Jahrhundert jedoch hatte man aufgehört, nach den andern zu sehen, und war unbekümmert um sie seine eigene Straße gezogen. Nur das eine wußte man, daß über die Herren im grünen Wald schwere Wetter gegangen waren, und auch das andere hatte man gehört, daß der Stamm im Norden nur noch auf zwei Augen stehe. Dann aber war auf einmal dieser letzte Mann gekommen. Er war ein alter Offizier von großer Gestalt, er hatte blitzende, blaue Augen und wellige Haare wie alle Männer des Kerderngeschlechts, aber seine Haare waren schneeweiß. Von der Sehnsucht getrieben hatte er die Stätten bereist, an denen seine Väter gewohnt hatten, das Klosterpfarrhaus im Frankenlande hatte er besucht, hatte die Stube mit dem alten Kamin betreten, hatte über das weite Thal zu den Waldhügeln geschaut und war wieder in seine Heimat zurückgekehrt.
Man unterhielt sich anfangs viel von ihm in unsern Häusern, dann zeigte man nur noch zuweilen seine Karte den Kindern, zuletzt aber vergaß man ihn fast ganz; die Verwandten im Norden wurden wieder zu sagenhaften Leuten, und ruhig ging man seine Alltagswege dahin.
Und doch wurde gerade in unserem Stamme von jeher gar viel über die alten Geschichten des Geschlechtes gesprochen; ich glaube, daß weder die Herren im Walde mit der neuen Adelskrone, noch die Soldaten auf ihren Schlössern droben im Norden sich je so sehr um die Vergangenheit kümmerten, als diese armen Geistlichen und diese schlichten Professoren. Es mochte das wohl zum Teil an unsern Müttern gelegen sein, die fast alle auch aus alten Familien waren, unsere ehrwürdigen Überlieferungen begierig in sich aufnahmen und sie mit den Geschichten ihrer eigenen Geschlechter an ihre Kinder weitergaben.
So hat sich viel von wahren und sagenhaften Dingen bei uns erhalten, von der alten, geheimnisvollen Stammburg Kerdern herab bis auf die merkwürdige Geschichte von dem Häuflein verbrannter Pergamente und dem sterbenden alten Manne.
Unter allen seinen Brüdern und Vettern war es wieder mein Vater, den diese Dinge von seinen Jugendjahren her am meisten beschäftigten.
In seine Knabenspiele schaute sagenumhüllt, sonnig und doch dunkel die verlassene Burg der Väter – und oft fragte er die Erwachsenen, wo im weiten Böhmen sie denn läge; aber niemand vermochte ihm Antwort darauf zu geben, auf keiner Landkarte konnte er sie finden.
Da setzte sich allmählig in dem kleinen Kopfe die Idee fest: Wenn ich erst groß bin, dann suche ich die Burg; und wenn sie zerfallen ist, dann baue ich sie wieder auf im grünen Wald und lebe als Ritter darinnen mit glänzendem Harnisch und Helme. Und er sprach von diesen Plänen und verworrenen Bildern auch zu seinen Geschwistern; als sie ihn aber verlachten, da verschloß er sie in sein Herz.
Und er wurde ein Jüngling, seine Gaben bewirkten, daß ihm die Welt offen stand, und es schien, als winke ihm das irdische Glück. Er aber jagte ihm freudig nach, und – hinter allem, was er dachte und that, hoffte und erreichte, lag eben immer noch die alte Burg, und wie damals der thörichte Knabe, und doch anders, sagte sich jetzt der Jüngling: Wenn ich das irdische Glück erreicht habe, dann mache ich mich auf und wandere hinein in dieses wunderbare Böhmen, gehe von Ort zu Ort und frage, wo mein Kerdern liegt, steige auf alle Berge und streife durch alle Thäler, und wenn es die Jahrhunderte etwa mit Wäldern umsponnen haben, dann will ich die Hirten fragen, ob sie's wissen, ich will die Köhler fragen, ob sie davon gehört haben, ich will die Jäger fragen, ob sie's gesehen haben. Und ist es dann gefunden, vielleicht zerfallen in einem Thale, vielleicht in Trümmern auf einsamer Höhe, dann werbe ich Leute, lasse die alten Mauern und die alten Türme aufs neue emporsteigen aus dem Schutt, aber in großer Pracht, und ziehe wieder ein, wo sie vor vierhundert Jahren verjagt wurden, erhebe mein Geschlecht zum alten Glanz und beschließe meine Tage. So dachte der Jüngling; das Leben aber führte ihn auf einmal andere Wege, es ging von Kampf zu Kampf, von Mühe zu Mühe, von Plage zu Plage; und ehe er sich besann, war er alt, grausilberne Fäden zogen sich durch die blonden Haare von damals, und die lustigen Träume von damals – sie waren mit den eilenden Jahren entflohen.
Da fiel ihm eines Tages bei seinem ältesten Bruder die Bibel Friedrichs, eine Abschrift jenes zerschnittenen Stammbaumes und der Brief des böhmischen Herrn in die Hände, und mit einemmale erwachte wieder die alte Sehnsucht mächtig in ihm: Das Kerdern möchte ich doch noch finden!
Aber es war nicht mehr der kindische Wunsch des Knaben, einen Ritter zu spielen, nicht mehr der gehaltlose Traum des Jünglings, zerfallene Mauern aufzubauen. Der Wille des ernsten Mannes war ein anderer. Wohl hoffte auch er noch das alte Kerdern zu finden, doch er gedachte, seine Trümmer ruhig liegen zu lassen. Den verlorenen Faden wollte er an ihnen anknüpfen, ihn rückwärts und vorwärts verfolgen, der Geschichte seiner Vorfahren wollte er nachgehen auf ihren verschlungenen Pfaden und seinem Geschlechte, das er sehr liebte, von seiner Vergangenheit erzählen. Und je länger er sann, desto fester wurde seine Absicht, desto greifbarer wurde die Gestalt ihrer Ausführung.
Er begann zunächst alles zu sammeln, was seine Brüder hatten – aber es war nicht viel. Dann nahm er die gedruckten Werke zur Hand, in denen von den Herren im Walde und von den Soldaten im Norden die Rede war – aber es standen manche Irrtümer darinnen. Zuletzt versuchte er es auch, in dem einen oder dem andern Archive Einlaß zu finden – aber diese Thüren blieben ihm sehr oft verschlossen.
So sammelte er eben, was zu erreichen war, beschränkte sich aber bald nicht mehr auf sein eigenes Geschlecht, sondern zog auch die Geschlechter unserer Mütter und Großmütter in den Kreis seiner Forschungen – und wurde so unvermerkt zum Genealogen.
Und je länger seine genealogischen Arbeiten dauerten, desto klarer wurde ihm, daß es eine große Menge gestürzter, verjagter Geschlechter gibt, und indem er die verschlungenen Pfade seiner verwandten Geschlechter zu verfolgen suchte, sah er auf einmal auch die große Geschichte selbst in einem viel wärmeren, helleren Lichte. Seine Augen waren durch den Blick aufs Kleine geschärft worden für die Erkenntnis des Großen, und er vermochte das zu sehen, woran die meisten Leute achtlos vorübergehen: die Wechselbeziehung zwischen Kleinem und Großem in der Geschichte.
Denn es sind breite Heerstraßen über die Erde gespannt, und auf ihnen ziehen die Großen, die Könige mit ihren goldenen Kronen, die Feldherrn mit ihren blutigen Schwertern, die Weisen, von denen man sagt, sie tragen ihrer Zeit die Fackel vorauf. Sie sind gut zu sehen in ihrer Pracht, und weit zurück kann man die mächtigen Gestalten mit den Augen verfolgen, bis auch die breiten Straßen immer enger und enger erscheinen, bis nur zuweilen noch ein goldener Helm ragt, eine hohe Lanze blitzt, ein weiser Spruch tönt, und dann endlich nichts mehr vorhanden ist als graue Nebel in einem tiefen Thale.
Auf diesen Heerstraßen, mit diesen hohen Gestalten ziehen die Völker aus dem Dunkel der Vergangenheit durch die helle Gegenwart in die verschleierte Zukunft, und es ist viel von diesen Straßen zu lesen in allen den dicken Geschichtsbüchern, die von den Großen der Erde zu reden, goldene Kronen, blutige Schwerter und weise Männer in dem bunten Gewimmel mit Namen zu nennen vermögen.
Aber neben diesen breiten Straßen laufen ungezählte schmale Pfade, und auf ihnen ziehen in unlösbarem Gewirre die »numeri« des Horaz, die namenlosen Leute, die nicht so gewichtig sind, daß sie die breiten Straßen mitzubahnen vermöchten, und sich deshalb auf schmalen Pfaden vorwärts schieben müssen, so gut es geht, einfache Leute, Bauern und Bürger, Edle und Unedle, Böse und Gute, Freie und Unfreie, unsere Voreltern, wir, unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Feinde, alles bunt durcheinander, lauter Menschen, von denen nichts in den dicken Weltgeschichten steht noch stehen wird.
Manchmal freilich will es uns dünken, wenn wir so zurücksehen, als ob fort und fort Wechsel wäre zwischen den kleinen Wegen und den großen Straßen, als ob da droben das eine oder das andere hohe Geschlecht seine Krone verlöre, sein Schwert sinken ließe und sich seitab verirrte; eine Zeit lang sehen wir vielleicht seine Gestalten noch ragen, dann aber verschwinden sie im namenlosen, unendlichen Haufen. Und zuweilen sehen wir auch wieder das eine oder das andere von den schmalen Weglein auf eine stolze Straße münden, neue Geschlechter treten unter die Reihen der Großen, heben gefallene Schwerter auf, lassen sie blitzen und sind weithin zu sehen, bis auch ihre Pfade wieder im Gewirre der drängenden, hastenden, schiebenden Haufen verschwinden.
Wo läuft nun die »Geschichte«? Auf den großen Straßen? Auf dem Wirrsal von kleinen Wegen? Auf beiden! Auf den großen Königsstraßen nicht mehr wie auf den kleinen Pfaden, auf denen die Masse der Geschlechter kämpft und leidet, lacht und weint, lebt und stirbt, ihren Zweck zu erfüllen. Und auf beiden ist sie gleich groß, gleich wunderbar zu schauen; denn die Sonne blitzt nicht nur schön auf dem blanken Helm und auf der goldenen Krone, sondern auch im kleinen Tautropfen am schwankenden Blatte, der Wind bläst nicht nur in die rauschenden Heerfahnen, er streicht auch über das grüne Gras am Wege, und der zornige Blitz fällt nicht nur die Eiche – er zerstört auch das stille Nest des Vogels, der sich in ihren Ästen geborgen hatte.
***
Lange war mein Vater den Wegen seines verjagten Geschlechtes nachgegangen, auf und ab, ab und auf hatten sie ihn geführt und lagen endlich ziemlich klar vor ihm bis zurück auf den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts. Von da ab verloren sie sich ganz im Dunkel. Martha hatte ja damals das Feuer gut geschürt, und die Flammen hatten alles verzehrt, was uns weitere Kunde hätte geben können über unsere Vorzeit!
Aber wo war doch die alte Urkunde mit den drei Siegeln geblieben, die man damals nicht in den Kamin geworfen hatte? Mein Vater fragte nach ihr bei den nächsten Verwandten – jeder hatte von ihr erzählen hören, doch keiner hatte sie jemals gesehen.
Da machte er sich im nächsten Herbste auf, diese geheimnisvolle Urkunde bei den Vettern im Walde und bei dem Zweig im Norden zu suchen und so auch einmal diese fremden Verwandten kennen zu lernen, zu hören, was sie noch von der Vergangenheit wußten, und die alten Stätten zu sehen, an denen das Geschlecht vordem gewohnt hatte. Mich aber nahm er mit auf die Fahrt.
Die Moosburg.
Da standen wir neben dem Bahngeleise, brennend fielen die Sonnenstrahlen auf uns herab, klingend und polternd und pustend enteilte der Zug auf den funkelnden Schienen, die Scheibe am letzten Wagen wurde immer kleiner und kleiner, dann verschwand alles im Walde.
Der Mann mit der roten Mütze ging schläfrig neben meinem Vater in das Gebäude, sein großer, schwarzer Hund streckte sich unter der Glocke in den Schatten und fing Fliegen, und auf der Holzbank neben ihm saß ein alter Jude in schmierigem Gewande und schlief. Ich aber nahm unser Täschchen auf den Rücken, schritt quer durch die staubige Straße draußen, warf einen Blick auf das gelbe Postvehikel, vor dem zwei betrübte Klepper die Ohren hängen ließen, schritt durch Gebüsch den schmalen Fußsteig hinab und stand auf der breiten Holzbrücke, die über den trägen Fluß führt. Dort wartete ich.
Eine weite Fernsicht that sich auf, viele Stunden thalabwärts lag das Land im heißen Sonnenglanz und schien mit offenen Augen zu schlafen, und auch die hohen Erlen am linken Ufer schliefen und rührten leise, wie im Traum erzitternd, ihre Blätter; unter den grauen Pfeilern der Brücke aber zog ruhig das klare, braune Wasser, nur dann und wann schnellte der silberne Leib eines Fisches blitzend aus den kühlen Wellen empor und fiel wieder in sein Bett zurück.
Ich lehnte am Geländer und schaute hinunter in das fließende Wasser. Es zieht mich immer mächtig zu sich hin, wo ich's sehe, dieses feindliche, freundliche, schmeichelnde, schreckliche, so unendlich heimliche und doch so fremde, entgegengesetzte Element – mag es nun in schäumendem Sturze von moosgrünen, tannengekrönten Felsen herabdonnern und in Milliarden von Tropfen zerstäuben, oder süß glucksend am Meeresstrande mit schmeichelnden Zungen den weißen Sand belecken und mir Seetang und Muscheln vor die Füße tragen; und ich liebe es nicht minder, wenn es im tiefen Strombett dahingleitet, eine gezähmte Schlange, der man Lasten auf die glitzernden Schuppen gelegt hat, oder wenn es im Dorfbach geschwätzig an mir vorübereilt und den Buben ihre Rindenschifflein entführt. Am schönsten aber ist's, auf einer Brücke zu stehen und hinunter ins fließende Wasser zu schauen, wenn die glänzende, warme Sonne auf den Wellen liegt, nur immer zu schauen, bis zuletzt auch die Brücke und das Land mitzufließen scheint, gar nichts zu denken und nur noch zu träumen.
So träumte auch ich, und ich weiß nicht, wie lange ich noch weiter geträumt hätte. Da kam mein Vater.
Noch einige hundert Schritte, und wir traten in den schattigen Kranz von Obstbäumen, der das Dorf umgab. Alles war ruhig, und auch die Hunde schienen zu schlafen.
Wir gingen in den nächsten Hof und in das strohgedeckte Haus. Eine angenehme Kühle umfing uns, wir trockneten die heißen Stirnen, und dann klopften wir an der ersten Thüre.
Eine Frauenstimme rief »herein«, und wir hatten uns beide tief zu bücken, damit wir die Köpfe nicht an dem niedrigen Thürbalken anstießen.
Da drinnen in der Stube war's Sonntag, wie es drüben im Stationsgebäude Sonntag war, wie es in der gelben Postkutsche auf der heißen Straße Sonntag war und wie es draußen Sonntag war auf der Brücke unter den Erlen. Sonntagsluft ging durch das Land, und es lag allenthalben ein stiller Sonntagsglanz.
Den Fußboden des Zimmers bedeckte weißer, feiner Sand und kleingehacktes, grünes Tannengezweige, durch die schwankenden Reben und die blitzhellen Fenster schossen die Sonnenstrahlen herein, zeigten, wie blank der Ahorntisch in der Ecke gescheuert war, und spielten in dem weißen Haar eines Mannes, der den Kopf in die Hände gestützt hatte und in einem Buche las. Hinten am kalten Kachelofen aber saßen Zwei, denen es wohl auch recht wie Sonntagsluft und Sonntagsglanz ums Herz sein mochte. Sie hatte ein schwarzes Kleid an, das in vielen Falten herabhing, hatte ein schönes, blaues Mieder an, das mit silbernen Spangen geschlossen war, und um ihren runden Kopf, aus dem zwei lustige Augen in die Welt guckten, war in dicken Flechten flachsblondes Haar geschlungen. Er hatte ein gutmütiges, junges Gesicht und ein schwarzes Schnurrbärtchen; er stak in grünen Reiterhosen, hatte lange Stiefel mit glänzenden Sporen an, und auf dem Kopfe trug er die kecke, grüne Mütze mit dem roten Ausputz. Sein Waffenrock aber hing hinter ihm an der Thüre.
Alles war sonntagsruhig in dieser Stube, selbst die graue Katze, die sich zu Füßen des Alten putzte, war sonntäglich anzusehen, und die summenden Fliegen an der Decke hatten auch stille Zeit.
Die drei Menschen schauten uns an, als wir in die Stube traten. Der Alte nahm seine große Hornbrille von den Augen und stand langsam auf; die Zwei auf der Ofenbank blieben ruhig sitzen, aber das Dirnlein war auf einmal ganz rot geworden und steckte ihren Zeigefinger in den Mund.
»Grüß Gott«, sagte mein Vater. »Wo geht man denn zur Moosburg, Bauer?«
»Die Moosburg wollen die Herren sehen? Ja, da schauen's aber nit viel dran.«
»Macht nichts, Bauer. Wir schauen's uns auch an, wenn wenig zu sehen ist. Stehen die Mauern noch?«
»Nein, Herr, kein einziger Stein. Wirklich, wenn mir's mein Großvater seliger nit gesagt hätt', er hätt' selber als kleiner Schulbub noch die schwarzen Trümmer gesehen, ich glaubet's nit, daß dorten ein Geschloß gestanden ist.«
»Wer hat denn dort gehaust?«
»Ja, sehen's, das weiß ich nit ganz genau; der Herr Lehrer hat gesagt, daß es Raubritter gewest sind. Warten's nur, er hat's auch einmal genannt, wie sich die geschrieben haben; aber jetzt fallt mir's nit ein. Ist halt auch schon lang her, gewiß hundert Jahr, daß die da gewohnt haben.«
»Raubritter!« Ich mußte lachen im stillen. Wenn der Eilzug durch die Thäler schnaubt und da und dort von steilen Höhen die kühnen Trümmer einer alten Bergveste ins Land hinaus grüßen, dann schaut wohl einer aus den weichen Kissen empor, dehnt sich und freut sich über seine gebildete, friedliche, gerechte Zeit, freut sich, daß die böse und grausam rohe Raubzeit aus ist, freut sich – und nimmt sein Börsenblatt zur Hand.
Und wenn an linden Sommernachmittagen der biedere Spießbürger mit den Seinen sich draußen ergeht, auszuruhen von den Mühen der Woche – dann nimmt er wohl im Drange des Belehrungseifers seinen Jüngsten bei der Hand, heißt ihn emporschauen zu einer alten Burg und sagt ihm, daß dort oben einst vor langen Zeiten ein Räubergeschlecht in eisernen Kleidern gesessen sei und die Leute im Thal gedrückt und geschunden habe. Und dann sagt er sicher noch: »Dank deinem Schöpfer, Michel, daß die nimmer sind.« Der Brave ahnt nicht, wie vielleicht diese Herren da oben lange, schreckliche Jahrhunderte hindurch mit starker Hand das Land schützten, er weiß es nicht, daß unter diesem Schutze der Bauer friedlich seinen Acker bestellen, der Bürger seinen Hantierungen nachgehen, Frauen und Kinder ruhig und unbehelligt leben konnten!
Wohl haben an vielen Orten ritterbürtige Männer ihre Ritterehre vergessen und ihre Kraft und ihre festen Häuser mißbraucht. Aber die gedankenlose Menge feindet alles an, was aus den Niederungen emporragt, und so macht sie aus jeder Burg ein Raubnest, aus jedem Ritter einen Räuber – gerade, wie sie in jedem alten Kloster nichts sieht als einen Sumpf. Sie kann ja nicht denken, sie weiß nicht, daß unsere Kultur nicht nur aus den stolzen Städten des späten Mittelalters, sondern auch aus Tausenden von Klöstern und Edelsitzen erblüht ist, die lange vor diesen Städten gewesen sind.
»Raubritter!« Hier kannte ich die »Raubritter« recht genau: Zwei Generationen hindurch hatten im sechzehnten Jahrhundert Glieder meines eigenen Geschlechtes die kleine Burg im Moos bewohnt, während sie in dem Städtlein eine halbe Stunde flußabwärts eifrig dem friedlichen Pflegamt oblagen, für das Wohl ihrer Untergebenen sorgten und ein ehrbares Leben führten. Der Herr Lehrer aber sagt, es seien Raubritter gewesen – nun, der Mann mußte es ja wohl wissen.
»Sehen's,« sagte der Alte, schmunzelte und griff in einen Wandschrank, »da haben's im Fruhjahr 'was von dem Geschloß aus dem Erdboden 'rausgeackert. Das ist alles, was noch von dem Geschloß übrig ist.« Und damit reichte er uns einen gewaltigen, verrosteten Schlüssel herüber. Er hatte einen großen, kunstvollen Bart, ein Meisterwerk altdeutscher Schlosserkunst.
Der Vater nahm ihn und schaute ihn lange an; hierauf fragte er, ob wir ihn vielleicht für Geld und gute Worte haben könnten. Da kicherte die Kleine auf der Bank am Ofen und wurde noch röter, als wir hinsahen. Der Alte aber sagte: »Wär' schon recht grob, wenn ich für so 'was Geld nehmen wollt! Den können's so einstecken. Geh', Johann, weis die Herrn an's Gschloß.«
Wir dankten dem Bauern und gingen mit dem Soldaten, der sporenklirrend vor uns herschritt, aus der Stube. Er führte uns durch den schattigen Grasgarten, an einigen Äckern vorüber, und nach wenigen Minuten kamen wir auf eine große Wiese.
Drüben zur Rechten stieß sie an den Fluß und an die Erlen, und links dehnten sich die dunkelgrünen Waldhügel, so weit das Auge sah. Gerade vor uns aber, mitten in der Wiese, erhob sich ein mäßig großer Erdring, um den ein Graben lief. Die ganze Wiese war sumpfig und hatte sauere Gräser, und als wir auf dem schmalen Wege an den Graben gekommen waren, sahen wir, daß braunes Wasser in ihm stand.
Wir gingen auf einem engen, festen Damme hinüber, und jetzt bemerkten wir, daß in der Umwallung ein Stoppelfeld war. Dort hatten sie den Schlüssel aus der Erde gepflügt, den der Vater in der Hand hielt. Seltsam, der alte, verrostete Schlüssel, der versumpfte Graben, der Wall und der Acker mit den gelben Stoppeln!
Ich ging auf die andere Seite des Feldes, warf mich auf den Boden, lehnte meinen Kopf an den Erdwall und schaute hinauf in die blaue, flimmernde Luft. Und während vorne der Vater bald da bald dort auf den Boden stampfte und auf den hohlen Klang horchte, und während der Bursch wieder durch die sumpfige Wiese zu seinem Schatz in die Sonntagsstube zurückging, und während die Grillen rings um mich her um die Wette zirpten, träumte ich mit offenen Augen, und aus dem Sumpf stiegen mir die grauen Mauern der alten Moosburg empor und streckten und reckten lustig ihre Türmchen und Dächer in den Sonnenschein hinaus und grüßten aus kleinen Fenstern hinüber zu den grünen Hügeln, und die grünen Hügel grüßten herüber, wie sie heute herübergrüßten – aber die Fenster waren längst zerbrochen und die Mauern waren vertilgt vom Erdboden.
Ich sprang auf und ging über den Acker. Da stand mein Vater auf seinen Stock gestützt, schaute nachdenklich auf den großen Schlüssel und wog ihn hin und her in den Händen. Er bemerkte mich nicht. Ich aber trat hinter ihn und sagte leise die Worte des französischen Emigranten:
»So stehst du, o Schloß meiner Väter, Mir treu und fest in dem Sinn, Und bist von der Erde verschwunden, Der Pflug geht über dich hin.«
Nun wandte er sich zu mir, lächelte und sagte: »Es ist wahr! Es gibt doch nichts, was nicht auch schon ein anderer vor uns empfunden hat.«
Die Grillen zirpten, und ein leichter Luftzug strich über die Stoppeln des Ackers. Langsam gingen wir auf dem engen Pfad über die feuchte Wiese zurück; sorgfältig steckte der Vater seinen Schlüssel in die Tasche und sagte: »Auch eine alte Urkunde.«
Hinter uns rauschte das Schilf im versumpften Graben, und bald waren wir in dem Wald auf dem Hügel verschwunden.
Aus meiner Kindheit.
Wir wanderten durch die Wälder und schwiegen. Mir aber trat plötzlich in voller Frische ein Erlebnis aus meiner Kindheit vor die Seele. An einem Herbsttag war's gewesen vor vielen Jahren, und lange hatten wir zu steigen gehabt; endlich standen wir auf der Höhe. Es war einer der schönsten Berge im bayerischen Walde.
Eine frische Luft strich über den Bergrücken, man rief die erhitzten Kinder herzu und hüllte sie in warme Überkleider.
Dann standen die großen Leute auf dem höchsten Punkte des Grates und schauten über das wogende Waldmeer hinein in das hellbeleuchtete böhmische Land. Ich hatte meinen Steinhammer gezogen und klopfte an den schwarz und weiß gesprenkelten Felsblöcken, den letzten Resten eines uralten Gemäuers. Der Fernblick kümmerte mich wenig; was wissen Kinder mit dem anzufangen, das sie nicht zu greifen, in ihren Besitz zu ziehen vermögen? Später freilich bin ich einmal an derselben Stelle gestanden, und da ist mir die gewaltige Rundschau tief zu Herzen gegangen, und ich habe mich fast nicht zu trennen vermocht von dem Blick auf das unendliche Land, das sich von diesem Berge hinzieht, soweit die Wolken gehen, das ein Menschenherz hinlockt über seine grünen Wellen und eine mächtige Sehnsucht in ihm entbrennen läßt, hinabzusteigen und zu wandern, immer weiter zu wandern.
Das alles war damals auch schon vorhanden, ich sah es nicht. Zuletzt ward ich müde, setzte mich auf einen Stein und schaute einem Käfer zu, der neben mir über den Rasen kroch.
Da stand auf einmal mein Vater hinter mir und fragte mich: »Georg, siehst du den Wald dort unten?«
Ich wandte meinen Kopf und sagte: »Ja wohl, Vater.«
»Dann schau' auch dorthin! Siehst du das glänzende, weite Land und die Hügel ganz draußen, zu denen der große Wald hinläuft?«
»Ja, ich sehe sie.«
»Wie weit mag es wohl bis dorthin sein, Georg, wenn einer rüstig ginge?«
Ich besann mich und sagte: »Eine gute Stunde.«
»Nein,« antwortete mein Vater und lächelte. »Es sind sechs gute Wegstunden.«
Ich sagte nichts mehr. Der Vater aber setzte sich zu mir auf den moosigen Stein und schlang den Arm um mich. Das that er sonst nur an meinem Geburtstag.
Ich war recht verwundert und wegen meiner thörichten Antwort in ziemlich gedrückter Stimmung. Dann grübelte ich darüber nach, was der Vater wohl jetzt denken möchte.
Was der Vater jetzt wohl denke! Das beschäftigte mich auch sonst sehr oft, es beschäftigte mich, wenn ich mein Mittagsbrot mit Vater, Mutter und der kleinen Schwester verzehrte, wenn ich mit den Meinen spazieren ging, oder wenn ich den Vater gar zu seinem Amtshause begleitete. Immer hatte ich eine so unendlich hohe Vorstellung von dem Ernst und von der unergründlichen Tiefe seiner Gedanken, daß ich's gar nicht auszudenken vermochte. Die blühende Mutter – ja, die war mir zwar das Idealbild aller irdischen Schönheit, und von dieser ihrer Schönheit und meiner Liebe zu ihr war ich einst so überwältigt, daß ich mich vor sie hinstellte, lange unverwandt zu ihr emporschaute und endlich in einer seltsamen Ideenverbindung mit zuckenden Lippen sagte: »Mutter, wenn du einmal gestorben bist, dann laß' ich dich ausstopfen und stelle dich in mein Zimmer.« Darauf umklammerte ich ihre Schürze und begann zu schluchzen. Das war meine Mutter – aber daran, daß sie gleich dem Vater so ganz unergründliche Gedanken habe, daran hatte mein Herz nie gedacht. Sie war uns ja doch den ganzen Tag so nahe, vom Aufstehen bis zum Niederlegen, teilte alle unsere kleinen Freuden und Leiden, und wir sahen sie viel mehr für unseresgleichen an. –
Da saß ich denn auf dem Stein und hatte meinen Kopf an die Brust des Vaters gelehnt und getraute mich in meiner feierlichen Stimmung kaum zu atmen.
Der Vater sprach lange nichts mehr, und als ich endlich vermeinte, er habe mich über seinen Gedanken gar vergessen, und verstohlen zu ihm emporsah, da bemerkte ich, daß seine glänzenden Augen unverwandt über die Wälder in die Ferne schauten. Ich schlug meinen Blick nieder und holte leise recht tief Atem.
»Georg!«
»Ja?«
»Georg, schau' noch einmal hinaus zu den blauen Hügeln.«
»Ja, Vater.«
»Sieh', Georg, das ist unsere alte Heimat.«
»Wie?«
Mein Vater hörte mich schon nicht mehr, und ich hatte Zeit, über seine seltsamen Worte nachzudenken. »Unsere alte Heimat« – das verstand ich doch gar nicht. Unsere Heimat war ja nicht da drüben, sondern hinter uns, draußen im flachen Land! Da lag das Städtlein mit dem hohen Kirchturm und mit der großen Burg auf dem waldigen Hügel und mit den breiten Straßen, und dort stand unser Wohnhaus, und dort war ich geboren, und dort hatte ich meine guten Freunde, und dort war unsere Heimat. Ich wußte nicht, was der Vater wollte.
»Georg!«
»Ja?«
»Georg, weißt du, auf was wir sitzen?«
»Ja, es ist ein Felsen, und einen solchen habe ich noch gar niemals gesehen und habe auch keinen in meinem Steinkasten. Er ist aber so hart, daß ich kein Stücklein von ihm wegbringe. Bitte, haue mir doch ein Stück weg.«
Mein Vater hieb lächelnd ein Stück ab von der vielhundertjährigen Mauer, die ich für einen Felsblock hielt.
Dann sagte er: »Höre, Georg, das ist kein gewachsener Felsen, sondern eine alte Mauer. Auf diesem Berg ist einmal vor langer Zeit ein vornehmer Mann, ein Graf, gestanden, hat weit umhergesehen und sodann beschlossen, hier eine feste Burg mit Türmen und Ringmauern und Gemächern zu bauen. Seine Leute kamen aus dem Thale heraus, hieben tiefe Keller in den Felsen und bearbeiteten die Steine. Und der Graf freute sich in seinem Herzen und trieb seine Leute an, damit er recht bald auf dem hohen Berg wohnen könnte, so hoch, wie sonst keiner im Lande. Aber – es ging alles anders, als er sich dachte: Auf einmal fielen Feinde ins Reich und der König rief seine Ritter zu Hilfe. Alles zog in den Krieg, auch der Graf machte sich auf mit seinen Leuten, wie es seine Pflicht war, und die halbfertige Burg da oben blieb einsam und verlassen. Er ist nie mehr zurückgekehrt, die Feinde hatten ihn in einer blutigen Schlacht getötet; auf die Mauern aber, auf denen wir sitzen, fiel durch lange Jahrhunderte der Regen und der Schnee, die Sonne brannte auf sie hernieder, und der scharfe Frost zerbröckelte die harten Mauern bis auf diese kleinen Reste. Kannst du dir den Grafen vorstellen, Georg?«
»O ja Vater, wie der bei uns zu Hause mit dem blauen Zwicker und mit den gelben Hosen, der mir alle Mittag begegnet und mich immer in den Backen kneipt!«
Der Vater lachte laut auf; ich aber schwieg beschämt; denn ich hatte wieder das Gefühl, etwas sehr Dummes gesagt zu haben.
»Nein, Georg, so gewiß nicht. Denke dir etwa einen großen, stolzen Mann, und denke dir, der habe einen schönen Helm auf dem Haupte, einen glänzenden Harnisch am Leibe und sitze auf einem kräftigen Pferde – dann wird's richtiger sein. Hast du das alles vor Augen?«
»Ja,« sagte ich leise und dachte mir meinen Vater auf dem Pferde.
»Jetzt schau wieder hin über die Wälder, Georg, zu dem Lande, das so glänzend daliegt.«
»Ja, Vater.«
»In diesem Lande gibt es Städte mit hohen Häusern und Dörfer mit strohgedeckten Hütten, und fast auf jedem Hügel steht eine alte Burg oder eine Ruine. Vor vielen Jahren nun, vor Hunderten von Jahren, als die alten Burgen noch viel neuer waren, als es noch viel weniger Trümmer gab auf den Hügeln, da wohnten dort vornehme Herren gleich dem Grafen, von dem ich dir vorhin erzählte, sie wohnten dort wie ihre Väter und Großväter und hofften, daß dereinst auch ihre Kinder und Kindeskinder dort nach ihnen wohnen würden. Aber da kam ein schwerer Krieg in das schöne Land, einer der entsetzlichsten Kriege, die es gibt, ein Religionskrieg.«
»Was ist ein Religionskrieg?«
»Die Leute wurden uneins darüber, wie man dem lieben Gott am besten diene, und zuletzt wurde ihr Streit so arg, daß sie zu den Waffen griffen. Da wurde Feuer in die Städte geworfen, viele Burgen wurden zerstört und liegen seitdem in Trümmern gleich den Trümmern, auf denen wir sitzen, unzählige Menschen wurden getötet, und die Flüsse des Landes färbten sich rot vom Blute der Erschlagenen. Sehr viele Menschen aber, die Gott auf die alte Weise verehren wollten, wurden von ihren stärkeren Gegnern aus ihrer Heimat vertrieben. Es wurden Bürger aus den Städten vertrieben, und sie mußten mit ihren Frauen und Kindern fliehen, es wurden Bauern aus den Dörfern vertrieben, es wurden Edelleute aus den hohen Burgen vertrieben. Hörst du, Georg?«
»Ja,« sagte ich und hielt den Atem an.