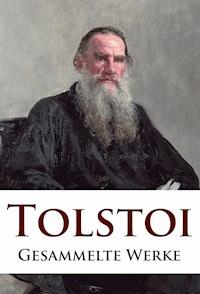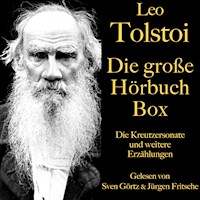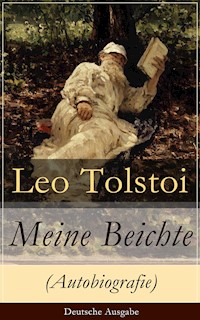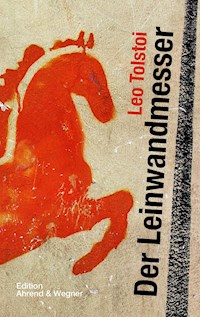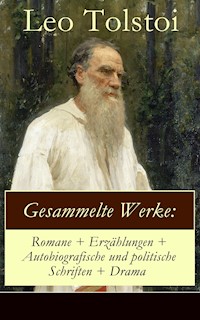
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Autobiografische und politische Schriften + Drama E-Book
Leo Tolstoi
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Autobiografische und politische Schriften + Drama" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Leo Tolstoi (1828 - 1910), war ein russischer Schriftsteller. Seine Hauptwerke Krieg und Frieden und Anna Karenina sind Klassiker des realistischen Romans. Inhalt: Romane: Krieg und Frieden Anna Karenina Auferstehung Glück der Ehe Hadschi Murat (Chadschi Murat) Erzählungen: Ein Präludium Chopins Vater Sergius Wieviel Erde braucht der Mensch? Die drei Tode Der Schneesturm Albert Luzern (Aus den Aufzeichnungen des Fürsten D. Nechljudow) Polikei Herr und Knecht Die Kreutzersonate Autobiografische und politische Schriften: Meine ersten Erinnerungen Briefe über Gewissensfragen Brief an die Frau Baronin Rosen Brief an die Redaktion der Londoner Zeitung " Daily Chronicle" Eine Schande Brief an einen Polen Patriotismus oder Frieden? Zur Frage von der Freiheit des Willens Satirisches Gedicht von Graf L. N. Tolstoi und anderen aus der Zeit der Belagerung von Sewastopol Meine Beichte Drama: Der lebende Leichnam
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 5236
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Autobiografische und politische Schriften + Drama
Krieg und Frieden + Anna Karenina + Glück der Ehe + Auferstehung + Hadschi Murat (Chadschi Murat) + Die Kreutzersonate + Der lebende Leichnam + Ein Präludium Chopins und mehr von Lew Tolstoi
Übersetzer: Hans Moser, Alexander Eliasberg, Hermann Röhl und August Scholz
Inhaltsverzeichnis
Romane:
Erzählungen:
Autobiografische und politische Schriften:
Drama:
Krieg und Frieden
Inhalt
1
»Nun, Fürst, hat die Familie Bonaparte auch Genua und Lucca in Besitz genommen? Ich sage Ihnen, Sie sind nicht mehr mein Freund, mein getreuer Sklave, wie Sie sagen, wenn Sie noch ferner die Notwendigkeit des Krieges leugnen und noch länger die Greuel verteidigen wollen, welche dieser Antichrist begeht, denn es ist der Antichrist selbst, davon bin ich überzeugt. Setzen Sie sich hierher und erzählen Sie.«
Es war im Juni 1805, als Anna Pawlowna Scherer diese Worte sprach. Sie war Hofdame der Kaiserin Maria Feodorowna und gehörte sogar zu dem vertrauten Kreis Ihrer Majestät. Sie sprach mit dem Fürsten Wassil, welcher zuerst zu ihrer Abendgesellschaft eingetroffen war.
Ein Diener in roter, kaiserlicher Livree hatte am Morgen in der ganzen Stadt Einladungsbriefe zu dieser Abendgesellschaft umhergetragen.
»O Himmel, welch heftiger Überfall!« erwiderte der Fürst, ohne durch diesen Empfang in Aufregung zu geraten. Der Fürst trug die goldgestickte Uniform des Hofes mit Ordenssternen, seidene Strümpfe und Schnallenschuhe. Sein Gesicht zeigte beständig ein liebenswürdiges Lächeln. Er sprach Französisch, jenes gewählte Französisch, in dem unsere Großväter nicht nur sprachen, sondern auch dachten, und in dem gemessenen, herablassenden Ton eines einflußreichen Würdenträgers, der am Hofe alt geworden ist. Er näherte sich Anna Pawlowna, küßte ihr die Hand, indem er sein kahles, parfümiertes Haupt neigte, und ließ sich dann bequem auf einem Sofa nieder.
»Vor allem, verehrte Freundin, beruhigen Sie mich über den Zustand Ihrer Gesundheit«, fuhr er in galantem Tone fort, der aber nicht frei von Spott war.
»Wie könnte ich mich wohl befinden bei solchen Aufregungen? Sie bleiben den ganzen Abend, hoffe ich?«
»Nein, heute nicht. Der englische Gesandte gibt ein großes Fest, auf dem ich erscheinen muß; meine Tochter wird mich abholen.«
»Ich glaubte, das Fest sei verschoben worden, und ich gestehe Ihnen sogar, daß alle diese Festlichkeiten mich nachgerade schrecklich langweilen.«
»Hätte man Ihren Wunsch ahnen können, so hätte man sie gewiß verlegt«, erwiderte der Fürst maschinenmäßig, wie eine gut gehaltene Uhr, ohne den geringsten Anspruch darauf, daß man seine Worte ernst nehme. »Spotten Sie nicht, und nun, da Sie alles wissen, sagen Sie mir, was ist beschlossen worden über die Depesche von Nowosilzow?«
»Was soll ich Ihnen sagen?« erwiderte der Fürst mit dem Ausdruck der Langenweile. »Sie wollen wissen, was man beschlossen hat? Nun, man hat entschieden, daß Bonaparte seine Schiffe hinter sich verbrannt habe, und es scheint, daß wir im Begriff sind, dasselbe zu tun.«
Der Fürst Wassil sprach immer mit einer gewissen Nachlässigkeit, wie ein Schauspieler, der eine alte Rolle spielt. Fräulein Scherer dagegen zeigte trotz ihrer vierzig Jahre eine große Lebhaftigkeit. Ihre soziale Stellung beruhte darauf, für eine enthusiastische Dame zu gelten. Das politische Gespräch, das sich entwickelte, brachte sie nach und nach in Aufregung.
»Ach, sprechen Sie mir nicht von diesem Österreich! Es ist möglich, daß ich nicht alles richtig verstehe, aber nach meiner Ansicht will es nicht den Krieg und hat ihn nie gewollt. Es verrät uns. Rußland allein muß Europa befreien. Unser Herr und Wohltäter ist durchdrungen von seiner hohen Mission und wird sich ihr gewachsen zeigen. Gott wird ihn nicht verlassen, er wird seine Aufgabe erfüllen und die Hydra der Revolution zerschmettern. Aber wem können wir vertrauen, frage ich Sie! England hat zu viel Krämergeist, um den hohen Flug der Seele des Kaisers Alexander zu begreifen, es weigert sich, Malta zu räumen, es wartet und argwöhnt Hintergedanken bei uns. Was haben die Engländer zu Nowosilzow gesagt? Nichts, denn sie begreifen nicht die Selbstverleugnung unseres Kaisers, welcher nichts für sich selbst, sondern nur das allgemeine Wohl will. Was haben sie versprochen? Nichts. Und Preußen? Hat es nicht erklärt, Bonaparte sei unüberwindlich und England ohnmächtig, ihn zu bekämpfen? Ich glaube nicht an Hardenberg, noch an Haugwitz, diese berühmte preußische Neutralität ist nur eine Schlinge! Aber ich glaube an Gott und an die höchste Bestimmung unseres Kaisers.« Sie schloß mit einem Lächeln über ihren eigenen Enthusiasmus.
»Wie schade, daß Sie nicht an der Stelle unseres liebenswürdigen Winzingerode stehen. Sie hätten den König von Preußen im Sturm erobert. Aber werden Sie mir Tee reichen lassen?«
»Sogleich!… Apropos«, fügte sie ruhiger hinzu, »ich erwarte heute abend zwei sehr interessante Herren, den Grafen Mortemart, einen der Emigranten, und den Abbé Morio, diesen eminenten Geist. Sie wissen ja, daß er vom Kaiser empfangen wurde. Aber sprechen wir ein wenig von den Ihrigen. Wissen Sie, daß die ganze Gesellschaft über Ihre Tochter entzückt ist seit ihrem Erscheinen in der Welt? Man findet sie schön wie der Tag!« Der Fürst verbeugte sich.
»Wie oft habe ich daran gedacht, wie ungleich die Glücksgüter in unserem Leben verteilt sind! Warum hat das Schicksal Ihnen so reizende Kinder gegeben, mit Ausnahme von Anatol, Ihrem Jüngsten, den ich nicht liebe«, fügte sie mit der Bestimmtheit eines unerbittlichen Urteils hinzu, indem sie die Augenbrauen in die Höhe zog. »Sie wissen Ihr Glück nicht zu schätzen, also verdienen Sie es auch nicht.« Sie begleitete diese Worte mit einem enthusiastischen Lächeln. »Was wollen Sie?« erwiderte der Fürst. »Lavater hätte wahrscheinlich entdeckt, daß auf meinem Schädel der Höcker, der die Liebe zu den Kindern andeutet, fehlt.«
»Hören Sie auf zu scherzen. Ich muß ernsthaft mit Ihnen sprechen. Ich bin sehr unzufrieden über Ihren Jüngsten! Unter uns gesagt, man hat bei Seiner Majestät über ihn gesprochen, und man bedauert Sie!« Bei diesen Worten nahm sie eine betrübte Miene an.
»Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll«, erwiderte der Fürst entmutigt. »Ich habe als Vater für ihre Erziehung alles getan, was ich konnte, und doch ist aus beiden nichts geworden. Hippolyt ist wenigstens ein friedlicher Dummkopf, während Anatol ein Tollkopf ist. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen.« Es lag ein unangenehmer Ausdruck in den Winkeln seines faltigen Mundes, während er lächelte.
»Leute wie Sie sollten gar keine Kinder haben! Wenn Sie nicht Vater wären, so hätte ich Ihnen gar nichts vorzuwerfen«, bemerkte Fräulein Scherer nachdenklich.
»Ich bin Ihr treuer Sklave, wie Sie wissen, und Ihnen allein kann ich mich anvertrauen. Meine Kinder sind für mich nur eine schwere Last, aber was ist zu machen?« Er schwieg und drückte durch eine Gebärde seine Unterwerfung unter das Schicksal aus.
Fräulein Scherer schien nachzudenken. »Haben Sie nie daran gedacht, Ihren verschwenderischen Sohn Anatol zu verheiraten? Alte Jungfern, sagt man, haben die Manie, Heiraten zu stiften, ich glaube mich frei von dieser Schwachheit, aber dennoch habe ich ein junges Mädchen für ihn in Aussicht, eine Verwandte von uns, die Fürstin Bolkonska, welche bei ihrem Vater sehr unglücklich ist.«
Der Fürst Wassil gab keine Antwort, aber eine leichte Bewegung seines Kopfes zeigte an, daß er diese Mitteilungen zu schätzen wisse. »Wissen Sie, daß dieser Anatol mich jährlich vierzigtausend Rubel kostet?« seufzte er. »Was soll das in fünf Jahren werden, wenn es so fort geht? Sehen Sie, was für ein Glück es ist, Papa zu sein! Ist sie reich, die junge Fürstin?«
»Ihr Vater ist sehr reich und sehr geizig und lebt immer zu Hause, auf dem Lande. Es ist dieser berühmte Fürst Bolkonsky, welcher noch bei Lebzeiten des verstorbenen Kaisers veranlaßt worden war, den Dienst zu verlassen und welchem man den Beinamen ›der König von Preußen‹ gab. Er ist sehr interessant, sehr originell und es ist schrecklich schwer, mit ihm auszukommen. Die arme Kleine ist schrecklich unglücklich. Sie hat nur einen Bruder, welcher vor kurzem Lisa Meynen heiratete und welcher Adjutant bei Kutusow ist. Sie werden ihn heute abend sehen.«
»Ich bitte Sie, teuerste Anna Pawlowna«, sagte der Fürst, indem er plötzlich die Hand des Fräulein Scherer ergriff, »bringen Sie mir diese Sache zustande und ich will für ewig der treueste Ihrer Sklaven sein! Sie ist von guter Familie und reich, das ist alles, was ich wünsche.«
»Gut, gut«, erwiderte Anna Pawlowna, »ich werde noch diesen Abend mit Lisa Bolkonska sprechen. Vielleicht läßt sich die Sache machen. Ich werde im Interesse Ihrer Familie mein Probestück als alte Jungfer machen.«
2
Der Salon füllte sich mehr und mehr. Die Blüte der vornehmen Welt Petersburgs versammelte sich. Die Gesellschaft bestand aus Personen, welche zwar von sehr verschiedenem Charakter und Alter, aber alle aus denselben Kreisen waren.
Die Tochter des Fürsten Wassil, die schöne Helene, kam, um ihren Vater abzuholen und mit ihm die Festlichkeit beim englischen Gesandten zu besuchen. Sie war in Balltoilette und trug das Zeichen der Hofdamen auf der Brust. Die reizendste Frau Petersburgs, die junge, niedliche Fürstin Bolkonska, war gleichfalls zugegen. Sie war seit dem letzten Winter verheiratet und ihre interessanten Umstände, welche ihr den Besuch der »großen Welt« verboten, erlaubten ihr doch, an kleineren Zirkeln teilzunehmen.
»Haben Sie meine Tante gesehen?« Oder: »Kennen Sie meine Tante noch nicht?« wiederholte Anna Pawlowna jedem ihrer Gäste. Darauf führte sie ihn zu einer kleinen alten Dame mit auffallender Frisur. Fräulein Scherer erhob langsam den Blick von dem Neuangekommenen auf »ihre Tante« und verließ sie sogleich nach der Vorstellung wieder. Alle erfüllten dieselbe Zeremonie bei dieser unbekannten, überflüssigen Tante, welche niemand interessierte. Sie gebrauchte immer dieselben Ausdrücke, indem sie jeden nach seinem Befinden fragte, von dem ihrigen und dem Ihrer Majestät der Kaiserin sprach, »welches Gott sei Dank sich gebessert« habe. Aus Höflichkeit suchte man zu vermeiden, sich mit zu auffallender Hast zu entfernen, hütete sich aber wohl, der alten Dame während des Abends zum zweitenmal nahezukommen.
Die junge Fürstin Bolkonska hatte ihre Arbeit in einem »Ridikül« von Sammet mit Goldstickerei mitgebracht. Ihre reizende kleine Oberlippe, welche mit zartem Flaum beschattet war, erreichte niemals ganz die Unterlippe. Aber trotz der sichtbaren Anstrengung, mit der sie sich niederzulassen oder zu erheben suchte, gab es nichts Graziöseres, ungeachtet dieses leichten und originellen Fehlers, ein Vorrecht der wirklich anziehenden Damen; denn dieser halb offene Mund verlieh ihr einen eigentümlichen Reiz. Jeder bewunderte diese junge Dame voll Leben und Gesundheit, welche bald Mutter werden sollte und noch so leicht ihre Last trug.
Die kleine Fürstin ging mit leichten Schritten um den Tisch, ordnete die Falten ihres Kleides und setzte sich auf das Sofa, beim Samowar.
»Ich habe meine Arbeit mitgebracht«, sagte sie, indem sie ihren Ridikül öffnete, zu der Gesellschaft im allgemeinen. »Nehmen Sie sich in acht, Anna, spielen Sie mir keinen Streich! Sie haben mir geschrieben, Ihre Gesellschaft werde ganz klein sein, und nun sehen Sie, in welchem Aufzug ich bin!« Sie breitete die Arme aus, um ihr elegantes, graues, mit Spitzen besetztes Kleid deutlicher zu zeigen.
»Seien Sie unbesorgt, Lisa, Sie werden doch die Hübscheste sein.«
»Wissen Sie auch, daß mein Mann mich verläßt?« fuhr sie fort. »Er wird sich den Tod holen. Wozu dieser schreckliche Krieg?« sagte sie zum Fürsten Wassil, und ohne seine Antwort abzuwarten, plauderte sie mit seiner Tochter, der schönen Helene.
Bald darauf erschien ein großer, plumper, junger Mann mit kurz geschorenen Haaren im Salon. Er trug eine Brille, ein helles Beinkleid nach der Mode, eine ungeheure Hemdkrause und einen braunen Rock. Er war der natürliche Sohn Peter des Grafen Besuchow, eines großen Herrn, der zu Zeiten Katharinas sehr bekannt war, jetzt aber in Moskau dem Tode nahe war. Der junge Mann hatte sich noch keine Laufbahn ausgewählt; er kam aus dem Ausland, wo er erzogen worden war, und erschien zum erstenmal in der vornehmen Welt. Fräulein Scherer begrüßte ihn mit einem Lächeln, dabei drückte ihre Miene aber eine Unruhe aus, wie man sie beim Erblicken eines kolossalen Gegenstandes, der nicht am rechten Platze ist, empfindet. Peters Gestalt war viel höher als die der anderen Gäste, aber die Unruhe der Dame hatte eine andere Ursache, sie bezog sich auf seinen guten, schüchternen, dabei forschenden Blick.
»Höchst liebenswürdig von Ihnen, Monsieur Pierre, daß Sie zu einer armen Kranken kommen«, sagte sie. Peter stotterte einige unverständliche Worte, indem er seine Augen umherschweifen ließ. Plötzlich lächelte er heiter und grüßte die kleine Fürstin wie eine gute Bekannte. Dann verbeugte er sich vor der »Tante«. Fräulein Scherer hatte wohl Grund zur Unruhe und zur Besorgnis; denn Peter verließ die Tante plötzlich, ohne das Ende der Phrase über die Gesundheit Ihrer Majestät abzuwarten. Erschrocken hielt sie ihn an.
»Kennen Sie den Abbé Morio?« fragte sie. »Ein sehr interessanter Mann!« »Ja, ich habe von seinem Projekt des ewigen Friedens gehört. Sehr geistreich … aber unausführbar.«
»Glauben Sie?« fragte Fräulein Scherer, nur um als Dame des Hauses etwas zu sagen.
Peter aber machte sich einer zweiten Unhöflichkeit schuldig. Er hatte eben eine Dame plötzlich verlassen, ohne das Ende ihrer Phrase anzuhören und jetzt hielt er die andere zurück, die sich entfernen wollte, und begann ihr zu erklären, warum das Projekt des Abbé Morio nur ein Hirngespinst sei.
»Wir werden noch später darüber sprechen«, sagte Fräulein Scherer.
Nachdem sie sich von dem jungen Mann losgemacht hatte, der keine Lebensart besaß, kehrte sie zu ihren Pflichten als Wirtin zurück und hielt sich bereit, auf schwachen Punkten einzugreifen und eine stockende Unterhaltung wieder in Fluß zu bringen. Bald näherte sie sich einer schweigenden Gruppe, bald trat sie zu einem schwatzhaften Kreis, ein Wort oder eine geschickt vorgenommene Versetzung einer Person brachte die Gesprächsmaschine wieder in leichten, regelmäßigen Gang. Peter erschien zum erstenmal in einer Gesellschaft in Rußland. Er wußte, daß alles versammelt war, was Petersburg an Intelligenz besaß, und seine Blicke schweiften von einer Seite zur anderen. Immer befürchtete er, ein geistreiches Wort von diesen vornehmen, selbstbewußten Persönlichkeiten zu überhören, und dann suchte er nach einer Gelegenheit, seine Meinung auszusprechen. Denn das ist die Schwachheit aller jungen Leute.
3
Die Unterhaltung war in lebhaftem Gang. Die Gäste hatten sich in drei Gruppen geteilt. Der Mittelpunkt der einen, in welcher das männliche Element vorherrschte, war der Abbé, die zweite, aus jungen Leuten bestehend, umgab Helene, die fürstliche Schönheit, und die Fürstin Bolkonska, diese reizende kleine Dame, die dritte Gruppe hatte sich um die Dame des Hauses und Mortemart gebildet. Der Graf Mortemart mit seinem sanften Gesicht und seinen angenehmen Manieren spielte die Rolle einer Berühmtheit. Anna Pawlowna bediente sich des Gastes wie eines kostbaren Gerichts für Feinschmecker. So hatte sie für ihre Gäste heute zwei delikate Bissen, zuerst den Grafen und dann den Abbé. Man sprach von der Hinrichtung des Herzogs von Enghien, und der Graf behauptete, er sei aus Seelengröße gestorben.
»Ja, erzählen Sie! Erzählen Sie!« rief Fräulein Scherer heiter aus. Der Graf verbeugte sich lächelnd.
»Der Graf«, sagte Fräulein Scherer leise zu ihrem Nachbar, »war mit dem Herzog intim bekannt.«
»Der Graf«, sagte sie zu einem anderen, »ist ein vortrefflicher Erzähler.« »Der Graf gehörte zur besten Gesellschaft, wie man sieht«, flüsterte sie einem dritten zu. Auf diese Weise wurde der Vikomte wie ein Roastbeef auf einer erwärmten Schüssel mit Grünwerk verziert den Gästen serviert. »Setzen Sie sich hier neben mich, liebe Helene«, rief Fräulein Scherer der jungen Dame zu, welche den Mittelpunkt einer anderen Gruppe bildete. Die Fürstin Helene erhob sich mit ihrem beständigen Lächeln auf den Lippen, die Herren traten zurück, und unter einem Strom von Licht, der von ihren Edelsteinen widerstrahlte, trat sie näher. Sie lächelte allen zu, ohne eine einzelne Person anzusehen, und gewährte so allen das Recht, die Schönheit ihrer Toilette und ihrer blendend weißen Schultern zu bewundern.
»Wie schön sie ist!« rief man bei ihrem Anblick.
»Ich bin ganz eingeschüchtert«, sagte der Graf, vor einem solchen Zuhörerkreis.
»Warten Sie!« rief die kleine Fürstin, welche den Teetisch verlassen hatte, »ich muß meine Arbeit holen. Was machen Sie? An was denken Sie?« sagte sie zu Hippolyt. »Bringen Sie mir doch meinen Ridikül!«
Der Graf erzählte sehr gewandt die neue Anekdote über den Herzog von Enghien. Dieser hatte sich heimlich nach Paris begeben, um Mademoiselle George zu besuchen. Dort begegnete er Napoleon, welchen die berühmte Künstlerin gleichfalls begünstigte. Die Folge dieses unglücklichen Zufalls war, daß Napoleon in eine Ohnmacht fiel, wie ihm dies zuweilen begegnete und welche ihn der Gewalt seines Feindes überlieferte. Der Herzog hatte sie nicht benutzt; Bonaparte aber rächte sich später für diesen Edelmut, indem er ihn erschießen ließ. Diese Erzählung wurde besonders interessant in dem Augenblick, wo die beiden Rivalen sich begegneten, und erwies sich besonders für die Damen aufregend. »Reizend!« flüsterten sie sich zu und die kleine Fürstin steckte die Nadel in ihre Arbeit, um zu zeigen, daß das Interesse der Anekdote ihre Arbeit unterbrach.
Inzwischen hatte Fräulein Scherer bemerkt, daß der schreckliche Peter mit dem Abbé disputierte, und beeilte sich, einer Gefahr vorzubeugen. Peter war es wirklich gelungen, ein Gespräch über das politische Gleichgewicht anzuknüpfen, und der Abbé schien über den jugendlichen Eifer Peters sichtlich entzückt. Die beiden sprachen laut und lebhaft, und das war es eben, was der Hofdame mißfiel.
»Aber wie soll man dieses Gleichgewicht herstellen?« rief Peter in dem Augenblick, als Fräulein Scherer ihm einen strengen Blick zuwarf und den Italiener fragte, wie er das nordische Klima vertrage.
»Ich stehe zu sehr unter dem Zauber des Geistes und der Bildung, besonders der weiblichen Gesellschaft, in der ich die Ehre habe, mich zu bewegen, um an das Klima denken zu können«, erwiderte er.
In demselben Augenblick erschien eine neue Persönlichkeit im Salon, das war der junge Fürst Bolkonsky, der Gemahl der kleinen Fürstin, ein hübscher junger Mann von Mittelgröße, mit stark ausgesprochenen Zügen. In allem, besonders in seinem müden Blick und seinem gemessenen Gang war er das ganze Gegenteil der so lebhaften, kleinen Frau. Er kannte jedermann im Salon; alle waren ihm langweilig, und er hätte viel darum gegeben, sie nicht sehen und hören zu müssen, seine Frau mit eingeschlossen. Sie schien ihm noch mehr Antipathie als die anderen einzuflößen, und er wandte sich mit verdrießlicher Miene von ihr ab und küßte Fräulein Scherer die Hand.
»Sie bereiten sich auf den Krieg vor, Fürst?« fragte sie.
»Der General Kutusow hat mich zum Adjutanten erwählt«, erwiderte Bolkonsky.
»Und Ihre Frau?«
»Sie wird aufs Land gehen.«
»Schämen Sie sich nicht, uns Ihrer entzückenden Frau zu berauben?«
»Andree!« rief die kleine Fürstin, ebenso kokett ihrem Mann wie den anderen gegenüber. »Wenn du die hübsche Geschichte wüßtest, welche der Graf uns eben erzählt hat.«
Der Fürst machte wieder ein verdrießliches Gesicht und entfernte sich.
Peter, der ihn seit seinem Eintreten mit seinen vergnügten, freundlichen Augen verfolgt hatte, näherte sich ihm jetzt und ergriff seine Hand. Die Miene des Fürsten Andree erhellte sich plötzlich und mit gutmütigem, herzlichem Lächeln rief er: »Ach, wirklich! Bist du auch in der großen Welt?«
»Ich wußte, daß Sie hier sein würden! Ich werde nächstens bei Ihnen speisen, darf ich?« fügte er leise hinzu.
»Nein, du darfst nicht«, sagte Andree lachend, indem er Peter durch einen Händedruck die Überflüssigkeit seiner Frage begreiflich machte.
Er wollte noch etwas sagen, als der Fürst Wassil und seine Tochter sich erhoben, und die Umstehenden auf die Seite traten, um ihnen Raum zu geben.
»Entschuldigen Sie, verehrter Graf«, sagte der Fürst, »diese ungelegene Festlichkeit beim englischen Gesandten beraubt uns eines Vergnügens und nötigt uns, Sie zu unterbrechen. Ich bedaure sehr, teuerste Anna Pawlowna, Ihre reizende Soiree verlassen zu müssen.«
Seine Tochter Helene bahnte sich einen Weg durch die Stühle, indem sie ihr Kleid mit einer Hand zurückhielt. Peter betrachtete diese blendende Schönheit mit einer Mischung von Entzücken und Schrecken.
»Sie ist sehr schön!« sagte der Fürst Andree.
»Ja, sehr«, erwiderte Peter. Der Fürst Wassil drückte ihm im Vorübergehen die Hand.
»Vollenden Sie die Erziehung dieses Bären«, sagte er zu der Hofdame. »Seit elf Monaten wohnt er bei mir und dies ist das erstemal, daß ich ihn in Gesellschaft sehe. Nichts bildet einen jungen Mann so wie die Gesellschaft geistreicher Damen.«
4
Die Hofdame versprach lächelnd, sich mit Peter zu beschäftigen, welcher, wie sie wußte, durch seinen Vater mit dem Fürsten Wassil verwandt war. Die alte Dame, welche neben der Tante saß, erhob sich plötzlich und holte den Fürsten Wassil im Vorzimmer ein.
»Was haben Sie mir zu sagen, Fürst, wegen meines Boris? Ich kann nicht länger in Petersburg bleiben. Bitte, sprechen Sie, was ich meinem armen Sohne sagen kann.« Ungeachtet der sichtlichen Verdrießlichkeit und Unhöflichkeit, mit der der Fürst sie anhörte, lächelte sie ihm zu und hielt ihn mit der Hand zurück. »Es würde Sie nur ein Wort beim Kaiser kosten, daß er direkt in die Garde eintreten könnte.«
»Seien Sie überzeugt, Fürstin, daß ich alles tun werde, was ich kann, aber es ist schwierig, Seine Majestät darum zu bitten. Ich möchte Ihnen raten, sich lieber an Rumjanzow zu wenden, das wäre besser.«
Die alte Dame war die Fürstin Drubezkoi und gehörte einer der ersten Familien Rußlands an, aber sie lebte in Armut und Zurückgezogenheit und hatte alle früheren Verbindungen verloren. Sie war nur nach Petersburg gekommen, um ihren Sohn in der Garde unterzubringen, und in der Hoffnung, dem Fürsten Wassil zu begegnen, hatte sie diese Soiree besucht. Ihr einst schönes Gesicht drückte lebhaften Verdruß aus, aber dann lächelte sie wieder und ergriff den Arm des Fürsten noch kräftiger.
»Hören Sie, Fürst, ich habe Sie nie um etwas gebeten und werde auch nie wieder etwas von Ihnen erbitten. Ich habe Sie niemals an die Freundschaft meines Vaters für Sie erinnert. Aber um Gottes willen, tun Sie das für meinen Sohn, und Sie werden unser Wohltäter sein«, fügte sie hastig hinzu. »Nein, Sie müssen mir das versprechen. Ich war schon bei Galizin, aber er hat mich abgewiesen. Seien Sie so gut, wie Sie ehemals waren«, fuhr sie fort und versuchte zu lächeln, während ihre Augen sich mit Tränen füllten.
»Papa, wir werden zu spät kommen«, rief die Fürstin Helene von der Tür her.
Der Einfluß ist in dieser Welt ein Kapital, mit dem man sparsam zu wirtschaften verstehen muß. Das wußte der Fürst Wassil. Das sicherste Mittel, nichts mehr für sich selbst zu erreichen, wäre es gewesen, wenn er für alle, die sich bittend an ihn wandten, sich hätte verwenden wollen, das hatte er längst begriffen. Deshalb wandte er nur sehr selten seinen persönlichen Einfluß an. Aber die dringende Bitte der Fürstin Drubezkoi erweckte ihm leichte Gewissensbisse. Auf was sie angespielt hatte, das war die Wahrheit, ihrem Vater hatte er in der Tat die ersten Schritte seiner Laufbahn zu verdanken. Er wußte auch, daß sie zu den Frauen, zu denjenigen Müttern gehörte, welche keine Ruhe geben, bevor sie das Ziel ihrer hartnäckigen Wünsche erreicht haben, und welche stets bereit sind, bei jeder Gelegenheit eine Szene zu machen. Dieser Gedanke war bei ihm entscheidend.
»Teuerste Anna Michailowna«, sagte er mit seiner gewöhnlichen Vertrautheit, »was Sie verlangen, ist mir fast unmöglich, aber ich werde es dennoch versuchen, aus Achtung für das Andenken Ihres Vaters. Ihr Sohn wird in die Garde kommen, mein Wort darauf. Sind Sie jetzt zufrieden?« »Teurer Fürst, Sie sind mein Wohltäter! Das habe ich von Ihnen erwartet, denn ich kenne Ihre Herzensgüte. Noch ein Wort«, sagte sie, als er sie verlassen wollte, »wenn er in der Garde ist…« und sie hielt verwirrt an… »Sie stehen so gut mit Kutusow, Sie werden ihm meinen Boris empfehlen, nicht wahr, damit er ihn zum Adjutanten nimmt? Dann werde ich ruhig sein und niemals wieder …«
Fürst Wassil lächelte.
»Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Seit Kutusow zum Obergeneral ernannt wurde, wird er mit Bittschriften überschüttet. Er sagte mir selbst, alle Damen von Moskau wollen ihm ihre Söhne zu Adjutanten geben.«
»Nein, nein, versprechen Sie mir das, mein Freund, mein Wohltäter, versprechen Sie mir das, oder ich halte Sie noch länger zurück!«
»Papa«, wiederholte die schöne Helene, »wir kommen zu spät.«
»Nun, Sie sehen!… Auf Wiedersehen! Ich kann nicht länger…«
»Also, Sie werden morgen mit dem Kaiser sprechen?«
»Unfehlbar, aber was Kutusow betrifft, kann ich nichts versprechen.« »Mein Wassil«, begann Anna Michailowna wieder mit einem koketten Lächeln. Sie vergaß, daß ihr Lächeln von ehemals mit ihrem müden Gesicht nicht mehr harmonierte. Sie dachte nicht mehr an ihr Alter und suchte nur alle Mittel anzuwenden. Kaum aber war der Fürst verschwunden, als ihr Gesicht wieder seinen früheren kalten Ausdruck annahm. Sie trat wieder zu der Gruppe, in deren Mitte der Graf erzählte, und gab sich den Anschein, sich dafür zu interessieren, während sie nur an den günstigen Moment zum Verschwinden dachte, da sie ihr Vorhaben nun ausgeführt hatte.
»Wie finden Sie diese neue Komödie?« fragte die Hofdame. »Monsieur Bonaparte sitzt auf einem Thron und hört die Wünsche der Nation an. Wunderbar! Nein, man sollte glauben, die ganze Welt habe den Kopf verloren!« Der Fürst Andree lächelte.
»Wirklich«, rief die Hofdame, »die Regenten können diesen Menschen nicht länger dulden, er ist für alle eine lebendige Drohung.«
»Die Regenten«, sagte der französische Emigrant höflich und in traurigem Tone. »Was haben sie für Ludwig XVI. getan und für die Königin? Nichts! Und glauben Sie mir, sie sind dafür gestraft, daß sie die Bourbonen verlassen haben. Und wenn Napoleon noch ein Jahr auf dem Throne von Frankreich bleibt, so wird die französische Gesellschaft, ich meine die gute Gesellschaft, wohlverstanden, vernichtet sein, und dann…« Peter wollte ihn unterbrechen, aber die Hofdame, die ihn beobachtete, kam ihm zuvor.
»Der Kaiser Alexander«, begann sie mit jenem Anflug von Traurigkeit, der immer ihre Bemerkungen über die kaiserliche Familie begleitete, »hat erklärt, daß er es den Franzosen überlasse, ihre Regierungsform zu wählen, und ich bin überzeugt, die ganze Nation wird sich in die Arme ihres legitimen Königs werfen, wenn sie einmal von dem Usurpator befreit ist.« Augenscheinlich lag es Fräulein Scherer daran, dem royalistischen Emigranten zu schmeicheln.
»Das ist wenig wahrscheinlich«, bemerkte Fürst Andree, »die Sachen sind zu weit gegangen und ich glaube, es wäre schwierig, auf die Vergangenheit zurückzukommen.« »Wie ich hörte«, fügte Peter hinzu, »ist der größte Teil des Adels von Napoleon schon gewonnen.«
»Das behaupten die Bonapartisten!« rief der Graf, ohne Peter anzusehen. »Die Hinrichtung des Herzogs von Enghien«, bemerkte Peter, »war eine politische Notwendigkeit, und Napoleon hat wirklich Seelengröße gezeigt, indem er die Verantwortlichkeit dafür auf sich nahm.«
»Oh! Oh!« riefen mehrere Stimmen. Der Graf zuckte mit den Achseln. »Ich sage das«, fuhr Peter fort, »weil die Bourbonen vor der Revolution geflohen sind und das Volk der Anarchie überlassen haben. Napoleon allein hat es verstanden, die Revolution zu besiegen und deshalb durfte er sich nicht von einem einzelnen auf seinem Wege aufhalten lassen, wenn er das allgemeine Wohl im Auge hatte.«
»Wollen Sie nicht an den andern Tisch gehen?« sagte die Hofdame, aber Peter fuhr immer lebhafter fort: »Ja, Napoleon ist groß, weil er sich über die Revolution gestellt hat, weil er ihre Mißbräuche unterdrückt und beibehalten hat, was sie Gutes hatte, die Gleichheit, die Freiheit der Presse und des Wortes, und nur dadurch hat er die Macht erlangt.«
»Wenn er diese Macht dem legitimen König zurückgegeben hätte, ohne sie zu benutzen, um einen Mord zu begehen, dann würde ich ihn einen großen Mann nennen«, sagte der Graf.
»Das war ihm unmöglich. Die Nation hatte ihm die Macht nur gegeben, damit er sie der Bourbonen entledigen solle. Die Revolution war ein großes Werk.« Peter bewies seine jugendliche Unbedachtsamkeit, indem er so vorgeschrittene Ideen äußerte.
»Die Revolution ein großes Werk!… Aber wollen Sie nicht an den anderen Tisch gehen?« wiederholte die Hofdame.
Der Fürst Andree betrachtete lächelnd bald Peter, bald den Franzosen, bald die Dame des Hauses, welche durch die Äußerungen Peters in Entsetzen geriet.
Als sie bemerkte, daß diese lästerlichen Worte den Zorn des Grafen nicht erregten, und daß es auch nicht möglich war, sie zu ersticken, machte sie gemeinschaftliche Sache mit dem Emigranten.
»Aber mein lieber Monsieur Pierre«, sagte sie, »ist das die Handlung eines großen Mannes, einen Herzog erschießen zu lassen, wenn er nichts begangen hat und ohne Urteil?«
»Er ist eben ein Bürgerlicher«, fügte Fürst Hippolyt hinzu. Andere und ähnliche Bemerkungen folgten. Peter wußte nicht mehr, was er antworten sollte und blickte lächelnd um sich.
»Wie sollte er anders handeln?« sagte plötzlich Fürst Andree, »ich sollte doch glauben, man müßte einen Unterschied machen zwischen den Handlungen eines Privatmannes und denen eines Staatsmannes.«
»Gewiß, gewiß«, rief Peter erfreut über diese unverhoffte Unterstützung. »Napoleon auf der Brücke von Areole oder im Hospital der Pestkranken in Jaffa ist groß als Mensch, das ist nicht zu leugnen, aber andere seiner Handlungen sind schwer zu entschuldigen«, fuhr Fürst Andree fort, augenscheinlich um Peters Unbedachtsamkeit womöglich wieder gutzumachen, indem er sich erhob und seiner Frau damit das Zeichen zum Aufbruch gab.
5
Nach diesem Zwischenfall begannen die Gäste sich zu verabschieden.
Außer einer ungewöhnlichen Größe und einem äußerst linkischen Benehmen hatte Peter unter anderen physischen Nachteilen auch ungeheuer rote Hände. Er wußte nicht, wie er in einen Salon eintreten sollte, noch weniger, wie er es anstellen sollte, auf gute Weise abzugehen und dabei etwas besonders Angenehmes zu sagen. In seiner sprichwörtlichen Zerstreutheit hatte er anstatt seines Hutes den dreispitzigen Federhut eines Generals ergriffen. Aber all diese Mängel wurden ausgeglichen durch seine Herzensgüte, Aufrichtigkeit und Bescheidenheit.
Fräulein Scherer begrüßte ihn zum Abschied mit christlicher Milde, die ihm ihre Verzeihung verhieß.
»Ich hoffe«, sagte sie, »nun öfters das Vergnügen zu haben, Sie zu sehen, aber ich hoffe auch, mein werter Monsieur Pierre, daß Sie Ihre Ansichten ändern werden.«
Er gab keine Antwort, verbeugte sich aber mit jenem aufrichtigen Lächeln, welches sagte: »Ansichten sind Ansichten, und Sie sehen, ich bin dabei doch ein guter Junge.« Das war so wahr, daß alle es unwillkürlich begriffen.
Fürst Andree war seiner Frau in das Vorzimmer gefolgt, begleitet von Hippolyt, den er gleichgültig anhörte.
»Gehen Sie hinein, Anna Pawlowna«, sagte die junge Frau, »Sie werden sich erkälten … Es ist abgemacht«, fügte sie leise hinzu.
Die Hofdame hatte Zeit gefunden, mit Lisa über die beabsichtigte Heirat zwischen ihrer Schwägerin und Anatol zu sprechen.
»Ich rechne auf Sie, meine Liebe«, erwiderte Anna Pawlowna ebenso leise. »Sie werden ihr ein Wörtchen schreiben und mir sagen, wie ihr Vater die Sache ansieht. Au revoir!« Sie kehrte in den Salon zurück. Hippolyt näherte sich der kleinen Fürstin, beugte sich zu ihr herab und flüsterte ihr etwas zu.
»Ich bin glücklich, nicht zu dem Gesandten gegangen zu sein«, sagte Fürst Hippolyt. »Wie langweilig!«
»Man sagt, der Ball heute abend werde sehr schön sein«, erwiderte die Fürstin. »Alle Zierden der Gesellschaft werden dort sein.«
»Nicht alle, weil Sie nicht da sind«, erwiderte er lächelnd.
»Bist du bereit?« sagte Fürst Andree zu seiner Frau.
Hippolyt zog rasch seinen Mantel an und eilte voran, um der Fürstin beim Einsteigen zu helfen.
»Entschuldigen Sie«, sagte Fürst Andree in trockenem, schroffem Tone zu dem jungen Mann, der ihm im Wege stand. »Peter, wirst du kommen?
Ich erwarte dich!« rief er freundlich.
Der Wagen fuhr ab. Hippolyt ließ ein nervöses Lachen hören, indem er den Franzosen erwartete, dem er versprochen hatte, ihn nach Hause zu bringen.
»Nun, mon cher, Ihre kleine Fürstin ist wirklich sehr niedlich«, sagte der Graf, indem er sich in den Wagen setzte. Dabei küßte er seine Fingerspitzen.
Hippolyt lachte geschmeichelt.
»Wissen Sie, daß Sie schrecklich sind mit Ihrer unschuldigen Miene«, fuhr der Graf fort. »Ich bedaure den armen Gemahl, diesen kleinen Offizier mit dem gespreizten Wesen wie ein regierender Fürst.«
»Und Sie sagen, die russischen Damen seien nicht wie die Französinnen?« rief Hippolyt, laut lachend. »Man muß sie nur zu nehmen verstehen!«
6
Peter kam zuerst an und ging direkt in das Kabinett des Fürsten Andree. Nachdem er sich nach seiner Gewohnheit auf dem Sofa ausgestreckt hatte, griff er nach einem Buch – es waren Cäsars Kommentarien –, stützte sich auf den Ellbogen und öffnete es in der Mitte.
»Was hast du bei Fräulein Scherer gemacht?« sagte Fürst Andree, welcher bald darauf eintrat, seine kleinen weißen Hände reibend. »Sie wird aus Alteration ernstlich krank werden.«
Peter wandte sich so rasch um, daß das Kanapee ächzte, und drückte durch eine Gebärde seine Gleichgültigkeit aus.
»Dieser Abbé ist wirklich interessant, nur faßt er die Frage nicht richtig auf. Ich bin überzeugt, daß ein unverbrüchlicher Friede möglich ist, aber ich kann nicht sagen, wie. Nur wird es niemals mittels des politischen Gleichgewichts sein.«
Der Fürst Andree, der sich für abstrakte Fragen nicht zu interessieren schien, unterbrach ihn. »Siehst du, mein Lieber, es ist nun einmal unmöglich, überall und immer zu sagen, was man denkt. Nun, hast du dich für etwas entschieden? Wirst du zur Chevaliergarde gehen oder Diplomat werden?«
»Darüber bin ich noch nicht im reinen, weder das eine noch das andere gefällt mir«, sagte Peter, indem er sich nach türkischer Weise auf den Diwan setzte.
»Aber du mußt dich doch zu etwas entschließen, dein Vater wartet darauf.« Peter war mit zehn Jahren mit einem Hofmeister ins Ausland gesandt worden und war dort geblieben bis zum fünfundzwanzigsten Jahre. Bei seiner Rückkehr nach Moskau verabschiedete sein Vater den Hofmeister und sagte zu dem jungen Mann: »Jetzt gehe nach Petersburg, beobachte und wähle, ich stimme allem bei. Hier ist ein Brief an den Fürsten Wassil und hier ist Geld! Schreibe mir wieder und rechne auf meine Hilfe.«
Seit drei Monaten suchte nun Peter eine Karriere und tat nichts.
»Er muß ein Freimaurer sein«, sagte er, mit der Hand über die Stirn fahrend. Er dachte an den Abbé, den er in der Soiree gesehen hatte.
»Das ist alles gleichgültig«, unterbrach ihn Fürst Andree, »wir wollen ernsthaft sprechen. Hast du die Chevaliergarde gesehen?«
»Nein, ich bin nicht hingegangen, aber ich habe über etwas nachgedacht, das ich Ihnen mitteilen will. Wir haben Krieg mit Napoleon. Wenn man sich für die Freiheit schlagen würde, so wäre ich der erste, der sich anschließt. Aber England und Österreich zu helfen, den größten Mann der Welt zu bekämpfen, das ist nicht gut.«
Fürst Andree zuckte nur die Achseln bei dieser kindlichen Äußerung und verschmähte es, eine ernsthafte Antwort darauf zu geben.
»Wenn man sich nur für seine Überzeugung schlagen würde«, sagte er, »so gäbe es keinen Krieg mehr.«
»Und das wäre vortrefflich«, erwiderte Peter.
»Möglich, aber dazu wird es niemals kommen«, erwiderte lächelnd Fürst Andree.
»Nun, aber warum werden wir Krieg führen?«
»Warum? Das weiß ich nicht, es muß sein, und überdies gehe ich hin.. weil… das Leben, das ich hier führe, mir überdrüssig ist.«
7
Im Nebenzimmer wurde das Rauschen eines Kleides hörbar. Bei diesem Geräusch schien Fürst Andree zu sich zu kommen. Er richtete sich auf und gab seinem Gesicht denselben Ausdruck, den es während der ganzen Soiree gehabt hatte. Peter schob die Füße zur Erde. Die Fürstin trat ein. Sie hatte bereits Zeit gefunden, ihre Abendtoilette mit einem Hauskleid zu vertauschen, das nicht weniger frisch und elegant war. Ihr Mann erhob sich und schob höflich einen Lehnstuhl für sie herbei.
»Ich frage mich oft«, sagte sie französisch nach ihrer Gewohnheit, indem sie lebhaft Platz nahm, »warum Anna Pawlowna nicht geheiratet hat? Wie dumm die Herren sind, daß sie sie nicht geheiratet haben! Entschuldigen Sie, Monsieur Pierre, aber Sie verstehen nichts von den Frauen. Und was Sie für ein Redner sind!«
»Ich streite mich mit Ihrem Gemahl, denn ich verstehe nicht, warum er in den Krieg ziehen will«, sagte Peter, ohne eine Spur jener Befangenheit, welche oft zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau sich einschleicht.
Die Fürstin fuhr zusammen.
»Nun ja, ich sage dasselbe. Ich begreife wirklich nicht, warum die Männer nicht ohne Krieg leben können. Warum wünschen wir Frauen nichts und haben nichts nötig? Urteilen Sie selbst! Immer wiederhole ich ihm, daß seine Stellung hier als Adjutant meines Onkels eine der glänzendsten ist, jedermann kennt ihn und schätzt ihn. Erst vor einigen Tagen hörte ich bei der Fürstin Apraxin eine Dame fragen: ›Ist das der berühmte Fürst Andree?«
Sie brach in ein lautes Lachen aus. »Und wenn er wollte, könnte er Flügeladjutant des Kaisers werden, denn Sie müssen wissen, der Kaiser hat sich neulich sehr freundlich mit ihm unterhalten. Das wäre so leicht zu machen, was denken Sie davon?«
Peter sah seinen Freund an und schwieg, da dieser ärgerlich zu sein schien.
»Wann reisen Sie ab?« fragte er die Fürstin.
»Ach, sprechen Sie nicht von der Abreise, ich will nichts davon hören!« rief die Fürstin. »Als ich heute daran dachte, daß ich alle meine teuren Bekanntschaften aufgeben soll… und dann, weißt du Andree … ich habe Angst!« Sie kniff dabei die Augen zusammen, was für Peter unverständlich blieb.
Ihr Mann sah sie verdutzt an, als ob er eben erst ihre Gegenwart bemerkt hätte.
»Was fürchtest du, Lisa?« fragte er mit kalter Höflichkeit, »Ich verstehe dich nicht.«
»So sind die Männer! Egoisten, lauter Egoisten! Einer Laune zuliebe verläßt er mich, Gott weiß, warum, und schickt mich allein aufs Land.«
»Mit meinem Vater und meiner Schwester, das vergißt du.«
»Das kommt auf dasselbe heraus! Ich werde allein sein, fern von meinen Freundinnen, und dabei soll ich zufrieden sein?«
Sie sprach in verdrießlichem Tone, ihre aufgezogene Lippe gab ihrer Miene einen keineswegs reizenden Ausdruck, sondern einen solchen, der eher an ein kleines Nagetier erinnerte. Sie schwieg, da sie es nicht für passend hielt, in Peters Gegenwart auf ihre Mutterhoffnungen anzuspielen, denn darin lag der Knoten der Situation.
»Ich kann aber nicht erraten, vor was du Angst hast«, bemerkte langsam ihr Mann, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
Die Fürstin errötete und machte eine Gebärde der Ungeduld. »Andree! Andree, warum hast du dich so verändert?«
»Der Arzt hat dir verboten, lange zu wachen, du solltest dich schlafen legen.«
Die Fürstin gab keine Antwort, aber plötzlich zuckte ihre Lippe. Er erhob sich, zuckte mit den Achseln und ging im Zimmer auf und ab.
Peter beobachtete sie beide mit naivem Erstaunen. Endlich machte er eine Bewegung, um sich zu erheben, gab dies aber sogleich wieder auf.
»Es ist mir gleichgültig, ob Monsieur Pierre zugegen ist!« rief die Fürstin, deren hübsches Gesicht sich verzog wie das eines Kindes, das weinen will. »Schon lange wollte ich dich fragen, Andree, warum du so ganz anders gegen mich geworden bist? Was habe ich dir getan? Du gehst zur Armee, ohne Mitleid mit mir zu haben! Warum?«
»Lisa!« rief der Fürst Andree.
Und dieses eine Wort enthielt Bitte, Drohung und die Versicherung, daß sie ihre Worte bereuen werde.
Sie fuhr aber heftig fort: »Du behandelst mich wie eine Kranke oder wie ein Kind! Ich sehe alles!… vor sechs Monaten warst du nicht so!«
»Lisa, ich bitte dich, höre auf!« erwiderte er lauter.
Peter, dessen Erregung bei dieser Unterhaltung immer mehr stieg, erhob sich und näherte sich der jungen Frau. Er schien den Anblick der Tränen nicht ertragen zu können und selbst dem Weinen nahe zu sein.
»Beruhigen Sie sich, Fürstin, das sind nur Ideen, ich habe das auch empfunden … Ich versichere Ihnen … und übrigens … nein, entschuldigen Sie mich, ich bin hier als Fremder überflüssig… beruhigen Sie sich! Adieu!«
Fürst Andree hielt ihn zurück.
»Nein, Peter, warte noch, die Fürstin ist zu gut, um mich des Vergnügens, den Abend mit dir zu verbringen, berauben zu wollen.«
»Ach ja, er denkt nur an sich«, murmelte sie, ohne ihre Tränen des Verdrusses zurückhalten zu können.
»Lisa«, sagte der Fürst Andree scharf, mit einer Stimme, welche anzeigte, daß sein Zorn aufs höchste gestiegen war. Plötzlich verbreitete sich auf ihrem zornigen Gesicht ein furchtsamer Ausdruck.
»Mein Gott, mein Gott«, murmelte sie mit einem hastigen Blick nach ihrem Mann, dann nahm sie das Kleid mit einer Hand auf, näherte sich ihm und drückte einen Kuß auf seine Stirn.
»Gute Nacht, Lisa!« sagte er, sich erhebend, und küßte ihr die Hand wie einer Fremden.
8
Die beiden Freunde schwiegen, keiner konnte sich entschließen, zu sprechen. Peter betrachtete heimlich seinen Freund, der sich mit seiner kleinen Hand die Stirn rieb.
»Wir wollen speisen gehen«, sagte er seufzend und schritt zur Tür. Sie traten in einen prachtvollen Speisesaal. Die Einrichtung, das Geschirr, das Silberzeug und die Wäsche, alles trug den Stempel der Neuheit einer jungen Haushaltung. Plötzlich stützte der Fürst Andree den Ellbogen auf den Tisch und sprach mit einer nervösen Hast, welche Peter noch niemals an ihm bemerkt hatte, und wie ein Mensch, der seit langer Zeit etwas auf dem Herzen hat und sich endlich zu einem Geständnis entschloß.
»Lieber Freund, heirate nicht früher, als bis du alles vollbracht hast, was du machen willst, als bis du aufgehört hast, die Frau deiner Wahl zu lieben und bis du sie genau studiert hast, sonst wirst du dich grausam täuschen. Heirate lieber, wenn du alt bist und zu nichts mehr taugst, dann wirst du wenigstens nicht Gefahr laufen, alles, was Gutes und Erhabenes in dir ist, zu vertrödeln. Ja, sieh mich nur so erstaunt an! Wenn du fernerhin noch etwas von dir selbst erwartest, so wirst du bei jedem Schritt empfinden, daß alles aus und alles für dich verschlossen ist, außer den Salons, wo du auf einem Brett mit einem Hoflakai und einem Dummkopf stehst. Aber wozu? …« Er machte eine heftige Gebärde.
Peter nahm die Brille ab, und jetzt wurde seine gutmütige Miene und sein Erstaunen noch deutlicher sichtbar.
»Meine Frau«, fuhr Fürst Andree fort, »ist ein vortreffliches Weib, eine von jenen, bei welchen die Ehre eines Ehemannes nichts zu fürchten hat, aber was würde ich in diesem Augenblick nicht dafür geben, großer Gott, nicht verheiratet zu sein! Du bist der erste und einzige, dem ich das eingestehe.«
Fürst Andree glich immer weniger jenem Fürsten Bolkonsky, der sich bei Fräulein Scherer in einem Lehnstuhl niedergelassen hatte und mit halb geschlossenen Augen französische Phrasen aussprach. Ein fieberhaftes, nervöses Zucken bewegte jeden Muskel seines finsteren Gesichts, seine Augen glühten, man sah, daß er in den kurzen Augenblicken krankhafter Reizbarkeit um so heftiger war, je schwächlicher er in seinem gewöhnlichen Zustand erschien.
»Du verstehst mich nicht, und doch ist das die Geschichte eines ganzen Menschenlebens. Du sprichst von Bonaparte und seiner Laufbahn«, fuhr er fort, obgleich Peter kein Wort gesagt hatte, »aber als Bonaparte arbeitete, nach einem Ziel strebte, war er frei und hatte nur dieses Ziel im Auge, und dann erreichte er es. Aber wenn man das Unglück hat, an eine Frau gebunden zu sein, so ist man gefesselt wie ein Sträfling. Alles, was du an Kraft und Strebsamkeit in dir fühlst, kann nur die Last der Reue vermehren. Das Salongeschwätz, die Bälle, die Eitelkeit und Kleinigkeit, das ist der mächtige Zirkel, der dich einschließt. Jetzt gehe ich in den Krieg, einen der furchtbarsten Kriege, welche jemals die Welt erlebt hat, und weiß nichts, bin zu nichts fähig, dafür aber bin ich sehr liebenswürdig, sehr sarkastisch und bei Fräulein Scherer hört man mich an. Und dann diese alberne Gesellschaft, welche meine Frau nicht entbehren kann!… Wenn du nur wüßtest, was sie wert sind, alle diese vornehmen Damen, und alle Frauen überhaupt! Mein Vater hat recht, Egoismus, Eitelkeit, Dummheit, Mittelmäßigkeit in allem, das sind die Frauen, wenn sie sich zeigen, wie sie sind. Wenn man sie in der Welt sieht, könnte man glauben, es sei etwas anderes in ihnen. Aber nein, es ist nichts, nichts! Ja, mein Freund, ich sage dir, heirate nicht!…«
»Ich bin erstaunt«., sagte Peter, »daß Sie sich für unfähig halten und glauben können, Ihr Leben verfehlt zu haben, während die Zukunft vor Ihnen liegt, und…« In dem Ton, in dem er diese Worte sprach, konnte man die hohe Achtung vernehmen, die er für seinen Freund hegte.
»Mit mir ist’s zu Ende, sprechen wir nicht mehr von mir, sondern von dir«, begann der Fürst nach kurzem Schweigen lächelnd wieder. Peters Gesicht strahlte sogleich diese Veränderung in der Miene seines Freundes wider. »Von mir?« wiederholte er mit einem heiteren, unbefangenen Lächeln. »Über mich gibt es nichts zu sagen. Was bin ich überhaupt? Ein Bastard!« Und er errötete plötzlich, denn er hatte dieses Wort mit sichtlicher Anstrengung ausgesprochen. – »Ohne Namen, ohne Vermögen! Und in Wirklichkeit bin ich frei und zufrieden, für den Augenblick wenigstens. Nur gestehe ich, ich weiß nicht, was ich unternehmen soll, und ich wollte Sie ernsthaft darüber um Rat fragen.«
Fürst Andree betrachtete ihn wohlwollend, aber dieses freundschaftliche Gefühl ließ doch das Bewußtsein seiner Überlegenheit erkennen.
»Ich bin dir gut, weil du der einzige lebende Mensch in unserm Kreise bist. Du bist zufrieden. Wähle nach deinem Geschmack, gleichviel was, du wirst dich überall wohl befinden. Aber ich bitte dich, gib die Bekanntschaft mit diesem Kuragin und dein jetziges Leben auf! Es paßt für dich so schlecht, diese Ausschweifung, dieses Husarenleben, diese …«
»Was wollen Sie, mein Lieber?« sagte Peter, die Achseln zuckend. »Die Frauen, mein Freund, die Frauen.«
»Nun ja«, erwiderte Andree, »die Frauen comme il faut – meinetwegen, aber nicht diese von Kuragin und den Wein – das kann ich nicht gutheißen.«
Peter wohnte bei dem Fürsten Wassil Kuragin und teilte das leichtsinnige Leben seines Sohnes Anatol, desselben, den man an die Schwester des Fürsten Andree verheiraten wollte, um ihn zu bessern.
»Wissen Sie«, sagte Peter, als ob ihm plötzlich ein glücklicher Gedanke gekommen wäre, »ich habe seit langer Zeit das auch gedacht. Bei dieser Lebensweise kann ich mich zu nichts entschließen und an nichts denken. Ich habe Kopfschmerzen und kein Geld. Er hat mich zu heute abend wieder eingeladen, aber ich werde nicht hingehen!«
»Gib mir dein Ehrenwort, daß du nicht hingehen wirst!«
»Gewiß, ich gebe es Ihnen!«
9
Es war ein Uhr vorüber, als Peter seinen Freund verließ. Es war eine Juninacht, eine jener Petersburger Nächte fast ohne Dämmerung. Er stieg in eine Droschke, mit der Absicht, nach Hause zu fahren, aber während der Fahrt erschien es ihm immer unmöglicher, während einer solchen Nacht zu schlafen. Sein Blick schweifte durch die öde Straße. Dann dachte er daran, daß die gewöhnliche Spielgesellschaft sich jetzt bei Anatol Kuragin versammelte. Nach dem Spiel begann das Trinkgelage und das Ganze endigte mit einem Lieblingsvergnügen Peters.
»Soll ich nicht hingehen?« fragte er sich und dachte daran, daß er dem Fürsten Andree sein Wort gegeben hatte.
Aber wie es bei charakterlosen Leuten gewöhnlich ist, erfaßte ihn eine so unüberwindliche Lust, noch einmal dieses leichtsinnige Leben zu genießen, daß er beschloß, zu Anatol zu gehen. Er sagte sich, sein Versprechen habe keinen Wert, weil er Anatol versprochen hatte, zu kommen, ehe er dem Fürsten sein Wort gegeben hatte. Durch seine Wankelmütigkeit wurden oft seine dem Anscheine nach festen Entschlüsse umgestoßen. Peter gab wieder nach und ging zu Kuragin. Vor einem großen Hause neben der Kaserne der Chevaliergarde ließ er anhalten und stieg die erleuchtete Treppe hinauf. In dem leeren Vorzimmer herrschte Weingeruch; leere Flaschen, Mäntel und Galoschen lagen umher und in der Ferne hörte man ein Stimmengewirr und Rufen. Nachdem Peter den Mantel abgenommen hatte, trat er in das Zimmer ein, wo die Reste des Abendessens umherstanden, und ein Diener, der Straflosigkeit sicher, heimlich die halbvollen Gläser leerte. Weiterhin im dritten Zimmer hörte man unter allgemeinem Gelächter und Lärm das Brummen eines Bären. An einem offenen Fenster standen acht junge Leute, drei von ihnen spielten mit einem jungen Bären, welchen einer von ihnen an einer Kette hielt und auf seine Genossen hetzte.
»Ich wette auf Stevens«, rief der eine.
»Aber nicht helfen«, sagte ein zweiter.
»Ich wette auf Dolochow!« schrie eine dritte Stimme. »Kuragin, trinken Sie!«
»Nun, laßt Mischka beiseite, es handelt sich um eine Wette.«
»Aber mit einem Wurf, sonst hat er verloren«, rief eine fünfte Stimme.
»Heda, die Flasche!« brüllte der Herr des Hauses, ein großer, schöner, junger Mann in der Mitte der Gruppe, ohne Rock und mit vorn offenem Hemd.
»Stille, meine Herren, da ist Petruschka«, wandte er sich an Peter.
Ein hochgewachsener junger Mann mit hellblauen Augen, dessen ruhige, nüchterne Stimme in seltsamem Kontrast zu den anderen stand, rief ihn ans Fenster.
»Komm her, ich will dir die Wette erklären.«
Das war Dolochow, ein Offizier vom Semenowschen Regiment, ein bekannter Raufbold und Spieler, der bei Anatol wohnte. Peter lächelte und blickte vergnügt um sich.
»Um was handelt es sich?«
»Einen Augenblick, er ist noch nüchtern! Schnell eine Flasche her!« rief Anatol. Dann nahm er ein Glas vom Tische und näherte sich ihm.
»Vor allem mußt du trinken.«
Peter trank Glas auf Glas, doch dies hinderte ihn nicht daran, der Unterhaltung zu folgen und alle Gäste zu beobachten, welche sich wieder beim Fenster versammelt hatten. Anatol goß ihm Wein ein und erklärte ihm die Wette Dolochows mit dem Engländer Stevens, einem Seemann. Der erstere hatte sich verpflichtet, eine Flasche Rum auszutrinken, auf einem Fenster der dritten Etage sitzend, die Beine zum Fenster hinaushängend. »Da trink«, wiederholte Anatol, indem er Peter das letzte Glas anbot, »ich lasse dich nicht früher los.«
»Nein, ich will nicht mehr«, sagte Peter. Dolochow hielt den Engländer am Arm und wiederholte ihm nochmals deutlich die Bedingungen der Wette. Dolochow war von mittlerer Größe und etwa fünfundzwanzig Jahre alt. Er hatte blaue Augen und trug, wie alle Infanterieoffiziere, keinen Schnurrbart. Die Linien seines Mundes waren merkwürdig fein, die Oberlippe trat etwas über die Unterlippe hervor, in beiden Mundwinkeln spielte beständig ein Lächeln, man hätte fast sagen können zwei Lächeln, welches in Verbindung mit seinem festen, zuversichtlichen und intelligenten Blick die Aufmerksamkeit anzog. Er hatte kein Vermögen, keine Verbindungen, wohnte bei Anatol, gab Tausende von Rubeln aus und verstand es bei alledem, sich so zu stellen, daß seine Bekannten mehr Achtung für ihn als für Anatol hatten. Er spielte alle Spiele, gewann immer wieder und trank enorm, ohne jemals die Selbstbeherrschung zu verlieren. Kuragin und er waren damals Berühmtheiten in der leichtsinnigen Welt der Petersburger Lebemänner.
Man brachte eine Flasche Rum. Zwei Diener, welche von dem Lärm und den widersprechenden Befehlen schon ganz konfus geworden waren, bemühten sich, den Fensterrahmen herauszureißen, welcher dabei hinderlich war, sich auf den äußeren Rand der Fensteröffnung zu setzen.
Anatol näherte sich. Vom Verlangen getrieben, etwas zu zerbrechen, stieß er den Diener zurück und rüttelte an dem Rahmen, welcher Widerstand leistete, wobei eine Fensterscheibe zerbrach.
»Nun, du Herkules«, sagte er zu Peter. Peter faßte den Rahmen und riß ihn mit Krachen heraus.
Dolochow hatte die Rumflasche ergriffen, trat an das offene Fenster und sprang auf die Brüstung.
»Hört!« rief er, das Gesicht nach dem Innern des Zimmers gewendet.
Alles schwieg. Dann begann er französisch, damit der Engländer ihn verstehen konnte: »Ich wette fünfzig Imperials, oder wollen Sie hundert?«
»Nein, fünfzig«, erwiderte der Engländer.
»Gut, ich wette fünfzig Goldstücke, daß ich diese Flasche Rum austrinken werde, ohne abzusetzen, und daß ich sie hier außerhalb des Fensters sitzend austrinken werde, ohne mich an irgend etwas festzuhalten. Einverstanden?«
»Einverstanden«, sagte der Engländer.
Anatol hielt denselben am Rockknopf fest und wiederholte ihm auf englisch die Bedingungen.
»Das ist nicht alles«, rief Dolochow, indem er mit der Flasche auf die Fensterbank schlug, um sich Gehör zu verschaffen. »Kuragin, paß auf! Wenn jemand dasselbe tut, bezahle ich ihm hundert Goldstücke. Verstanden?«
Der Engländer nickte, machte aber keine Miene, diese neue Wette anzunehmen. Ein junger Gardehusar, welcher den ganzen Abend Unglück im Spiel hatte, kletterte auf das Fenster und blickte hinab.
»Oh! Oh!« murmelte er.
»Still!« rief Dolochow und zog den Offizier zurück, welcher an seinen Sporen hängenblieb und linkisch ins Zimmer stolperte.
Dolochow stellte die Flasche in die Fensteröffnung und kletterte langsam und vorsichtig hinauf. Dann stützte er sich mit beiden Händen gegen die beiden Seiten des Fensters und maß mit dem Auge seine Breite. Dann setzte er sich langsam nieder, ließ die Hände los, neigte sich etwas zur Linken, dann zur Rechten und ergriff die Flasche.
Anatol brachte zwei Kerzen und stellte sie in die Fensteröffnung. Es war jedoch schon heller Tag, Kopf und Rücken Dolochows, in Hemdsärmeln, waren von beiden Seiten beleuchtet. Alle drängten sich ans Fenster, der Engländer vor den anderen. Peter lächelte still. Plötzlich drängte sich einer der jungen Leute mißbilligend und erschreckt vor, in der Absicht, Dolochow am Hemd zurückzuziehen.
»Meine Herren, das sind Torheiten, er wird ums Leben kommen!« rief dieser weise Herr, der sicherlich vernünftiger war als die anderen. Anatol hielt ihn zurück.
»Rühre ihn nicht an, du wirst ihn erschrecken, und er fällt hinab. Was dann?«
Dolochow stützte sich auf die Hände und suchte sich ein zuversichtliches Ansehen zu geben.
»Wenn noch einmal jemand sich untersteht, sich einzumischen, so werfe ich ihn da hinab?« sagte er. Dann wandte er sich um, setzte die Flasche an den Mund, warf den Kopf zurück und erhob den Arm, der noch frei war, um sich ein Gegengewicht zu sichern. Einer der Diener, welche die Gläser auf dem Tische zusammenräumten, blieb unbeweglich in halb gebückter Haltung stehen und wandte keinen Blick von dem Fenster und Dolochows Kopf ab.
Der Engländer blickte mit zusammengepreßten Lippen zur Seite. Derjenige, welcher vergebens versucht hatte, diese Torheit zu hintertreiben, hatte sich in einer Ecke des Zimmers auf einen Diwan geworfen und kehrte das Gesicht nach der Wand. Peter bedeckte sich die Augen, und es trat eine tiefe Stille ein.
Als Peter die Augen öffnete, sah er Dolochow in derselben Stellung im Fenster sitzend, nur der Kopf war noch stärker zurückgeneigt, während der Arm, der die Flasche hielt, sich immer höher hob und bei der Anstrengung etwas schwankte. Die Flasche wurde sichtbar leerer.
»Wie lange das dauert!« dachte Peter; er glaubte, es sei eine halbe Stunde verflossen. Dolochow machte plötzlich eine Bewegung, und sein Arm zitterte stark. Da er auf der nach abwärts geneigten Fensterbrüstung saß, konnte diese nervöse Bewegung ihn hinabstürzen. Unwillkürlich erhob er eine Hand, wie um sich an dem Fensterkreuz anzuklammern, ließ sie aber sogleich wieder sinken. Peter schloß die Augen in der Absicht, sie nicht wieder zu öffnen, aber eine allgemeine Bewegung, die einen Augenblick darauf entstand, veranlaßte ihn, aufzublicken, und er sah Dolochow bleich, aber vergnügt in der Fensteröffnung sitzen.
»Sie ist leer!« Er warf die Flasche dem Engländer zu, der sie im Fluge auffing. Dolochow sprang ins Zimmer in einer Wolke von Branntweinduft.
»Bravo! Bravo! Das ist eine Wette!« riefen alle zugleich.
Der Engländer hatte seine Börse gezogen und rechnete mit Dolochow ab, der schweigsam und mürrisch geworden war. Peter stürzte an das Fenster. »Meine Herren, wer wettet mit mir, daß ich dasselbe tun werde? Und selbst ohne Wette! Schnell eine Flasche, schnell!«
»Bist du wahnsinnig geworden? Was fällt dir ein? Das darf nicht sein, hörst du? Du wirst ja schon auf einer Treppe schwindelig«, riefen mehrere Stimmen durcheinander.
»Eine Flasche her«, rief Peter, »ich werde sie austrinken!« Und er schlug heftig auf den Tisch. Einer der jungen Leute stürzte auf ihn zu, aber Peter schob ihn leicht zur Seite.
»Nein, so werden Sie ihn nicht halten«, sagte Anatol. »Höre!« rief er Peter zu, »ich werde die Wette halten, aber nicht früher als morgen! Jetzt gehen wir alle zu…«
»Gut, gut, gehen wir«, rief Peter vergnügt, »und Mischka nehmen wir mit!« Er ergriff den jungen Bären, umfaßte ihn mit seinen Armen, hob ihn auf und tanzte mit ihm durchs Zimmer.
10
Der Fürst Wassil hatte das Versprechen, das er der Fürstin Drubezkoi gegeben hatte, nicht vergessen. Die Bitte wurde dem Kaiser vorgetragen und der Sohn der Fürstin ausnahmsweise als Leutnant in die Garde, in das Semenowsche Regiment aufgenommen. Aber trotz aller Anstrengungen seiner Mutter wurde Boris nicht Adjutant von Kutusow. Einige Zeit nach der Soiree kehrte die Fürstin nach Moskau, zu Rostows, ihren reichen Verwandten, zurück, wo sie sich immer aufhielt. Hier hatte ihr kleiner angebeteter Boris den größten Teil seiner Kindheit verlebt. Die Garde hatte Petersburg am 10. August verlassen, und der junge Mann, der in Moskau durch die Equipierung aufgehalten wurde, sollte sie in Radsiwilow einholen.
Es war ein Fest bei Rostow, man feierte den Namenstag der Mutter und der jüngsten Tochter Natalie. Eine lange Reihe Wagen brachte eine Menge Besucher nach dem Hause in der Pawarskajastraße. Die Gräfin empfing sie mit ihrer älteren Tochter, einem hübschen Mädchen, im Salon.
Die Mutter war eine Frau von fünfundvierzig Jahren, mit orientalischem Typus, magerem Gesicht und augenscheinlich etwas erschöpft durch die zwölf Kinder, die sie ihrem Manne geschenkt hatte. Ihre lässigen Bewegungen und langsames Sprechen, welche von ihrer Schwachheit herkamen, verliehen ihr ein imposantes Wesen. Die Fürstin Drubezkoi war bei ihr und half als Familienmitglied die Gäste zu empfangen und das Gespräch zu unterhalten. Die jungen Leute, denen nichts daran lag, an dem Empfang teilzunehmen, hielten sich in den inneren Zimmern auf. Der Graf ging den Ankommenden entgegen und lud sie alle zu Tisch ein.
»Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar, ma chére oder mon cher«, sagte er unabänderlich zu jedem, zu Niedrigstehenden so gut wie zu Höherstehenden, »ich sage Ihnen meinen Dank im Namen derjenigen, deren Namensfest wir feiern. Sie werden unfehlbar zum Diner kommen, nicht wahr? Sonst würden Sie mich beleidigen, mon cher. Ich bitte Sie, mit Ihrer ganzen Familie zu kommen, ma chére.« Er wiederholte genau dieselben Worte bei jeder Einladung und begleitete sie genau mit demselben Gesichtsausdruck. Darauf folgte dann Händedrücken und wiederholte Begrüßung. Nachdem er von den Abfahrenden sich verabschiedet, kam er zu denen zurück, die noch blieben, schob sich einen Lehnstuhl herbei, stellte die Beine vor sich und stützte die Hände auf die Knie. Bald wandte er sich rechts, bald links, wie ein Mann, der Lebensart zu besitzen glaubt. Der Diener der Gräfin erschien an der Tür und meldete mit seiner Baßstimme: »Maria Lwowna Karagin!«
Die Gräfin überlegte einen Augenblick, indem sie aus einer goldenen Tabaksdose eine Prise nahm.
»Mein Gott, wie diese Besuche mich erschöpft haben! Und nun noch diese; sie ist so langweilig! Ich lasse bitten, einzutreten!« rief sie traurig dem Diener zu, als ob sie sagen wollte: »Oh, das wird mein Ende sein!«
Eine große, starke Dame mit hochmütiger Miene trat in den Salon, in Begleitung eines jungen Mädchens mit rundem und lachendem Gesicht. Man hörte das Rauschen ihrer Schleppkleider.
»Teuerste Gräfin! … Wie lange schon!… Sie hat zu Bett gelegen, das arme Kind … auf dem Ball bei Rasumow und der Gräfin Apraxin… ich war so glücklich!«
Diese Höflichkeiten in abgebrochenen Sätzen mischten sich mit dem Rauschen der Kleider und dem Geräusch der herbeigerückten Stühle. Dann ging die Unterhaltung wohl oder übel vor sich, bis zu dem Augenblick, wo man bei einer ersten Pause sich mit Anstand erlauben konnte, die Sitzung aufzuheben und Abschied zu nehmen mit den stereotypen Redensarten: »Je suis bien charmée«, – »la santé de maman«, – »la comtesse Apraxine.«
Die Krankheit des alten Grafen Besuchow, eines der schönsten Männer der Zeit Katharinas, diente zum Stoff der Unterhaltung. Man sprach sogar auch von seinem natürlichen Sohne Peter, demselben, der sich auf der Soiree von Fräulein Scherer so ungeschickt benommen hatte.
»Ich beklage wirklich den armen Grafen«, sagte Madame Karagin, »seine Gesundheit ist so schwach, und einen Sohn zu haben, der ihm solchen Kummer macht!«