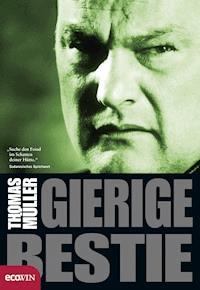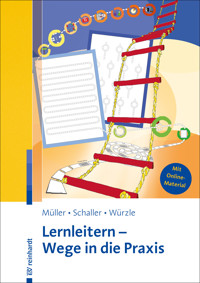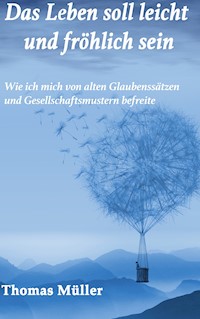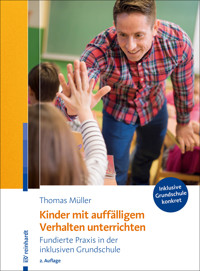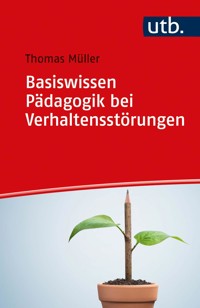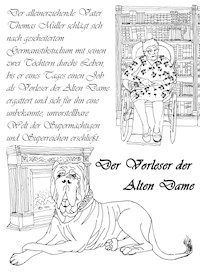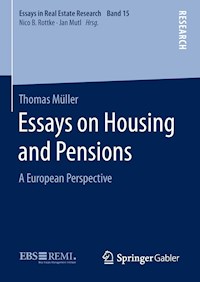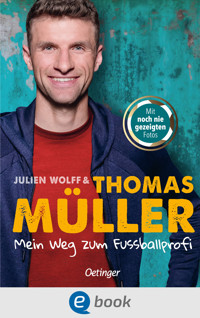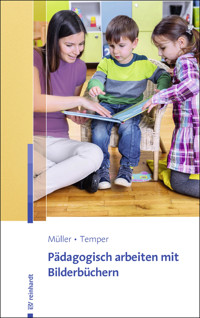Geschichte und Geschichten: Zu Hans Magnus Enzensbergers »Der kurze Sommer der Anarchie« E-Book
Thomas Müller
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Universität des Saarlandes (Neuere Deutsche Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Hans Magnus Enzensberger, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Textgattung des "Kurzen Sommers der Anarchie" und zeichnet den Diskurs nach, der sich um die Frage ergab, ob es sich wirklich um einen Roman oder nicht doch um eine Dokumentation handelt. Dazu wird der Fiktionsdiskurs der sechziger Jahre nachvollzogen, um die erzähltechnischen Hintergründe für die Bewertung zu klären. Anschließend wird der Text als Roman analysiert und Probleme sowie abweichende Interpretationen des Textes dargestellt. Abschließend werden metahistorische Aspekte des Werkes beleuchtet und die Frage geklärt, welches Geschichtsbild hinter dem Roman steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 2
1 Einleitung
Weil es also ein anderer ist,
immer ein anderer, der da redet, und weil der, von dem die Rede ist, schweigt.1
Die Hegemonie des Autors ist zu brechen; nicht weit genug kann der Fanatismus der Selbstverleugnung getrieben werden. Oder der Fanatismus der Entäußerung: ich bin nicht ich, sondern die Straße, die Laternen, dies und dies Ereignis, weiter nichts.2
Nein, Hans Magnus Enzensberger hat nicht seinen „ersten Roman“ geschrieben, wie er oder sein Verlag oder beide uns jetzt weismachen wollen. Er hat aus dem Stimmengewirr der Augenzeugen und Zeitgenossen das Leben des spanischen Anarchisten Buenaventura Durruti zusammengestzt […]3
Wenn man wollte, könnte man durchaus in der gleichen Form über EnzensbergersDer kurze Sommer der Anarchieschreiben, wie Enzensberger den Roman geschrieben hat. Das liegt besonders an der Tatsache, dass sein erster Roman für Unsicherheit in der literarischen Fachwelt sorgte und über einen langen Zeitraum Fragen offen ließ - so liegt heute Material über das Buch vor, das ähnlich kontrovers und widersprüchlich ist wie die Dokumente über den Protagonisten des Werkes. Die Fragen, die dabei gestellt wurden, waren allerdings fast immer die gleichen: Warum montiert Enzeneberger eine Collage von Aussagen über einen spanischen Anarchisten, der scheinbar keine politische Relevanz mehr hat, und warum nennt er diese dann auch noch einen Roman?
Hier scheint ein Konflikt zwischen zwei Ansichten vorzuliegen, was ein Roman sein sollte und wie er auszusehen hat. Ein weiterer Grund für die Tatsache, dass der Roman oft als Dokumentation aufgefasst wurde, ist auch in der Entstehungsgeschichte zu finden: Enzensberger sammelte die Berichte, Interviews, Zeugenaussagen etc. tatsächlich für eine Dokumentation, nämlich für
1 Enzensberger (1989), S. 321.
2 Döblin (1963), S. 18. 3 Baumgart (1972), S. 194.