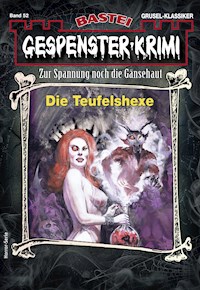1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Jojakim warf die leere Flasche in hohem Schwung ins Wasser. Dazu rülpste er laut. Torkelnd bewegte er sich auf dem betonierten Deich entlang. Er blinzelte zum Mond hinauf und sah ihn doppelt.
"Mist", knurrte er. Er bemerkte nicht, wie sich hinter ihm eine Gestalt im Wasser aufrichtete.
Plötzlich stolperte Jojakim. Er schlug der Länge nach hin und bewahrte sich im allerletzten Augenblick davor, von der Schräge ins Wasser zu rollen. Doch noch ehe er sich von dem feuchten Betonboden aufrichten konnte, legten sich kräftige, lange, vom Meerwasser ausgelaugte Hände um seinen Hals ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Monster aus der Tiefe
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-7303-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Das Monster aus der Tiefe
von Rebecca LaRoche
Jojakim warf die leere Flasche in hohem Schwung ins Wasser. Dazu rülpste er laut. Torkelnd bewegte er sich auf dem betonierten Deich entlang. Er blinzelte zum Mond hinauf und sah ihn doppelt.
Jojakim hatte Elis, dieses schlampige Frauenzimmer, tüchtig verprügelt. Richtig gut hatte es ihm getan, sie einmal seine Kraft fühlen zu lassen. Dann hatte er das windschiefe Fischerhaus verlassen und sie blutüberströmt am Boden liegen lassen.
Zum Kotzen war das Leben. Jojakim stierte vor sich hin. Die Arbeit hatte er verloren, weil er dauernd betrunken war. Und Elis, seine Frau, war einen Dreck wert. Die Kinder waren groß, aber sie wollten von ihm nichts mehr wissen. Und deshalb hatte er zu saufen angefangen. Es war ein idiotisches Karussell, von dem man nicht abspringen konnte.
»Mist«, knurrte er. Er bemerkte nicht, wie sich hinter ihm eine Gestalt im Wasser aufrichtete.
Plötzlich stolperte Jojakim.
Er schlug der Länge nach hin und bewahrte sich im allerletzten Augenblick davor, von der Schräge ins Wasser zu rollen.
Doch noch ehe er sich von dem feuchten Betonboden aufrichten konnte, legten sich kräftige, lange, vom Meerwasser ausgelaugte Hände um seinen Hals.
»Was – was ist das …?«, röchelte Jojakim …
Er sah in ein schaurig grinsendes Gesicht. Breite Nasenflügel blähten sich über einem fratzenähnlichen Mund mit scharfen Schneidezähnen. Jojakim roch scharfen Seetang, spürte die mordenden Hände an seiner Kehle, und ächzte: »Loslassen, verdammt!«
Jojakim vernahm ein Geräusch, das eine Mischung aus dem Wutgebrüll eines Raubtieres und dem Schrei einer Möwe war. Sekundenlang nur musste er an das Gespenst von Kroyenkoog denken, von dem man sich im Dorf erzählte.
Er hatte nie daran geglaubt. Jojakim hatte die alten Weiber – allen voran die geschwätzige Notburga Levin – immer ausgelacht. »Gespenster gibt es nur in eurer Einbildung«, hatte er gespottet. »Das ganze Weiberpack braucht immer was, wovor es sich fürchten will.«
Und die Männer in der Schenke hatten ihm recht gegeben.
Schlagartig wurde Jojakim nüchtern. In der Todesangst verlor der Alkohol seine Wirkung.
»Ihr werdet alle umkommen … alle«, hörte er eine Stimme sagen, die kaum menschenähnlich klang.
»Aber …« Er wollte protestieren, doch die langen Finger um seinen Hals schlossen sich fester zusammen.
Jojakim röchelte, ächzte, versuchte die Finger an seinem Hals auseinander zu biegen, aber vergebens. Immer weiter zerrte das Monster ihn ins Wasser.
Sekundenschnell verengte sich sein Hals. Das Ungeheuer, das ihn mit den Knien in das niedrige Wasser niederdrückte und ihn immer fester würgte, presste das letzte Quäntchen Atem aus seinem Körper. Als es keine Gegenwehr mehr spürte, ließ es von Jojakim ab.
»Alle werden umkommen«, wiederholte das Monster. Langsam stieg es den Deich hinauf bis zu dessen höchsten Stelle.
Es starrte hinunter zu den strohbedeckten Dächern dicht hinterm Deich. Sie hatten vor vierundzwanzig Jahren, als der alte Deich brach und die heranflutenden Wassermengen das Dorf Kroyenkoog unter sich begruben, einen neuen gebaut. Größer, höher als die vorigen. Er sollte das Dorf Thadminnen abschirmen vom Meer. Und er hatte vierundzwanzig Jahre lang gehalten.
Thadminnen lag tiefer als der Wasserspiegel in der Bucht, ebenso wie einst Kroyenkoog. Kroyenkoog war jetzt auch bei Ebbe nicht mehr sichtbar. Es war ein verlorenes Dorf, untergegangen und vergessen, einst erbaut im heidnischen Götzenkult an dieser ungünstigen Stelle, die viel tiefer lag als der Meeresspiegel.
Das Monster ging zurück, packte Jojakims Körper und warf ihn sich über die Schulter.
Wie es dort stand, den Toten geschultert wie ein Stück Vieh, sah es zum Fürchten aus. Über dem fast nackten, stark behaarten, grünlich schimmernden Körper lag eine dicke Schicht Seetang. Im Haar des Monsters wucherte üppiges Laichkraut. Der strenge Fischgeruch, der dem Ungeheuer anhaftete, ließ den Eindruck aufkommen, einen seltenen Meeresbewohner vor sich zu haben.
Das Seeungeheuer war aus den Fluten entstiegen und hatte sich ein neues Opfer geholt.
✞
»Nein!« Jobst Sylbitz’ Faust schlug auf den Tisch. »Ich wünsche nicht, dass diese Dummheiten unter meinem Dach ausgesprochen werden. Seeungeheuer! Meeresgespenst! Dass ich nicht lache! Hat jemand schon dieses Monstrum gesehen, he?«
Noel Paschwitz, der Bürgermeister von Thadminnen, seufzte. »Das nicht, Jobst, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es seine Finger im Spiel hatte.«
»Und so sprichst du, eine Amtsperson? Ein erwachsener Mann?« Sprachlos blickte Jobst Sylbitz über den Tisch hinweg auf den verstörten Mann. »Aber ich weiß schon, warum du solchen Unfug sprichst, deine Frau hat dir die Hölle heiß gemacht, wie?«
»Stella hat kein Sterbenswörtchen gesagt!«, behauptete Paschwitz. »Aber das ganze Dorf spricht von Jojakims Verschwinden.«
»Er wird sich ein Boot genommen haben und weggerudert sein. Es war Ebbe«, murmelte Jobst Sylbitz. »Das schlechte Gewissen hat ihn fortgetrieben. Elis hat er halb totgeprügelt. Er war wieder einmal stinkbesoffen, Noel. Und hinterher hat er das heulende Elend gekriegt. Ist es ein Wunder? Nein. Bei Säufern findet man das häufig. Sie bereuen ihre Tat und begehen irgendeine Kurzschlusshandlung.«
»Draußen steht die alte Notburga«, erwiderte Noel Paschwitz. »Hör sie dir an, Jobst. Sie hat eine seltsame Theorie aufgestellt.
»Notburga!«, stieß Jobst Sylbitz verächtlich hervor. »Ein altes Waschweib, das aus den Handlinien liest, alle Frauen im Dorf mit ihrem Gewäsch verrückt macht und herumtönt, dass sie aus ihrem Urin genau erkennen kann, wann ein Sturm aufkommt und die Fischer nicht hinausfahren dürfen. Hat man jemals eine dümmere Person als Notburga Levin gesehen?«
»Hör doch an, was sie sagt«, bettelte der Bürgermeister. »Wirklich, du als reichster Mann von Thadminnen solltest deine Ohren nicht vor dem Gerede der Leute verschließen.«
»Ich denke nicht daran. Ich kann die alte Krähe nicht ausstehen.«
»Aber was sie sagt, hat unmittelbar mit dir zu tun.«
»Mit mir?«
»Ja. Darf ich sie reinholen, Jobst?«
»Zum Teufel, ja. Was habe ich eigentlich mit der ganzen Geschichte zu tun, he?«
Noel Paschwitz eilte zur Tür und riss sie auf. »Komm herein, Notburga.«
Die weißhaarige Alte, die hereinschlurfte, hielt den Blick gesenkt. Sie hatte mit ihrer vorspringenden Nase und dem fliehenden Kinn wirklich Ähnlichkeit mit einer Krähe.
Sie blieb dicht vor Jobst Sylbitz stehen, sodass dieser angewidert einen Schritt zurücktrat.
»Raus mit der Sprache, Notburga«, knurrte er. »Was für ein Ammenmärchen saugst du dir jetzt wieder aus den ungewaschenen Fingern?«
»Kein Ammenmärchen, Herr Sylbitz.«
»Was sonst?«
»Die Wahrheit, Herr Sylbitz.«
»Die Wahrheit, Herr Sylbitz!«, äffte er sie nach. »Rede endlich, sonst jag ich dich zum Teufel.«
Notburga hob den Blick. Sie hatte schwarze Nadelknopfaugen, die wie Tollkirschen schillerten. »Der Teufel«, sprach sie mit singender Stimme, »lebt im Wasser und ist das Seeungeheuer. Und ich weiß auch, wer es ist.«
Jobst Sylbitz verschränkte die Arme vor der Brust. »So, du weißt, wer es ist. Das Seeungeheuer hat wohl einen Namen, wie?«
»Gewiss, Herr Sylbitz.« Die alte Notburga senkte den Blick. »Es heißt Barnabas Sylbitz.«
Unmerklich fuhr Jobst Sylbitz zurück.
»Wie kommst du dazu …«
»Doch, Herr Sylbitz«, beharrte Notburga. »Barnabas, Ihr Bruder, lebt. Er wohnt im versunkenen Dorf Kroyenkoog in Ihrem alten Elternhaus von einst. Und er hat in der vergangenen Nacht Jojakim ermordet und in die Tiefe gezogen.«
»Barnabas ist tot. Seit vierundzwanzig Jahren. Weißt du nicht, wie er damals aufs Meer hinausfuhr und nie mehr zurückkehrte?«
»Sie haben nie seine Leiche gesehen, Herr Sylbitz.«
»Das Meer«, blaffte Jobst Sylbitz, »gibt seine Opfer nicht immer zurück. Sein Körper kann sich in einem Riff verfangen haben und nie wieder an die Oberfläche kommen.«
»Barnabas lebt, Herr Sylbitz«, beharrte die alte Frau. »Ich habe es geträumt.«
»Geträumt«, höhnte Jobst. »Und auf die Träume einer alten Schwätzerin soll ich wohl gar etwas geben, wie?«
»Es ist wahr. Ich kann mich auf meine Träume bei Neumond verlassen. Sie sagen stets die Wahrheit. Barnabas lebt. Und er sinnt auf Rache, Herr Sylbitz.«
»Rache? Wofür sollte er sich wohl rächen?«
»Sie haben ihm damals die Braut weggenommen. Das vergisst Barnabas niemals.«
»Barnabas ist tot. Und ich habe ihm damals Colette ausgespannt …« Jobsts Gesicht verzerrte sich. Er bekam plötzlich einen Lachkrampf. Sein feistes Gesicht lief rot an. »Colette …«, keifte er, »wegen Colette soll er sich rächen? Dann weiß er nicht, dass sie seit Abels Geburt bettlägerig ist. Ich habe eine kranke Frau seit zweiundzwanzig Jahren …« Er rang nach Luft. »Barnabas hätte sie ruhig behalten können. Und dafür will er sich rächen?«
»Dafür will er sich rächen«, sagte Notburga mit metallischer Stimme.
Dem Bürgermeister lief ein Angstschauer über den Rücken. Wie konnte Notburga so sicher sein, dass Barnabas lebte?
»Man hat auf dem Deich im dünnen Dünengras Spuren gefunden«, mischte sich Noel Paschwitz jetzt ein. »Zwei gewaltige Fußabdrücke mit Krallen – und sie verloren sich im Wasser.«
»Barnabas hat zwar immer gut schwimmen können«, höhnte Jobst Sylbitz, »aber unter Wasser leben kann er nicht. Und Krallen hat er auch nie gehabt. Vielleicht war es irgendein Tier?«
»Ein zweibeiniges Tier, Jobst?«, fragte der Bürgermeister. »Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Lasst mich, zum Teufel, mit diesem blöden Kram zufrieden«, schrie Jobst sie an. »Haut ab, damit ich eure Visagen nicht mehr sehen muss. Barnabas soll leben? Pah, hat jemand schon solche Idiotie gehört? Wo soll er denn vierundzwanzig Jahre lang gelebt haben, wie? Sind ihm vielleicht inzwischen Krallen gewachsen?«
»Ja«, flüsterte Notburga.
»Schaff sie mir vom Hals«, brüllte Jobst Sylbitz den Bürgermeister an, »sonst vergesse ich mich.«
Stumm packte Bürgermeister Noel Paschwitz Notburgas Hand und zog sie zur Tür.
Sie drohte Jobst Sylbitz mit der Faust. »Eines Tages werden Sie einsehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe, als ich Sie warnte«, rief sie schrill.
Jobst Sylbitz packte eine Bierflasche, die auf dem Tisch stand, und schmetterte sie in Richtung Tür.
Doch der Bürgermeister hatte die alte Frau längst hinausgezogen und die Tür zugeworfen. Die Bierflasche prallte gegen die Türfüllung und zerbrach in viele Scherben.
Jobst Sylbitz ließ einen lauten Fluch hören. Sein Atem ging rasselnd.
Barnabas! Sein Schatten war wieder da, heraufbeschworen von der törichten alten Notburga.
Barnabas’ Körper befand sich irgendwo auf dem Meeresgrund, in vierundzwanzig Jahren zerfressen von Fischen, zerstört vom salzigen Wasser. Sicher hing noch sein Skelett in einem Riff, nicht mehr erkennbar als Barnabas Sylbitz.
Und dort sollte es auch bleiben bis in alle Ewigkeit.
✞
Wie ein Hai schoss er durch das grünlich-milchige Wasser, vorbei an dem Kirchturm, an den steinernen Häusern und dem alten Spritzenhaus von Kroyenkoog.
Bei einem Haus hielt er an, stemmte die Tür auf und steckte den Kopf durch die Öffnung ins Hausinnere.
Der tote Körper von Jojakim schwamm oben an der Decke des ehemals prächtigsten Hauses von Kroyenkoog, ebenso wie ein paar Knochenskelette.
Das Monster zog die Tür wieder zu. Es musste sich beeilen, wieder in seinen Unterschlupf zu kommen.
Kein Fischer von Thadminnen fuhr jemals mit seinem Boot nach Osten aufs Meer hinaus. Barnabas hatte früh genug dafür gesorgt, dass alle Bürger von Thadminnen fürchteten, genau wie Hein und Titus damals vor zweiundzwanzig Jahren zu ertrinken. Hein und Titus waren auch Fischer gewesen. Und sie waren nach Osten aufs Meer gefahren und nie mehr wiedergekommen.
Zwei Jahre lang hatte Barnabas damals die Sandbank in Höhe des Deichs ausgehöhlt und sich mit Steinen eine Ruine gebaut. Dort war er sicher. Niemand ahnte, dass die Sandbank hohl war und ein großes Luftloch hatte, durch das er genügend Atem schöpfen konnte.
Dort hielt sich Barnabas auf und sann auf Rache.
Vierundzwanzig Jahre lang arbeitete er pausenlos an seinen Racheplänen. Aus Wut über den Betrug Colettes damals und die Gemeinheit seines Bruders Jobst hatte Barnabas den alten Deich zerstört und dafür gesorgt, dass Kroyenkoog im Meer versank.
Achtundzwanzig Dorfbewohner waren in den Fluten umgekommen.
Jobst Sylbitz aber und Colette hatten sich retten können. Colette war damals Wöchnerin gewesen und hatte gerade ihren Sohn geboren. Zweiundzwanzig Jahre war das jetzt her.
Immer wieder war Barnabas aus dem Meer gekrochen und hatte sich ein Opfer geholt. Er wusste, dass die Angst vor ihm immer neue Nahrung bekommen musste.
Das Entsetzen musste sich steigern. Das Dorf musste vor Furcht vor ihm zittern.
Barnabas, der Totgeglaubte, tyrannisierte das ganze Dort.
Auch Thadminnen würde eines Tages in den Fluten versinken.
Der Zeitpunkt war gar nicht mehr fern. In jahrelanger Arbeit hatte Barnabas in den neuen, hohen Deich eine Höhle gegraben. Der Deich – er hatte eine betonierte Oberschicht – würde bei der nächsten Sturmflut brechen. Und dann gab es für keinen Einwohner von Thadminnen mehr eine Rettung.
Vor allem Jobst Sylbitz würde daran glauben müssen, und Colette, die Treulose, mit ihrem Sohn Abel.
Über Barnabas’ hässliches Gesicht zuckte ein böses Grinsen. Erst dann würde sein Lebenswerk erfüllt, seine Rache vollendet sein.
Barnabas presste sein Gesicht gegen die Scheibe. Er sah die Fische dicht vor seinen Augen vorbeischwimmen.
Er schlüpfte aus seiner Ruine, tauchte ins Meer ein, streckte die Hand aus und fing einen jungen Seelachs.
Dann kehrte er in die Ruine zurück, betrachtete den zappelnden Fisch, streckte die Hand flach aus und versetzte ihm damit einen Schlag gegen den Kopf. Der Schwanz zuckte noch, da riss Barnabas dem Lachs den Kopf ab und versenkte die langen Schneidezähne in dem rohen Fischfleisch.
Schmatzend verzehrte Barnabas seine Mahlzeit. Die Gräten zog er genüsslich durch seine Zähne. Dann warf er sie hinter sich auf den Haufen, wo schon viele andere Reste von früheren Mahlzeiten lagen.
Barnabas legte sich zurück und schloss die Augen.
Zeitweise vergaß er seinen Nachnamen.
Er kannte dann nur noch die Vornamen der drei Menschen, an denen er sich rächen wollte:
Colette.
Jobst.
Abel.
Ja, auch Abel, den Sohn der beiden Meistgehassten.
Zweiundzwanzig Jahre war er alt, und er würde eines Tages Herr über allen Besitz sein, der damals Barnabas hätte gehören sollen.
Sie haben mir nicht einmal einen Gedenkstein im Friedhof errichtet, obwohl sie denken, ich wäre im Meer ertrunken, dachte er.
Egal. Sie werden es büßen. Es dauert nicht mehr lange.
Über die grausamen Augen senkten sich wimpernlose Lider. Barnabas schlief immer bei Tage.
Nachts war Barnabas, das Monster, unterwegs in Thadminnen.
Nachts gehörte Thadminnen ihm. Keine Tür war vor ihm sicher. Er trat in die Häuser und an die Betten der Schlafenden. Er betrachtete sie.
Und er stellte sich vor, wie dieses Dorf von wilden Meereswogen erfasst und untergehen würde.
Das waren die Höhepunkte in seinem Leben. Diese Träume konnte ihm keiner nehmen.
✞
Felicia Rajock war ein blondes, achtzehnjähriges Mädchen. Das schönste im Ort. Ihr Vater, ein pensionierter Oberst, achtete darauf, dass sie stets um acht Uhr abends zu Hause war.
Hätte er gewusst, dass sie tagsüber hin und wieder mit dem jungen Abel Sylbitz schüchterne, flehende Blicke wechselte, hätte sie vermutlich Hausarrest bekommen.
Felicia wurde strenger gehalten als eine Klosternovizin.
Hadwin Rajock glaubte, dass alle Männer unter dreißig Jahren im Dorf nichts anderes ersehnten, als Felicia zu verführen. Deshalb musste sie dunkelgraue hochgeschlossene Kleider tragen, die die Waden noch bedeckten, und hatte das strenge Gebot, beim Einkaufen und Spazieren gehen im Dorf kein Wort mit fremden Männern zu wechseln.
Obwohl Felicias schimmerndes blondes Haar unter einem Wolltuch verborgen war, ahnte Abel Sylbitz, wie schön sie war. Er hatte genug Fantasie, sich vorzustellen, wie sie ohne diese hässlichen Kleider aussehen würde.
Außerdem hatte er sie einmal im Dämmerschein beim Bad im Meer beobachtet. Sie war mit drei Freundinnen der Flut entgegengelaufen und hatte sich mit lautem Jauchzen in die hohen Wellen geworfen.
Ein schöneres Mädchen als Felicia gab es nicht in Thadminnen und nicht auf der ganzen, weiten Welt.
Abel Sylbitz war sehr erfindungsreich, wenn es galt, Felicia zu treffen. Ging sie in die Gärtnerei, um Gemüse zu kaufen, tauchte er unvermutet auf und sah sie still und bewundernd an. Im Kramladen von Thadminnen stand er auf einmal hinter ihr. Er hätte nur den Arm ausstrecken müssen, um sie zu berühren, doch er wagte es nicht.
Abends, wenn alles dunkel war und die Leute die Lichter in ihren Häusern einschalteten, strich er um das Haus von Hadwin Rajock und versuchte, einen Blick ins Innere des Hauses zu tun.
Hadwin Rajock aber hatte Felicia angewiesen, sobald es dämmerte, alle Vorhänge zu schließen.
Erst dann durfte sie das Tuch vom Kopf nehmen und ihr goldenes Haar offen tragen.
Auch heute Abend stand Abel Sylbitz wieder am Zaun hinter einer Immergrün-Hecke und starrte zum Haus hinüber.
Eine Katze strich um seine Beine. Abel bemerkte es nicht. Auf einmal vernahm er neben sich eine Stimme. Abel erschrak und fuhr herum.
Notburga Levin, die alte Schwätzerin, stand neben ihm.
»Nun?«, schmatzte sie. »Willst wohl die kleine Felicia verführen, he? Das gelingt dir nicht. Der alte Rajock hat eine geladene Flinte im Haus.«
»Schweig, Notburga. Was geht es dich an?«
»Nicht so hochmütig, junger Herr«, lautete Notburgas Antwort. »Weißt du, warum Rajock so ist? Warum er sich benimmt wie der dreiköpfige Zerberus, der wütend den Eingang zur Hölle bewacht?«
Abel schwieg. Es gefiel ihm nicht, dass die Klatschbase aus dem Dorf hinter sein Geheimnis gekommen war. Bald würde ganz Thadminnen darüber lachen.
»Ich will es dir verraten«, fuhr Notburga fort. »Hadwin Rajock ging einst mit deinem Onkel Barnabas in dieselbe Dorfklasse. Sie saßen nebeneinander auf einer Bank.«
»Mit Onkel Barnabas?« Abel staunte. »Wirklich?«