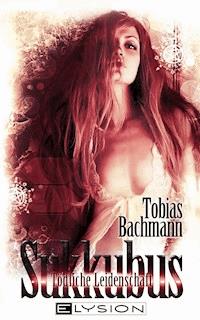1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Geist
Ich bin nicht verrückt. Nicht mehr.
Ich war es. Viele Jahre lang. Solange ich in der Anstalt eingesperrt war, war ich verrückt. Diagnose: Schizophrenie mit dialogisierenden akustischen Halluzinationen. Doch kaum habe ich es geschafft, der Anstalt zu entkommen, bin ich geheilt. Verdammt noch mal. Ich will nicht geheilt sein. Will wieder krank sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Geist
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8317-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Geist
von Tobias Bachmann
»Ein Geist geht um in Deutschland …«
Geisterstimmen
Ich bin nicht verrückt. Nicht mehr.
Ich war es. Viele Jahre lang. Solange ich in der Anstalt eingesperrt war, war ich verrückt. Diagnose: Schizophrenie mit dialogisierenden akustischen Halluzinationen. Doch kaum habe ich es geschafft, der Anstalt zu entkommen, bin ich geheilt. Verdammt noch mal. Ich will nicht geheilt sein. Will wieder krank sein …
Ich sehne mich nach meinen Tabletten, den täglichen Sitzungen mit meinem Psychiater, Doktor Voss. Für den Klinikfraß würde ich sterben.
Schaler Kaffee ohne Koffein.
Das Lallen meiner Mitpatienten. Das herrische Auftreten mancher Pfleger. Doktor Voss natürlich. Und – wie sehne ich mich nach ihr: Schwester Gisela.
Schwester Gisela war die Blüte des gesamten Klinikpersonals. Sobald sie Dienst hatte, ging die Sonne in meinem Herzen auf. Schwester Gisela war eine Wucht. Nicht nur vom Aussehen her. Die ganze Art und Weise wie sie mich und meine Mitinsassen behandelte – mit Respekt und, wie ich mir einredete: Liebe. Schwester Gisela gab uns die Zuneigung, die wir von keinem Menschen mehr erwarteten. Und ich spreche hier nicht von sexuellen Aufwartungen. Dergleichen hätte sie nie getan – und sie hatte es auch nicht nötig gehabt (wir hingegen schon, aber das änderte nichts). Schwester Gisela war einfach die gute Seele der Anstalt.
Doch das ist alles lang her. Viel ist passiert.
Jetzt befinde ich mich in einem U-Bahn-Schacht. Ich kann nicht behaupten, mich hier wohlzufühlen, aber hier unten ist es nicht ganz so schlimm wie auf der Erdoberfläche. Scheinbar verirren sich diese … diese Irren … nur selten hier hinunter.
Da gibt es einen Raum, den ich entdeckt habe. Es war wohl mal eine Art Überwachungsraum des Sicherheitspersonals der Verkehrsgesellschaft. Durch ein Fenster kann ich den Bahnsteig bis hinter zu den Rolltreppen überblicken. Monitore, die von einem unabhängigen Generator betrieben werden, geben mir den Überblick über den kompletten Bahnhof. Eine Art Notlicht hat hier alles in diffus mattes Rot getaucht. Es ist gespenstisch hier unten, aber sicher.
Hier kann ich schlafen. Essen. Leben. Das Gefährlichste ist der Weg nach oben. Die Suche nach neuer Nahrung. Noch habe ich zwei Dosen Ravioli. Schmecken kalt fast genauso scheußlich wie der Klinikfraß, nach dem ich mich so sehr sehne.
Während ich mich ausruhe, schreibe ich. Das Schreiben hilft. Falls ich draufgehen sollte, findet das vielleicht mal wer und kann sich darauf einen Reim machen. Oder auch nicht. Eigentlich egal.
Mir hilft es. Selbst der Gedanke, dass ich vielleicht bald schon tot bin, aber die Welt an sich überlebt und wieder normal wird, beruhigt mich. Deswegen versuche ich, die Gedanken, die Erinnerungen und Geschehnisse ein wenig zu ordnen. Vielleicht hilft es mir, wieder zurückzufinden. Zurück in die Anstalt. Zurück in meinen Kopf. Mit etwas Glück schaffe ich es, allein durch die Aufbereitung meiner Erinnerung, meine psychische Erkrankung erneut ausbrechen zu lassen.
Das klingt verrückt, denken Sie? Das ist es natürlich auch. Aber wissen Sie was? Zum einen bin ich das eh, und zum anderen kann es helfen, in einer Welt wie dieser zu überleben.
Als ich mich noch in der Sicherheit der Anstalt befand, war das natürlich anders. Die Schizophrenie galt dort als mein Problem. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich zum Wahnsinnigen werden ließen.
Ich weiß noch, wie ich in einem Moment der Klarheit in meinem Zimmer in der Anstalt erwachte, meine verschwommene Fratze in der Spiegelfolie an der Wand betrachtete, (echte Spiegel waren uns aus Gründen des Selbstschutzes nicht gestattet) und mir mit einem Mal klar wurde, dass ich verrückt war. Irre. Durchgedreht. Wahnsinnig. Ich hörte Stimmen, verdammt! Stimmen, die mir sagten, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Stimmen, auf deren Anweisungen und Befehle ich gehorchte. Stimmen, die mir wohlvertraut waren, denn ich hörte sie schon seit meiner Kindheit. Seit mein Vater vor meinen Augen von meiner Mutter mit einem Messer erstochen wurde, kurz bevor sie sich selbst die Kehle durchschnitt.
»Was für Stimmen sind das denn?«, wollte Doktor Voss immer von mir wissen.
»Sie sind nett. Seltsam vertraut.«
»Wie vertraut sind Ihnen die Stimmen?«
Ich zuckte mit den Schultern, blähte die Backen auf. »Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll.«
»Sind es die Stimmen von Freunden? Von Bekannten oder Verwandten? Oder anonyme, fremde Stimmen, die Ihnen nur durch ihre ständige Gegenwart vertraut erscheinen?«
»Ah, darauf wollen Sie hinaus. Nein, es sind nicht die Stimmen meiner Eltern, falls Sie das meinen.«
»Ich meine gar nichts, Herr Geist«, sagte Doktor Voss und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Ich stelle nur die Fragen. Die Antworten müssen Sie schon selbst geben. Sind die Stimmen denn jetzt gerade bei Ihnen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie sind nicht immer da.«
»Wie viele sind es?«
»Zwei.«
»Und sie unterhalten sich mit Ihnen oder untereinander?«
»Mal so, mal so«, sagte ich. »Vielleicht haben Sie recht. Es sind zwei Freunde. Gesichtslose Freunde. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Es ist, als hätte ich Kopfhörer im Ohr, angeschlossen an ein Handy, und führe eine Konferenzschaltung. Die beiden unterhalten sich, und ich mich mit ihnen. Manchmal haben wir auch Spaß miteinander. Hin und wieder streiten wir aber auch.«
»Können Sie den Stimmen ein Geschlecht zuordnen?«
»Nein.«
»Haben die Stimmen Namen?«
»Auch nicht.«
»Empfinden Sie eine der Stimmen als dominanter als die andere?«
Ich lachte kurz auf. »Das ist witzig, dass Sie das sagen. Wissen Sie: Normalerweise erkenne ich bei den beiden keine Hierarchie. Aber vor ein paar Tagen, da stritten sie sich genau deswegen miteinander. Sie wollten von mir wissen, wen ich lieber mochte. Ich sagte, ich würde keinen von beiden bevorzugen, aber mit dieser Antwort waren sie nicht zufrieden. Jeder stellte sich als besser dar. So als buhlten sie um meine Liebe. Ist es nicht seltsam, dass man die Stimmen in seinem Kopf lieben soll?«
»Wann war das?«
»Am Freitag. Als man mich hierher brachte.«
»Meinen Sie, die Stimmen haben Angst, dass sie verschwinden müssten?«
»Vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie gehen wollen. Ich glaube, sie fühlen sich ganz wohl in mir.«
»Weshalb glauben Sie, dass Sie diese Stimmen hören?«
»Meiner Theorie nach sind es zwei Geister, die sich aus irgendwelchen Gründen in meinem Kopf eingenistet haben. Sie wollen nicht ins Totenreich, sondern hier bei mir, am Leben teilhaben. Wie sie in meinen Kopf hineingekommen sind, weiß ich nicht. Aber es ist nicht so, dass ich mich unwohl mit den Stimmen fühlen würde.«
»Aber die Stimmen hindern Sie daran, ein normales Leben zu führen.«
»Ja, das kann man wohl sagen. Wenn ich alleine bin, ist alles gut. Aber arbeiten oder einkaufen … das geht gar nicht.«
Das Anamnesegespräch mit Doktor Voss zog sich auf diese Weise schier endlos in die Länge. Aber es war ein interessantes Gespräch. Ich spürte, dass dieser Doktor Voss ernsthaft an mir und an meiner Geschichte interessiert war. Er verteufelte die Stimmen in meinem Kopf nicht. Mit keiner Silbe sagte er, dass er mich für verrückt halte, oder dass es nicht normal sei, Stimmen zu hören. Im Gegenteil: Voss gab mir das Gefühl, ganz normal zu sein.
Doch trotz der ganzen Gespräche, der Therapiesitzungen und Selbsthilfegruppen, die Doktor Voss leitete, lernte ich sein wahres Wesen erst viel später kennen. Zu spät, will ich meinen, doch ich werde noch darauf zu sprechen kommen.
Zunächst aber möchte ich von Schwester Gisela erzählen. Ihre Grundwesenszüge habe ich ja bereits beschrieben. Der Alltag in der Anstalt war meist recht trostlos, bis zu jenen Momenten, an denen die Schicht von Schwester Gisela begann. Alle freuten sich auf sie. Ausnahmslos alle.
Sie war das Wunder der Anstalt.
Ich nur der Geist, der durch die Flure schlich.
Norbert Geist.
Schizophren.
Zwei Geister in meinem Kopf.
Willkommen in meiner Welt.
✞
Schwester Gisela
In meinem Zimmer.
Ein Bett, auf dem ich liege. Nur mäßig bequem, aber ich habe mich daran gewöhnt. Kreuzschmerzen, seit ich hier bin. Massagen gibt es nicht.
Ein Regal mit ein paar wenigen Büchern darauf: Salingers »Der Fänger im Roggen«, Hesses »Der Steppenwolf«, Bölls »Ansichten eines Clowns« – solche Sachen eben. Zerlesen. Zerfetzt. Gelbes, brüchiges Papier. Hier und da sind die Zeilen mit Bleistift unterstrichen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal eine Zeile gelesen habe. Ich kann mich nicht erinnern.
Darunter: ein Tisch und ein Stuhl. Stifte und ein Block mit kariertem Papier. Mehr nicht.
Ein Waschbecken. Verschmierter Zahnputzbecher, mit klebrigen Zahnputzutensilien darin. Ein klumpiges Stückchen Seife, das den Dreck von der Werkgruppe nicht von meinen Händen gebracht hat. Der ewig tropfende Wasserhahn.
Ein Kleiderschrank, in dem sich Klamotten befinden, in die man meinen Namen eingenäht hat. So können die Arbeiter in der Wäscherei die Berge der Wäsche des Wahnsinns leichter zuordnen. Weiße Stoffschildchen mit rot bestickter Schrift: »Norbert Geist, Station C-7, Zimmer 12«, mehr bin ich hier nicht.
Zwei Poster an den ansonsten kahlen, beige getünchten Wänden. Das eine zeigt eine nackte Frau, vor der ich manchmal masturbiere. Das Bild stammt aus einer Zeitschrift. Coupé oder so was. Solche Sachen kann man sich hier problemlos im Lesezimmer besorgen. Lesezirkel heißt das.
Wir dürfen die Zeitschriften zwar nicht zerreißen, aber letztlich macht es doch jeder, und mir hat die Frau gefallen. Ich schätze sie auf Anfang zwanzig. Sie ist nackt und liegt auf einem Sofa, die gespreizten Beine angewinkelt. Ihre eine Hand bedeckt ihre Scham, während die andere über ihre Brüste streichelt. Ihr Haar ist dunkel und sieht nass aus, so als käme sie gerade aus der Dusche. Sie erinnert mich an ein Mädchen, das ich einmal kannte, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
Das andere Poster ist ein Filmplakat, das ich aus einer anderen Zeitschrift des Lesezirkels entwendet habe: »Dracula has risen from the grave«, eine Hammer-Film-Produktion mit Christopher Lee und Rupert Davies. Mein Lieblingsfilm. Ich habe ihn noch nie gesehen.
Zu guter Letzt gibt es noch das Fenster. Wenn ich auf meinen Stuhl steige, kann ich hinaussehen, so weit oben befindet sich das schmale Fenster, das kaum Licht hineinlässt. Von dort kann ich auf den Innenhof der Anstalt blicken, den man wie einen Park angelegt hat, durch den nur selten Menschen spazieren. Auch weiß ich nicht, wie man in diesen Park gelangt. Ich war noch nie dort und habe auch nicht das Bedürfnis, dort meine Runden zu drehen. Wozu auch? Die Anstaltsmauern, die sich um den Innenhof befinden, scheinen massiv. Ein quadratisch angelegter Gebäudekomplex. Anonyme Fenster starren in den Innenhof, genau wie meines. Manchmal kann man hinter den Fenstern Lichter sehen, aber meistens bleibt es dunkel.
Die Anstalt … weder weiß ich, wo ich mich befinde, noch seit wann. Ich bin schon lange hier. Ein fester Bestandteil der Insassen. Schwester Gisela meinte letztens, ich gehöre hier bereits zum Inventar. Sie meinte das lustig, weswegen ich lachte, aber in Wirklichkeit verstörte mich diese Aussage sehr, denn seitdem denke ich darüber nach, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ich hier gelandet bin. Doch meine Überlegungen werden im Keim erstickt.
Meine Stimmen melden sich.
A: »Tag.«
B: »Tag auch.«
A: »Die dritte Katastrophe naht.«
B: »Ach ja?«
A: »Ja. Katastrophe zwei zu eins.«
B: »Du mit deinen grausamen Visionen.«
»Wovon redet ihr, bitte?«, frage ich.
A: »Hörst du die Musik?«
»Welche Musik?«
B: »Hörst du sie nicht?«
»Nein«, sage ich und lausche. Doch außer den beiden Stimmen ist da nichts. Schon gar keine Musik.
A: »Die Musik wird lauter.«
B: »Ohrenbetäubend, diese Musik. Hast du schon einmal über ihren Sinn nachgedacht?«
A: »Nein. Du?«
B: »Und ob. Sie berichtet vom Tod der Sterblichen.«
A: »Wer ist sterblich?«
B: »Die Menschheit.«
A: »Und weiter?«
B: »Danach sind sie angeblich erlöst. In einen anderen Zustand des Seins eingetreten. Verpufft im Nichts der Existenz.«
A: »Existenz?«
B: »Leben.«
A: »Tod, meinst du wohl.«
B: »Ach ja, stimmt. Du hast recht.«
»Könntet ihr bitte mal etwas deutlicher reden? Wovon sprecht ihr beiden nur?«
A: »Ich glaube, wir wissen es noch nicht. Ich habe bislang nur die Musik gehört.«
B: »Ich auch. Die Musik und die Gerüchte.«
»Was für Gerüchte?« Ich stehe auf und wandere im Zimmer umher.
B: »Vom nahenden Ende der Menschheit.«
»Ihr spinnt.«
B: »Du bist hier derjenige, der verrückt ist.«
A: »Was geschieht dann?«
B: »Ich weiß es nicht. Sie haben das Märchen nie weiter erzählt.«
»Wer?«, rufe ich. »Wer erzählt euch solche absurden Märchen?«
B: »Die Menschen.«
A: »Ungetümer.«
B: »Ja.«
A: »Wie denkst du persönlich darüber?«
B: »Gar nicht.«
A: »Warum?«
B: »Es hat keinen Sinn.«
A: »Ja? Na denn.«
Ich halte mir die Ohren zu. »Genug! Ich kann euer Geschwätz grade nicht brauchen.«
A: Lacht.
B: Lacht auch.
»Wieso lacht ihr?«
A: »Wollen wir ihn zur Weißglut bringen?«
B: Lacht noch lauter.
»Bitte nicht«, sage ich. »Nicht heute.«
B: »Was machst du heute Abend?«
A: »Sterben.«
»Was? Wieso sterben. Was soll das heißen?«
B: »Siehst du.«
A: »Und du?«
B: »Das Übliche.«
A: »Ach so.«
B: »Wenn du stirbst, werden wir uns wohl kaum wiedersehen.«
A: »Stimmt.«
B: »Also, tschüss.«
A: »Schönen Tag noch.«
Stille. Endlich. Sie sind wieder fort. Dabei sind sie nicht immer so nervtötend. Und oft ergibt das Gesagte tatsächlich auch Sinn. Aber heute?
Heute bin ich einfach nur froh, dass sie erst mal wieder weg sind. Vielleicht haben die Tabletten auch endlich wieder die Oberhand gewonnen. Ein wenig ermattet fühle ich mich. Leicht abgestumpft. Nicht müde oder erschöpft, aber doch ein wenig sediert. Schlafen möchte ich jetzt aber nicht.
Um mich auf andere Gedanken zu bringen, öffne ich die Tür und verlasse mein Zimmer. Auf dem Gang ist nur wenig los. Der grüne, durch Generationen von Verrückten stark abgelaufene Linoleumboden erstreckt sich verwaist in beide Richtungen.
Weiter vorne liegt das Personalzimmer, eingefasst in Glas. Dahinter halten sich normalerweise die Pfleger und Schwestern auf, trinken Kaffee, lachen und tratschen, stellen Medikamente, bereiten das Essen auf Servierwägen vor, brüten über Dienstpläne, telefonieren … all solche Sachen eben. Doch heute ist etwas anders. Das Personalzimmer ist leer.
Direkt daneben erstreckt sich eine Art großer, offener Aufenthaltsraum. Manche der Insassen spielen hier Schach oder schauen Fernsehen. Andere sitzen einfach nur da und sabbern vor sich hin, wohingegen Jesus meist schwungvolle Reden hält.
Jesus ist mein Kumpel, hier drin. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt oder warum er sich für Jesus hält, aber er sieht genauso aus, wie man sich Jesus eben so vorstellt. Vielleicht ist er es wirklich. Wer weiß das schon.
Normalerweise also müsste ich Jesus’ Reden bis hierher hören. Ich müsste das Sitcomgelächter aus dem Gemeinschaftsfernseher hören. Ich müsste die Pfleger und Schwestern in ihrem gläsernen Personalzimmer sehen können, das wir Insassen passenderweise Aquarium getauft haben.
Doch heute ist alles anders.
Neugierig schleppe ich mich in die Richtung des Gemeinschaftsraumes. Der Fernseher läuft tatsächlich, aber es ist ein anderes Programm als sonst.