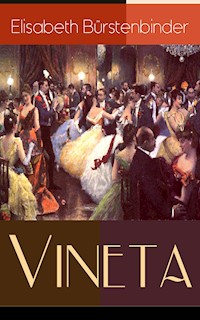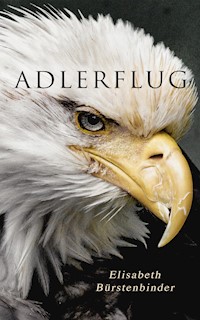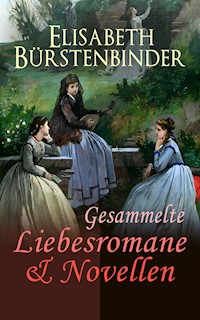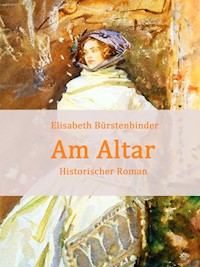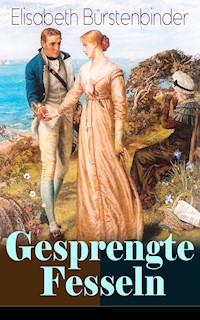
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gesprengte Fesseln" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Elisabeth Bürstenbinder (1838-1918) war eine deutsche Schriftstellerin. Sie schrieb unter dem Pseudonym E. Werner. Erste kleinere Veröffentlichungen Elisabeth Bürstenbinders erschienen in einer kleinen Zeitschrift in Süddeutschland. Einem größeren Publikum wurde sie durch Romane, die sie in der Zeitschrift Die Gartenlaube veröffentlichte, bekannt. Bald zählte sie zu den beliebtesten Autoren der Zeitschrift. Auch weitere Veröffentlichungen Elisabeth Bürstenbinders erschienen in den folgenden Jahren zuerst in der Gartenlaube, bevor sie in Buchform veröffentlicht wurden. Aus dem Buch: "Hugo machte eine Wendung, in das Besuchszimmer hinüberzugehen, aber auf der Schwelle blieb er noch einmal stehen und blickte nach der Thür hinüber, durch die seine junge Schwägerin sich entfernt hatte. Der Zug von Spott und Uebermuth in seinem Gesichte war völlig verschwunden; es hatte einen nachdenklichen Ausdruck angenommen, als er leise sagte: "Und da glaubt Reinhold nur, daß sie blaue Augen hat? Unbegreiflich!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gesprengte Fesseln
Inhaltsverzeichnis
Der Vorhang sank unter dem Beifallssturme des ganzen Hauses. Logen, Parterre und Galerien verlangten einstimmig das Wiedererscheinen der Sängerin, die in dem Finale des soeben beendigten Actes Alles zur Begeisterung fortgerissen hatte. Das ganze Parquet gerieth in Aufruhr, und man ruhte nicht, bis die Gefeierte sich endlich zeigte, um, begrüßt von dem mit neuer Macht hervorbrechenden Beifall, von Blumen, Kränzen und Huldigungen aller Art, dem Publicum zu danken.
„Das ist ja heut’ ein echt italienischer Theaterabend,“ sagte ein älterer Herr, in eine der Logen des ersten Ranges tretend. „Signora Biancona scheint die Kunst zu verstehen, das sonst so ruhig und gesetzt fließende Patricierblut unserer edlen Hansastadt mit dem südlichen Feuer ihrer Heimath zu erfüllen. Die Begeisterung für sie fängt nachgerade an, epidemisch zu werden. Wenn das noch weiter um sich greift, so erleben wir, daß die Börse ihr einen Fackelzug votirt, und der Senat der freien Reichsstadt in corpore bei ihr erscheint, um ihr die Huldigung derselben zu Füßen zu legen. An Ihrer Stelle, Herr Consul, würde ich beiden hohen Körperschaften diesen Vorschlag unterbreiten. Ich bin überzeugt, daß er eine enthusiastische Aufnahme findet.“
Der Herr, an den diese Worte gerichtet waren, und der an der Seite einer Dame, augenscheinlich seiner Gattin, im Vordergrunde der Loge saß, schien sich der soeben verspotteten allgemeinen Begeisterung gleichfalls nicht entziehen zu können. Er hatte das Klatschen mit einer Ausdauer und Energie betrieben, die einer besseren Sache würdig war, und wandte sich jetzt halb lachend, halb ärgerlich um.
„Dachte ich es doch, daß die Kritik sich wieder in Opposition zu der allgemeinen Stimme setzen würde! Freilich, Doctor, Sie schonen in Ihrem entsetzlichen Morgenblatte ja weder Börse noch Senat; wie sollte da Signora Biancona Gnade finden?“
Der Doctor lächelte ein wenig malitiös und trat an den Sessel der Dame, als ein junger Mann, der hinter demselben seinen Sitz hatte, sich artig erhob, um ihm Platz zu machen.
„Herr Almbach,“ sagte die Dame vorstellend, „Herr Doctor Welding, der Redacteur unseres Morgenblattes, dessen Feder –“
„Um Gotteswillen, gnädige Frau,“ unterbrach sie Welding, „discreditiren Sie mich nicht gleich von vornherein in den Augen dieses Herrn. Man braucht einem jungen Künstler nur als Kritiker vorgestellt zu werden, um sofort seiner vollsten Antipathie sicher zu sein.“
„Möglich!“ lachte der Consul, „aber diesmal hat Sie Ihr Scharfblick doch getäuscht. Herr Almbach wird, Gott sei Dank! nie in den Fall kommen, vor Ihrem Richterstuhle zu erscheinen. Er ist Kaufmann“
„Kaufmann?“ Ein Blick der Verwunderung streifte die Gestalt des jungen Mannes. „Dann bitte ich allerdings um Verzeihung wegen meines Irrthums. Ich hätte Sie für einen Künstler gehalten.“
„Sehen Sie, lieber Almbach, da spielen Ihnen Ihre Stirn und Augen schon wieder den schlimmen Streich!“ scherzte der Consul. „Was würden die Ihrigen daheim zu dieser Verwechselung sagen? Ich fürchte beinahe, sie nähmen das als eine Art von Beleidigung.“
„Vielleicht! Ich nehme es als keine solche,“ sagte Almbach sich leicht gegen Welding verneigend. Die Worte sollten wohl den angeschlagenen Ton des Scherzes fortsetzen, aber es lag in ihnen eine halb verborgene Bitterkeit, die dem Doctor nicht entging. Sein Auge heftete sich forschend auf die Züge des jungen Fremden, aber gerade in diesem Augenblicke wandte sich die Dame zu ihm und nahm das vorhin berührte Thema wieder auf.
„Sie werden doch zugeben, Herr Doctor, daß die Biancona heute ganz hinreißend war. Dieses junge, eben erst auftauchende Talent ist in der That ein neuer Stern an unserem Theaterhimmel –“
„Der einst zur strahlenden Sonne werden wird, wenn er hält, was er uns heute verspricht – gewiß, gnädige Frau, das leugne ich auch keineswegs, wenn diese künftige Sonne auch gegenwärtig noch einige Flecken und Unvollkommenheiten zeigt, die einem so begeisterten Publicum natürlich entgehen.“
„Nun, dann rathe ich Ihnen, diese Unvollkommenheiten nicht gar zu stark zu betonen,“ sagte der Consul, in das Parquet zeigend. „Dort unten sitzt eine Schaar von begeisterten Rittern der Signora. Nehmen Sie sich in Acht, Doctor, sonst erhalten Sie mindestens sechs Herausforderungen.“
Das malitiöse Lächeln spielte wieder um Welding’s Lippen, während er mit einem ironischen Blicke den jungen Almbach streifte, der schweigend, aber mit finster gerunzelter Stirn dem Gespräche gefolgt war.
„Und vielleicht die siebente noch dazu! Herr Almbach zum Beispiel scheint meine eben geäußerte Ansicht als eine Art von Hochverrath zu betrachten.“
„Ich bedaure, Herr Doctor, im Punkte der Kritik noch sehr weit zurück zu sein“ entgegnete der Angeredete kühl. „Ich,“ hier flammte es fast leidenschaftlich auf in seinem Auge, „ich pflege den Genius unbedingt zu bewundern.“
„Eine höchst poetische Art der Kritik,“ spottete Welding. „Wenn Sie das unserer schönen Signora persönlich und in diesem Tonfalle wiederholen, so kann ich Sie im Voraus ihrer vollsten Gnade versichern. Uebrigens bin auch ich diesmal in der angenehmen Lage, ihr in dem morgen erscheinenden Artikel sagen zu können, daß sie in der That ein Talent ersten Ranges ist, daß ihre Fehler und Mängel nur die der Anfängerin sind, und daß es allein in ihrer Hand liegt, dereinst eine musikalische Größe zu werden. Für den Augenblick ist sie es noch nicht.“
„Nun, das ist vorläufig genug des Lobes in Ihrem Munde,“ sagte der Consul. „Aber ich denke, wir brechen jetzt auf. Die Glanzpartie der Biancona ist zu Ende; der letzte Act bietet ihrer Rolle fast gar nichts, kaum daß sie noch einmal auf der Bühne erscheint, und uns ruft die Pflicht der Wirthe an unserem heutigen Empfangsabende. Darf ich Ihnen einen Platz in unserem Wagen anbieten, Doctor? Ihre kritische Pflicht ist ja wohl gleichfalls zu Ende, und Sie, lieber Almbach, begleiten Sie uns auch, oder wollen Sie den Schluß abwarten?“
Der junge Mann hatte sich ebenfalls erhoben. „Wenn Sie und die gnädige Frau es gestatten – die Oper ist mir noch fremd, ich würde gern –“
„Nun, dann bleiben Sie ohne Umstände!“ unterbrach ihn Jener freundlich. „Aber sein Sie pünktlich heute Abend! Wir rechnen bestimmt aus Ihr Kommen.“
Er reichte seiner Frau den Arm, um sie hinauszuführen. Doctor Welding begleitete die Beiden.
„Wie können Sie nur glauben,“ spottete er draußen auf dem Corridore, „Ihr junger Gast würde vom Platze weichen, so lange die Biancona noch einen Ton zu singen hat, oder er würde es sich nehmen lassen, mit unserer übrigen Herrenwelt an ihrem Wagen Spalier zu bilden! Die schönen Augen der Signora haben schon manches Unheil angerichtet – der hat Feuer gefangen, ärger als alle Uebrigen.“
„Das wollen wir doch nicht hoffen,“ sagte die Dame mit einem leisen Anfluge von Besorgniß in ihrer Stimme. „Was würden dazu die Schwiegereltern und vor Allem die junge Frau sagen?“
„Ist Herr Almbach bereits verheirathet ?“ fragte Welding überrascht.
„Schon seit zwei Jahren,“ bestätigte der Consul. „Er ist der Neffe und Schwiegersohn meines Geschäftsfreundes. Die Firma ist Almbach und Compagnie, kein sehr bedeutendes Haus, aber höchst solid und respectabel. Uebrigens thun Sie dem jungen Manne doch wohl Unrecht mit Ihrem Verdachte. In solchen Jahren ist man leicht hingerissen, besonders wenn einem der Kunstgenuß so selten zu Theil wird, wie es gerade hier der Fall ist. Unter uns gesagt, Almbach hegt in solchen Dingen etwas spießbürgerliche Ansichten und hat seinen Schwiegersohn scharf im Zügel. Er wird schon dafür sorgen, daß das Unheil, das jene Augen etwa anrichten könnten, seinem Hause fern bleibt; darauf kenne ich ihn.“
„Um so besser für ihn!“ sagte der Doctor lakonisch, während er neben dem Ehepaare im Wagen Platz nahm, der die Richtung nach dem Hafen einschlug, wo die Paläste der reichen Handelsherren liegen.
Eine Stunde darauf war in den Salons des Kaufmannes eine zahlreiche Gesellschaft versammelt. Consul Erlau gehörte zu den reichsten und angesehensten Handelsherren der reichen Handelsstadt, und wenn schon dieser Umstand hinreichend war, ihm dort eine unbestrittene Bedeutung zu sichern, so setzte er andererseits eine Ehre darein, sein glänzendes und gastfreies Haus als das erste in H. genannt zu sehen. Seine Empfangsabende vereinigten gewöhnlich Alles, was die Stadt an Capacitäten überhaupt zu bieten hatte. Es gab nicht leicht eine Berühmtheit, die sich nicht wenigstens einige Male dort zeigte, und auch der Stern der gegenwärtigen Saison, die Primadonna der augenblicklich hier gastirenden italienischen Operngesellschaft, Signora Biancona, hatte der an sie ergangenen Einladung Folge geleistet, und war nach Beendigung der Oper erschienen.
Die junge Künstlerin bildete nach ihrem heutigen Triumphe im Theater natürlich den Mittelpunkt der ganzen Gesellschaft. Von den Herren mit Huldigungen aller Art bestürmt, von den Damen mit Artigkeiten überhäuft, von dem Wirthe und seiner Gattin mit schmeichelhafter Aufmerksamkeit ausgezeichnet, vermochte sie sich kaum zu retten vor dem Strome der Bewunderung, der ihr von allen Seiten entgegenfluthete und der vielleicht in ebenso hohem Maße der Schönheit als der Kunst galt.
Hier fand sich freilich beides vereinigt. Auch ohne ihr so hoch gefeiertes Talent wäre Signora Biancona schwerlich in den Fall gekommen, irgendwo übersehen zu werden. Sie war eine von jenen Frauen, die überall, wo sie nur erscheinen, Auge und Sinn zu fesseln und in einer oft gefährlichen Weise festzuhalten wissen, deren bestrickender Reiz nicht allein in ihrer Schönheit liegt, sondern weit mehr noch in dem seltsamen, fast dämonischen Zauber, den gewisse Naturen ausüben, ohne daß man sich Rechenschaft zu geben vermag, woher er stammt. Es lag wie ein Hauch des glühenden farbenreichen Südens über dieser Erscheinung, die sich mit ihrem dunklen Haar und Teint, mit den großen tiefschwarzen Augen, aus denen ein so volles heißes Leben strahlte, fremdartig genug ausnahm in dieser nordischen Umgebung. Ihre Art zu sprechen, sich zu bewegen, war vielleicht lebhafter und zwangloser, als es die strengen Formen der Convenienz verlangten, aber das Feuer eines südlichen Naturells, das bei jeder Regung unwillkürlich hervorbrach, war von hinreißender Grazie. Der leichte idealische Anzug schloß sich wenig der herrschenden Mode an, aber er schien wie eigens erfunden, um die Vorzüge dieser Gestalt in das hellste Licht zu setzen, und behauptete sich siegreich neben der ringsum entfalteten Toilettenpracht der übrigen Damen. Die junge Italienerin war eben ein Wesen, das über all den Schranken und Formen des Alltagslebens zu stehen schien, und es gab wohl Keinen in der Gesellschaft, der ihr diese Ausnahme nicht bereitwillig zugestand.
Auch Almbach hatte sich nach dem Schlusse des Theaters eingefunden, aber er war völlig fremd in diesem Kreise und schien es auch zu bleiben, trotz der wohlgemeinten Versuche des Consuls, ihn mit Diesem oder Jenem bekannt zu machen. Sie scheiterten, theils an der fast düsteren Schweigsamkeit des jungen Mannes, theils an dem Benehmen der Herren, denen er vorgestellt wurde, und die, fast durchweg den höheren Börsen- oder Finanzkreisen angehörig, es nicht der Mühe werth hielten, mit dem Vertreter eines kleinen Geschäftshauses viel Umstände zu machen. Augenblicklich stand er ganz isolirt am unteren Ende des Saales und blickte scheinbar gleichgültig auf das glänzende Gewühl, aber die Augen kehrten immer wieder zu dem einen Punkte zurück, der heute Abend der Magnet für die gesammte Herrenwelt zu sein schien.
„Nun, Herr Almbach, Sie machen ja gar keinen Versuch, sich dem eigentlichen Sonnenkreise des Salons zu nähern,“ sagte Doctor Welding, an ihn herantretend. „Soll ich Sie dort einführen?“
Eine leichte Röthe der Verlegenheit darüber, daß man seinen geheimen Wunsch errieth, färbte das Antlitz des jungen Mannes.
„Signora Biancona wird von allen Seiten so in Anspruch genommen, daß ich es nicht wagte, sie auch noch zu belästigen.“
Welding lachte. „Ja, die Herren scheinen sich sämmtlich Ihrer kritischen Methode anzuschließen und gleichfalls ‚den Genius unbedingt zu bewundern‘. Nun, die Kunst hat ja das Vorrecht, Jedem Begeisterung einzuflößen. Kommen Sie! Ich werde Sie der Signora vorstellen.“
Sie schritten nach der anderen Seite des Saales, wo sich die junge Italienerin befand, aber es kostete ihnen wirklich einige Mühe, den Kreis der Bewunderer zu durchbrechen, der den gefeierten Gast umgab, und sich diesem zu nähern. Der Doctor übernahm die Vorstellung; er nannte seinen Begleiter, der heute zum ersten Male das Glück gehabt habe, Signora auf der Bühne bewundern zu dürfen, und überließ es ihm dann, sich allein im „Sonnenkreise“ zurecht zu finden. Die Bezeichnung war nicht so übel gewählt; es lag wirklich etwas von der sengenden Gluth dieses Gestirns auf seiner Mittagshöhe in dem Blicke, der sich jetzt auf Almbach richtete.
„Also auch Sie waren heute Abend im Theater?“ fragte die Sängerin leicht.
„Ja, Signora.“
Die Antwort klang kurz und düster. Kein Wort weiter, keins von jenen Complimenten, deren die Künstlerin heute bereits so viele gehört hatte – aber der Blick des jungen Mannes mußte die einsilbige Antwort wohl wieder gut machen. Zwar begegnete er nur einen Moment lang dem der Signora Biancona, aber das Aufleuchten darin war gesehen und verstanden worden; es sagte unendlich mehr als alle die Schmeicheleien.
Die übrigen Herren mochten keinen hohen Begriff von den gesellschaftlichen Talenten des neuen Ankömmlings erhalten, der es nicht einmal verstand, einer schönen Frau irgend eine Artigkeit zu sagen. Sie ignorirten ihn vollständig. Die Unterhaltung, an der sich jetzt auch der Consul betheiligte, wurde allgemeiner; man sprach von der Musik, von einem bekannten Componisten und einem gerade epochemachenden Werke desselben, über dessen Auffassung Signora Biancona und Doctor Welding in Meinungsdifferenz geriethen. Erstere begeisterte sich dafür, während der Letztere ihm gar keinen höhern Werth beimaß. Die Signora vertheidigte ihre Ansicht mit südlicher Lebhaftigkeit und wurde dabei von sämmtlichen Herren unterstützt, die von vornherein ihre Partei nahmen; der Doctor beharrte kühl auf der seinigen. Der Streit wurde hartnäckiger, bis sich endlich die Sängerin unmuthig und etwas gereizt von ihrem Widersacher abwandte.
„Ich bedaure sehr, daß unser Capellmeister verhindert war, die heutige Einladung anzunehmen. Er spielt gerade diese Composition meisterhaft, und ich fürchte, es bedarf eines Vortrages, um die Gesellschaft zum Richter darüber zu machen, wer von uns Beiden Recht hat.“
Die Gesellschaft war auch dieser Meinung und vermißte den Herrn Capellmeister sehr schmerzlich; zum Ersatz erbot sich Niemand. Die sehr zur Schau getragene Begeisterung für die Musik schien bei Keinem mit der Ausübung derselben gleichen Schritt zu halten, bis auf einmal Almbach vortrat und ruhig sagte:
„Ich stelle mich Ihnen zur Verfügung, Signora.“
Diese wendete sich rasch und mit sichtlicher Genugthuung zu ihm. „Sie sind musikalisch, Signor?“
„Wenn Sie und die Gesellschaft mit dem Versuche eines Dilettanten vorlieb nehmen wollen –“ er machte eine fragende Bewegung nach dem Herrn des Hauses hin, und als dieser eifrig beistimmte, trat er an den Flügel.
Die in Rede stehende Composition, ein modernes Paradestück im vollsten Sinne des Wortes, verdankte ihre allgemeine Beliebtheit wohl weniger ihrem innern Gehalte – sie besaß in der That nicht allzu viel davon – als der enormen Schwierigkeit der Ausführung. Schon die bloße Möglichkeit, sie zu spielen, erforderte eine Meisterschaft in der Beherrschung des Flügels. Man war gewohnt, diesen Vortrag nur von Virtuosen ersten Ranges zu hören, und blickte daher halb überrascht, halb spöttisch auf den jungen Mann, der sich ohne Weiteres dazu erbot. Er hatte sich freilich mit seinem Dilettantismus entschuldigt, aber es war doch immerhin eine Keckheit, diesen im Salon des Consuls Erlau zu probiren, wo man schon das Spiel so mancher Berühmtheit gehört und bewundert hatte.
Um so erstaunter war daher die Gesellschaft, als Almbach sich all diesen Schwierigkeiten vollkommen gewachsen zeigte, als er, ohne auch nur eine Note vor sich zu haben, sie gleichsam spielend überwand, mit einer Leichtigkeit und Sicherheit, die einem Künstler von Fach Ehre gemacht hätte. Zugleich aber wußte er in seinen Vortrag ein Feuer zu legen, das selbst die älteren und anspruchsvolleren Zuhörer mit fortriß. Das Musikstück schien unter seinen Händen eine ganz andere Gestalt anzunehmen; er lieh ihm eine Bedeutung, die bisher noch Niemand, vielleicht der Componist selbst am wenigsten, hineingelegt hatte, und besonders der in etwas stürmischem Tempo vorgetragene Schluß trug ihm von allen Seiten den reichsten Beifall ein.
„Bravo, bravissimo, Herr Almbach!“ rief der Consul, der zuerst hervortrat und ihm herzlich die Hand schüttelte. „Wir müssen wirklich der Signora und dem Doctor dankbar sein, daß ihr musikalischer Streit uns zur Entdeckung eines solchen Talentes verhalf. Da kündigen Sie uns ganz bescheiden einen Versuch an und geben uns eine Leistung, deren sich der vollendetste Künstler nicht zu schämen hätte. Sie haben unserer Signora zu einem glänzenden Siege verholfen; sie hat Recht, unbedingt Recht, und der Doctor bleibt diesmal mit seinem Angriffe entschieden in der Minorität.“
Die Sängerin war gleichfalls vor den Flügel getreten. „Auch ich bin Ihnen dankbar, daß Sie meinem Wunsche so ritterlich nachkamen,“ sagte sie lächelnd; „aber“ – hier senkte sie die Stimme – „aber nehmen Sie sich in Acht! Ich fürchte, mein kritischer Gegner wird noch mit Ihnen rechten über die Art, wie Sie meiner Ansicht Geltung verschafften. War das Spiel und vor Allem der Schluß so ganz correct?“
Eine verrätherische Gluth flog über das Antlitz des jungen Mannes, aber er lächelte gleichfalls. „Er entsprach Ihrer Auffassung und fand Ihren Beifall, Signora – das ist für mich genug.“
„Wir sprechen noch darüber,“ flüsterte die Sängerin schnell, denn jetzt trat die Dame des Hauses heran, um ihrem jungen Gaste gleichfalls einige Artigkeiten zu sagen, und der größte Theil der Gesellschaft folgte ihrem Beispiele. Ein Strom von Redensarten und Complimenten rauschte auf Almbach ein; man war entzückt von seinem Spiele, seiner Auffassung; man wollte wissen, wo er seine musikalischen Studien gemacht; je weniger man ihn früher beachtet hatte, je unbekannter er den Meisten war, desto mehr überraschte sein plötzliches Hervortreten, und dazu die Bescheidenheit des jungen Mannes, die ihm kaum erlaubte, auf all die an ihn gerichteten Fragen zu antworten; ein Jeder aus der Gesellschaft fühlte augenblicklich etwas vom Kunstmäcen in sich und war bereit, diesem jungen Talente seine volle Protection angedeihen zu lassen.
Ob es wirklich nur Bescheidenheit war, was Almbach’s Lippen schloß? Es blitzte bisweilen wie eine Art von Spott in seinem Auge, wenn man immer und immer wieder seine geniale Auffassung hervorhob und behauptete, die Composition noch nie in dieser Vollendung gehört zu haben. Er benutzte die erste Gelegenheit, sich der auf ihn gerichteten Aufmerksamkeit zu entziehen, und ward bei diesem Versuche von Doctor Welding in Beschlag genommen.
„Kann man endlich auch einmal zu Ihnen gelangen? Man läuft ja förmlich Sturm auf Sie mit Complimenten. Nur ein Wort, Herr Almbach! Wollen wir hier eintreten?“
Er wies in ein Nebenzimmer, das Beide kaum betreten hatten, als der Doctor in ziemlich scharfem Tone fortfuhr:
„Signora Biancona hat Recht behalten, das heißt in Folge Ihres Vortrages. Mein Angriff richtete sich gegen die Composition, wie sie im Original existirt. Darf ich fragen, wo Sie diese sehr eigenthümliche Bearbeitung aufgefunden haben? Mir war sie bis zu dieser Stunde völlig unbekannt.“
„Wie meinen Sie, Herr Doctor?“ fragte der junge Mann kühl. „Ich kenne das Musikstück nur in dieser Gestalt.“
Welding sah ihn von oben bis unten an; in seinem Gesichte stritt ein ärgerlicher Ausdruck mit einem unverhohlenen Interesse, als er entgegnete:
„Sie scheinen die Musikkenntniß der Gesellschaft ganz richtig zu taxiren, da Sie ihr dergleichen zu bieten wagen. Man hört das bekannte Thema heraus und ist zufrieden; aber es giebt doch zuweilen Ausnahmen. Mich zum Beispiel würde es sehr interessiren, zu wissen, von wem gewisse Variationen stammen, die den Charakter des Ganzen total verändern, und was nun vollends den Schluß betrifft – war diese kühne Improvisation vielleicht auch der ‚Versuch eines Dilettanten‘?“
Almbach hob ein wenig trotzig den Kopf. „Und wenn sie es nun wäre, was würden Sie dazu sagen?“
„Daß es ein arger Mißgriff der Ihrigen war, Sie zum – Kaufmann zu machen.“
„Herr Doctor, wir sind im Hause eines Kaufmanns.“
„Gewiß,“ sagte Welding ruhig, „und ich bin der Letzte, diesen Stand gering zu schützen, zumal wenn er, wie bei unserm Wirthe, mit tüchtiger rastloser Arbeit beginnt und mit dem Ausruhen auf Millionen endigt; aber er paßt eben nicht für Jeden. Es gehört vor allen Dingen ein klarer kühler Kopf dazu, und der Ihrige scheint mir gerade nicht dazu geschaffen, sich einzig mit dem nüchternen Soll und Haben abzugeben. Verzeihen Sie, Herr Almbach! Das ist nur so meine unmaßgebliche Meinung; im Uebrigen tadele ich Sie gar nicht wegen Ihrer Keckheit. Was thut man nicht, um dem Eigensinne einer schönen Frau Recht zu geben! In diesem Falle war das Manöver sogar äußerst genial; ein Anderer hätte das mit dem besten Willen nicht fertig gebracht. Ich gratulire Ihnen dazu.“
Er machte eine halb ironische Verbeugung und verließ das Gemach. Es lag zwar dicht neben dem Saale, aber die halb geschlossenen Portièren schieden es von demselben, und völlig einsam und matt erleuchtet, bot es wenigstens ein minutenlanges Alleinsein Dem, der danach verlangte. Der junge Mann hatte sich in einen Sessel geworfen und schaute träumend vor sich hin. Woran er dachte, das wagte er sich vielleicht selbst nicht zu gestehen, und doch verrieth es sein jähes Auffahren beim Klange einer Stimme, die im Tone leichter Ueberraschung sagte:
„Ah Signor Almbach, Sie hier?“
Es war Signora Biancona; ob sie beim Eintritte den bereits Anwesenden wirklich nicht bemerkt hatte, ließ sich nicht entscheiden, denn sie fuhr mit voller Unbefangenheit fort:
„Ich suchte auf einen Augenblick Erholung von der Hitze und dem Gewühle des Salons. Auch Sie haben sich der Gesellschaft so kurz nach Ihrem Triumphe entzogen?“
Almbach hatte sich schnell erhoben. „Wenn von Triumphen die Rede ist, so bleibt wohl kein Zweifel, wer sie heute feiert. Meine improvisirte Leistung vermag sich nicht entfernt mit dem zu messen, was Sie dem Publicum gaben“
Die Sängerin lächelte. „Ich gab ihm auch nur Töne, wie Sie, aber ich gestehe Ihnen offen, daß es mich überrascht hat, erst heute und hier von einem Künstler zu hören, der gewiß schon längst –“
„Verzeihung, Signora,“ unterbrach sie der junge Mann kalt. „Ich habe bereits im Salon erklärt, daß ich nur auf Dilettantismus Anspruch machen darf. Ich gehöre dem Kaufmannsstande an.“
Derselbe Blick der Verwunderung, den er bei Welding im Theater gesehen, streifte hier zum zweiten Male das Gesicht Almbach’s.
„Unmöglich! Sie scherzen!“
„Weshalb unmöglich, Signora? Weil ich ein schwieriges Bravourstück geläufig vorzutragen vermochte?“
„Weil Sie es so vorzutragen vermochten und weil –“ sie sah ihn eine Secunde lang fest an und setzte dann mit voller Bestimmtheit hinzu: „weil Ihr Antlitz den Stempel zeigt, den, wie man sich immer einbildet, das Genie an der Stirne tragen muß.“
„Sie sehen, wie sehr der Schein bisweilen trügt.“
Signora Biancona schien dieser Ansicht nicht beizustimmen; sie ließ sich auf den Divan nieder; das helle Gewand legte sich leicht und luftig wie eine Wolke auf den dunklen Sammet.
„Ich bewundere Sie,“ begann sie von Neuem, „daß Sie im Stande sind, mit solchen künstlerischen Anlagen sich einem Alltagsberufe zu widmen. Mir wäre das unmöglich. Ich bin in der Welt der Klänge und Töne aufgewachsen und vermag nicht zu begreifen, wie sich in ihr noch Raum finden kann für andere Pflichten.“
Es lag eine diesmal unverhohlene Bitterkeit in der Stimme des jungen Mannes, als er entgegnete: „Ihre Heimath ist auch Italien, die meine – eine norddeutsche Handelsstadt. In unserem Alltagsleben ist die Poesie nur ein seltener, flüchtiger Gast, dem oft genug die Stätte versagt wird. Die Arbeit, das Mühen um den Erwerb steht immer und ewig im Vordergrunde.“
„Auch bei Ihnen, Signor?“
„Es sollte wenigstens dort stehen; daß es nicht immer der Fall ist, hat Ihnen wohl mein musikalischer Versuch gezeigt.“
Die Sängerin schüttelte zweifelnd das Haupt. „Ihr Versuch? Ich möchte darauf hin Ihre Meisterschaft kennen lernen. Aber es kann doch unmöglich Ihre Absicht sein, dieses Talent der Oeffentlichkeit ganz zu entziehen und es nur im Kreise der Ihrigen zu üben?“
„Im Kreise der Meinigen?“ wiederholte Almbach mit eigenthümlicher Betonung. „Ich pflege dort keine Taste anzurühren, am wenigsten in Gegenwart meiner Frau.“
„Sie sind bereits vermählt?“ fragte die Italienerin rasch, während eine momentane Blässe ihr Antlitz überflog.
„Ja, Signora.“
Es klang schwer und kalt dieses Ja, und der halb spöttische Ausdruck, der einen Augenblick lang um die Lippen der Sängerin spielte, als sie den kaum vierundzwanzigjährigen Mann betrachtete, verschwand vor diesem Tone.
„Man vermählt sich, wie es scheint, sehr früh in Deutschland,“ bemerkte sie ruhig.
„Bisweilen.“
Die junge Italienerin schien die Pause, welche diesen Worten folgte, etwas peinlich zu finden; sie ging rasch zu einem anderen Thema über.
„Ich fürchte, Sie haben bereits das Examen bestehen müssen, vor dem ich Sie vorhin warnte. Die Gesellschaft war nichtsdestoweniger entzückt von Ihrem Vortrage.“
„Vielleicht!“ sagte der junge Mann halb verächtlich. „Und doch war er sicher nicht für die Gesellschaft bestimmt.“
„Nicht? Und wem galt er denn?“ fragte Signora Biancona den Blick fest auf ihn richtend.
Auch er sah sie an; es lag etwas Verwandtes in den beiden Augenpaaren, die jetzt einander begegneten, beide groß, dunkel und räthselhaft. Auch in dem Blicke Almbach’s leuchtete der gleiche Strahl, wie in dem der Künstlerin; auch dort flammte eine heiße leidenschaftliche Seele; auch dort schlummerte in der Tiefe der dämonische Funke, der so oft das Erbtheil genialer Naturen ist und ihnen zum Fluche wird, wenn keine schützende Hand ihn mehr behütet, wenn er zur Flamme angefacht wird, die dann nicht mehr Licht, sondern nur noch Verberben bringt.
Er trat einen Schritt näher und dämpfte die Stimme, aber die tiefe Erregung darin verrieth sich doch.
„Nur der Einen, die mir und uns Allen vor wenig Stunden die höchste Schönheit und die höchste Poesie verkörperte, getragen von den Tönen eines unsterblichen Meisterwerkes. Man hat Ihnen heute tausendfach gehuldigt, Signora! Was die Begeisterung nur zu erfinden vermochte, das legte man zu Ihren Füßen. Der Fremde, Unbekannte wollte Ihnen doch auch sagen, wie sehr er Sie bewundert, und da that er es denn in der Sprache, die Ihrer allein würdig ist. Ganz fremd ist sie auch mir nicht geblieben.“
In der Huldigung lag etwas, was sie über jede Schmeichelei erhob, der Ton echter, voller Begeisterung, und Signora Biancona war doch Künstlerin genug, um diesen Ton zu kennen, Weib genug, um zu ahnen, was sich dahinter barg; sie lächelte mit bezaubernder Anmuth.
„Nun, ich habe es ja gesehen, wie sehr diese Sprache Ihnen zu Gebote steht. Werde ich sie nicht öfter von Ihnen hören?“
„Schwerlich!“ sagte der junge Mann düster. „Sie kehren, wie ich höre, in Kurzem nach Italien zurück, ich – bleibe hier im Norden. Wer weiß, ob wir je wieder einander begegnen.“
„Unser Impressario beabsichtigt bis zum Mai hier zu bleiben,“ fiel die Sängerin rasch ein. „Da wird unsere heutige Begegnung doch wohl nicht die letzte sein? Gewiß nicht, ich rechne bestimmt darauf, Sie wiederzusehen.“
„Signora!“ Das leidenschaftliche Aufflammen Almbach’s dauerte nur eine Secunde. Es schien ihn plötzlich eine Erinnerung oder Warnung zu durchzucken; er trat zurück und verneigte sich tief und fremd.
„Ich fürchte, es muß die letzte sein – leben Sie wohl, Signora!“
Er war fort, noch ehe es der Sängerin möglich war, ein Wort der Befremdung über diesen seltsamen Abschied zu äußern, und es schien ihm Ernst damit zu sein, denn nicht ein einziges Mal während des ganzen Abends näherte er sich wieder dem verhängnißvollen „Sonnenkreise“.
„Das ist zu arg. Diese Manie fängt wirklich an, alle Grenzen zu übersteigen. Ich werde dem Reinhold das musikalische Handwerk noch ganz und gar legen müssen, wenn er fortfährt, es in so unsinniger Weise zu betreiben.“
Mit diesen Worten eröffnete der Kaufmann Almbach eine Familiendebatte, die im Wohnzimmer in Gegenwart seiner Frau und Tochter stattfand und der zum Glück der eigentliche Gegenstand derselben nicht beiwohnte. Herr Almbach, ein Mann von fünfzig Jahren etwa, dessen ruhiges, gemessenes und etwas pedantisches Wesen sonst dem ganzen Comptoirpersonale als Muster vorleuchtete, schien durch die oben erwähnte „Manie“ völlig aus der Fassung gebracht zu sein, denn er fuhr in vollster Aufregung fort:
„Da kommt der Buchhalter heute Morgen gegen vier Uhr von dem Jubiläum zurück, das ich schon gleich nach Mitternacht verlassen hatte. Von der Brücke aus sieht er das Gartenhaus erleuchtet und hört den Reinhold über die Tasten hinrasen, daß ihm Hören und Sehen vergeht. Natürlich konnte er mich zum Feste nicht begleiten; er behauptete krank zu sein, aber in dem eiskalten Gartenzimmer bis an den hellen lichten Morgen seinen Flügel zu maltraitiren, daran hinderte ihn der ‚unerträgliche Kopfschmerz‘ nicht. Ich werde es wohl nächstens wieder von meinen Collegen zu hören bekommen, daß mein Herr Schwiegersohn wie in der Unbrauchbarkeit, so auch in der Rücksichtslosigkeit das Möglichste leistet. Es ist kaum zu glauben. Der jüngste Commis weiß besser Bescheid in den Büchern und hat mehr Interesse für das Geschäft, als der Compagnon und dereinstige Chef des Hauses Almbach und Compagnie. Mein Leben lang habe ich geschafft und gearbeitet, um meine Firma zu einer festgegründeten, geachteten zu machen – und nun die Aussicht, sie einst in solchen Händen lassen zu müssen!“
„Ich habe es Dir stets gesagt, Du solltest ihm den Umgang mit dem Musikdirector Wilkens verbieten,“ fiel Frau Almbach ein. „Der allein ist an Allem schuld. Mit diesem alten menschenfeindlichen Musiknarren konnte Niemand auskommen; Jedermann floh und haßte ihn, aber für Reinhold war das nur ein Grund mehr, die intimste Freundschaft mit ihm zu schließen. Tag für Tag war er drüben, und dort allein ist der Grund zu all dem musikalischen Unsinn gelegt worden, den der Herr Lehrer bei seinem Tode auf ihn vererbt zu haben scheint. Es ist kaum mehr zu ertragen, seit wir das Vermächtniß des Alten, den Flügel, im Hause haben. Ella, was sagst Du denn eigentlich zu diesem Benehmen Deines Mannes?“
Die junge Frau, an welche die letzten Worte gerichtet waren, hatte bisher noch nicht eine Silbe gesprochen. Sie saß am Fenster, den Kopf tief auf ihre Näherei herabgebeugt, und blickte erst bei dieser direct an sie gerichteten Frage empor.
„Ich, liebe Mutter?“
„Ja, Du mein Kind, denn Dich geht die Sache doch wohl zumeist an. Oder fühlst Du es wirklich gar nicht, in welcher unverantwortlichen Weise Reinhold Dich und das Kind vernachlässigt?“
„Er liebt die Musik so sehr,“ sagte Ella leise.
„Willst Du ihn etwa noch entschuldigen?“ eiferte die Mutter. „Das ist ja eben das Unglück, daß er sie mehr liebt als Frau und Kind, daß er nach Euch Beiden nichts fragt, wenn er nur an seinem Flügel sitzen und phantasiren kann. Hast Du denn gar keinen Begriff davon, was eine Frau von ihrem Manne fordern darf und fordern muß, und daß sie vor Allem die Pflicht hat, ihn zur Vernunft zu bringen? Aber freilich, von Dir ist niemals auch nur das Geringste zu erwarten.“
Die junge Frau sah nun allerdings nicht aus, als ob von ihr viel zu erwarten wäre. Sie hatte überhaupt wenig Anziehendes in ihrer Erscheinung, und das Einzige, was an dieser vielleicht hübsch zu nennen war, die zarte, noch mädchenhaft schlanke Gestalt, verbarg sich völlig unter einem höchst unkleidsamen Hausanzuge, der in seiner grenzenlosen Einfachheit eher auf eine dienende Person, als auf die Tochter des Hauses schließen ließ und ganz dazu gemacht war, jeden etwaigen Vorzug möglichst zu verstecken. Von dem blonden Haare war nur ein einziger, schmaler Streifen sichtbar, der glatt gescheitelt über der Stirn lag; das Uebrige verschwand gänzlich unter einer Haube, die wohl besser für die Jahre ihrer Mutter gepaßt hätte und einen eigenthümlichen Gegensatz zu dem Gesichte der kaum zwanzigjährigen Frau bildete. Dieses blasse Gesicht mit den niedergeschlagenen Augen war nicht geeignet, irgend ein Interesse zu erwecken; es hatte gar keinen Ausdruck; es lag etwas Starres, Leeres darin, etwas, das beinahe an Stumpfheit streifte, und in diesem Augenblicke, wo sie die Näherei sinken ließ und ihre Mutter anblickte, zeigte es eine so hülflose Aengstlichkeit und Rathlosigkeit, daß Almbach sich veranlaßt fand, seiner Tochter zu Hülfe zu kommen.
„Laß Ella in Ruhe!“ sagte er mit jenem halb ärgerlichen, halb mitleidigen Tone, mit dem man die Einmischung eines Kindes zurückweist. „Du weißt ja, daß mit ihr nichts anzufangen ist, und was sollte sie auch wohl hier ausrichten!“
Er zuckte die Achseln und fuhr dann bitter fort: „Das ist der Lohn für die Aufopferung, mit der ich mich der verwaisten Knaben meines Bruders angenommen habe! Hugo schlägt aller Dankbarkeit, aller Vernunft und Erziehung in’s Gesicht und geht heimlich auf und davon, und Reinhold, der hier in meinem Hause unter meinen Augen aufgewachsen ist, macht mir die schwersten Sorgen mit seinem unseligen Hange zu allen möglichen Phantastereien. Aber bei ihm wenigstens habe ich den Zügel in Händen behalten und werde ihn jetzt so straff anziehen, daß ihm die Lust vergehen soll, sich noch ferner dagegen zu sträuben.“
„Ja, Hugo’s Undankbarkeit war wirklich himmelschreiend,“ stimmte Frau Almbach ein. „Bei Nacht und Nebel aus unserem Hause zu entfliehen, zur See zu gehen, um ‚sein Glück allein in der Welt zu versuchen‘, wie es in dem kecken Abschiedsbriefe hieß, den er zurückließ! Nun, er scheint es trotzalledem draußen gefunden zu haben. Schon vor zwei Jahren kam der erste Brief des ‚Herrn Capitain‘ an Reinhold an, und dieser deutete erst kürzlich ganz offen auf die bevorstehende Rückkehr hin. Ich fürchte, er weiß bereits ganz Bestimmtes darüber.“
„Ueber meine Schwelle darf Hugo nicht kommen,“ erklärte der Kaufmann mit einer feierlichen Handbewegung. „Ich weiß nichts von seinem Briefwechsel mit Reinhold, will nichts davon wissen. Mögen sie hinter meinem Rücken correspondiren; aber wenn der Ungerathene die Frechheit haben sollte, mir vor Augen zu kommen, so wird er den Zorn eines beleidigten Oheims und Vormundes kennen lernen.“
Während die Eltern sich anschickten, dies augenscheinlich sehr oft behandelte Thema mit der gewohnten Ausführlichkeit und Empörung zu erörtern, hatte Ella unbemerkt das Zimmer verlassen und stieg jetzt die Treppe hinunter, die nach dem zu ebener Erde gelegenen Comptoir führte. Die junge Frau wußte, daß jetzt, zur Mittagszeit, das Personal abwesend war, und das gab ihr wohl den Muth, dort einzutreten.
Es war ein großer düsterer Raum, dem die kahlen Wände und die vergitterten Fenster etwas Gefängnißartiges verliehen. Man hatte sich nicht die Mühe genommen, dem Geschäftszimmer irgend einen Comfort oder auch nur ein freundlicheres Ansehen zu geben. Wozu auch! Was zur Arbeit gehörte, war vorhanden; das Uebrige war Luxus, und einen Luxus pflegte sich das Haus Almbach und Compagnie trotz seines notorisch nicht unbedeutenden Vermögens nie zu gestatten.
Es befand sich augenblicklich Niemand im Comptoir außer dem jungen Manne, der an einem der Pulte saß und das große Hauptbuch vor sich aufgeschlagen hatte. Er sah bleich und überwacht aus, und die Augen, die sich mit den Zahlen beschäftigen sollten, hafteten unverwandt auf dem schmalen Sonnenstreif, der schräg in das Zimmer fiel. Es lag in dem Blicke etwas von der Sehnsucht und Bitterkeit des Gefangenen, dem der Sonnenstrahl, der in seine Zelle dringt, Kunde giebt von dem Leben und der Freiheit draußen. Er wandte kaum den Kopf beim Oeffnen der Thür und fragte gleichgültig:
„Was giebt es? Was willst Du, Ella?“
Jede andere Frau wäre bei der nun folgenden Frage wohl zu ihrem Manne getreten und hätte den Arm um seine Schulter gelegt. Ella blieb dicht an der Schwelle stehen. Es klang doch gar zu eisig, dieses „Was willst Du?“ Sie kam ihm offenbar ungelegen.
„Ich wollte fragen, wie es mit Deinem Kopfschmerz steht,“ begann sie schüchtern.
„Mein Kopfschmerz?“ Reinhold besann sich plötzlich. „Ja so. Ich denke, er ist vorüber.“
Die junge Frau schloß die Thür und kam einige Schritte näher.
„Die Eltern sind wieder recht ungehalten, daß Du gestern nicht beim Feste warst und statt dessen die ganze Nacht hindurch gespielt hast,“ berichtete sie zögernd.
Reinhold runzelte die Stirn. „Wer hat ihnen denn das wieder einmal gesagt? Du vielleicht?“
„Ich?“ Es klang wie ein halber Vorwurf in der Stimme. „Der Buchhalter hat heute Morgen bei der Rückkehr das Gartenhaus noch erleuchtet gesehen und Dein Spiel gehört.“
Ein Ausdruck verächtlichen Spottes zuckte um die Lippen des jungen Mannes. „Ach so; daran hatte ich allerdings nicht gedacht. Ich glaubte nicht, daß die Herren nach ihrem Jubiläum noch Zeit und Lust zu Beobachtungen übrig hätten. Freilich, zum Spioniren sind sie immer nüchtern genug.“
„Der Vater meint –“ begann Ella wieder.
„Was meint er?“ fuhr Reinhold gereizt auf. „Ist es ihm vielleicht noch nicht genug, daß ich vom Morgen bis zum Abend hier an’s Comptoir gefesselt bin? Mißgönnt er mir sogar die Erholung, die ich Nachts in der Musik suche? Ich dächte, ich und mein Flügel wären weit genug verbannt worden; das Gartenzimmer liegt ja so fern und einsam, daß ich nicht in Gefahr komme, den Schlaf eines der Gerechten hier im Hause zu stören. Man kann zum Glück keinen Laut vernehmen.“
„Doch!“ sagte die junge Frau leise. „Ich höre jeden Ton, wenn es ringsum so still ist und ich ganz allein wach liege.“
Reinhold wandte sich um und sah seine Frau an. Sie stand mit niedergeschlagenen Augen und völlig ausdruckslosem Gesichte vor ihm. Sein Blick glitt langsam an ihrer Gestalt nieder, als stelle er unbewußt irgend eine Vergleichung an, und die Bitterkeit in seinen Zügen trat noch deutlicher hervor.
„Das thut mir leid,“ entgegnete er kalt; „aber ich kann es nicht ändern, daß Deine Fenster nach dem Garten hinausgehen. Schließe künftig die Läden! Dann werden Dich meine musikalischen ‚Extravaganzen‘ hoffentlich nicht mehr im Schlafe stören.“
Er schlug die Seiten des Buches um und schien sich wieder in die Zahlen zu vertiefen. Ella wartete wohl noch eine Minute lang; als sie aber sah, daß von ihrer Gegenwart nicht die geringste Notiz genommen wurde, ging sie so still und lautlos, wie sie gekommen war.
Kaum war sie fort, so schleuderte Reinhold mit einer leidenschaftlichen Bewegung das Hauptbuch zur Seite. Der Blick, der auf den so verächtlich behandelten Gegenstand fiel und dann durch das ganze Comptoir schweifte, zeugte von bitterstem Hasse; dann legte er schwer athmend den Kopf auf beide Arme und schloß die Augen, als wolle er nichts mehr von der ganzen Umgebung sehen und hören.
„Grüß Gott, Reinhold!“ sagte aus einmal eine fremde Stimme dicht neben ihm.
Der Gerufene fuhr empor und blickte verwirrt und fragend den Fremden in Seemannstracht an, der unbemerkt eingetreten war und jetzt vor ihm stand. Auf einmal aber schien ihn eine Erinnerung zu durchblitzen; mit einem Aufschrei der Freude warf er sich an die Brust des Ankömmlings.
„Ist’s möglich, Hugo! Du schon hier?“
Zwei kräftige Arme umschlossen ihn fest und ein paar warme Lippen drückten sich wieder und immer wieder auf die seinigen.
„Kennst Du mich wirklich noch? Ich hätte Dich unter Hunderten herausgefunden. Freilich etwas anders siehst Du aus, als der kleine Reinhold, den ich hier zurückließ. Nun, mit mir mag es wohl auch nicht viel besser sein.“
Die ersten Worte klangen noch in tiefer Bewegung, die letzten hatten schon wieder einen etwas übermüthigen Ton. Reinhold’s Arm lag noch zärtlich um den Hals des Bruders.
„Und Du kommst so plötzlich, so ganz unangemeldet? Ich erwartete Dich erst in Wochen.“
„Wir haben eine ungewöhnlich schnelle Fahrt gehabt,“ sagte der junge Capitain heiter. „Und als ich erst einmal im Hafen war, litt es mich auch nicht eine Minute länger an Bord; ich mußte zu Dir. Gott sei Dank, daß ich Dich allein fand! Ich fürchtete schon, ich müsse das ganze Fegefeuer des heimathlichen Zornes passiren und mich mit der gesammten Verwandtschaft herumschlagen, um zu Dir zu gelangen.“
Reinhold’s Gesicht, das noch in der ganzen Freude des Wiedersehens strahlte, verdüsterte sich bei dieser Erinnerung und sein Arm sank langsam nieder.
„Es hat Dich doch noch Niemand gesehen?“ fragte er. „Du weißt, wie der Onkel gegen Dich gesinnt ist, seit –“
„Seit ich mich seiner hochweisen Bestimmung entzog, die mich durchaus an den Comptoirtisch schrauben wollte, und auf und davon ging?“ unterbrach ihn Hugo. „Ja, das weiß ich, und ich hätte den Lärm mit ansehen mögen, der im Hause losbrach, als sie entdeckten, ich sei durchgegangen. Aber die Geschichte ist ja beinahe zehn Jahre her. Der Taugenichts ist nicht gestorben und verdorben, wie es die verwandtschaftliche Liebe ohne Zweifel hundertmal prophezeit und noch öfter gewünscht hat, er kehrt zurück als höchst respectabler Capitain eines höchst vortrefflichen Schiffes, mit allen nur möglichen Empfehlungen an Eure ersten Handelshäuser. Sollten die maritimen und mercantilischen Vorzüge nicht endlich das Herz des zürnenden Hauses Almbach und Compagnie erweichen?“
Reinhold unterdrückte einen Seufzer. „Spotte nicht, Hugo! Du kennst den Onkel nicht, kennst nicht das Leben in seinem Hause.“
„Nein, ich ging noch zu rechter Zeit durch,“ bekräftigte der Capitain. „Und das ist überhaupt das Gescheidteste – so solltest Du es auch machen.“
„Was fällt Dir ein? Meine Frau, das Kind –“
„Ja so!“ sagte Hugo etwas verlegen. „Ich vergesse immer, daß Du verheirathet bist. Armer Junge, Dich haben sie bei Zeiten festgekettet. Solch ein Traualtar ist der sicherste Riegel, den man allen etwaigen Freiheitsgelüsten vorschiebt. Nun, fahre nur nicht gleich auf! Ich glaube ja gerne, daß man Dich zu dem Jawort nicht geradezu gezwungen hat. Wie Du aber dazu gekommen bist, das wird wohl der Onkel zu verantworten haben, und die melancholische Stellung, in der ich Dich traf, spricht auch nicht gerade sehr für die Glückseligkeit eines jungen Ehemannes. Laß Dir doch einmal in’s Auge blicken, damit ich sehe, wie es drinnen ausschaut!“
Er ergriff ihn ohne Umstände beim Arme und zog ihn nach dem Fenster hin. Erst hier im hellen Tageslichte sah man, wie unendlich ungleich die beiden Brüder waren, trotz einer unleugbaren Aehnlichkeit in ihren Zügen. Der Capitain, der Aeltere von Beiden, war von kräftiger und doch eleganter Gestalt, das hübsche, offene Antlitz gebräunt von Luft und Sonne; sein Haar kräuselte sich leicht, und die braunen Augen sprühten Lebenslust und Lebensmuth. Seine Haltung war leicht und sicher, wie die eines Mannes, der gewohnt ist, sich in den verschiedensten Umgebungen und Verhältnissen zu bewegen, und das ganze Wesen hatte einen Zug kecker, übermüthiger Laune, die bei jeder Gelegenheit hervorbrach, aber zugleich eine so frische, offene Liebenswürdigkeit, daß es schwer war, ihm zu widerstehen.
Der um einige Jahre jüngere Reinhold machte einen durchaus verschiedenen Eindruck. Er war schlanker, bleicher als der Bruder; Haar und Augen waren dunkler, und die letzteren blickten ernst, ja düster. Aber es lag etwas auf dieser Stirn und in diesen Augen, das um so mehr anzog, als sich nicht leicht enträthseln ließ, was sich eigentlich dahinter barg. Hugo war vielleicht der Hübschere von Beiden, und doch entschied eine Vergleichung unbedingt zu Gunsten des jüngeren Bruders, der im vollsten Maße jenen seltenen und gefährlichen Reiz des „Interessantseins“ besaß, dem oft genug die vollendete Schönheit weichen muß.
Der junge Mann machte einen hastigen Versuch, sich der angedrohten Beobachtung zu entziehen. „Hier darfst Du nicht bleiben,“ sagte er bestimmt. „Der Onkel kann jeden Moment eintreten, und dann giebt es eine furchtbare Scene. Ich bringe Dich vorläufig nach dem Gartenhause, das ich für mich allein habe einrichten lassen. Du wirst schwerlich der Familie vor die Augen kommen dürfen, aber Deine Ankunft muß sie doch – erfahren. Ich werde sie ihr mittheilen –“
„Und den ganzen Sturm allein aushalten?“ unterbrach ihn der Capitain. „Bitte, das ist meine Sache! Ich gehe jetzt stehenden Fußes hinauf zu dem Herrn Onkel und der Frau Tante und stelle mich ihnen als gehorsamer Neffe vor.“
„Aber Hugo! Bist Du denn ganz von Sinnen? Sie ahnen ja noch gar nichts von Deinem Hiersein.“
„Eben deshalb! Mit Ueberrumpelung nimmt man die stärksten Festungen, und ich habe mich lange darauf gefreut, einmal wie eine Bombe mitten unter die grollende Verwandtschaft zu fahren und zu sehen, was für ein Gesicht sie macht. Aber noch eins, Reinhold, Du giebst mir das Versprechen, ruhig hier unten zu bleiben, bis ich zurückkomme. Du sonst nicht in die peinliche Lage gerathen, Zeuge davon zu sein, wie die ganze Schale des Familienzornes auf mein sündiges Haupt geleert wird. Du könntest in brüderlicher Aufopferung etwas davon auffangen wollen, und das stört mir den ganzen Feldzugsplan. – Jonas, komm einmal herein!“
Er öffnete die Thür und ließ eine Mann ein, der bisher draußen im Hausflur geharrt hatte. „Das ist mein Bruder. Sieh ihn Dir ordentlich an! Du hast Dich bei ihm zu melden und Dein Compliment zu machen. Noch einmal, Reinhold, Du versprichst mir, während der nächsten halben Stunde das Familienzimmer nicht zu betreten. Ich werde schon allein da oben Ordnung schaffen, und müßte ich die ganze Baracke mit Sturm nehmen.“
Er war zur Thür hinaus, ehe der jüngere Bruder auch nur eine Einwendung machen konnte. Noch halb betäubt von dem schnellen Wechsel der letzten zehn Minuten, blickte er auf die breite vierschrötige Gestalt des neuen Ankömmlings, der jetzt einen eleganten Reisekoffer auf die Dielen niedersetzte und sich dicht daneben aufpflanzte.
„Matrose Wilhelm Jonas von der ,Ellida‘, jetzt zur Dienstleistung bei dem Herrn Capitain Almbach!“ rapportirte er vorschriftmäßig, und versuchte dabei eine Bewegung, die wahrscheinlich eine Verbeugung ausdrücken sollte, mit dem anbefohlenen Complimente aber nicht die geringste Aehnlichkeit hatte.
„Es ist gut,“ sagte Reinhold zerstreut. „Lassen Sie das Gepäck einstweilen hier! Ich muß erst hören, wie lange mein Bruder zu bleiben gedenkt.“
„Wir bleiben einige Tage hier bei dem Herrn Onkel,“ versicherte Jonas in großer Gemüthsruhe.
„So? Ist das schon fest bestimmt?“
„Ganz fest.“
„Ich begreife Hugo nicht,“ murmelte Reinhold. „Er scheint keine Ahnung von dem zu haben, was ihm hier bevorsteht, und doch müssen meine Briefe ihn darauf vorbereitet haben. Unmöglich kann ich ihn den ganzen Sturm allein aushalten lassen.“
Er machte eine Bewegung nach der Thür hin, aber diese war vollständig blockirt durch die breite Gestalt des Matrosen, die auch auf den unwillig fragenden Blick des jungen Mannes sich nicht vom Platze rührte.
„Der Herr Capitain hat gesagt, er würde schon allein da oben Ordnung schaffen,“ erklärte er lakonisch, „also schafft er sie auch. Der setzt Alles durch.“
„Wirklich?“ fragte Reinhold, etwas betroffen von der unerschütterlichen Zuversicht dieser Worte. „Sie scheinen meinen Bruder sehr genau zu kennen.“
„Ganz genau.“
Unschlüssig, ob er dem Wunsche Hugo’s Folge leisten solle oder nicht, trat Reinhold an das nach dem Hofe hinausgehende Fenster und gewahrte dort drei oder vier Gesichter, dem Dienstpersonal angehörig, die mit dem Ausdruck grenzenloser Wißbegierde einen Einblick in das Comptoir zu gewinnen strebten. Der junge Mann ließ einen Ausruf unterdrückten Aergers hören und wandte sich wieder zu dem Matrosen.
„Die Ankunft meines Bruders scheint bereits im Hause bekannt zu sein,“ sagte er hastig. „Fremde sind doch sonst nicht eine solche Seltenheit im Comptoir, und die Neugierde gilt offenbar Ihnen.“
„Hat nichts zu sagen,“ brummte Jonas. „Wenn auch das ganze Nest rebellisch wird und uns angafft. Dergleichen ist uns gar nichts Neues mehr. Die Wilden auf den Südseeinseln machen es gerade ebenso, wenn unsere ,Ellida‘ anlegt.“