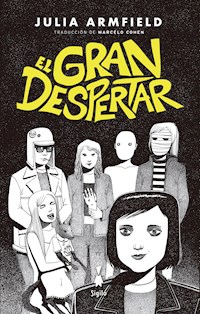Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Kommode
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Meeresbiologin Leah sinkt bei einer Forschungsreise im U-Boot mit ihrem Team auf den Ozeanboden ab und bleibt nach dem Unfall sechs Monate lang verschollen. Als Leah wieder nach Hause kommt, ist ihre Frau Miri überglücklich. Doch schnell wird Miri klar, dass Leah sich verändert hat. Julia Armfield gelingt es, die Liebesbeziehung dieser zwei Frauen mit all ihren Facetten darzustellen: die Verleumdung aus Selbstschutz, die zarten Empfindungen, Rituale, Wut und Trauer um entschwundene Freuden, all die kleinen Momente, aus denen eine innige und dauerhafte Liebe besteht. Stilsicher, hervorragend und abgrundtief ehrlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Armfield
Gestalten der Tiefe
1. Auflage
© 2024 Kommode Verlag, Zürich
Alle Rechte vorbehalten.
Originaltitel der englischen Erstausgabe:
Our Wives Under The Sea, Picador 2022
© Julia Armfield 2022
Übersetzung: Hannah Pöhlmann (Planet Neun – Kommunikation in Wort und Bild, planet-neun.de)
Lektorat: Sabine Wolf, torat.ch
Korrektorat: Patrick Schär, torat.ch
Cover, Gestaltung und Satz: Anneka Beatty
ISBN 978-3-905574-39-5
Kommode Verlag GmbH, Zürich
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Julia Armfield
Gestalten der Tiefe
Inhalt
Lichtdurchflutete Zone
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Dämmerzone
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Mitternachtszone
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Grundlose Tiefe
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Tiefseegraben
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Miri.
Leah.
Eine Anmerkung zum Text
Danksagung
für Rosalie, auf trockenem Boden und andernorts
Bedenke die List der See – wie ihre schrecklichsten Geschöpfe unter Wasser dahingleiten, zum größten Teile unsichtbar, heimtückisch verborgen unter dem schönsten Azur. Bedenke auch den teuflisch schönen Glanz, der viele seiner gedankenlosesten Geschlechter schmückt, wie bei der schlanken Wohlgestalt vieler Haifischarten. Bedenke einmal mehr den universalen Kannibalismus der See, wo ein Geschöpf das andre frißt und Krieg herrscht bis in Ewigkeit, seit Anbeginn der Welt.
Bedenk das alles und betrachte dann die sanfte, grüne und fügsame Erde; betrachte sie beide, die See und das Land – bemerkst du nicht in dir die seltsame Entsprechung? Denn wie dies schaurige Weltmeer das grüne Land umschließt, so liegt ein Eiland in des Menschen Seele, ein Tahiti, voller Frieden, voller Freude – jedoch umringt vom ganzen Grauen unseres kaum gekannten Lebens. Gott schütze dich! Leg nicht von jenem Eiland ab, denn du kannst nie zurück!
Moby-Dick
Gibt es da nicht einen medizinischen
Ausdruck für?
Ertrinken.
Der weiße Hai
Lichtdurchflutete Zone
Miri.
Die Tiefsee ist ein Geisterhaus, ein Ort, an dem sich in der Dunkelheit Dinge bewegen, die nicht existieren sollten. Unruhig, das ist das Wort, das Leah benutzt. Sie neigt ihren Kopf zur Seite, als ob sie auf ein Geräusch reagiert, doch der Abend ist still, nur das gleichmäßige Summen der Straße ist hörbar, wenig, worauf man aufmerksam werden könnte.
»Der Ozean ist unruhig«, sagt sie, »sogar weiter unten, als man denkt. Bis zum tiefsten Punkt gibt es Bewegung.« Sie spricht selten so viel und so zusammenhängend, die Beine gekreuzt und den Blick zum Fenster gerichtet, die vertraute Schräglage ihres Ausdrucks, alle Züge rutschen leicht nach links. Mir ist inzwischen bewusst, dass diese Art von Unterhaltung im Grunde nicht für mich bestimmt ist, es ist einfach ein Gespräch, das sie nicht anders führen kann, das Ergebnis von Fragen, die in einem verschlossenen Teil ihres Kopfes gestellt werden. »Man muss sich vor Augen führen«, sagt sie weiter, »dass Lebewesen unter unvorstellbaren Bedingungen gedeihen können, sie brauchen nur die richtige Haut.«
Wir sitzen auf dem Sofa, seit ihrer Rückkehr letzten Monat machen wir das abends so. Früher saßen wir auf dem Teppich, die Ellbogen auf den Couchtisch gestützt wie Teenager, und aßen bei laufendem Fernseher. Sie isst nur noch selten zu Abend, deshalb esse ich in der Küche im Stehen, um später weniger aufräumen zu müssen. Manchmal schaut sie mir beim Essen zu, dann kaue ich alles zu einem Brei und strecke ihr die Zunge raus, bis sie damit aufhört. An den meisten Abenden reden wir nicht miteinander – Schweigen, das Rückgrat der neuen Form unserer Beziehung. An den meisten Abenden sitzen wir nach dem Essen bis um Mitternacht zusammen auf dem Sofa, dann sage ich ihr, dass ich ins Bett gehe.
Wenn sie spricht, redet sie immer über das Meer, die Hände gefaltet und in einem Tonfall, als würde sie zu einem anderen Publikum als mir sprechen. »Es gibt keine leeren Stellen«, sagt sie, ich stelle mir vor, wie sie auf Moderationskarten schaut, durch Folien klickt, »wie tief man auch hinuntergeht, man findet immer etwas.«
Ich dachte immer, es gäbe so etwas wie Leere, dass es Orte auf der Welt gibt, an denen man allein sein kann. Ich glaube, das stimmt immer noch, aber mein Denkfehler war, dass ich angenommen hatte, Einsamkeit wäre ein Ort, an den man gehen kann, und nicht ein Ort, an dem man zurückgelassen wird.
∼
Es ist drei Uhr, und ich halte den Telefonhörer vom Ohr weg, die Warteschleifenmusik klingt nach Beethovens Schlachtensinfonie, gespielt auf einem Spielzeugsynthesizer. Die Küche ist eine Müllhalde aus Kaffeetassen, der Abfluss mit Teebeuteln verstopft. Eines der Lämpchen über der Abzugshaube flackert – aus dem Augenwinkel wie ein zuckender Muskel im Lid. Auf der Arbeitsfläche liegt Folgendes: eine Orange, halb geschält; zwei Messer; eine Plastiktüte mit Toastbrot. Ich habe noch kein Mittagessen vorbereitet, vor etwa einer Stunde habe ich wahllos verschiedene Sachen herausgeholt, bevor ich merkte, dass ich der Aufgabe nicht gewachsen war. Am Kühlschrank klebt ein Zettel mit der Einkaufsliste, geschrieben mit einem lila Kugelschreiber: Milch, Käse, Schlafmittel (irgendeins), Heftpflaster, Kochsalz.
Die Warteschleifenmusik läuft weiter, ich taste mit meiner Zunge im Mund herum, meine Zahnlücken erfühlend, wie ich es immer tue, wenn ich auf etwas warte. Einer meiner Backenzähne ist angeknackst, was ich seit einigen Wochen ignoriere, weil es nicht weh genug tut, um einen Aufstand zu rechtfertigen. Ich fahre mit der Zunge über den Zahn, fühle die Erhebung und den Spalt, wo der Bruch entlang des Zahnschmelzes verläuft. Mach das nicht, ich stelle mir vor, wie Leah mich ermahnt, wie sie es immer tat, wenn ich in der Öffentlichkeit mit der Zunge über meine Zähne fuhr, das sieht aus, als hättest du vergessen, Zahnseide zu benutzen. Auch wenn ich Leah davon nichts erzähle, träume ich fast jede Nacht, wie ich meine Backenzähne über die Bettdecke spucke wie Wasser, das aus einem Hahn tropft. Ich halte mir die Hände unters Kinn, um die Zähne aufzufangen. Das allgemeine Tempo dieser Träume ist immer ähnlich: das Greifen und Ziehen an etwas Lockerem, das Innehalten, dann der plötzliche Schwall der Fontäne. Jedes Mal scheint der Fehler darin zu liegen, dass ich den Backenzahn unten links nicht hätte berühren dürfen. Jedes Mal: Ich lege den falschen Schalter um, meine Neugier wird durch einen Regen von Zähnen belohnt, zu viele, um sie mit zwei Händen zu fangen und wieder in den Mund zu schieben, mein Zahnfleisch eine blanke rosa Linie unter meiner Lippe.
Die Verbindung wird unterbrochen, die Musik wird von einer Tonbandstimme abgelöst, die mir zum fünfzigsten Mal mitteilt, mein Anruf sei wichtig, bevor die Schlachtensinfonie mit gefühlter Feindseligkeit erneut einsetzt. Leah sitzt auf der anderen Seite des Zimmers und hält eine Tasse mit Wasser in den Händen – eine seltsam wärmende Geste, wie man eine Tasse Tee halten würde. Sie trinkt seit ihrer Rückkehr nichts Heißes mehr und hat mich gebeten, meinen Kaffee nicht in ihrer Nähe zu kochen, der Geruch der Kaffeemaschine scheint bei ihr einen Würgereiz auszulösen. Kein Grund zur Sorge, hat sie mehr als einmal gesagt, das regelt sich von selbst. Normalerweise ist das doch so. Empfindungen sind immer noch kompliziert: Berührungen schmerzen, Gerüche und Geschmäcker sind wie kleine Invasionen. Ich habe Leah dabei zugesehen, wie sie den Rand eines Toasts mit ihrer Zunge berührt und sie dann mit verzogenem Gesicht zurückgezogen hat, als ob er sauer wäre.
»Ich bin immer noch in der Warteschleife«, sage ich ohne wirklichen Grund außer, es gesagt zu haben. Sie sieht mich an und blinzelt langsam. Falls dich das interessiert, überlege ich hinzuzufügen und tue es dann doch nicht.
Heute Morgen gegen sechs Uhr, als Leah aufgewacht ist, hatte sie sofort Nasenbluten. Ich habe im Zimmer gegenüber geschlafen und habe es daher nicht gesehen, doch selbst aus der Entfernung kenne ich inzwischen ihre Muster. Ich war vorbereitet, bin um Viertel nach sechs aufgestanden, rechtzeitig, um ihr im Badezimmer einen Waschlappen zu reichen, den Wasserhahn aufzudrehen und ihr zu sagen, sie soll den Kopf nicht in den Nacken legen. Man kann die Uhr danach stellen – morgens roter Mund, rotes Kinn, roter Schwall ins Waschbecken.
Wenn sie überhaupt darauf eingeht, erklärt sie, dass es etwas mit dem Druck zu tun habe, ohne den sie jetzt wieder auskommen müsse. Ihr Blut hat den Sinn für Grenzen verloren, es fließt einfach, wohin es will. Manchmal blutet sie aus den Zähnen, oder eigentlich eher aus dem Zahnfleisch, was aufs Gleiche hinausläuft, wenn man sie anschaut. In den Tagen direkt nach ihrer Rückkehr quoll das Blut unkontrolliert aus ihren Poren, sodass ich manchmal hereinkam und sie vorfand wie ein Nadelkissen, rot gepunktet, wie von feinen Stichen durchlöchert. Eiserne Jungfrau, hatte sie beim ersten Mal gesagt und versucht zu lachen – ein angestrengtes Geräusch, wie das Auswringen von etwas Nassem.
Anfangs fand ich die ganze Sache furchtbar beängstigend. Wenn sie blutete, geriet ich in Panik, zog mir die Schuhe an und wollte sie in die Notaufnahme bringen. Erst allmählich begriff ich, dass man ihr gesagt hatte, so etwas in der Art zu erwarten. Mit einer fast schon geübten Geste schob sie meine Hände von ihrem Gesicht und meinte, es sei kein Problem. So kannst du sowieso nicht rausgehen, Miri, sagte sie und deutete auf die Schuhe, in die ich mich ohne zu gucken gezwängt hatte, die passen nicht zusammen.
Wieder und wieder flehte ich sie an, sich von mir helfen zu lassen, und stieß nur auf Widerstand. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, sagte sie und blutete weiter. Die Offensichtlichkeit des Problems und ihre Weigerung, Hilfe von mir anzunehmen, waren erst frustrierend und machten mich irgendwann ziemlich wütend. Das alles ging schon zu lange, und ich war zu hilflos. Wie jemand, der mehr als viermal niest, schlagartig die Sympathie des Publikums verliert, so war es bei mir und Leah. Kannst du nicht damit aufhören, wollte ich sie fragen, du machst die Laken dreckig. An manchen Morgen würde ich ihr gern vorwerfen, sie tue es absichtlich, dann schaue ich weg, verleihe meinem Mund einen anderen Ausdruck und gieße mir Kaffee ein, überlege, joggen zu gehen.
Heute früh im Bad habe ich ihr den Waschlappen gereicht und zugesehen, wie sie sich die Hände mit einem Stück Seife einschmierte. Meine Mutter hat immer gesagt, es sei genauso schlimm, das Gesicht mit Seife zu waschen wie es schmutzig zu lassen, wegen irgendwelcher aggressiver Chemikalien, die die natürlichen Öle zerstörten. Bei meiner Mutter hat sich alles um aggressive Chemikalien gedreht – sie hatte eine Mappe mit Zeitungsausschnitten über die Krebsrisiken verschiedener Fleischprodukte, und mir hatte sie Bücher über UV-Strahlen und Wohnungseinbrüche geschickt und eine Broschüre darüber, wie man aus Bettlaken eine Feuerleiter knotet.
Nachdem sie ihr Gesicht gewaschen hatte, trat Leah vom Waschbecken zurück. Sie klopfte sich das Gesicht erst mit den Handrücken, dann mit den Handflächen ab und fuhr dann mit einem Finger unter das linke Augenlid und dann unter das rechte, ihre öligen Augenhöhlen untersuchend. Im Spiegel sah ihre Haut aus wie etwas, das aus dem Wasser geholt wurde. Die gelben Augen von jemandem, der ertrunken war, von jemandem, der auf dem Rücken trieb. Es ist alles in Ordnung, sagte sie, gleich ist alles wieder in Ordnung.
Zurück in der Küche: lautes Rauschen am Telefon. Dann ein plötzliches Klicken. Es meldet sich eine andere Roboterstimme, die sich leicht von der unterscheidet, die fortlaufend wiederholt hat, mein Anruf sei wichtig. Ich soll Leahs Personalnummer eingeben, gefolgt von ihrer Dienstnummer, ihrer Versetzungsnummer und der Bescheinigungsnummer, die sie vom Center nach der letzten Expedition erhalten haben soll. Die Stimme erklärt weiter, der Anruf werde beendet, wenn ich die Nummern nicht in der richtigen Reihenfolge eingebe. Ich habe Leahs Personalnummer nicht, und der ganze Zweck meines Anrufs war zu versuchen durchzukommen, mit jemandem zu sprechen und die Personalnummer zu erhalten. Ich gebe alle geforderten Nummern ein, abgesehen von der Personalnummer, woraufhin sich eine dritte Bandstimme meldet, mich in einem strengen, roboterhaften Tonfall ausschimpft und als hilfreichen Nachtrag anmerkt, mein Anruf werde nun beendet.
Leah.
Bis vor Kurzem waren mehr Menschen auf dem Mond als unter sechstausend Meter unter dem Meeresspiegel. Daran denke ich oft – die Unbewohnbarkeit bestimmter Orte. Ein Fußabdruck, der irgendwann auf der Mondoberfläche hinterlassen wurde, könnte theoretisch auf unbestimmte Zeit dort bleiben, unverändert. Unerodiert von der Atmosphäre, von Wind oder Regen, könnte eine dort entstandene Spur sicherlich mehrere Jahrhunderte überdauern. Der Ozean ist anders, der Ozean verwischt seine Spuren.
Wenn ein U-Boot abtaucht, muss innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne eine Reihe von Dingen passieren. Der Auftrieb entsteht einzig und allein dadurch, dass das Wasser mit einer Kraft gegen ein Objekt drückt, die proportional zum Gewicht des verdrängten Wassers steht. Wenn ein U-Boot also an der Oberfläche treibt, sind die Ballasttanks mit Luft gefüllt, wodurch die Gesamtdichte geringer ausfällt als die des umliegenden Wassers (und es somit weniger Wasser verdrängen kann). Beim Sinken füllen sich die Ballasttanks mit Wasser, das durch elektrische Pumpen in das Schiff gesaugt wird, während gleichzeitig die Luft herausgedrückt wird. Es ist ein seltsamer Akt der Hingabe, wenn man genauer darüber nachdenkt, der Akt des Sinkens. Das Abtauchen unter die Wasseroberfläche ist und bleibt ein Untergang, auch wenn er absichtlich herbeigeführt wird – ein einfacher Vorgang, bei dem Wasser aufgenommen wird, so wie man zum Ertrinken nur den Mund öffnen muss.
Solche Gedanken nannte Miri meine versunkenen Gedanken, sie klopfte mir mit der flachen Hand auf den Kopf, wenn ich still wurde und wegen eines kreisenden Gedankens die Stirn runzelte. Wie haben sie es so tief dort hineingeschafft?, fragte sie dann. Gleich stecken sie dir schon im Hals. Wenn sie das tat, griff ich nach ihrer Hand und hielt sie fest, dann nahm ich die andere dazu und drückte beide Hände an meine Schläfen, als ob ich ihr die Verantwortung dafür gäbe, meinen Kopf in einem Stück zu halten.
Den Geruch eines untergehenden U-Boots zu beschreiben, ist schwierig. Er ist nicht einfach zu fassen – Metall und heißes Fett, Sauerstoffmangel, Ammoniak, der Geruch von allem außer dem Notwendigsten wird weggefiltert. Zwanzig Minuten bevor wir den Kontakt verloren, hatte Jelka gesagt, sie habe den Eindruck, es rieche nach Fleisch, was seltsam war, denn ich hatte dasselbe gedacht – ein heißer, unangenehmer Geruch nach etwas Gekochtem. Ich weiß noch, dass ich meine Finger anschaute und fast damit rechnete, sie wären gebraten, dann beugte ich mich hinunter, um die Haut an meinen Schienbeinen, Knien und Knöcheln zu betrachten. Natürlich war da nichts, und es gab auch keinen anderen Grund für den Geruch, der uns beide mit solcher Wucht traf. Als Jelka Matteo davon erzählte, antwortete er, sie solle sich die Nase zuhalten, wenn es sie so sehr störe, und ich sagte nichts zu ihrer Unterstützung. Zuerst war es nur das Funkgerät, knisternd war der Kontakt zur Oberfläche abgebrochen und nicht wiedergekommen. Ich weiß noch, wie Matteo die Stirn runzelte und mich bat, nach einem Signal zu suchen, während er sich um die Steuerung kümmerte. Ich hielt die Sendetaste gedrückt und redete unsinniges Zeug ins Funkgerät, in der Annahme, das Center würde jeden Moment wieder online sein und mich fragen, was ich da tue. Zehn Minuten später, als das gesamte System offline ging, fiel mir auf, dass die Kommunikation nicht wie ein schwankendes Signal allmählich verschwunden, sondern vielmehr abgeschaltet worden war, doch da hatten wir es schon mit dringenderen Dingen zu tun.
Miri.
Seit drei Wochen ist sie jetzt wieder zu Hause, und ich habe mich an fast alles gewöhnt.
Morgens frühstücke ich, sie isst nichts, dann beantworte ich eine halbe Stunde lang meine EMails und ignoriere, dass sie mit Klopapierbündeln, die sie sich zum Blutaufsaugen ans Zahnfleisch geklemmt hat, in der Wohnung herumwandert. Ich schreibe Förderanträge für gemeinnützige Organisationen und habe schon immer von zu Hause aus gearbeitet, das hat mich auch nie besonders gestört, bis sie wegging und ich gezwungen war, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Jetzt, wo sie wieder da ist – jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, dass sie wieder da ist –, kann ich mich nicht entscheiden, ob ich ihre Anwesenheit als Erleichterung oder als Belästigung empfinde.
Ich meckere über halb leere Gläser auf der Fensterbank, über nicht weggebrachten Müll. Ich habe ständig Geschwüre im Mund und beschwere mich über nicht staubgesaugte Böden. Nachts träume ich, ich würde so stark mit den Zähnen knirschen, dass sie abbrächen wie Streichhölzer.
Bei den Leuten, die über uns wohnen, läuft grundsätzlich der Fernseher. Selbst wenn ich weiß, dass beide nicht zu Hause sind, bei der Arbeit oder im Kino, sickert der Lärm durch die Decke – tröpfelnde Dialoge, Titelmusik, die an der Wand herunterläuft wie die Feuchtigkeit, die sich am Kaminsims zu Schimmel versprenkelt.
Manchmal, wenn ich ganz genau hinhöre (oder mich auf einen Stuhl stelle), kann ich erraten, welche Sendung oben läuft, und stelle unseren Fernseher auf denselben Sender, was die Belästigung etwas abschwächt. Ihre bevorzugten Programme sind Gameshows und Sendungen, in denen Menschen die Aufgabe haben, sich an exotischen Orten gegen Geld ineinander zu verlieben. Solche Shows mag ich auch, mag ihren Zauber, die mondfarbenen Zähne. Die Teilnehmenden einer der Shows, die ich oft simultan mit den Nachbarn schaue, müssen einander vier Minuten lang ununterbrochen in die Augen schauen, denn angeblich besagen Studien, dass man sich innerhalb dieser Zeitspanne verlieben kann. Das scheint auch oft zu klappen, zumindest für die Dauer einer Folge. Nur einmal warf ein Teilnehmer nach zwei Minuten seinen Stuhl zurück und verließ das Set, später sagte er, etwas an seiner Partnerin habe ihn verunsichert. Naturdokus mag ich weniger, wenn die Nachbarn eine schauen, passe ich den Sender in der Regel nicht an. Einmal bin ich abends auf dem Sofa eingeschlafen, und als ich aufwachte, vernahm ich eine ungewöhnlich deutliche Stimme aus der Wohnung über uns, die etwas über kalifornische Schlauchpflanzen erzählte: Futtersuchende Insekten werden von der tassenartigen Öffnung des Blattes – beziehungsweise dem Mund – angezogen, einmal dort, sind sie bereits in die Falle getappt, sie rutschen am glatten Rand ab, der von einer natürlichen Nektarspur ständig feucht gehalten wird. Nun ist das Insekt gefangen, wird von den Verdauungssäften der Pflanze ertränkt und langsam aufgelöst. Das war ein paar Monate nachdem Leah weg war, als die Anrufe vom Center noch halbwegs regelmäßig waren – die freundlichen, professionellen Stimmen, die mir versicherten, sie täten, was sie könnten. Ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa lag und der Sendung mehrere Minuten lang zuhörte, dann griff ich nach der Fernbedienung und richtete sie auf die Decke.
Leah ging manchmal zu ihnen nach oben, klopfte spät in der Nacht und bat sie, den Fernseher leiser zu stellen. Sie waren nett, sagte sie, als sie zurück war, und rieb sich die Hände als Zeichen für einen erfolgreich erledigten Job. Haben sich mehrmals entschuldigt, ich mag die. Sie ließen nachts den Fernseher laufen, damit die Katze Gesellschaft habe, sie würden ihn leiser stellen, alles halb so wild. Die Lautstärke wurde nie heruntergedreht, aber ich glaube nicht, dass Leah das sonderlich störte. Mit dem Hochgehen schien für sie der Sinn des Ganzen erfüllt; den Nachbarn mitzuteilen, leiser zu drehen, schien wichtiger, als dass tatsächlich leiser gedreht wurde. Nach Leahs Abreise war ich dankbar für den Lärm, obwohl er mich vorher genervt hatte. Sonntagmorgens stellte ich mich auf den Küchentisch und lauschte den Titelsongs von Serien und fröhlichen Stimmen, die Nasenspray, Zuckerrübensirup oder nicht klebende Teflonpfannen bewarben.
»Ich kann das nicht leiden«, sagt Leah plötzlich. Seit mindestens einer Stunde sitzt sie in der Zimmerecke und kaut auf dem Kragen ihres Pullovers herum, eine seltsame, reflexartige Geste, so wie man an einem eingerissenen Fingernagel herumnagt. Ich frage sie, was sie meint, und sie sagt nichts, gestikuliert nur nach oben, in dem Moment schwappt das Fernsehprogramm der Nachbarn von dem Abspann einer Sendung zu den Klängen eines Werbespots in einer hektischen Dur-Tonart. Ich gehe nach oben und hämmere an die Tür, aber die Nachbarn antworten nicht, der Fernsehlärm im Flur merkwürdig leiser als in der darunter liegenden Wohnung. Da fällt mir auf, dass ich die Nachbarn noch nie zu Gesicht bekommen habe, dass ich die ganze Zeit, in der wir hier leben, wo wir leben, ihre Anwesenheit als selbstverständlich wahrgenommen habe, bestätigt durch gelegentliche Indizien: Schritte, gedämpfte Musik, nächtliches Möbelrücken. Ich habe Leah nie etwas über die Nachbarn gefragt; kein einziges Mal, nachdem sie bei ihnen war und sie bat, den Fernseher leiser zu stellen, habe ich irgendetwas gefragt. Ich überlege, ob das seltsam ist, und verwerfe die Frage dann wieder. Eigentlich spielt es keine Rolle, mit den Nachbarn habe ich ja kein Problem, vielmehr mit ihrem Fernseher.
Ich war insgesamt nur sechs Minuten lang weg, aber in dieser Zeit hat sich Leah schon aus der Ecke im Wohnzimmer bewegt und ins Badezimmer eingeschlossen, wo sie Badewasser einlässt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Momentan wache ich oft zu merkwürdigen Uhrzeiten auf und höre, dass im Badezimmer das Wasser läuft. Vier Uhr früh, Morgengrauen, aschfahles Zucken am Himmel über den Telefonleitungen – laufendes Wasser im Bad, in der Küche, in dem Raum, wo die Waschmaschine und der Trockner stehen. Schon mehrmals bin ich hereingekommen und habe Leah auf dem Wannenrand sitzend vorgefunden, im Halbschlaf ins Wasser starrend. Manchmal wirkt es auf mich, als würde sie überlegen, ob sie in die Wanne steigen soll, manchmal hat das Bild aber auch etwas Unbehagliches – der Anblick von jemandem, dessen Blick ins Wasser gefallen ist, unwiederbringlich versunken.
Ich stehe vor der Badezimmertür, überlege, ob ich klopfen soll, ob ich sie bitte, mich hereinzulassen. Ich stelle mir vor, dass ich höre, wie Wasser über den Boden fließt und sich auf dem lavendelfarbenen Linoleum ein Pool bildet. Sie hat die elektrische Kiste, die sie zum Schlafen benutzt, mit ins Badezimmer genommen. Das Ding kam per Post, ohne Absender – ein Abschiedsgeschenk vom Center –, zusammen mit einem Paar Kompressionsstrümpfen und einem in PVC eingebundenen Buch mit Aphorismen. Ich höre, wie sie es einschaltet, es erzeugt ein schauriges Geräusch – etwas Aufquellendes, das Dröhnen von etwas, das sich ausbreitet, brodelt, das Grollen und Stöhnen von etwas, das sich zu einem Brüllen auftürmt.
∼
Vor langer Zeit lernten wir uns kennen. Ich glaube, das ist wichtig – die Tatsache eines Kennenlernens, die Tatsache, dass ich mich an das Empfinden eines Davor erinnere. Sich kennenlernen impliziert einen Punkt vor dem Wissen, einen Punkt bevor Leah und ich dieses ineinander verwobene unentwirrbare Ding wurden. Früher machten wir ein Spiel daraus, uns zu erinnern, wir stießen uns gegenseitig den Ellbogen in die Seite: Weißt du noch, als ich dir Blumen geschickt habe, als du in einer anderen Stadt gewohnt hast, weißt du noch, wie du mir Schwimmunterricht gegeben hast, weißt du noch, als wir an meinem Geburtstag essen waren und du hast Wasser über den ganzen Tisch verschüttet und der Kellner hat uns angeschaut, als ob wir gerade aus einem Loch in der Erde gekrabbelt wären. Ich glaube, jedes Paar genießt seine eigene Mythologie, Erinnerungen wie Tafeln, die einen durch die Ausstellung führen: Abb. A. Porträt des tanzenden Paares bei der katholischen Hochzeit eines Kollegen. Abb. B. Kohlezeichnung des Paares, das sich streitet, wer was gesagt hat bei einem verkoksten Dinner mit Bekannten (beachten Sie die feinen Linien, die teilweise durchscheinen, dort hat der Künstler wiederholt ausradiert und neu gezeichnet). Einzeln betrachtet ist es leicht, sich an Dinge zu erinnern. Die Szenen scheinen in sich abgeschlossen: als wir auf der Kostümparty waren, als jemand im Club mein Portemonnaie klaute, als unser Zug für eine Stunde und fünfundvierzig Minuten unter der Erde stehen blieb und Leah meine Hand hielt, bis er wieder losfuhr. So kann man durch die Ausstellung gehen, sich Lieblingsbilder aussuchen, jene, die man am ehesten behalten will, mit einem aufgeklebten Punkt auf dem Rahmen kennzeichnen. Schwieriger ist es, die Bilder zusammenzubringen, die Punkte so zu verbinden, dass sie greifbaren Sinn ergeben. Ich erinnere mich an das erste Mal, als wir uns küssten, das erste Mal, als wir miteinander schliefen, das erste Mal, als Leah mir erzählte, ihr Vater sei ihr als Geist am Fußende ihres Bettes erschienen. Ich erinnere mich an den Sex – oder an Sex im abstrakten Sinn –, daran, dass wir es oft und gern taten, obwohl ich mich kaum an das eine oder andere Mal erinnern kann. Ich erinnere mich an das erste Mal, als sie wegging, an das erste Mal, als ich zum Verabschieden mitkam. Ich erinnere mich an das letzte Mal – daran, dass sie für drei Wochen weg sein sollte und sechs Monate lang verschwunden war, daran, dass niemand von uns wusste, was passiert war, daran, dass das Center mehrmals anrief, um widersprüchliche Informationen zu geben, bis es aufhörte anzurufen. Aus nächster Nähe ist das alles ganz einfach – helle Blitze, eine Beziehung, die durch Beweise bestätigt wird, die Bruchstücke, die sie zu einer Tatsache machen. Schwieriger ist es, weit genug zurückzutreten, um uns als Ganzes zu betrachten, nicht als eine Reihe von Bildern, sondern als das Ganze, das diese Bilder darstellen. Das tue ich nicht besonders gern. Wenn ich zu weit zurücktrete, wird mir schwindelig – mein Gedächtnis fühlt sich an, als ob es geschlagen wurde und herumtaumelt, ich bedecke das Gesicht mit den Händen. Ich glaube, es ist einfacher, unsere Manifestation in vielen verstreuten Teilen zu betrachten denn als dieses riesige unlösbare Ding. Ich glaube, es ist einfacher, sich durch unsere verstreuten Stücke durchzukämpfen, in der Hoffnung, etwas zu finden, etwas Einzigartiges aus den Trümmern herauszuziehen und es ans Licht zu retten.
In Kleinteilen betrachtet: Vor langer Zeit lernten wir uns kennen.
Leah.
Panik ist Sauerstoffverschwendung. Als Erstes lernt man beim Tauchen, wie man richtig atmet. Als die Kontrollleuchten ausgingen, hielt ich sechzig Sekunden lang die Luft an, in Gedanken war ich bei der feuchten Flügelform meiner Lunge. In der nordischen Mythologie gibt es einen Brauch, bei dem der Rücken aufgeschnitten wird, die Rippen von der Wirbelsäule getrennt werden und anschließend die Lunge herausgezogen wird. Angeblich soll das Opfer dabei weiterhin atmen können. Meistens wird das Ritual als Foltermethode oder Menschenopfer beschrieben, es ist aber umstritten, ob es tatsächlich jemals außerhalb literarischer Darstellungen praktiziert wurde. So etwas an einer lebenden Person durchzuführen, wäre unmöglich – außerhalb des Körpers würde die Lunge in sich zusammenfallen, und auch wenn sie weiterhin funktionierte, würde das Opfer einen Schock erleiden und von allein aufhören zu atmen. Das Ritual kann einem dennoch glaubwürdig erscheinen, wenn man sich die Lunge vorstellt. Ihre weiten walartigen Kammern, das kahle Gebot all dessen, was sie enthalten sollen. Ich weiß nicht, warum ich das erwähne, außer dass dies meine Gedanken waren in den sechzig Sekunden zwischen dem Herunterfahren des Systems und meinem nächsten Atemzug. Ich stellte mir vor, wie meine Lunge durch meinen Rücken geschleudert wurde und sich weiter aufblähte und zusammenzog. Ich stellte mir vor, wie der Raum in meinem jetzt leeren Brustkorb von Wasser durchströmt wurde und meine Lunge trotzdem weiter funktionierte.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir immer noch dem Protokoll folgten, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Es kommt eigentlich sehr selten vor, dass ein U-Boot sinkt, und es gibt Richtlinien für diesen Fall, wie es Richtlinien für alles gibt. Das Wichtigste ist das sofortige Aussenden eines Notrufs. Je früher man das tut (und je näher man sich der Oberfläche befindet), desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Küstenwache oder ein vorbeifahrendes Schiff das Signal empfängt und bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das Problem ist natürlich, dass ein Notruf nur gesendet werden kann, wenn das System online ist, was bei uns nicht der Fall war. Ich weiß noch, dass Matteo versuchte, das Funkgerät zu bedienen, er bewegte seine Hand über die Konsole und schaute mich an. Ich erinnere mich auch, wie beunruhigend es war, als das elektrische Licht ausging und die Armaturenlichter erloschen – unser U-Boot wirkte plötzlich weniger wie ein Meisterwerk der Technik, sondern eher wie eine schnell sinkende Kiste. Matteo überprüfte die Motoren, die Verteilerkästen, die Druckmessgeräte. »Es ist alles in Ordnung. Es sollte alles funktionieren.«
Wir waren noch am Sinken, als das System ausging, aber schon zu tief, um zu evakuieren. Die CO2-Filter schienen, aus welchen Gründen auch immer, intakt geblieben zu sein, aber da wir keine Möglichkeit hatten, die Ballasttanks zu bedienen, blieb uns nichts anderes übrig, als tiefer zu sinken.
Miri.
Ich drücke den Hörer ans Schlüsselbein und schreie Leahs Namen. Ich mag es eigentlich nicht, die Stimme zu erheben, aber das Geräusch von fließendem Wasser ist in unserer Wohnung inzwischen so allgegenwärtig, dass ich manchmal laut werden muss, um gehört zu werden. Die Frau am Telefon will direkt mit der autorisierten Mitarbeiterin sprechen, ich kann keine Informationen in Leahs Namen entgegennehmen.
»Aber ich habe alle Nummern«, sage ich, »Sie wissen, warum ich anrufe – warum können Sie nicht mit mir sprechen?«
Es hat sechs Anläufe an sechs unterschiedlichen Tagen gebraucht, um überhaupt zu einer echten Person durchzukommen, und die damit verbundene Euphorie hat leider dazu geführt, dass ich überschätzt habe, inwieweit ein echter Mensch tatsächlich helfen kann.
»Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht weiterhelfen«, sagt der echte Mensch, »über Unternehmensangelegenheiten darf ich nur mit autorisierten Mitarbeitern sprechen.«
Ich öffne den Mund, schließe ihn wieder, setze erneut an.
»Aber sie ist meine Ehefrau. Ich habe alle ihre Daten. Wie wäre es, wenn ich so tun würde, als wäre ich sie? Würde das gehen?« Der echte Mensch macht ein kleines unbeholfenes Geräusch.
»Tut mir leid, das ist nicht möglich.« Das laufende Wasser ist weiterhin hörbar. Ich überlege, wieder nach Leah zu rufen, und lasse es.
»Ich könnte auflegen und dann wieder anrufen und meine Stimme verstellen. Wie wäre das? Ich sage gleich am Anfang des Gesprächs, dass ich Leah bin, so kommen Sie nicht in Schwierigkeiten. Wenn jemand fragt, sagen Sie einfach, dass ich sie bin, das klappt, versprochen.«
In der Leitung ist ein seltsames Geräusch zu hören – ich kann nicht sagen, ob der echte Mensch seufzt, weint oder ein Sandwich isst.
»Tut mir leid, das ist nicht möglich, Miri.«
∼
Ein dünner, stechender Regen, als ob jemand Nadeln von den Dächern wirft. Leah sitzt auf dem Sofa und gießt Cherry Cola in einen Plastikbecher mit Hamburgermotiven und trinkt sie nicht, sie gleitet mit ihren Fingern über die Haut ihres linken Arms. Ihre Haut ist silbrig, an den Ellenbogenfalten und um den Hals herum wie Austern. Ich hatte es gleich gesehen, als sie zurückkam, wusste aber nicht, wie ich es ansprechen sollte, doch dann machte sie selbst eine Bemerkung: Sieh dir das an, und das hier, sie haben uns gesagt, wir müssten mit so etwas rechnen.
»Das wird bald weggehen«, sagt sie mehr zu sich selbst als zu mir. Nur eine weitere Irritation, eine Kleinigkeit, der keine Wichtigkeit beizumessen ist, wie das Bluten, wie das Schlafwandeln ins Badezimmer, wo sie den Kopf unter Wasser hält, nachdem sie die Badewanne bis zum Rand gefüllt hat. Sie weiß nicht, dass ich, als ich ihre Hautveränderung zum ersten Mal bemerkte, so alarmiert war, dass ich gleich die 112 anrief und dreißig Minuten in der Warteschlange hing, bis sich schließlich jemand meldete und fragte, ob ich schon mal von Borkenflechte gehört hätte.
»Du musst mich nicht so anschauen«, sagt sie und fährt immer noch mit den Fingern ihren Arm entlang. »Ich spüre deine Blicke«, fügt sie hinzu, als ich den Mund öffne, um etwas zu sagen, »aber du musst nicht. Es ist okay.«
»Ich schaue dich doch gar nicht irgendwie besonders an«, sage ich, will witzig klingen, was mir aber nicht gelingt. Sie wirft mir einen Seitenblick zu, beginnt zu lächeln und tut es dann doch nicht ganz.
»Okay, du schaust mich also nicht an. Mein Irrtum«, sagt sie.
Die Unterhaltung, so kurz sie auch war, ist eine willkommene Unterbrechung der Stille, die jedoch kurz darauf wieder einsetzt und sich irgendwie schwerer anfühlt als vorher. Ich ertappe mich dabei, wie ich versuche, diesem neuen Abstand zwischen uns zu entfliehen. Ich bin gewissenhaft geworden, was das Joggen angeht. Und ich verweile stundenlang im Supermarkt, sinnlos nachdenkend über Waschmittelmarken, Joghurtbecher, Butter, Butterersatz. Ab und zu sage ich Leah, dass ich gehe, um etwas Bestimmtes zu tun, und stattdessen laufe ich einfach bis zu einem Punkt und bleibe dort stehen, bis ich mich so sehr langweile, dass ich wieder nach Hause gehe. Ich glaube, ich bin nicht mal besonders clever dabei. Du hast gesagt, dass du zum Sport gehst, fällt ihr manchmal auf, aber du hast deine Sachen gar nicht mitgenommen. Ich sage ihr dann, sie hätte mich falsch verstanden, was sie akzeptiert und dann weiter auf einen Punkt auf ihrer Arminnenseite starrt oder den Wasserhahn in der Küche aufdreht und das Spülbecken volllaufen lässt.
Im Supermarkt. Carmen schielt auf Dosen mit gehackten Tomaten, nimmt Packungen mit unterschiedlich geformten Nudeln aus dem Regal und stellt sie wieder zurück. Sie hat ihre Brille im Büro vergessen und kann nicht sehen, wie viele Finger ich hochhalte, wenn ich mehr als einen Meter von ihr entfernt stehe. »Was ist das?«, fragt sie mich, eine Packung Orecchiette in der Hand. »Sind das die, die aussehen wie Ohren?«
Wir sind seit der Universität befreundet, aber ihre Sehkraft hat sich erst im letzten Jahr oder so verschlechtert. Es ging so plötzlich bergab, dass sie deswegen beim Arzt war – vermeintlicher Hirntumor, graue Schatten auf den Röntgenaufnahmen ihres Schädels. Das war schon immer der rote Faden unserer Freundschaft – das hypochondrische Hin und Her zweier Frauen, die zu viel Zeit haben. Wir haben uns immer wieder gegenseitig auf den Boden zurückgeholt – von Carmens Meningitis-Panik über meine allgemeine Angst vor Krebs und Alzheimer bis hin zu Krankheiten, von denen ich befürchte, dass ich sie bekommen oder geerbt haben könnte –, doch als Carmens Sehkraft nachließ, war ich so beschäftigt, dass ich sie nicht ausreichend unterstützte, und das spüre ich jetzt ein wenig zwischen uns.
»Und wie läuft’s bei dir?«, fragt sie später, als wir beide wie Spiegelbilder über Kaffeetassen gebeugt im Café sitzen, beide mit vom Regen fettigen Haaren, um die Schläfen herum krisselig. Wir treffen uns öfters in diesem Café, Vertrautheit ist Carmen ein wichtiges Anliegen, vor allem in letzter Zeit. Ich beobachte, wie sie sich zum Tresen und wieder zurück tastet, ihre langen Hände gleiten über das Plexiglas der Tortenvitrine und hinterlassen zwei identische Schlieren, die wohl später weggewischt werden müssen.
»Alles in Ordnung«, sage ich, während ich meine Initialen mit dem Stiel meines Latte-Löffels in den Schaum schreibe, »es ist etwas seltsam, weiß du, aber es ist alles in Ordnung.«
»Glaube ich dir, dass es seltsam ist«, sagt sie – ihre Stimme ist wie eine süße Pflaume, ihre Vokale scheinen mehr Raum einzunehmen, als die Form ihres Mundes erlaubt – »das muss seltsam sein, wieder mit jemandem zusammenzuwohnen, nach so einer langen Zeit die Wohnung wieder zu teilen.«
Ich schaue sie an und will sagen, dass ich das überhaupt nicht so gemeint habe. Ich will sagen:
Wieder mit jemandem zusammenzuleben, ist nicht, wonach sich das anfühlt.
»Als ich mit Tom zusammengezogen bin«, spricht sie weiter – wahrscheinlich hat sie nicht registriert, dass ich noch etwas sagen wollte –, »war es für eine Weile wirklich seltsam. Es hat sich angefühlt wie eine Invasion. Ich meine, nur weil du jemanden liebst, musst du die Person ja nicht die ganze Zeit um dich herumhaben, oder? Manchmal habe ich mich im Badezimmer eingeschlossen und eine halbe Stunde lang in der Badewanne gelegen, ohne Wasser, einfach in der leeren Wanne, weil das die einzige Möglichkeit war, etwas Abstand zu gewinnen. Und ich habe ihn geliebt, weißt du? Ich kann die Distanz also wirklich nachvollziehen.«
Carmens Ex-Freund Tom war Sozialarbeiter und am Wochenende DJ, und irgendwann hat er sie verlassen, aus Gründen, die ich nie ganz nachvollziehen konnte. Wenn Carmen über ihn spricht, klingt es wie bei anderen Leuten, wenn sie über ihren Uniabschluss sprechen: eine drei Jahre andauernde Phase, durch die man durchmuss, um dann mit anmaßender Autorität über genau ein Thema sprechen zu können. Sie ist die weltweit führende Expertin für das Lieben und Verlieren von dreißigjährigen Männern namens Tom.
»Das ist es eigentlich nicht«, sage ich und drehe meinen Kopf zum Fenster, damit sie meinen Gesichtsausdruck nicht sehen kann. Der Regen ist stärker geworden. »Es hat mir nie etwas ausgemacht, die Wohnung zu teilen. Das ist ja eigentlich der Sinn des Zusammenlebens.«