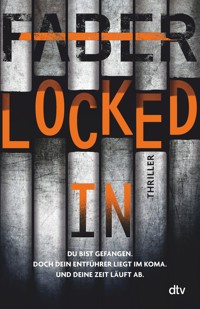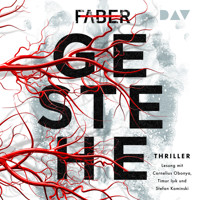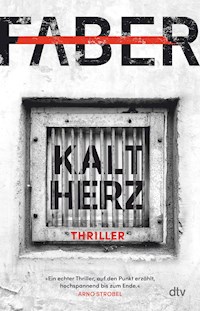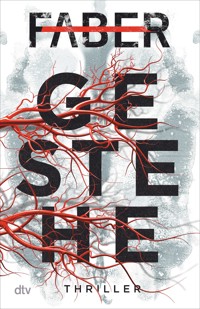
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Mord. Ein berühmter Ermittler. Und die einzige Spur führt zu ihm selbst. Der rasante Thriller von Henri Faber um einen Serienkiller, der in Wien sein Unwesen treibt. Für Leser*innen von Sebastian Fitzek, Andreas Gruber und Andreas Winkelmann Der Wiener Star-Ermittler Johann »Jacket« Winkler kommt an einen Tatort, der die Polizei vor ein Rätsel stellt. Das Opfer wurde grausam ermordet und mit einem mysteriösen Wort markiert: GESTEHE. Doch es ist nicht die Brutalität, die Jackets Welt ins Wanken bringt, sondern die Tatsache, dass er den Tatort kennt – aus seinem eigenen unveröffentlichten Roman, den noch niemand gelesen hat. Er trägt den Titel GESTEHE. Und Jacket ahnt: Das Morden hat gerade erst begonnen. Jacket und sein Underdog-Kollege Mo: ein kurioses Gespann, aber unschlagbar! Der neue Pageturner vom Meister der Cliffhanger »Henri Faber – Die neue aufregende Stimme der Thrillerszene!« DB mobil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Vor vier Jahren wurde der Wiener Chefinspektor Johann »Jacket« Winkler durch einen spektakulären Fall zur nationalen Berühmtheit. Er hat sogar ein Buch über den Fall herausgebracht, das ein Bestseller wurde, und genießt seither das Rampenlicht. Doch jetzt muss sich Jacket erneut beweisen. Gemeinsam mit seinem jungen, unerfahrenen Kollegen Mohammad »Mo« Moghaddam wird er an einen mysteriösen Tatort gerufen. Das Opfer wurde grausam ermordet und mit einem blutigen Wort markiert: GESTEHE. Während Mo fieberhaft an der Aufklärung arbeitet, um endlich von seinen Kollegen ernstgenommen zu werden, scheint Jacket etwas zu verbergen. Denn was niemand weiß: Er kennt den Tatort – aus seinem neuen, noch unveröffentlichten Roman, der ebenfalls GESTEHE heißt. Und das Morden darin hat gerade erst begonnen.
Henri Faber
Gestehe
Thriller
Für Ohana
»Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer.«
Isaiah Berlin
PROLOG
Als sie mich holen, bin ich bereits fast tot.
Die Glieder leblos und starr. Der Blick unbestimmt in der Ferne verhaftet. Die Haut blass und marmorkalt, durchzogen vom nachtblauen Geflecht meiner Adern, in denen mein Blut zum Stillstand gerät. Es besteht kein Zweifel: Mein Ende ist nah. Und jede Sekunde, die vergeht, jeder Atemzug, der meine Lunge kaum füllt, jeder Herzschlag, der matt und träge in meiner Brust verebbt, bringen mich dem Unausweichlichen ein Stückchen näher.
Und das ist gut so.
Ich bin, wie mich die Jäger haben wollen. Sterblicher Überrest. Bloße, nackte Hülle – aber nicht leer, nicht wertlos, im Gegenteil: Für sie bin ich kostbar, mit Gold kaum aufzuwiegen. Dennoch behandeln sie mich wie Abfall, packen mich in Plastik, bringen mich an einen Ort, an dem sie mir ungestört das nehmen können, was mich so kostbar macht. Sie werden mich ausweiden, so, wie sie es mit Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten vor mir getan haben. Ihre Beute sind lebende Tote, alles andere interessiert sie nicht.
Sie sind Profis, die Jagd ist ihr Geschäft. Sie wissen, wie man sich unbemerkt anpirscht. Es ist auch gar nicht so schwer: Die Beute ahnt schließlich nicht, dass sie Beute ist. Aber was, wenn doch? Wenn sie ihre Rolle kennt und dennoch verharrt, scheinbar schicksalsergeben. Macht sie das überhaupt zur Beute?
Ende ich hier und jetzt als Beute?
Vielleicht. Ich weiß es nicht, denn noch befinde ich mich im freien Fall. Noch lauere ich in der Schwebe zwischen den Welten, kämpfe dagegen an, ins Nichts zu driften, und klammere mich eisern an den seidenen Faden, an dem mein Leben hängt. Es ist mein Faden, ich habe ihn selbst geknüpft; gesponnen aus Wut und blankem Hass. Er ist alles, was ich noch habe, alles, was mir bleibt, meine einzige Verbindung zu den Lebenden. Wenn er reißt, höre ich auf zu existieren, aber wenn er hält und ich mich im richtigen Moment an ihm hochziehen kann, dann wendet sich das Blatt, und die Karten werden neu gemischt.
Etwas geschieht um mich herum.
Wortfetzen dringen an mein Ohr. Hände hieven mich auf eine eisige Bahre, schneiden mir die Kleider vom Leib.
Dann setzt der Jäger an. Sein Skalpell dringt in mein Fleisch, durchtrennt Haut, Muskelfasern, Gewebe, Fett – aber nicht meinen Faden. Er hält. Meine Augen öffnen sich, erfassen den Jäger. Und als sich unsere Blicke treffen, wissen wir beide, dass ich keine Beute bin, sondern eine Falle. Dass er kein Jäger mehr ist, sondern ein Gejagter. Und dass nicht bloß mein Blut die Schlachtbank beflecken wird, sondern auch seins.
Sie dachten, sie würden mich holen. Dabei bin ich es, der sie holt. Einen nach dem anderen. Die Rechnung muss beglichen werden.
Bis zum letzten Leben.
TEILEINS
Er
Und so beginnt es wieder: harmlos, in einem Haus mitten in Wien.
Vielleicht ist es ein verschlafenes »Schatz?« oder ein leise gehauchtes »Liebes?«, vielleicht ist es auch nur eine Hand, die nicht findet, wonach sie sucht – ich weiß es nicht. Ich kann nicht genau sagen, wie es ablaufen wird, mir bleibt nur die ungefähre Vorstellung davon, aber das ist ja das Schöne daran: Ich darf meiner Fantasie freien Lauf lassen. Und ich habe viel Fantasie, sehr viel. Sonst könnte ich nicht tun, was ich tue.
Ich stelle mir Folgendes vor: Dein Mann erwacht in einem leeren Bett. Beim Einschlafen dachte er sich nichts dabei, du bist häufig länger weg, arbeitest viel, bist auf zahlreichen Veranstaltungen unterwegs. Aber jetzt ist es mitten in der Nacht, und deine Seite des Bettes ist immer noch kalt. Du wirst doch nicht etwa …? Nein, so dumm kannst du nicht sein. Hättest du eine Affäre, würdest du es besser verheimlichen. Es muss etwas anderes sein.
Es muss etwas passiert sein.
Er sucht sein Telefon, wählt deine Nummer, du gehst nicht ran. Er versucht es noch einmal, immer und immer wieder, setzt Kaffee auf, überlegt. Wo könntest du sein? Hast du irgendetwas erwähnt, irgendwelche Termine, vielleicht eine Tagung außerhalb der Stadt, die ihm entfallen ist? Ihm fällt nichts ein. Er wird nervös. Richtig nervös.
Was soll er jetzt tun? Die Polizei einschalten? Nach so kurzer Zeit? Wahrscheinlich klingeln dort um diese Uhrzeit ständig die Telefone, und verheulte Stimmen fordern groß angelegte Suchaktionen, weil der Partner nicht nach Hause ins eheliche Bettchen gekommen ist. Die Beamten haben mit Sicherheit schon Standardsprüche einstudiert. Rufen Sie wieder an, wenn alle Kneipen dicht sind oder Haben Sie es bei der Eheberatung probiert? Nein, für die Polizei ist es noch zu früh. Er muss selbst suchen. Aber wo soll er anfangen?
Der Kaffee ist kalt geworden. Er braucht ihn nicht, um wach zu werden. Er war noch nie wacher. Hastig zieht er sich etwas über, schnappt sich die Autoschlüssel, stürmt in die Nacht.
Im Auto schaltet er das Radio aus – keine Musik, kein Geräusch, absolut keine Störung. Er klappert die üblichen Punkte ab: Arbeitsstelle, Lieblingsbar, den nahe gelegenen Park, fährt die Wege ab, die du öfter nimmst, sucht in den U-Bahn-Stationen – nichts.
Freunde und Bekannte haben ihre Handys abgeschaltet. Er versucht es wieder bei dir, aber natürlich hebst du nicht ab. Da ist nur immer die Mailbox, auf der schon zahlreiche Nachrichten von ihm gespeichert sind. Eine besorgte, eine wütende, eine verzweifelte, eine, bei der er dich anschreit, dass du diesen kindischen Scheiß lassen sollst. Doch es ist die letzte Nachricht, die er nie vergessen wird. Vielleicht steht er an einer Ampel, die gerade auf Grün schaltet, aber er fährt nicht los. Er überlegt. Was hat er als Letztes zu dir gesagt? Wie habt ihr euch verabschiedet? Was hattest du an? Das alles geht ihm durch den Kopf, während er eigentlich auf die Mailbox sprechen sollte. Doch er sagt kein Wort. Im Prinzip weiß er schon, dass du sie nicht abhören wirst. Er weiß, dass das schlimmste Anzunehmende passiert ist. Und ich weiß, dass er recht hat. Aber nicht ganz. Denn im Gegensatz zu mir hat er bestimmt keine so blühende Fantasie. Seine Vorstellungskraft reicht nicht einmal ansatzweise aus, um sich auszumalen, was ich mit dir anstellen werde. Doch er wird es bald herausfinden.
Sehr bald.
Jacket
Dienstag, 18.10.2022–19:55 Uhr
Vier kahle Wände, keine Fenster, eine Tür, verschlossen.
Von draußen dringen Stimmen herein, unverständlich, aber dennoch bedrohlich. Sie werden bald kommen. Wenn Jacket nicht schnell etwas einfällt, wird das hier sein Grab. Mit einem Fuß steht er bereits darin.
Die Folter hat Spuren hinterlassen. Blutergüsse, Platzwunden, gebrochene Rippen. Die Ketten um seine Gelenke sind so fest, dass seine Hände blau sind und zittern. Aber er verdrängt den Schmerz, kämpft. Nicht für sich, sondern für das kleine Mädchen. Wenn er nichts unternimmt, werden diese Dreckskerle sie ausweiden und im Hinterhof verscharren. So, wie sie es mit Dutzenden zuvor gemacht haben. So, wie sie es mit Leo gemacht haben.
Jackets Blick schnellt in die andere Ecke des Raumes, zuckt sofort zurück. »Ich werde dich rächen, Leo«, knurrt er leise in sich hinein, schluckt schwer. Sie haben ihm seinen Partner in die Zelle gelegt, tot, das Gesicht bloß von einem blutdurchtränkten Fetzen verhüllt. Jacket soll sehen, was ihm blüht. Er soll vor Angst verrückt werden. Aber er denkt nicht daran.
»Verdammt«, entfährt es ihm. Abgerutscht. Fluchend zieht er den Dorn des Gürtels aus seinem blutigen Handballen. Mit einer Büroklammer wäre das hier ein Kinderspiel. Aber er will nicht undankbar sein. Sie haben seinen Gürtel übersehen. Wieder setzt er an, stochert im Schloss herum. Und plötzlich: das ersehnte Geräusch. Klick. Die Handschellen fallen zu Boden.
Geschafft.
Aber was jetzt?
Hinter der Tür wartet ein gutes Dutzend Arschlöcher, bis an die Zähne bewaffnet. Er muss sich etwas einfallen lassen. Sein Blick irrlichtert durch den Raum, erfasst eine Spiegelscherbe. Spitz, scharf, aber kaum größer als seine Handfläche. »War schon schlimmer zugerichtet«, stöhnt er und betrachtet sein zerschundenes Gesicht. »Die haben mich bloß halb tot geschlag-«
Er stockt. Halb tot? Widerwillig schaut er zu Leo. Eine Idee blitzt in ihm auf. »Entschuldige, alter Freund, aber mir bleibt keine Wahl.«
Schnitt.
Die schwere Metalltür schwingt auf. Ein bewaffneter Mann betritt den Raum, flucht. Seine Sprache ist fremd, aber die Untertitel übersetzen seine Wut. Hastig stürzt er zu Jacket, sieht das viele Blut an dessen Pulsadern, die Scherbe neben ihm. Er tritt zu, einmal, zweimal – Jacket regt sich nicht.
Der Mann ruft Helfer herbei. Sie hüllen den Leichnam in eine Plastikfolie, hieven ihn auf eine Bahre, bringen ihn zum »Doktor«, wie er sich nennt. Wieder sagt einer der Männer etwas Unverständliches. Die Untertitel übersetzen: »Sieh nach, ob sein Herz noch schlägt. Vielleicht können wir es brauchen.«
Der Doktor zückt sein Skalpell. Es bereitet ihm sichtlich Freude, die Klinge in Jackets Fleisch zu senken. Doch etwas macht ihn stutzig. Jackets Handgelenk … die Schnitte verlaufen quer, nicht längs. Und sie sind nicht tief, bloß Kratzer. Woher stammt all das Blut?
Die Antwort kommt blitzschnell. Zu schnell für ihn.
Benommen taumelt der Doktor zurück, schielt an sich herab, betrachtet ungläubig sein eigenes Skalpell, dann den Mann, der es ihm in die Kehle gerammt hat.
»Fahr zur Hölle!«, knurrt Jacket, zieht die Klinge wieder heraus. »Den Rest schick ich gleich hinterher.«
Der Doktor sackt leblos zu Boden, röchelt sein Leben aus. Die Dreckskerle nebenan haben nichts bemerkt.
Lautlos springt Jacket auf, wischt sich das Blut seines Partners vom Arm, eilt zum Operationstisch, auf dem das kleine Mädchen liegt. Eine gestrichelte rote Linie hebt sich von ihrer blassen Haut ab, direkt über ihrer Leber.
»Aufwachen, Kleines!«, raunt Jacket ihr zu. »Wir müssen hier weg!« Er gibt ihr einen leichten Klaps auf die Wange.
Ihre Lider beginnen zu flattern, sie öffnet die Augen. »Wo bin ich?«
»Keine Zeit, Kleines. Siehst du den Schrank da drüben?«
Ihr träger Blick folgt seinem. »Da verstecken wir dich, und du machst keinen Mucks, bis ich dich hole. Okay?«
Sie reagiert nicht. Beherzt hebt Jacket sie hoch, trägt sie hinüber, öffnet den Schrank und legt sie sanft ab. Als er sich von ihr loslösen will, lässt sie nicht ab.
»Nein … bitte!«, stammelt sie. »Bleib bei mir!«
Jacket kniet nieder. »Keine Angst, ich komme wieder.«
»Schwörst du es?«
»Bei meinem Namen!«, antwortet er leise und streicht ihr eine blonde Locke aus der Stirn. Dann erhebt er sich, fixiert eisern die Tür. »Ich muss nur den Müll rausbringen.« Seine Hand umschließt das Skalpell so fest, dass seine Knöchel weiß hervortreten.
»Wie … wie heißt du denn?«, fragt das Mädchen.
Er blickt über die Schulter, lässt sein strahlend weißes Lächeln aufblitzen und tippt sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Inspektor Jacket, Kleines. Stets zu Diensten.«
Schwarzblende.
Rauschen.
Ende.
Der Zeiger meiner Armbanduhr frisst zwei Sekunden, in denen man eine Stecknadel fallen hören könnte. Dann räuspere ich mich. Mein Blick gleitet vom Bildschirm zu dem aufgeschlagenen Drehbuch in meinem Schoß, geht wieder hoch. Alle starren mich an: Regisseur, Produzent, Aufnahmeleiter, die Assistenten, Setrunner, sämtliche Schauspieler bis hin zu den Komparsen. Selbst die Äffchen vom Catering haben aufgehört, ihre matschigen Kürbisgnocchi in der Salbeibutter zu schwenken. Die gesamte Aufmerksamkeit in diesem Raum gilt mir.
Und ich liebe es.
»Meine Herrschaften«, beginne ich in einem Tonfall, der kaum erkennen lässt, in welche Richtung er sich entwickeln wird. »Das wird … ein Kassenschlager!«
Kollektives Aufatmen. Verkrampfte Schultern senken sich, mürrische Mienen weichen freundlichen Gesichtern, die ganze Last des Ungewissen fällt ab, und jeder Einzelne in der Crew wirkt plötzlich befreit und gelöst. Und das nur, weil mir der Film gefällt. Weil mir mein Film gefällt.
Zumindest sollen sie das denken.
»Maestro!«, beginne ich, springe vom Stuhl und deute eine Verneigung vor dem Regisseur an. »Ich ziehe meinen Hut. Das wird ganz großes Kino. Diese Spannung, diese Atmosphäre – einmalig. Genau so habe ich mir das vorgestellt!«, schwärme ich. Dabei ist meine Vorstellung meilenweit von dem entfernt, was ich gerade gesehen habe.
Ich muss nur den Müll rausbringen? Fahr zur Hölle, den Rest schick ich hinterher? Wer denkt sich solche Dialoge aus? In meinem Buch stand das ganz anders. Auch die Details: Im Hinterhof fand man nicht Dutzende von Leichen verscharrt, sondern vier, und das Mädchen war nicht blond, und sie hat auch nicht gesprochen. Die Kleine ist sowieso eine komplette Fehlbesetzung, genau wie der Hauptdarsteller. Apropos …
»Tom!«, wende ich mich ihm zu, schoppe mir den Hemdsärmel hoch. »Siehst du das? Gänsehaut pur, am ganzen Körper! Dieser Blick in die Kamera, dein Temperament – brutal gut.«
Er lächelt.
Ich lächle. Ich lüge.
Von wegen Temperament: Tom Wegerichs ist der emotionsloseste Schauspielerexport, den Deutschland zu bieten hat. Im Prinzip ist er gar kein richtiger Schauspieler – er spielt nicht mich, er spielt sich selbst. Er spielt immer nur sich selbst, und das seit dreißig Jahren.
Eigentlich wollte ich einen Künstler, einen richtigen Jedermann. Nicolas Ofczarek zum Beispiel, der wäre perfekt gewesen. Doch die Produktionsfirma bestand auf Tom. In höchsten Tönen haben sie ihn angepriesen, aber das Offensichtliche haben sie ausgeblendet: Er ist ein Piefke! Nicht einmal Bayer, nein, Hesse! Und der soll mich spielen? Ein Hesse als Wiener Inspektor?
Ich wurde in Wien geboren, bin hier aufgewachsen, lebe hier, arbeite hier, bin ein echtes Original, ein Aushängeschild der Stadt. Jeder in diesem Land, der die letzten Jahre nicht in einer Höhle verbracht hat, kennt mich, hat mich schon irgendwo gehört, gesehen, Interviews von mir gelesen … Aber im Film soll mich ein Piefke spielen, der Kaffee bestellt statt Kaffeee und jeden Tag mit seinem Sprachcoach zusammensitzt, damit sein aufgesetzter Wiener Schmäh nicht völlig zur Farce verkommt? Das ist doch Irrsinn!
Ich hätte mich ja selbst gespielt, immerhin fließt Schauspielerblut in meinen Adern, aber sie wollten ja nicht. Tom oder keine Finanzierung – Punkt, aus. Ofczarek sähe mir wenigstens ähnlich. Ein bisschen das Alter und das Abgefuckte in der Maske entschärfen, eine Runde ins Solarium, ein paar um den Block, und sie hätten mehr oder weniger meinen großen Bruder bekommen. Zugegeben: Bei Tom hat die Maske keine schlechte Arbeit geleistet. Die haben ja Möglichkeiten heutzutage, da kann jeder wie jeder aussehen. Aber mein markantes Lächeln haben sie natürlich nicht hinbekommen. Das bekommt keine Maske der Welt hin.
»Wirklich gute Arbeit«, schmiere ich Tom noch ein wenig Honig ums Maul, wende mich dann an den Rest der Filmcrew. »Ihr alle! Ihr macht einen richtig guten Job! Von dem Streifen werden die Leute noch lange reden.«
Und darüber lachen, ergänze ich in Gedanken, spendiere der Runde ein breites Grinsen und mustere dann erschrocken meine Armbanduhr. »So, Kinder, ich muss!«
Ich muss nicht. Aber ich sollte. Wenn sie mir noch mehr Szenen vorspielen, falle ich vielleicht aus der Sunnyboy-Rolle, und das hilft niemandem. Nörgeln bringt nichts, es ist zu spät. Der Cast steht, die Dreharbeiten laufen, selbst die Lizenzverkäufe ins Ausland sind schon unter Dach und Fach. Schlechte Stimmung streut nur Sand ins Getriebe. Außerdem ist jede Beschwerde Meckern auf hohem Niveau. Sie verfilmen mein Leben. Da kann ich schon mal ein Auge zudrücken, dass mich ein Piefke spielt. Aber bei diesem Namen auf meinem Regiestuhl kenne ich kein Pardon.
»Entschuldige?« Ich winke einen der Assistenten herbei. »Auf ein Wort, ja?«
Er trabt an wie ein lahmes Rennpferd auf dem Weg zum Schlachter.
»Könnten wir den Namen hier ändern?«
Sein Mund öffnet sich, schließt sich wieder, ohne etwas gesagt zu haben. Irritiert blättert er durch seine Unterlagen. »Johann Winkler«, liest er dann laut vor. »So heißen Sie doch, oder hat das die Produktion falsch eingetragen?«
Ich presse die Lippen zusammen, zwinge meine Gesichtsmuskeln, die Mundwinkel oben zu halten. »So steht es in meiner Geburtsurkunde, aber kein Mensch nennt mich so. Mach ›Jacket‹ draus, gerne mit ›Inspektor‹ davor. Danke.«
Er zückt eifrig einen Kugelschreiber, setzt an, zögert. »Wie das Sakko?«
»Was?«
»Na das Sakko, das Jackett … Schreibt man das wie das Jackett mit zwei t?«
Der Blondschopf meint es tatsächlich ernst. Bei dem medialen Dauerfeuer der letzten Jahre dürfte selbst ein Eremit mitbekommen haben, warum mir die Presse diesen Spitznamen umgehängt hat. »Nein, wie die Zahnkronen«, entgegne ich fassungslos, fahre mir mit der Zunge demonstrativ über meine blendend weißen Schneidezähne. »Jacketkronen!«
Nichts. Keine Reaktion. Sein Blick spricht Bände. Leere Bände.
»Was siehst du da?«, starte ich einen letzten Versuch, lege meine Hand auf seine Schulter und drehe seinen Oberkörper sanft herum.
Verunsichert blickt er auf das Plakat neben dem Eingang zum Studio. »Das … ist ein Entwurf für ein Werbeplakat zum Film?«
»Und was steht da?«, bohre ich nach.
»Blutnacht.«
»Nicht der Titel. Darunter!«
Er kneift die Augen zusammen. »Nach dem Bestsellerroman von Inspektor Jacket.«
»Na, alsdann!«, rufe ich laut aus und klatsche in die Hände. »Jacket mit einem t. Noch Fragen?« Mit einem sanften Schubs entlasse ich ihn wieder, setze zum Gehen an, komme nicht weit. Der nächste Blondschopf: anderes Geschlecht, anderes Auftreten. Ich weiß sofort, was sie will. Mein Blick ist mittlerweile darin geschult, Autogrammjäger zu erkennen.
Mit einer fließenden Bewegung ziehe ich den Signierstift aus der Hosentasche und lasse die Kugelschreibermine herausschnappen. »Für wen?«, frage ich, nehme ihr das Buch ab, betrachte es kurz. Wow, sogar mit rot-weiß-rotem Farbschnitt. Den hatte nur die Erstauflage von Blutnacht. Wahrscheinlich ein Fan der ersten Stunde. »Deinen Namen! Für wen darf ich das Buch signieren?«
Irritiert wandert ihr Blick zwischen meinem Lächeln und ihrem abgegriffenen Exemplar von Blutnacht hin und her. Dann beginnt sie zu schmunzeln, schüttelt ihre blonden Locken. »Für den Regisseur, wenn Sie wollen. Das ist sein Buch.«
Jetzt bin ich derjenige mit dem Brett vorm Kopf.
»Lexi, ich bin Script Supervisor hier am Set«, stellt sie sich vor, schüttelt meine Hand. »Ich arbeite eng mit dem Drehbuchautor und der Regie zusammen, sorge dafür, dass beim Dreh keine Logikfehler passieren, wenn kurzfristige Änderungen vorgenommen werden.«
»Verstehe«, behaupte ich, lasse die Kugelschreibermine wieder im Gehäuse verschwinden und versuche, den enttäuschten Unterton in meiner Stimme zu überdecken. »Die Dame mit dem erhobenen Zeigefinger, wie? Einer muss es ja machen.«
Sie nickt, klopft dabei mit ihren Fingerspitzen auf dem Einband des Buches herum. »Ich wollte nur mal fragen, wie Sie zu den Änderungen stehen. Der Drehbuchautor hat ja doch einiges angepasst. Stichwort Müll rausbringen.« Sie lächelt verlegen.
»Ganz so flotte Sprüche hatte ich damals nicht auf Lager«, antworte ich vage, weiß nicht so recht, worauf dieses Gespräch hinauslaufen soll.
Sie beklopft nun nicht mehr das Buch, sie streichelt es vielmehr. Und mir wird alles klar. Nicht die Autogramme berühmter Männer sind ihre Trophäen, sondern die Männer selbst.
»Was ist das eigentlich für ein Gefühl?«, fährt sie fort, nestelt dabei mit ihrem Zeigefinger in ihren goldenen Locken herum. »Wenn das eigene Leben verfilmt wird? Das muss doch unglaublich sein, oder?«
»Was ist das für ein Gefühl?«, wiederhole ich ihre Worte, reibe mir nachdenklich übers Kinn, lasse den Blick in die Ferne schweifen, so als müsste ich meine Gedanken reifen lassen, um eine adäquate, tiefgründige Antwort zu finden. Dabei suche ich nur nach irgendeiner Ausrede, um hier schnellstmöglich zu verschwinden. Doch das Einzige, das meinen Blick quert, ist der Bildschirm, auf dem die Szenen von vorhin abermals laufen. Jacket in seinem Verlies. Jacket übersät mit Wunden. Jacket im Angesicht des sicheren Todes.
Ich im Angesicht des sicheren Todes.
»Was ist das für ein Gefühl?«, höre ich mich erneut sagen, doch es klingt, als wäre ich weit weg. Gebannt starre ich auf den Bildschirm, tauche darin ein, werde Teil der Szenerie.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man fast gestorben wäre und das ganze Land einen dafür feiert, dass es bei dem fast geblieben ist? Was ist das für ein Gefühl, wenn die schlimmsten Tage deines Lebens bald schon von Tausenden Kinogängern begafft werden, während sie sich mit Popcorn vollstopfen und darüber vergessen, dass das, was sie auf der Leinwand sehen, nicht bloß pure Fiktion ist? Es ist eine wahre Begebenheit. Mein Schicksal, mein Leid.
Sie drehen einen Film über mein Leben, aber ich habe meine eigene Vorstellung. Sie läuft, seit ich dieser Hölle entkommen konnte, Tag für Tag für Tag. Und was ich auch versuche, sie läuft weiter – trotz all der schlauen Sprüche. Sie sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Sie sagen, morgen wird es besser. Doch morgen wird es nicht besser. Dann kommt der Tag nach morgen, die Woche, der Monat, das Jahr nach morgen … Und du begreifst, dass dich die Vergangenheit dein ganzes Leben lang verfolgen wird. Sie ist mittlerweile mehr als nur ein Film, mehr als Erinnerungen oder Flashbacks, sie ist Teil deiner selbst, übergegangen in Fleisch und Blut. Sie ist die Panik, die dich nachts hochschrecken lässt, die Furcht, die dir ohne Vorwarnung die Kehle zuschnürt. Sie ist der Schatten, der sich auf jeden Funken Hoffnung legt und ihn im Keim erstickt. Mein Körper trägt immer noch die Narben dieser Nacht, meine Seele ist immer noch vor Angst zerfressen. Und Lexi fragt: »Was ist das für ein Gefühl?«
»Gefühle sind nicht gerade mein Metier«, sage ich, löse den Blick vom Bildschirm und verschanze mich hinter meinem Lächeln. »Aber das Schönste ist natürlich, dass diese Bande niemandem mehr Leid zufügen kann.«
Sie nickt eifrig und bearbeitet ihre Unterlippe, als mein Klingelton ihre Koketterie unterbricht. Genau im richtigen Moment.
»Da muss ich leider rangehen«, erkläre ich, ziehe mein Handy aus der Sakkotasche und schiebe es auf.
Plötzlich kraust sich ihre Stirn. »Aus welchem Jahrhundert ist denn das Teil?«
»Aus einem, in dem Menschen noch nicht jeden Mist mit der halben Welt teilen mussten. Und jetzt entschuldige mich.« Ich presse mein getreues Nokia ans Ohr, ohne einen Blick auf das Display zu werfen, spule den üblichen Spruch ab. »Inspektor Jacket, stets zu Dien-«
»Jacket, ich bin’s.«
Ich stocke. »Oh … hallo«, antworte ich zögernd, bekomme sofort ein schlechtes Gewissen – wie immer, wenn ich mich länger nicht bei Nora gemeldet habe.
»Wann sehen wir dich mal wieder?«
»Du weißt doch: Arbeit, Arbeit, Arbeit.«
Stille macht sich am anderen Ende der Leitung breit, gefolgt von einem unangenehm langen Luftholen. »Du klingst müde, Darling«, sagt sie schließlich, und natürlich liegt sie damit richtig – auch wie immer. »Wo bist du gerade?«
»Filmstudio«, antworte ich, massiere dabei mit den Fingern meine geschlossenen Lider. »Draußen, in der Nähe vom Tiergarten, fast schon in der Provinz.«
»Fahr doch nach Hause und lass es für heute gut sein. Und morgen kommst du vorbei und besuchst uns mal wieder.«
Ich zögere kurz, überschlage den kommenden Tag im Kopf, finde keine Lücke in meinem Terminplan. Egal. »Ich komme vorbei, versprochen. Soll ich etwas mitbringen?«
»Nur dich. Wir freuen uns. Die Villa Grün steht dir immer offen«, sagt sie. Dann ist das Gespräch zu Ende.
Ich verharre noch eine Weile mit dem Telefon am Ohr, nehme jetzt erst wahr, wie schlaff und kraftlos meine Glieder sind, regelrecht bleiern. Als hätte sich die Schwerkraft verdoppelt. Ich sollte auf Noras Rat hören und nach Hause fahren, das wollte ich ohnehin längst tun. Beherzt lasse ich das Handy zusammenschnappen, wirble herum und … oh. Goldlöckchen ist immer noch da.
Sie wippt auf ihren Ballen hoch und nieder, mustert mich. »Alles in Ordnung?«, fragt sie, legt dabei den Kopf schief und verpasst mir einen gekonnten Augenaufschlag.
Nett serviert, Herzchen, aber nicht heute. »Meine Frau«, behaupte ich. »Die Kinder werden kalt, das Essen muss raus, der Hund hat noch Hausaufgaben … Ich muss jetzt wirklich.«
Sie hört auf zu wippen. »Verstehe.«
Ich deute ein Nicken an, spendiere ihr ein Lächeln und gehe in Richtung Ausgang, als …
»Ach, eins noch.«
Ich seufze. »Ja?«
»Ich weiß, es steht so in Ihrem Buch, und wir alle lieben diese Szene, aber …«, sie wirft einen prüfenden Blick zur Crew, presst sich dann dicht an mich, um mir mit samtener Stimme ins Ohr zu flüstern, »… haben Sie die Handschellen wirklich mit Ihrem Gürtel geknackt?«
Ihr Parfüm steigt mir in die Nase. Irgendetwas mit Patschuli, wenn ich nicht irre. Früher hätte ich mich dieser Versuchung kaum entziehen können. Heute … halten mich andere Dinge im Bann.
Wie automatisch heftet sich mein Blick wieder an den Bildschirm, verweilt in den Szenen, die mein Schicksal überzeichnet in die Ewigkeit übertragen werden. Die Geschichte eines Paradepolizisten, eines wahren österreichischen Helden mit vielen Facetten. Der geschickte Jacket, der sich mit einem Trick von seinen Fesseln befreit. Der gewiefte Jacket, der die Schurken überlistet. Der heroische Jacket, der das unschuldige kleine Mädchen aus den Händen des Bösen rettet. Jacket, Jacket, Jacket – die Kamera verfolgt nur mich und beleuchtet dennoch nur einen Bruchteil meiner Geschichte. Sie blendet im richtigen Moment ab, schwenkt zur Seite, zeigt nur, was der Zuschauer sehen soll. Im Prinzip ist es mit Erinnerungen ähnlich. Der Kopf filtert, was die Seele nicht sehen darf, weil sie es nicht ertragen kann.
Die Szenerie beginnt von Neuem. Jacket im Verlies. Jacket übersät mit Wunden. Jacket in Handschellen. Und dann, für einen winzigen Augenblick, nicht einmal eine Sekunde lang, kommt er ins Bild: Leo.
Ich schlucke.
Im Film haben sie seine Leiche mit einem Tuch bedeckt, um die FSK-16-Einstufung nicht zu gefährden. In meinem Buch habe ich ihm zumindest die Kleider gelassen. Aber jeder, der den Polizeibericht gelesen hat, weiß, dass es eine Lüge ist. Und jeder, der die Tatortfotos gesehen hat, weiß, dass die Wahrheit nicht erzählt werden kann. Sie ist schlicht zu abstoßend, niemand würde sie glauben. Nicht einmal ich, obwohl ich mit eigenen Augen ansehen musste, was sie ihm angetan haben. Aber ich erinnere mich nicht daran. Nur so kann ich weitermachen. Nur so kann ich bestehen. Nur so kann ich mir vorgaukeln, frei zu sein.
Reflexartig fährt meine Hand in die Manteltasche, umklammert mein kleines Tablettendöschen, hält sich an ihm fest, lässt es nicht mehr los.
Im Fernseher bringt Helden-Jacket gerade den Müll raus. Im echten Leben bringe ich kaum ein Wort heraus. »Klar«, sage ich mit heiserer Stimme, beobachte auf dem Bildschirm, wie ich mich aus meinen Ketten befreie. »So steht es doch in meinem Buch.«
Dann gehe ich ab.
Lexi ist nicht die Erste, die diese Frage stellt, und sie wird nicht die Letzte sein, die diese Antwort von mir bekommt. Ich erzähle sie jedem, der sie hören will, und ich werde es weiterhin tun. Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie irgendwann zur Wahrheit.
Mo
Dienstag, 18.10.2022–21:40 Uhr
Der Fernseher dröhnt. Mein Kopf auch.
Genervt massiere ich mit dem Finger meine Schläfe, blicke von den Belegen auf und hinüber zum Sofa, doch mein Blick geht ins Leere. Sie hat sich unter einem Kissenbergmassiv verschanzt, das nur eine schmale Sichtscharte freilässt. Wahrscheinlich ist sie sauer. Natürlich ist sie sauer, eigentlich war der Abend reserviert für unsere Beziehungs-quality-time, wie der Paartherapeut das nennt. Aber ich musste es verschieben – schon wieder. Egal. Weiter. Die Abrechnungen können nicht wart-
»Inspektor Jacket, stets zu Diensten.«
Nein, nicht jetzt. Ich habe schon schlechte Laune, dieser Lackaffe macht es nur noch schlimmer. »Kannst du das bitte ausmachen?«, stöhne ich auf und werfe den Kopf in den Nacken.
Der Kissenberg schweigt.
»Lisa?«
Während ich versuche, meinen Blick durch Daunenfedern zu bohren, täuscht Jacket von rechts an und drängt sich mir über die Augenwinkel auf. Sein dämliches Hollywood-Grinsen füllt den halben Bildschirm. Er steht da, umringt von Polizeischülern, und deutet mit dem Zeigefinger in die Kamera. »Du willst auch ein Diener des Gesetzes sein? Dann komm in unser Team und bewirb dich noch heute!« – meine Güte, dieses Geschwätz hält ja kein Schwein aus.
»Lisa! Bitte!«
Als Antwort fliegt ein Sofakissen in meine Richtung, verfehlt sein Ziel, trifft dafür die Kaffeetasse, deren Inhalt sich im Jackson-Pollock-Style über den Tisch verteilt. Wie durch ein Wunder besudelt nur ein einziger Tropfen meine Unterlagen. Doch dieser Tropfen reicht aus, um mein Fass zum Überlaufen zu bringen. »Hey! Pass doch auf! Das sind wichtige Unterlagen für die Arbeit, die sin-«
»Arbeit?«, peitscht ein spitzer Protest unter dem Berg hervor und nimmt mir sofort den Wind aus den Segeln. Der Kissenberg bebt, eruptiert und spuckt ein Wesen aus, das nur entfernt an meine Freundin erinnert. Eher an ihre böse Zwillingsschwester. »Gibt es für dich noch etwas anderes als Arbeit? Das hier sollte eigentlich unser Abend werden, ich versteh gar nicht, warum wir überhaupt zu einem Paartherapeuten gehen, wenn wir ohnehin keine seiner Anweisungen befolgen!«
Ihre Wut trifft mich unvorbereitet, und genauso klingt meine Rechtfertigung. »Ist es denn meine Schuld, dass wir unterbesetzt sind?«, protestiere ich, weiß selbst, dass es nicht die beste Verteidigungsstrategie ist. Allerdings fällt mir nichts Besseres ein. »Wir können die Fälle nicht einfach liegen lassen, Lisa, nicht bei Mord- und Gewaltdelikten!«
Oh, ein guter Abschluss. Er klingt so, als stünden die Gerichte still und die Verbrecher auf freiem Fuß, wenn es mich und meine Arbeit nicht gäbe. Es klingt unheimlich wichtig.
»Was für ein Fall?«, bohrt sie nach, schielt auf die Zettel vor mir.
Und in diesem Moment wird mir mein Fehler bewusst: Es klingt zu wichtig. Es klingt nicht nach mir. »Ach … du weißt ja, dass ich darüber nicht reden darf«, versuche ich, das Schlimmste zu verhindern, doch da hält sie bereits einen der Belege in der Hand.
»Fünfmal Souvlaki-Platte, groß?«, platzt es aus ihr heraus. Sie knallt die Rechnung auf den Tisch und grabscht sich die nächsten. »Achtundsiebzig Euro im Hühnerhaus? Dreiundneunzig bei Jumbo-Burger? Siebenundzwanzig Euro für Taxi Doria? Was soll das?«
»Bitte nicht zerknittern!« Mit spitzen Fingern nehme ich ihr die Zettel wieder ab. »Die Kollegen hatten eine lange Überwachung! Wenn die Belege nicht bis morgen bei der Rechnungsstelle eingereicht werden, bleiben sie auf den Kosten sitzen.«
Entgeistert starrt sie mich an, wirft dann die Hände in die Höhe. »Warum reichen die ihren Scheiß nicht selbst ein, Mo? Warum bekommst immer du die Drecksarbeit aufgedrückt?«
Ich hole tief Luft, setze zu meiner üblichen Erklärungsarie an, entscheide mich jedoch für simples Kopfschütteln. Sie kennt die Antwort. Es ist die Antwort auf die Frage, warum ich mich als Mo vorstelle und nicht als Mohammad, warum ich als Jahrgangsbester der Polizeischule mit neununddreißig immer noch keine Führungsposition habe und warum mir Vermieter nur Bruchbuden anbieten. Die Antwort ist so einfach wie perfide: falscher Name, falsche Hautfarbe, falscher Beruf.
Dabei darf ich mich glücklich schätzen, es bei der Polizei überhaupt so weit geschafft zu haben – ich bin der Einzige meiner Art im Ermittlungsbereich Leib-Leben des Wiener LKA. Die Abteilung ist weißer als weiß, Skispringerweiß! Und wenn es nach meinem Chef ginge, sollte das auch so bleiben.
Oberst Köstner hat mir quasi einen Dauerplatz auf dem Abstellgleis reserviert. Selbst nach vier Jahren habe ich noch nie einen Tatort live gesehen. Ich schlage mich mit all dem bürokratischen Mist herum, den keiner machen will: Akten anlegen, Zeugenaussagen abtippen, Anträge schreiben, Protokolle anfertigen, Belege einreichen. Und weil ich der größte Pedant südlich des Weißwurstäquators bin, erledige ich diese Sachen obendrein auch noch gewissenhaft, selbst nach Feierabend.
»Du weißt, warum«, antworte ich leise und knete wieder meine Schläfe.
Lisa zögert einen Moment, stößt dann einen Seufzer aus, greift zur Fernbedienung und schaltet ab. »Okay. Und was jetzt?«
»Gib mir noch eine halbe Stunde, ja? Ich erledige das hier, und danach veranstalten wir eine Pärchen-Power-Night!«
Lisa schraubt eine Augenbraue hoch. »Pärchen-Power-Night, soso. Und was soll ich solange machen?«
»Du bist doch Buchhändlerin! Lies ein Buch!«
Sie blickt mich vorwurfsvoll an, aber nur kurz. Dann greift sie zu ihrer Handtasche, holt einen dicken Schmöker hervor, schenkt sich ein Glas Rotwein ein und macht es sich mir gegenüber am Tisch gemütlich. »Darf ich wenigstens ein bisschen Musik anmachen?«
»Natürlich«, antworte ich, obwohl mir Stille lieber wäre. Zumindest bevorzugt sie Klassik und nicht diesen unerträglichen Sender, den die Kollegen im Büro in Dauerschleife hören und bei dem ständig die alten Nummern von abgehalfterten Schlagersängern wie Andi Berg oder Richie Fenderl gespielt werden. Aber aktuell läuft sowieso überall das Gleiche: Wahlwerbung für die bevorstehende Nationalratswahl und …
»… minus zwanzig Prozent auf alle Auslegwaren und Polstermöbel bei Möbel Ludwig. Inspektor Jacket, jetzt auch bei der Preispolizei stets zu Diensten.«
»Das gibt es doch nicht!«, schnauze ich das Radio an. »Jetzt macht er schon Werbung für Möbelhäuser! Ist man denn nirgendwo sicher vor diesem Idioten?«
Lisa verzieht keine Miene, blättert seelenruhig in ihrem Buch weiter. »Was genau hast du eigentlich gegen diesen Typen?«
»Er ist ein aufgeblasener Wichtigtuer. Allein dieser bescheuerte Name, Inspektor Jacket …«
»Den hat sich doch die Presse ausgedacht, wegen seines Hollywood-Lächelns.«
»Ja, aber er nennt sich ja selbst so.«
»Und du nennst dich Mo, obwohl du Mohammad heißt, wo ist das Problem?«
»Das ist etwas völlig anderes!«, protestiere ich energisch.
»Du bist doch nur neidisch.«
»Auf Jacket? Warum sollte ich auf ein Werbemaskottchen neidisch sein? Er ist doch nicht einmal mehr ein echter Polizist. Seitdem ihn die Nation zum Helden erklärt hat, tingelt er durchs Fernsehen, lächelt mit den botoxstarren Gesichtern der Wiener Schickeria um die Wette und tanzt auf allen Bällen der Stadt. Der Polizeipräsident hat ihn quasi zur wandelnden Reklametafel erklärt, er ist ein Showbulle. Jacket hat keinen einzigen Fall übernommen, seit ich bei Leib-Leben bin.«
Sie nippt an ihrem Wein, blickt kurz von ihrem Buch auf, hebt die linke Augenbraue. »Na, dann habt ihr ja etwas gemeinsam.«
Treffer.
»Jetzt mal ehrlich«, legt sie nach, klappt ihr Buch zu und beugt sich über den Tisch. »Der Typ hat im Alleingang einen Organhändlerring gesprengt und ein kleines Mädchen vor dem sicheren Tod bewahrt – und du gönnst ihm kein bisschen Rampenlicht?«
Versenkt.
Das hindert mich aber nicht daran, aus allen Rohren zu feuern. »Alleingang stimmt schon mal nicht, er hatte einen Partner dabei. Und wenn sie vorschriftsmäßig Verstärkung angefordert hätten, dann wäre der Partner vielleicht noch am Leben.« Kaum, dass ich die Worte ausgesprochen habe, weiß ich, wie letztklassig sie waren. Doch anstatt sie zurückzunehmen, rede ich einfach weiter. »Und ja, er mag Schreckliches erlebt haben, aber rechtfertigt das diesen Zirkus, den er um sich inszeniert?«
»Du weißt schon, dass er die Einnahmen aus den Buchverkäufen gespendet hat, oder?«, erwidert Lisa gelassen.
»Ach«, winke ich ab. »Das sagen sie doch alle.«
Okay. Die Verwandlung ist abgeschlossen. Jetzt klinge ich vollends wie ein frustrierter alter weißer Mann. Was ist nur los mit mir? Das ist reinste Selbstdemontage, die ich hier betreibe.
»Es tut mir leid«, murmle ich nach einiger Zeit zerknirscht. »Ich habe es einfach satt, dass in diesem Land immer die Gleichen vorwärtskommen, während Leute wie ich auf der Stelle treten.«
Resigniert wende ich den Blick ab, stütze meine Hände in den Schoß. Dann spüre ich ihr Kinn auf der Schulter.
»Du wirst auch deine Chance bekommen, ganz bestimmt«, sagt sie, schlingt von hinten ihre Arme um meine Brust und drückt sich fest an mich.
Zärtlich streiche ich über ihren Handrücken, küsse ihn dann, lege ihre Hand in meine.
»Komm«, sagt sie. »Mach deine Souvlaki-Belege morgen. Lass uns ins Bett gehen.«
Sie reibt ihren Körper an meinem, löst Schicht um Schicht meines Widerstandes, als plötzlich meine Hose vibriert.
»Och nö!«
Irritiert hole ich das Diensthandy heraus, betrachte die Nummer. Was wollen die denn so spät?
Ich räuspere mich, hebe ab. Dann höre ich einfach nur zu, minutenlang. Bis die Verbindung getrennt wird.
»Was ist?«, fragt Lisa leise.
Ich hebe den Blick, zwinkere ein paar Mal, lasse dann das Telefon wieder in meiner Hosentasche verschwinden. »Sie schicken mich zu einem Tatort.«
Lisas Miene erhellt sich schlagartig. »Da ist sie ja, deine Chance, gratuliere!« Sie geht zur Vitrine und holt ein zweites Weinglas. »Haben sie dir etwas über den Tatort gesagt?« Sie schenkt einen tüchtigen Schluck ein, reicht mir das Glas.
»Nein«, lüge ich, versuche, einen klaren Kopf zu bekommen.
»Lass uns anstoßen!« Sie erhebt ihr Glas, wie ferngesteuert tue ich es ihr gleich. »Auf deinen ersten Fall, mein Schatz! Du wirst …« Sie unterbricht sich, scheint kurz abgelenkt, blickt dann verlegen zur Seite. Und in dem Moment bemerke ich es ebenfalls.
»Cheers«, sage ich schnell, spanne meine Muskeln an, doch das macht es nur schlimmer.
Wir stoßen an und nehmen beide einen großen Schluck, damit wir nichts sagen müssen. Damit wir ignorieren können, dass eine Chance auch zu groß sein kann. Dass Träume platzen können und manche sich als Albträume entpuppen. Aber am meisten ignorieren wir meine Hand. Sie zittert so stark, dass ich das Weinglas kaum halten kann.
Er
Wach auf, mein Schatz, es ist spät. Du schläfst schon zu lange, klammerst dich an deine Träume, als böten sie dir einen sicheren Hafen. Aber dir muss klar sein, dass das nicht stimmt, oder? Du weißt, dass du nirgendwo auf dieser Welt sicher bist vor mir. Du spürst es, tief in dir drinnen: Dies ist dein letzter Traum auf Erden.
Ich hoffe, du kostest ihn aus, ich wünsche es dir wirklich. Und ich wünschte, ich könnte ihn sehen, deinen letzten Traum. Wie er sich wohl gestaltet? Was erlebst du gerade?
Bist du irgendwo in deiner Kindheit, mit Papa, Mama und dem kleinen Hündchen, das du nie haben durftest, aber immer wolltest? Seid ihr an deinem Lieblingsort? Ihr seid hübsch hergerichtet, die Zeit steht still, und alles um dich herum ist so, wie du es dir gewünscht hast. Ist es so? Oder ist es abstrakter? Leuchtend bunte Farben, wogende Klänge, Gefühlsräusche, die über dich hinwegfluten, nicht greifbar, aber dennoch so schön, dass sie deine Seele zum Fliegen bringen. Rühren daher die Tränen, die unter deinen Lidern hervorquellen? Ist es ein Glitzern der Freude? Oder ist es ganz anders? Ist es nicht schön, kein Glitzern, keine Kindheit, kein Schoßhündchen, kein gar nichts? Oh, ich wüsste es zu gerne. Und ich wüsste gerne, ob ich sie beeinflussen kann, deine Träume.
Wie ist es … spürst du das? Fühlst du das Messer an deiner Schläfe? Die kalte Schneide, wie sie hinabwandert über deine Wangen, den Hals, dein Schlüsselbein. Ich kann sie über den gesamten Körper wandern lassen, sie wird auf keinen Widerstand stoßen. Deine edlen Kleider trägst du schon lange nicht mehr. Ich habe sie dir genommen, so, wie ich dir das Leben nehmen werde. Wenn sie dich finden, wird dein Blut überall sein. Die Dielen werden sich vollgesogen haben mit deinem Lebenssaft.
Aber noch ist es nicht so weit, noch müssen wir warten. Auf dass du zurückkehrst aus dem Reich der Träume und in der Wirklichkeit erwachst. Sie wird dir nicht gefallen, beileibe nicht. Wahrscheinlich wirst du denken, du wärst immer noch im Schlaf gefangen. Aber du täuschst dich. Denn glaube mir: Kein Albtraum, der deinem Geist entspringt, kann so schrecklich sein wie das, was ich mit dir vorhabe.
Wach auf, mein Schatz.
Ich bin gekommen, um dich zu rauben.
Jacket
Dienstag, 18.10.2022–21:40 Uhr
Als ich in die Metternichgasse einbiege, ramme ich beinahe einen Streifenwagen. Zum einen, weil die Tabletten meine Reaktionszeit verlangsamen, zum anderen, weil diese Idioten auf meinem Parkplatz stehen. Ich fahre auf Höhe des Wagens, kurble das Fenster herunter, bedeute den beiden Polizisten, das Gleiche zu tun.
»Na, Sportsfreunde, war die Straßenverkehrsordnung bei eurer Grundausbildung nicht dabei?«
Zwei Augenbrauenpaare ziehen sich gleichzeitig zusammen, lassen unschwer erkennen, dass die beiden keinen Spaß verstehen. Nichts könnte mir egaler sein – auch eine Begleiterscheinung der Tabletten. »Halten und parken verboten, ausgenommen W 1717K«, stichle ich weiter, nicke in Richtung der Hinweistafel. »Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war das mein Kennzeichen.«
Beide rümpfen die Nase, mustern irritiert das Schild.
Zugegeben: Eine Halteverbotszone, in der nur ein einziger Wagen stehen darf, ist äußerst selten. Aber in dieser Stadt gibt es nichts, was es nicht gibt. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Der Verkehrsstadtrat ist ein guter Bekannter. Den Parkplatz hat er mir letztes Jahr zu meinem vierundvierzigsten Geburtstag geschenkt.
»Stellt euch in die Einfahrt da vorne. Wenn die Besitzer die Polizei rufen, seid ihr schon da.«
Im Einsatzwagen kehrt Leben ein. Der Kollege auf dem Beifahrersitz reißt die Tür auf, schwingt sich heraus und macht ein Gesicht, als würde er für Zornesfalten werben. Erst als er mich erkennt, verändert sich seine Miene. Nicht unbedingt zum Besseren. »Jacket? Was machen Sie denn hier?«
»Ich wohne hier«, entgegne ich ungeduldig, trommle mit den Fingern auf meinem Lenkrad herum. »Wenn ihr also so freundlich wärt …«
Er starrt mich mit leerem Ausdruck an, macht keine Anstalten, den Wagen umzuparken.
Ich will schon aussteigen, um meiner Bitte Nachdruck zu verleihen, als sich im Rückspiegel eine weitere Streife breitmacht. »Herrgott noch mal«, fluche ich, lege den Gang ein und parke selbst in der Einfahrt. Der Klügere gibt bekanntlich nach.
Als ich vor ihm stehe und mir die Dienstnummer geben lassen will, hat er seinen Zorn gegen Bewunderung getauscht. »Schickes Teil«, kommentiert er knapp, nickt in Richtung meines Wagens. »Welches Modell?«
»Ein 1963er Mercury Monterey in Black-Cherry-Rot. Fährt sich wie ein Traum, schluckt Sprit wie ein Panzer.«
Er nickt abermals. Hinter ihm holen die eingetroffenen Kollegen Absperrbänder aus dem Kofferraum.
»Was ist hier eigentlich los?«, frage ich etwas gereizt. »Ich wohne in der Zehn, muss ich mir Sorgen machen?«
»Die Tote liegt in der Neun.«
»Tote?« Ich schaue zum Haus gegenüber, überlege kurz, ob ich dort jemanden kenne. Dann fällt mir eine Bewegung im Inneren des Streifenwagens auf. Der Kerl kommt mir irgendwie bekannt vor. »Und der Typ bei euch auf der Rückbank?«
»Haben wir bei der Leiche gefunden. Sagt kein Wort, starrt bloß apathisch vor sich hin.«
»Mhm. Und wie ist die Tote zur Toten geworden?«
Der Polizist nimmt einen tiefen Atemzug der lauen Nachtluft, kaut ein bisschen darauf herum, entlässt sie dann wieder mit einem Hauch schalem Kaffeegeruch. »Unglücklich gestolpert ist sie jedenfalls nicht«, sagt er schließlich schulterzuckend. »Kein schöner Anblick da oben. Aber das müssen die Kollegen von Leib-Leben klären.«
»Schon jemand da?«
»Dauert noch. Der Bereitschaftsdienst musste wohl in Quarantäne, die suchen gerade nach Ersatz.«
Ich stemme die Hände in die Hüften und überlege, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme. Ich habe absolut keine Lust auf diese Geschichte, brauche dringend eine Runde Schlaf und habe morgen früh Termine. Aber die Chancen, mich davonzustehlen, stehen denkbar schlecht. Jeder Polizist weiß, dass ich eigentlich beim Ermittlungsbereich Leib-Leben arbeite. Und Schlaf finde ich in letzter Zeit ohnehin kaum. »Na gut«, seufze ich auf. »Funken Sie in die Zentrale, dass ich übernehme.«
Einen Moment lang reagiert er gar nicht. Dann beginnt er zu lachen, als hätte ich einen Witz gemacht.
»Was soll das?«, fahre ich ihn an.
Er verstummt abrupt, flüchtet sich ins Stottern. »Äh … also … ich dachte …«
»Für die Leute da draußen bin ich der Einfachheit halber Inspektor, aber Sie wissen, dass ich eigentlich Chefinspektor bin und somit Ihr Vorgesetzter, richtig?«
»Ja schon, ich dachte nur …«
»Was dachten Sie?« Ich trete näher, rücke ihm auf die Pelle, kann förmlich sehen, wie er sämtliche Sprüche, die ihm auf der Zunge liegen, hinunterwürgt. Aber natürlich weiß ich, welche Sprüche das sind und was er über mich denkt. Es ist das, was sie alle denken: dass ich nur noch ein Showbulle bin. Ein zahnloser Tiger, der bloß so tut, als hätte er einen Dienstausweis und Waffenschein. Für das Volk bin ich ein Held, aber meine Kollegen halten mich für eine Witzfigur, weil ich im Fernsehen auftrete und ein Buch herausgebracht habe.
»Alsdann«, zische ich scharf und setze dann wieder mein Lächeln auf. »Ich bin dicht hinter Ihnen.«
Zögernd trottet er los in Richtung Hauseingang. Ich folge ihm und begreife im nächsten Moment, dass mir mein Stolz gerade Arbeit eingebrockt hat. Aber für einen Rückzieher ist es zu spät.
Im Innenhof wird mir klar, dass ich nie auch nur einen Fuß in dieses Gebäude gesetzt habe, obwohl es gleich gegenüberliegt. Das Haus, in dem ich wohne, ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz, ich lebe dort schon eine halbe Ewigkeit, aber ich war noch nie in einem der anliegenden Häuser. Trotzdem finde ich mich sofort zurecht. Im Grunde gleichen sich diese Wiener Altbauten wie ein Ei dem anderen. Dieses scheint jedoch nie in den Genuss einer Modernisierung gekommen zu sein, es wirkt ziemlich mitgenommen. Im dritten Stock wartet ein Beamter, von dem man Ähnliches behaupten könnte.
Kaum, dass er uns sieht, zieht ein Lächeln über sein fahles Puddinggesicht. Als wir näher kommen, verschwindet es jäh.
»Inspektor Jacket ist jetzt da«, eröffnet ihm sein Kollege verkrampft. »Er übernimmt den Fall.«
»Chefinspektor«, korrigiere ich trocken, mustere die schiefe Tür hinter dem Pudding. »Waren Sie das etwa?«
Erschrocken fährt er herum. »Ich?« Er schüttelt sich heftig. »Nein, sie war so – vermutlich schon länger. Hier wohnt niemand, wie es scheint.«
Ich betrachte das Klingelschild – kein Name. Das Gebäude wirkt generell verlassen. Leerstand, die Geißel aller Großstädter auf der Suche nach bezahlbaren vier Wänden. »Dann wollen wir uns die Sache mal ansehen«, sage ich und nicke dem Schwabbel zu. »Nach Ihnen.«
Er macht ein bedröppeltes Gesicht. »Wollen Sie nicht auf die Spurensicherung warten, damit sie den Tatort freigibt?«
»Wollen Sie mir meinen Job erklären?«, keife ich zurück, bohre meinen Blick in seinen, stoße auf wenig Widerstand. Befehlsgewohnt tut er wie ihm gesagt, hebt die Tür leicht an, schiebt sie zur Seite und zwängt sich durch den Spalt in die Wohnung.
Ich will ihm folgen, zögere. Eine Tote mitten in einer Millionenstadt, in einem leer stehenden Gebäude, schießt es mir durch den Kopf. Irritiert bleibe ich einen Moment stehen, überlege, verwerfe den Gedanken wieder. Lächerlich.
Drinnen ist es duster. Die Räumlichkeiten werden nur spärlich vom orangefarbenen Schein der Straßenlaternen erhellt, doch das Licht reicht aus, um zu erkennen, dass sich auch hier das typische Altbaumuster fortsetzt. Doppelflügelige Holztüren verbinden knapp vier Meter hohe Räume, ausgelegt mit einem obligatorisch knarrendem Fischgrätparkett, über dem eine stuckverzierte Decke thront. Ungewöhnlich ist nur der Zustand der Wohnung: Sie wurde ausgeschlachtet.
Das Gerippe einer längst vergangenen Ära …
Konzentrier dich, alter Mann!
Während an der einen Seite des Flurs lose Kabel aus dem Mauerwerk hängen, ziert auf der anderen ein bronzener Kandelaber die Wand – dick mit Staub bedeckt. An der Decke befindet sich eine Hängeleuchte, eines der teuren Modelle mit gebogenen Opalgläsern, allerdings zerbrochen.
Verfallener Prunk für eine verdorbene Seele, ploppt wieder ein Gedanke auf. Er fühlt sich irgendwie bekannt an. Als hätte ich ihn bereits gedacht. So als wäre ich schon mal hier gewesen, obwohl ich genau weiß, dass ich das nicht war. Vielleicht sollte ich eine Zeit lang die Finger von den Tabletten lassen.
»Licht«, rufe ich Pudding zu.
Als Antwort bekomme ich nur seine Taschenlampe in die Hand gedrückt. »Kein Strom.«
Ich knipse das Ding an, lasse Spinnweben und nackte Wände erstrahlen, wage ein paar Schritte in die Diele hinein. In jedem abgehenden Raum steht irgendein mit grobem Leinen verhülltes Trumm. Vermutlich Restbestände des Mobiliars. Entweder die Besitzer mussten überstürzt ausziehen, oder sie sind länger verreist, und die Wohnung wurde von Plünderern heimgesucht.
»Haben wir den Namen des Gebäudeverwalters?« Meine Frage verhallt im Raum. Ich lenke den Lichtstrahl den Flur hinunter.
Wachtmeister Pudding ist bei der Eingangstür stehen geblieben, glotzt mit zusammengekniffenen Augen in meine Richtung. »Ich bleibe lieber hier«, rechtfertigt er sich. »Ich möchte den Tatort nicht verunreinigen … mit meiner DNA und so.«
»Ach, jetzt hören Sie doch auf. Denken Sie, die Laborratten von der SpuSi sind auf den Kopf gefallen? Die schließen die DNA der beteiligten Ermittler natürlich aus, sonst wäre bei jedem zweiten Leichenfund irgendein Polizist der Hauptverdächtige, weil er sich gekratzt hat.«
Er presst die Lippen zu einem dünnen Strich, hält kurz inne. Dann schlingt er die Arme ganz eng um seinen Körper und tapst los. Schweigend beobachte ich, wie er versucht, leichtfüßig über das Parkett zu staksen, bei jedem Schritt bedacht, den Boden so wenig wie nur irgend möglich zu berühren. Ich glaube, er hält sogar den Atem an, bis er einsieht, wie zwecklos sein Unterfangen ist.
»In welchem Zimmer?«, frage ich, als er japsend vor mir steht.
Er deutet nach links zu einer Tür.
»Aufmachen. Ich habe keine Handschuhe dabei.«
Sein Blick bekommt etwas Flehendes.
»Ich sagte: aufmachen!«
Knarrend schwingt die Tür auf, verschwindet in der Schwärze des Raumes. Ich lasse den Lichtkegel über die Wand zu meiner Linken gleiten, erkenne schwere Brokatvorhänge, die beinahe das gesamte Licht der Straßenlaternen verschlucken. Als ich weiterwill, hält mich Pudding zurück. »Was denn jetzt?«, schnauze ich ihn an, verliere aber im nächsten Moment meinen Zorn. Etwas ist anders an ihm. Der Ausdruck in seinen Augen … Er hat Angst. Ich folge seinem Blick, richte den Lichtstrahl auf den dunklen Fleck vor mir, erstarre.
Wenn sie dich finden, wird dein Blut überall sein, schießt es mir durch den Kopf. Die Dielen werden sich vollgesogen haben mit deinem Lebenssaft. Hör auf. Reiß dich zusammen!
Ich blinzle, fokussiere, versuche, die Menge abzuschätzen. Einiges muss bereits in den Ritzen versickert sein, aber ich tippe auf einen halben Liter Blut, vielleicht mehr. Die Lache mündet in einer blutigen Schleifspur, die sich tief in den Raum hineinzieht und vor den Füßen eines antiken Tisches endet.
Gebettet auf Mahagoni mit Blick ins stuckbehangene Himmelszelt.
Ich lasse den Lichtkegel die gedrechselten Tischbeine hinaufwandern, bis der Schein den Saum eines Tuches erfasst. Und dann erfasst er noch etwas: einen nackten Fuß. Der Lichtkegel schnellt zur anderen Ecke des Tisches, lässt den zweiten Fuß knochenbleich erstrahlen.
So sollen sie dich finden: entblößt, entstellt und gedemütigt.
Ein Schauer läuft mir den Rücken hinunter, breitet sich aus und fährt mir in Mark und Bein. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich! Aber wenn doch, dann …
Panik! Sie explodiert in mir, durchdringt alles, übernimmt die Kontrolle. Aufgebracht stürze ich in den Raum hinein, steige über die Blutlache hinweg, ignoriere den Tisch, die Leiche, balanciere zwischen all den kleinen Spritzern und Flecken hindurch. Fahrig drehe ich mich um mich selbst, lasse den Lichtkegel die Wände entlangpeitschen auf der Suche nach etwas, das nicht da sein kann, nicht da sein darf! Und dennoch erwarte ich, dass es mich jeden Moment anspringt.
»Suchen Sie etwas?«, ertönt eine Stimme hinter mir.
Ich reiße die Taschenlampe herum. »Was?«
»Ob Sie etwas suchen?«, fragt Pudding erneut.
»Ich … wollte nur sehen, wie viele Zugänge der Raum hat«, rette ich mich in eine fadenscheinige Ausrede, betrachte wieder die Wände, als …
Licht!
Blendend hell und überall. Mit zusammengekniffenen Augen stehe ich da, blinzle die nackte Glühbirne an, die von der Decke baumelt.
Draußen werden Stimmen laut. »Strom ist wieder da«, ruft jemand. Weitere Geräusche folgen: Reißverschlüsse ratschen zeitverzögert zu, Kofferschlösser schnappen auf.
»Die Spurensicherung«, sagt Puddinggesicht hinter mir, kaum hörbar. Es vergehen ein paar Sekunden. Dann: »Mein Gott, das ist ja … Wer macht so etwas?«
Die Frage ist eindeutig an mich gerichtet, aber ich ignoriere sie, sehe mir das nicht an. Nicht, weil ich Angst habe vor dem, was da ist – ich habe Angst vor dem, was da sein könnte. Denn noch ist es nur ein Déjà-vu, noch ist es vielleicht bloß unzuverlässige Erinnerung, Störfeuer der Synapsen, reiner Zufall. Aber wenn ich mich umdrehe, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe und recht behalten sollte. Dann wird der Wahn zur Wirklichkeit. Deshalb starre ich weiter die Wand an, drehe mich nicht um, ignoriere, dass ich die Leiche der Frau nicht sehen muss, um zu wissen, was ihr angetan wurde. Ich weiß es bereits. Im Grunde weiß ich es seit Wochen.
Mo
Dienstag, 18.10.2022–22:58 Uhr
»Stimmt so«, knurre ich den Taxifahrer an, stecke ihm den Zwanziger zu und springe aus dem Auto. Wie kann man sich eigentlich so dermaßen verfransen? Noch dazu bei so einer bekannten Adresse. Metternichgasse, das ist Botschaftsviertel, das ist Palais Rothschild, das ist gleich gegenüber vom Prunkgarten des Schloss Belvedere. Wer so wenig Ahnung von Wiens Straßen hat, sollte …
»Hier kein Durchgang!«
Verdutzt blicke ich auf, brauche eine Sekunde, bis der Groschen fällt. »Ach so, ja, warten Sie«, beginne ich, krame in meiner Jackentasche. »Bitte!«
Der Streifenpolizist mustert argwöhnisch meinen Dienstausweis, dann mich, dann wieder den Ausweis. Typisch: Seitdem ich als Kriminalbeamter die Uniform gegen den Anzug getauscht habe, schlägt mir nur Misstrauen entgegen. Als wäre die Karriereleiter für meinesgleichen harām. Ich hasse diese Blicke. Und noch viel mehr hasse ich es, dass ich es nicht schaffe, den Ausweis ruhig zu halten. Dieses verdammte Zittern!
Oben im Hausflur hat die Spurensicherung bereits ihr Lager aufgeschlagen. Ich schnappe mir einen der herumliegenden Overalls, schlüpfe in die Schuhüberzieher und zwänge meine schwitzigen Hände in Latexhandschuhe. »Wo sind die Masken?«, frage ich einen Kriminaltechniker, der mit Adhäsionspulver und Pinsel bewaffnet aus der Wohnung kommt.
»Und Sie sind?«
Ich seufze. Wenn in besseren Gegenden Wiens Menschen meiner Hautfarbe ohne offensichtlichen Solariums- oder Zwei-Wochen-DomRep-All-Inclusive-Hintergrund keine Tüte eines Essenslieferdienstes in der Hand haben, dann sind sie für meine Kollegen vor allem eins: verdächtig. »Bezirksinspektor Mohammad Moghaddam, Leib-Leben. Wenn Sie jetzt auch noch meinen Ausweis sehen wollen, hab ich ihn jedem Beamten gezeigt, der heute Dienst hat.«
Er beachtet mich kaum, fummelt am Verschluss eines silbernen Aluminiumkoffers herum. »Wäre es Ihnen lieber, wenn wir jeden an einen Tatort lassen, der behauptet, Polizist zu sein?«, gibt er trocken zurück, verzieht keine Miene.
»Nein, ich …« Ach, was soll’s. Entnervt zippe ich den Overall wieder auf, zücke meinen Ausweis.
»Danke«, antwortet er schlicht, ohne auch nur für eine Sekunde hinzusehen. »Otto Kremaier, Leiter Assistenzbereich 7, Tatortgruppe. Wir sind uns noch nie begegnet, richtig?«
»Ich war bisher eher im Hintergrund tätig«, weiche ich aus, nur um das Gespräch gleich wieder auf den Fall zu lenken. »Die Zentrale hat mir nur einen kurzen Überblick gegeben. Gibt es schon mehr Infos?«
»Machen Sie sich gerne selbst ein Bild«, entgegnet er monoton, holt aus einem der Koffer ein Stativ und einen Reflektorschirm, aus einem anderen eine Maske und drückt mir alles in die Hand. »Mitkommen.«
Verzweifelt versuche ich, Schritt zu halten und gleichzeitig den Mundschutz anzulegen, ohne dabei die Teile fallen zu lassen.
»Das Gebäude steht fast leer. Eine letzte verbliebene Bewohnerin hat die Polizei alarmiert, es gebe Lärm im Haus. Sie hat sich am Nachmittag schon einmal beschwert – da sie anscheinend ständig in der Wache anruft, sind die Kollegen allerdings erst bei der zweiten Beschwerde am Abend zu ihr gefahren. Vor Ort haben sie dann die Tote hier gefunden, aber dazu fragen Sie am besten die Kollegen oder Showtime. Wir haben hier alles aufgebaut und …«
»Showtime?«, wiederhole ich irritiert und ziehe die Stirn kraus.
Als Antwort bricht Kremaier aus seiner Monotonie aus und ringt sich ein kehliges Lachen ab. »Wenn man so lange bei der Truppe ist wie ich, kennt man seine Pappenheimer unter vielen Namen. Früher hieß er bei uns ›Kommissar Showtime‹ oder ›Primetime‹, manche nannten ihn auch ›Hollywood‹. Er war schon eine Rampensau, als sich noch kein Schwein für ihn interessiert hat.«
Rampensau? Ich stehe auf dem Schlauch, begreife nicht, was Kremaier da faselt. Erst als einen Moment später seine Stimme aus dem Nebenraum dringt, geht mir ein Licht auf.
Mein Schicksal ist ein Arschloch.
Erst wirft es mir einen saftigen Knochen hin, nur um ihn mir dann wieder wegzuziehen. Das ist meine Bestimmung: scheitern, bevor ich es überhaupt versuchen durfte.
Aber warum er? Warum ausgerechnet er?
»Na, Kinder? Alle fit?« Jacket betritt den Raum, als wäre das hier kein Tatort, sondern ein Sektempfang und er der mondäne Gastgeber. »Ingo, was macht die Vorhand? Du kannst dich nicht ewig vor der Revanche drücken! Tini, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wolltest du nicht ins Ausland gehen?«
Er ist mit allen sofort per Du, schwebt leichtfüßig durch die Reihen der Spurensicherer und schüttelt jedem die Hand – ohne Handschuhe! Er trägt auch keinen Overall oder Überzieher! Er steht einfach in seinem üblichen feinen Zwirn da, trampelt mit seinen blank polierten Budapestern auf den Spuren herum, und niemand tut etwas dagegen.
»Otto!« Als er uns sieht, klatscht er in die Hände und hebt die akkurat gezupften Brauen fast bis zu seinem satt gegelten Haaransatz. »Solltest du nicht längst in Rente sein? Wie viel hast du noch? Ein oder zwei Jahre?«
»Ein Jahr, acht Monate und zwölf Tage«, entgegnet Kremaier stoisch und liefert mit seiner Antwort gleich die Begründung für seine Gleichgültigkeit.
»Die werden auf Knien rutschen, dass du bleibst«, witzelt Jacket, beachtet ihn jedoch gar nicht mehr, sondern mich. »Hilf mir kurz auf die Sprünge. Wie war noch gleich dein Name?«
Das war ja klar. Er kennt ausnahmslos jeden hier im Raum per Vornamen, aber ich bin bloß ein großes Fragezeichen. Und das, obwohl wir in derselben Abteilung arbeiten.
»Mohammad Moghaddam«, stelle ich mich zähneknirschend vor. »Wir kennen uns, ich …«
»Ach, richtig!«, tönt er lautstark, schlägt sich dabei theatralisch auf die Stirn. »Momo! Daten-Momo, der sich um die Akten kümmert! Ich hab dich gar nicht erkannt unter dem Overall und all dem Zeug.«
Mein Mund klappt auf, produziert nichts außer heißer Luft. Momo? So nennen mich die Kollegen, wenn ich nicht im Raum bin? Daten-Momo?
»Na, da haben sie aber jemanden unnötig aus den Federn geholt, was?« Er klopft mir mit einem Ausdruck der Anteilnahme auf die Schulter, zieht mich an sich. »Aber macht ja nichts, vier Augen sehen besser als zwei.«
Toll. Wirklich toll. Ich könnte jetzt gemütlich zu Hause mit Lisa im Bett liegen, stattdessen bin ich der Adjutant dieses Clowns. Ich fasse es nicht.
»Die fotografische Sicherung ist abgeschlossen«, ertönt Kremaiers Stimme. »Lassen Sie uns anfangen.«
Die Tür neben uns schwingt auf. Ich blinzle, erfasse, halte die Luft an … Und all die Wut und der Frust in meinem Bauch implodieren zu einem stecknadelgroßen Stachel, der sich mit jedem Atemzug tiefer in mein Innerstes bohrt und sein Gift absondert. Ein toxisches Gemisch aus Reue, Scham und Entsetzen über mich selbst und über das, was ich bis gerade eben noch als wichtig erachtet habe. Aber so ist es nun mal: Erst im Angesicht des Todes merkt man, wie unbedeutend und klein und geradezu lächerlich die eigenen Probleme doch sind.
Wir betreten den Raum, als wäre er eine Kirche, in der gerade ein Gottesdienst abgehalten wird. Sekundenlang herrscht Stille, niemand sagt etwas. Dann durchbricht ein leises Klicken den Bann.
»Erste Tatortbeschau durch den Leiter des Assistenzbereichs 7, Otto Kremaier, und die Ermittler Johann Jacket Winkler, LKA-Abteilung Leib-Leben, und Mohammad Mo-« Kremaier unterbricht sich, richtet sein Diktiergerät auf mich.
»Moghaddam«, ergänze ich gedankenverloren, trete näher an den Tisch heran.
»… Kollege Moghaddam, ebenfalls Leib-Leben. Wir haben jetzt 23:05 Uhr, das Opfer wurde um 21:26 Uhr gefunden. Witterung draußen milde fünfzehn Grad, hier drinnen höchstens ein oder zwei Grad mehr. Der Fund war weder Wind noch Wetter ausgesetzt, Tierfraß ist ebenso unwahrscheinlich. Zur Leiche …«
Kremaier drückt die Stopptaste, legt den Kopf schief, atmet schwer aus und lässt ein paar Sekunden verstreichen, bevor er die Aufnahme fortsetzt. »Das Opfer ist weiblich, weiß, schlank, geschätzt um die vierzig, aktuell keine weiteren Personalien feststellbar. Sie wurde nackt aufgefunden, rücklings an einen Mahagonitisch gefesselt. Ausgestreckte, gespreizte Beine, die Arme ebenso arrangiert. Die Fesseln sind augenscheinlich aus Nylondraht, Farbe Petrol. Fixiert wurde sie an den Hand- und Fußgelenken und …« Er unterbricht sich wieder, geht in die Knie. »Das Opfer ist teilweise mit einem Laken verhüllt, es bedeckt einen großen Teil des Rumpfes und des Unterleibs. Wir heben das Laken nun an. Meine Herren …«
Ich nicke, greife nach der rechten unteren Ecke des Tuches.
»Meine Herren!«, wiederholt Kremaier lautstark.
Jetzt erst fällt mir auf, dass Jacket immer noch in einigem Abstand zum Tisch steht. Er fühlt sich anscheinend nicht angesprochen, hebt bloß die Hände und schüttelt sie demonstrativ. »Sorry, keine Handschuhe.«
Kremaier verdreht die Augen, stopft das Diktiergerät in die Brusttasche seines Overalls, greift sich ein weiteres Ende des Lakens. Vorsichtig heben wir es an, gehen ein paar Schritte beiseite und legen es auf eine bereits ausgelegte Plastikfolie.
»Nichts!«
Verwundert sehe ich auf, Kremaier ebenso. Jacket hat es sich wohl anders überlegt, steht jetzt dicht am Tisch, begutachtet die Leiche, wirkt irgendwie … erleichtert.
»Nichts! Keine Schnitte, keine Verletzungen«, sagt er, mehr zu sich selbst als zu uns.
Kremaier räuspert sich, ignoriert Jackets seltsame Wortmeldung und spricht weiter aufs Band. »Das Laken ist entfernt. Das Opfer wurde auch an den Hüften mittels Nylondraht an den Tisch fixiert. Durch den Draht ist es zu Läsionen der Haut im Hüftbereich und an Händen und Füßen gekommen. Ansonsten finden sich an Unterkörper und Rumpf auf den ersten Blick keine Verletzungen. Am Hals jedoch …«