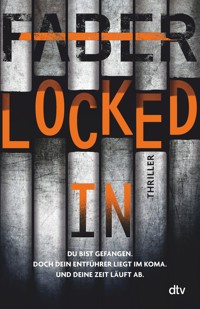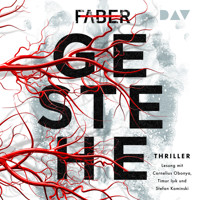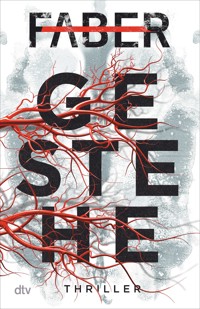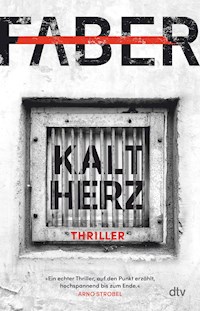
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lies Faber, wenn du dich traust! »Mama ist im Himmel. Jetzt habe ich eine Mami. Aber sie sagt, für das, was sie getan hat, kommt sie in die Hölle.« Acht Minuten. Länger war die fünfjährige Marie nicht alleine. Doch als ihre Mutter zum Auto zurückkommt, ist Marie spurlos verschwunden. Kommissarin Kim Lansky übernimmt den Fall. Es ist ihre letzte Chance, sich als Ermittlerin zu beweisen. Die Suche nach der Wahrheit führt sie in die dunkelsten Kapitel ihrer eigenen Vergangenheit – und zu einer erschreckenden Frage: Warum bleiben gerade in München so viele Kinder verschwunden? »Ein echter Thriller, auf den Punkt erzählt, hochspannend bis zum Ende.« Arno Strobel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Henri Faber
Kaltherz
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Rudolf senior
Nichts ist so leer wie ein Kinderzimmer, das einst voller Leben war.
Ich habe sie getötet.
Niemand wird je erfahren, dass ich es war. Alle werden denken, das Schicksal hätte sie gerichtet. Aber ich weiß es besser: Es war meine Schuld. Und die Strafe dafür ist ein Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Ringsherum knackt das Unterholz. Meine Füße fliegen über den Morast. Äste peitschen auf mich ein, fühlen sich an wie schartige Messer, die mir das Fleisch von den Knochen reißen; und ich stolpere, taumle, irre durch den Wald – so lange schon –, als wäre die ganze Welt bloß Wald und mein Leben eine nie enden wollende Flucht. Jeder Schritt ist Schmerz, jeder Atemzug ein Kampf um den nächsten, jeder Blick die Gewissheit, dass das Gift immer noch in meinen Adern fließt. Es frisst sich in mein Innerstes, höhlt es aus und hinterlässt nur das Echo eines Schreis, der auf ewig in mir widerhallen wird.
Ihr letzter Schrei.
Ich will ihn nicht hören. Alles, was ich will, ist raus. Raus aus dem Wald. Raus aus der Stadt. Raus aus mir selbst. Aber es gibt kein Entkommen. Die Erschöpfung ist ein Jäger, der kein Erbarmen kennt. Ich schaffe noch vier oder fünf Schritte, dann breche ich zusammen, schlage der Länge nach auf dem Waldboden auf. Spitze Steine bohren sich mir in die Wange. Mein Mund ist ausgedörrt bis tief in die Kehle. Die letzten Kraftreserven sind verbraucht. So liege ich da, unfähig auch nur zur kleinsten Regung. Außerstande, mich der Erinnerungen zu erwehren. Sie flackern vor meinen Augen wie Feuerzungen: schwitzende Leiber, malmende Kiefer, Blitze wie Maschinengewehrsalven. Es sind bruchstückhafte Schemen, zerfasert und verworren, durchzogen von blindem Hass auf mich selbst. Auf das, was aus mir geworden ist. Auf das, was ich getan habe.
Ich habe sie auf dem Gewissen.
Ich habe sie getötet.
Alle drei.
TEIL EINS
Marie
Der Papa hat keine Beine.
Das macht aber nichts, weil beim lieben Gott im Himmel braucht man keine. Im Himmel hat jeder Flügel und fliegt überallhin, wo er möchte. Ich weiß aber nicht, wie man schöne Flügel malt, also male ich dem Papa doch Beine. Mit Braun. Braun ist eine gute Beinfarbe. Ich hab schon Gelb für die Haare und Rosa für das Gesicht und Grün für die Jacke und … oh. Mit Braun hab ich schon Mister Knuddels gemalt, der sieht überhaupt nicht aus wie Papas Beine. Ich kneife die Augen zusammen, damit ich mich an Papas Beinfarbe erinnere, aber sie fällt mir nicht ein. An Mister Knuddels kann ich mich richtig gut erinnern, weil er immer bei mir war. Papa nicht, der war oft weg.
Jetzt sind beide im Himmel.
Das Auto macht einen Ruck, und der braune Buntstift rollt in den Schlitz bei der Tür, wo auch schon Lila, Blau und Rot sind. Da komm ich nicht ran, und abschnallen darf ich mich nicht. Miste-Kiste. Ich gucke aus dem Fenster. Die Bäume bewegen sich nicht mehr. Von hier unten sieht alles anders aus. Im Früher-Auto hatte ich einen eigenen Sitz, der war viel, viel höher, und ich konnte alles Mögliche vorbeifliegen sehen: Häuser, Bäume, Autos, Mamas, Papas, Kinder … Aber von hier unten geht das nicht so gut. Außerdem tut mir der Gurt an der Haut weh. Vielleicht kann ich mich ja nur ein bisschen abschnallen?
Irgendwas knirscht.
Ich gucke aus dem anderen Fenster, und da geht eine Erwachsenenperson an unserem Auto lang. Ich glaube, das ist ein Mann, er ist ganz breit und groß und hat so eine Jacke an wie die Polizisten. Im Fernsehen haben die Polizisten andere Jacken an, aber das darf ich eigentlich nicht wissen, weil die Sendungen nicht für Kinder sind.
»Na, Gnädigste? Haben wir’s ein bisschen eilig?«
Ich hab gar nicht gemerkt, dass vorne das Fenster offen ist. Er legt seine Hand auf das Auto, und dann kommt sein Kopf fast herein, aber nur fast. Als er mich sieht, wird sein Gesicht ganz lieb.
»Oh. Na hallo, wen haben wir denn da? Gleich zwei Prinzessinnen in einer Kutsche.«
Er lächelt mich an. Die Mama hat immer gesagt, wenn man was gefragt wird, dann muss man auch antworten, aber nicht Fremden, mit denen darf ich nicht reden. Ist das ein Fremder? Warum sind wir überhaupt Prinzessinnen in einer Kutsche? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und gucke einfach nur.
»Deine Mama war ein bisschen zu schnell dran, aber keine Angst, das dauert nicht lange«, sagt er jetzt und dann noch »Führerschein und Fahrzeugpapiere« und etwas von einem Kindersitz, der fehlt, doch das sagt er nicht zu mir. Das klingt komisch, Fahrzeugpapiere. Mein Papa hat mir einmal erklärt, dass ganz viele Wörter aus anderen zwei Wörtern zusammengepappt werden. Das Zeug mit dem ich spiele ist das Spielzeug und die Farbe an der Wand ist die Wandfarbe. Aber ein Fahrzeug aus Papier? Das wird ja dann ganz nass und matschig, wenn es regnet.
»Was sind Fahrzeugpapiere?«, fragt mein Mund von alleine, und der Polizist lacht so, als hätte ich einen Witz gemacht, aber das habe ich gar nicht.
»In den Fahrzeugpapieren steht, dass euer Auto deiner Mama gehört, du neugieriges Zuckermäuschen.«
Zuckermäuschen? Ich bin kein Zuckermäuschen! Und wieso sagt er das so lustig? Er sagt das so, wie wenn er es gar nicht meint. Wie wenn die Erwachsenenpersonen sagen, dass etwas gar nicht wehtut, aber es tut doch weh. Das find ich gemein. Selber Zuckermäuschen.
»Das stimmt nicht«, sage ich murrig, trete mit den Füßen gegen den Vordersitz, aber der Polizist lacht immer noch.
»Gehört das Auto nicht deiner Mama? Oder bist du kein Zuckermäuschen?«, will er wissen und zwinkert mir zu.
»Ich bin kein Zuckermäuschen. Und das Auto gehört nicht der Mama!«
Die Augenbrauen von dem Polizisten hüpfen fast bis zu seiner Mütze. »Nein?«, fragt er ganz überrascht und zeigt auf die Fahrzeugpapiere. »Hier steht aber, dass das Auto deiner Mama gehört. Was sagst du jetzt?«
Wieso redet er so? Er soll das nicht! Er soll so reden, dass er es meint! Ich bin kein Zuckermäuschen, ich bin kein kleines Baby, und ich will, dass er nicht so komisch spricht und nicht zwinkert und nicht lacht und mir zuhört.
Also schreie ich.
Und ich weiß nicht, warum, aber das macht alles anders. Jetzt ist der Polizist gar nicht mehr lustig. Sein Kopf kommt tiefer ins Fenster. Er guckt mich an, als wäre ich ganz plötzlich aufgetaucht und vorher gar nicht da gewesen.
»Was hast du gesagt?«, fragt er mit ernster Stimme.
Und ich sage es noch einmal, laut und deutlich, damit er es auch hören kann: »Das ist nicht meine Mama.«
Lansky
Mittwoch, 16. Oktober, 19:35 Uhr
»Und, wie war es heute in der Schule?«
»Ätzend«, fauche ich, schürze die Lippen zu einem perfekt geformten Schmollmund und gebe dem Wort zwei Sekunden, sich zu entfalten. Dann: »Tine hat voll die Bitch-Aktion gebracht.«
»Was hat sie denn getan?«, fragt er, mäßig interessiert.
»Meine Sachen versteckt.«
Sein Blick wird wacher. »Ja? Welche Sachen?«
»Meine Anziehsachen.«
Sehr viel wacher. »Wie ist das denn passiert?«
»Nach dem Turnunterricht. Frau Buschmann sagt immer, wir müssen duschen, diese Pädo-Tante. Ich hass das.« Wieder setze ich meine Lippen ein, ziehe eine Schnute. Er mag es auch, wenn ich mir eine Strähne aus dem Gesicht streiche oder mit den Augen rolle, aber die Lippen sind am effektivsten. Sie rauben ihm den Verstand. »Als ich rauskam, waren meine Klamotten nicht da, und Tine hat gelacht wie die größte Bitch.« Das letzte Wort klingt seltsam verzerrt. Erschrocken blicke ich zum oberen Bildschirmrand, prüfe das Internetsignal. Stabile vier Striche LTE, keine Selbstverständlichkeit, nicht mal hier, mitten in München. Ich checke das Video-Chatfenster – mein Gesicht ist perfekt. Dann fällt mein Blick auf sein Fenster. Es gefällt ihm nicht, dass ich »Bitch« sage. Am liebsten wäre es ihm, wenn ich solche Wörter gar nicht in den Mund nehme. Aber so sind wir elfjährigen Großstadtgören nun mal: bitchy as hell.
»Also wirklich«, sagt er, schüttelt den Kopf, zögert.
Komm schon, beiß an.
»Ihr macht Sachen …«
Friss den Köder, Junge! Schnapp ihn dir.
»Gehst … du nicht gerne duschen mit den anderen Mädchen?«
Jackpot! »Nee, ich mag das nicht. Die gucken so.«
»Das sind doch alles Mädchen aus deiner Klasse«, protestiert er unerwartet forsch. »Ihr seid doch alle gleich.«
»Ja, aber die anderen sind voll schön und so. Merle ist schon zwölf und hat echt einen Busen. Und Tine, die Bitch, sieht sowieso aus wie von Insta. Die hat sogar einen Freund.«
Stille. Sein Blick irrlichtert, das tut er immer, wenn er mit sich ringt. Manchmal lässt er das Gesprächsthema abtropfen. Diesmal nicht.
»Willst du auch einen Freund haben?«, fragt er distanziert, sieht mich nicht an.
»Ja, schon«, seufze ich, rolle mit den Augen, streiche mir eine Strähne aus dem Gesicht, schürze die Lippen. »Aber die Jungs in meinem Alter sind voll die Spacken. Voll kindisch und so. Ich will eher einen … erwachseneren Freund.«
Er richtet sich auf, presst den Oberkörper gegen die Rückenlehne seines Stuhls, als säße er in einem Porsche, der mit 280 Sachen über die Autobahn jagt. Dabei sitzt er nur zu Hause in seiner Wohnung. Das Licht dämmrig wie immer, hinter ihm seine »Heldenwand«, wie er sie nennt. Die Lieblinge seiner Serien – Star Wars, Game of Thrones, Herr der Ringe – in Plastik gegossen, zu Figuren gepresst und säuberlich aufgereiht auf einem Bücherregal, in dem kein einziges Buch steht. Man könnte meinen, es wäre das Regal eines Teenagers. Doch User voodoo_wulf ist kein Teenager. Sein Profil sagt, er ist achtundzwanzig. Das übertrieben jugendliche Käppi, mit dem er sein schütteres Haar versteckt, erzählt eine andere Geschichte.
»Oliver aus meiner Klasse hat letztens …«, setze ich an, als es plötzlich piept. Der Bildschirm dunkelt sich ab, eine Fehlermeldung ploppt am oberen Bildschirmrand auf. Warnung, sehr geringer Akkustand.Verdammt!
»Warte, meine Mum kommt, bin gleich wieder da«, sage ich hektisch, schalte die Webcam ab und verändere meinen Online-Status auf »Unsichtbar«, damit er mich nicht mehr sieht.
Drei Prozent Akku.
Verdammt, verdammt, verdammt. Dieser Drecks-Laptop hält nicht mal mehr drei Stunden durch! Warum ausgerechnet jetzt? Ich hatte ihn schon so weit. Wenn ich die Kiste zuklappe, muss ich dieses dämliche Programm wieder neu einrichten.
Ungelenk bugsiere ich den Laptop auf den Beifahrersitz, springe aus dem Wagen, bin mit einem Satz beim Kofferraum. Schnell, schnell – Tasche auf, vier Fächer, unendlich viel Zeug. Kabelbinder, Ersatzhandy, Zange, Verteilerstecker, Verlängerungskabel, AUX-Kabel, zu dickes Kabel, zu dünn, zu USB … Da ist es! Ich ziehe es aus der Tasche, reiße ein ganzes Knäuel weiterer Kabel mit, stürze zurück auf den Fahrersitz.
Zwei Prozent Akku.
Zigarettenanzünder raus, Adapter rein, Stecker rein, anderes Ende in den Laptop und … nichts. Es tut sich nichts. Immer noch zwei Prozent. Das Batteriezeichen blinkt knallrot. Gleich verabschiedet sich die Kiste. »Warum lädst du nicht, du Drecksteil?«, fluche ich. Als Antwort sinkt der Akku auf ein Prozent. »Du hast doch deinen Strom! Friss!« Bitte, bitte, lade! Die Karre hat genug Saft in der Batterie, warum … Geistesblitz! Meine Hand schnellt zum Zündschlüssel, reißt ihn herum. Der Motor startet, der Laptop lädt, und ich atme auf. Wenigstens hatte ich keinen Gang drinnen.
Ich schließe die Fahrertür, lasse meinen Blick durch die Gegend streifen, ob jemand die Aktion bemerkt hat. Das hier ist nicht das schlechteste Viertel. Schwabing West, Alte Heide, da drüben gleich der Park und der Spielplatz. Hier wird schnell einmal die Polizei gerufen, wenn eine Verrückte lautstark schimpfend aus dem Auto springt. Da, wo ich aufgewachsen bin, hätte das niemanden interessiert.
Ich platziere den Laptop wieder auf dem Armaturenbrett, präsentiere der Kamera mein Gesicht. Das Programm beginnt sofort, es abzutasten. Dutzende bunte Rechtecke tanzen über den Bildschirm, versuchen, aus meiner Physiognomie schlau zu werden, scheitern kläglich. Draußen ist es dunkel geworden, das Licht reicht nicht mehr. Ich schalte die Innenraumleuchte ein, verändere meine Position so lange, bis die Rechtecke finden, wonach sie suchen. Mach schon, mach hin!
Nach und nach rechnet der Algorithmus mein Gesicht um, ebnet den kleinen Höcker auf meiner Nase, macht aus dem verwaschenen Graugrün meiner Augen ein strahlendes Lapislazuliblau. Meine Brauen bekommen den richtigen Schwung, meine Wimpern Volumen, meine Haut wird straff. Das Programm bügelt jedes Fältchen aus, jede Unebenheit, schließt jede meiner großen, groben, talgigen Poren. Die Auswirkungen von vierunddreißig Jahren Sonneneinstrahlung, Stress, Schmutz, zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Schlaf und zu wenig Interesse an Pflegeprodukten werden einfach überschrieben von dem Gesicht einer elfjährigen Lolita mit perfekt ebenmäßigem Teint. Die Lippen hätte Da Vinci auch nicht besser hinbekommen. Vom Bildschirm strahlt mir eine zarte Schönheit entgegen, deren beneidenswerte Eltern bei sonntäglichen Spaziergängen sicher oft zu hören bekämen, dass ihre Tochter mit absoluter Sicherheit einmal Model oder Schauspielerin wird. Meiner Mutter hat man so etwas nie gesagt. Aber wir waren auch nie spazieren.
Ich bewege meine Lippen, Lolita tut es mir gleich. Sie wippt mit dem Kopf, hebt und senkt die Augenbrauen, rümpft ihre süße Stupsnase, folgt gehorsam. Das Programm arbeitet, die Echtzeitberechnung funktioniert. Die EDV-Heinis der Cybercrime-Abteilung wären verzückt, wenn sie wüssten, dass ihr kleines Wunderprogramm auch unter diesen Bedingungen seine Arbeit tut. Dass ich es nach meinem Rausschmiss für private Zwecke missbrauche, würde ihnen weniger gefallen.
Das Vocoder-Plugin lädt. Ich sage: »Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.« Dreimal, laut und deutlich, damit sich das Programm auf meine Stimme kalibrieren kann. Fertig. Ich ändere im Chatprogramm meinen Status, zähle. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig … Es klingelt. Voodoo_wulf kann es wohl kaum abwarten.
»Na, wieder da?«
»Mum nervt«, seufze ich, checke Bild und Ton – alles normal. »Wo waren wir?«
»Du hast gesagt, dass die Jungs in deiner Klasse so kindisch sind, und irgendwas von einem Oliver.«
»Ach so, ja. Oliver hat letzte Woche so Nacktfotos von Merle in der WhatsApp-Klassengruppe geteilt, aus Rache, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat und so. Seitdem sagen die Jungs nur noch Möpse-Merle zu ihr. Die sind so kindisch und gemein, das ist echt ein riesen Abfuck!«
Als Antwort brummt voodoo_wulf bloß gedankenverloren, leckt sich über die Lippen. Dann: »Hast du auch schon mal solche Fotos von dir gemacht und jemandem geschickt?«
Das wüsstest du wohl gerne, Freundchen, was? »Nee, die will sowieso keiner haben«, gebe ich trotzig zurück, spiele ihm in die Karten.
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist doch so schön.«
»Danke«, hauche ich, blicke verlegen zu Boden. »Das sagst du doch nur so. Die anderen in meiner Klasse sind viel schöner als ich.«
»Das glaub ich nicht. Aber … wenn du willst, könnten wir gemeinsam Fotos von dir machen. Du posierst, und ich mache Screenshots, das wird richtig gut. Ich sage dir, wie du schauen sollst, ich weiß, was Männer schön finden. Dann hast du super Aufnahmen von dir und siehst, wie schön du wirklich bist.«
»Ich weiß nicht«, murmle ich leise.
»Ein privates Fotoshooting, nur wir zwei!«
»Ich kenn ja noch nicht mal deinen Namen.«
Er kräuselt die Lippen. Enttäuschung macht sich in seiner Mimik breit. »Für was brauchst du den? Wir kennen uns doch! Vertraust du mir nicht?«
»Doch, schon …«, stottere ich, überlege. Ich brauche seinen Namen – unbedingt! Alles, was ich bisher habe, sind bloß Hinweise. Kleine Details aus unseren Gesprächen, die er hier und da hat fallen lassen. Dass letztens seine U-Bahn-Station gesperrt war. Dass er aus seinem Schlafzimmer auf einen Park mit Spielplatz blickt, dass Aldi gleich die Straße runter ist – lauter winzige Brotkrumen, die mich genau an diesen Ort geführt haben. Dietersheimer Straße, die Lage passt, irgendwo hier könnte er wohnen. Aber das alles nützt nichts, ich brauche seinen Namen.
»Ich vertrau dir ja«, nöle ich. »Aber ich erkenne dich nicht einmal richtig. Bei dir ist es voll dunkel, mach doch mal dein Licht an.« Ich luge über den Bildschirmrand, fixiere die offene Phalanx der Gebäude. Drei Häuser, drei Stockwerke plus Dachausbau, macht vierundzwanzig Wohnparteien. Nicht so viele wie in den monströsen Betonsilos, wo ich aufgewachsen bin, aber immer noch dreiundzwanzig zu viel.
»Ach nee, ich mag es nicht so hell«, mosert er, nestelt nervös an seinem Käppi.
»Komm schon. Du bist auf meinem Bildschirm bloß ein dunkler Fleck.«
Keine Reaktion. Ich spüre, wie er überlegt. Wie er in Gedanken durchspielt, was ihn verraten könnte. Doch sein Drang schlägt die Vernunft. »Na gut«, schnaubt er, reckt den Kopf in die Höhe. »Alexa, stelle Lampe Wohnzimmer auf achtzig Prozent.«
Im nächsten Moment wird es heller. Mein Blick schnellt hoch, fliegt über die Fassaden. War das Fenster oben links gerade eben auch schon beleuchtet? Und das darüber? Verdammt, ich kann keine sechzig Fenster von drei verschiedenen Gebäuden gleichzeitig im Auge behalten, dazu bräuchte ich ein komplettes Überwachungsteam.
»So besser?«, ertönt seine Stimme.
»Viel besser. Cooles Teil, dieses automatische Lichtdings. Was kann das denn noch alles?«, frage ich, um Zeit zu gewinnen. Über seinen Technikfirlefanz kann er stundenlang schwadronieren, das verschafft mir Luft. Hinter welchem Fenster versteckst du dich, mein perverser Freund? Wo bist du? Er faselt etwas von »stufenlos dimmbar« und Google oder Alexa – ich beachte ihn gar nicht. Bist du eher ein Erdgeschosstyp oder ein Dachbodentyp oder ein …
»Sechzehn Millionen.«
Ein Impuls durchzuckt mich. »Was hast du gesagt?«, falle ich ihm ins Wort, starre auf den Bildschirm.
»Dass die Lampe sechzehn Millionen Farben erzeugen kann.«
»Cool!«, antworte ich mit linkischer Freude. »Weißt du noch, was meine Lieblingsfarbe ist?«
Er grinst. »Alexa, stelle Lampe Wohnzimmer auf Pink.«
Mein Blick wandert über die Fassaden, bleibt beim mittleren Gebäude hängen. Ein Lächeln umspielt meine Lippen. Eigentlich hatte ich nie eine Lieblingsfarbe.
Jetzt schon.
Clara
Mittwoch, 16. Oktober, 19:40 Uhr
Ich möchte es schön haben.
Ein paar Kerzen, ein guter Wein, vielleicht ein Bad? Das ist es, ich lasse mir die Wanne ein. Ein heißes Bad lässt einen die Welt um sich herum vergessen.
Ich schlüpfe in meinen Frotteebademantel, tapse hinüber ins Badezimmer, drehe an der Armatur, und das Wasser plätschert angenehm temperiert auf die schneeweiße Keramik. Die Vorteile von solchen Luxuswannen sind die geräumigen Dimensionen und die einstellbaren Luftsprudler. Der Nachteil ist: Es dauert ewig, bis sie vollgelaufen sind.
Ein Schmunzeln huscht über meine Lippen. In meiner alten WG hat es im Bad auch ewig gedauert, aber aus anderen Gründen. Der Wasserhahn kannte nur zwei Temperaturen: Lava oder Flüssigstickstoff, alles dazwischen war kaum einzustellen. Jeden Morgen kauerte ich fröstelnd in der Wanne und pfriemelte an den Drehreglern herum, bis ich endlich einen einigermaßen erträglichen Wärmegrad gefunden hatte. Was für ein Theater …
Ich blicke hinab zu meinen nackten Füßen. Die Fliesen sind warm, fühlen sich angenehm glatt unter den Sohlen an. Eigentlich seltsam: Unsere Villa hat allen Komfort, den man sich nur wünschen kann, und dennoch habe ich mich nie so zu Hause gefühlt wie in meiner alten WG mit dem kaputten Boiler, dem bröckelnden Putz und dem ewig währenden Wasserschaden. Wir hatten nicht einmal ein Schloss am WC, bloß einen Haken zum Einhängen, den wir aber so ungeschickt angebracht hatten, dass sich die Tür trotzdem acht oder neun Zentimeter öffnen ließ. Es war wirklich eine Bruchbude. Aber es war unsere Bruchbude. Meine.
Ich lasse das Wasser laufen, hole Handtücher und Kerzen aus den Schubladen, bleibe mit dem Ring an der Kante hängen. Das passiert mir ständig. An meinem Ringfinger protzt ein goldener Solitärring mit diamantbesetzter Pavéfassung und vier Krappen – so hat es mir der Juwelier bei Cartier damals beschrieben, und so wiederhole ich es für jeden, der fragt. Ich weiß weder, was »Pavéfassung« bedeutet noch »Solitärring«, die Karat kann ich mir auch nicht merken, aber für die meisten ist das ohnehin nebensächlich, zumindest für meine früheren Kommilitoninnen. Alle nickten bloß anerkennend, sagten Dinge wie »zu schön, um wahr zu sein«, »das ganz große Los gezogen« oder »das kennt man sonst nur aus Filmen« und starrten fasziniert auf meine Hand. Aber eigentlich meinten sie nicht den Klunker, sondern den, der ihn mir angesteckt hat.
Ruppig ziehe ich den Ring vom Finger, lege ihn neben das Waschbecken, versinke immer mehr in meinen Erinnerungen.
Damals. Vor der neuen Wanne, dem neuen Haus, dem Ring, der Ehe, als Jakob und ich uns kennengelernt haben, da kam er manchmal in der WG vorbei. Diesen einen Abend werde ich nie vergessen. Wir lagen in der schäbigen kleinen Wanne in dem schäbigen kleinen Bad mit dem Wasserfleck an der Decke, mussten uns verrenken wie Schlangenmenschen, um zu zweit hineinzupassen, und tranken billigen Wein vom Supermarkt. Das Fenster stand offen, draußen ließ die drückende Sommerhitze langsam nach, und wir lagen einfach nur da, ineinander verschlungen, lauschten dem Zirpen der Grillen. Mehr ist nicht passiert. Dennoch ist es ein Moment, der mich bis zum Rand mit Glück vollpumpt, immer wenn ich daran denke. Alles war perfekt, aber jetzt, nach all dem, was geschehen ist … habe ich seine Liebe nicht mehr verdient. Niemandes Liebe.
Eine Träne läuft mir die Wange hinunter, ich wische sie weg, gehe nach unten in die Küche, hole mir ein Glas aus der Vitrine. Ein ordentlicher Schluck wird helfen, um die Beklemmung in meiner Brust wegzuspülen.
Mit der Weinflasche unterm Arm und dem Glas in der Hand gehe ich wieder hoch ins Bad. Ich zünde die Kerzen an, träufle drei, vier Tropfen Lavendelessenz ins Wasser, streue ein paar Rosenblütenblätter darüber. Dann sitze ich einfach nur da, nippe am Wein, beobachte, wie die Blüten ziellos über die Oberfläche treiben. Ich bin wie sie. Treibgut im Sog einer Strömung, die mich davonträgt – immer weiter, weg von Jakob, weg von mir selbst, weg von allem.
Behutsam stelle ich das Weinglas auf den Rand der Wanne, lasse mich auf den Boden sinken. Vor mir auf den Fliesen liegt Jakobs lederne Dokumentenmappe, aufgeschlagen. Die gähnende Leere eines weißen Blattes glotzt mich an. Wie schreibt man einen Abschiedsbrief? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir wenig Zeit bleibt.
Sehr wenig Zeit.
Lansky
Mittwoch, 16. Oktober, 19:55 Uhr
Dem Klingelbrett nach heißt voodoo_wulf mit Nachnamen Wülfing, und wäre das hier ein normaler Polizeieinsatz, würde ich bereits Wetten auf seinen Vornamen annehmen. Udo hätte die miserabelste Quote.
Ein böser Blick genügt, und die Haustür ist offen. Seine Wohnung ist auch schnell gefunden: zweiter Stock, links, eine schmucklose Tür und eine Star-Wars-Fußmatte mit der Aufschrift „Willkommen du bist“ nebst dreckverschmiertem Yoda-Aufdruck. Putzig.
Ich will klopfen, zögere. Was soll ich sagen? Polizei, aufmachen? Wenn es doch nur so einfach wäre … Instinktiv geht meine Hand zum Holster, greift ins Leere. Ich habe nicht einmal mehr einen Ausweis, den ich ihm vor die Nase halten könnte. Andererseits bin ich auch nicht hier, um ihn festzunehmen.
Ich entschließe mich für die Paketboten-Variante, klopfe, trete einen Schritt zurück und blicke zu Boden. Ein schmaler Lichtstreif dringt durch den Türspalt, wird kurz darauf von einem Schatten unterbrochen.
»Ja?«
»Paket für Sie«, knatsche ich, fische den Kaugummi aus dem Mund.
Metall kratzt auf Metall. Ein Schlüssel wird im Schloss gedreht, einmal, zweimal. Stille. Die Tür bleibt geschlossen.
»Ich kann Sie gar nicht sehen«, dringt seine Stimme dumpf hervor.
Es klebt ja auch ein Kaugummi auf deinem Türspion. »Zappenduster hier draußen«, antworte ich. »Machen Sie auf, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.«
»Legen Sie das Paket einfach auf den Fußabtreter.«
»Ich brauch ’ne Unterschrift, Meister. Sonst geht das Paket wieder retour.« Komm schon, zier dich nicht so!
»Machen Sie doch mal Licht an, ich erkenne absolut nichts.«
»Wo ist denn der Schalter?«, frage ich genervt, beobachte im Türspalt den Schatten, wie er schwächer wird, breiter, seine Kontur verliert.
»Den Flur runter, beim Treppenabgang.«
Ich trete lautstark auf der Stelle, überlege. Links oder rechts? Instinktiv würde ich ja sagen, links, weil weniger wichtig. Andererseits: zweimal angeknackst, dann diese böse Quetschung, das hinterlässt natürlich Spuren. »So besser, Meister?«, rufe ich, ziehe den Kaugummi ab, allerdings nicht ganz, nur ein bisschen. Der Schatten unter der Tür wird wieder dunkler. »Sehen Sie mich jetzt?« Ich sollte rechts nehmen, aber seit dem Armdrücken neulich im Pub ist rechts auch nicht besser. An schlechten Tagen zittere ich so stark, dass mir kaum Suppe auf dem Löffel bleibt. Links oder rechts, links oder rechts?
»Nee. Ich seh nix!«
Ich blicke zu Boden. Der Schatten seiner Beine zeichnet zwei dunkle Schneisen in den Lichtstreif. Er steht direkt vor der Tür, und ich entscheide mich für links, stoße mich mit aller Kraft von der Wand ab.
Eine Sekunde später bereue ich es.
Schmerz flammt auf, explodiert in meinem Arm, raubt mir den Atem. Ich hätte doch die rechte Schulter nehmen sollen.
Die Tür bricht auf. Sein Nasenbein erleidet ein ähnliches Schicksal. Wir gehen beide zu Boden, aber er bekommt davon nichts mehr mit, die Ohnmacht erlöst ihn. Mir bleiben die Schmerzen nicht erspart. Zusammengekauert lehne ich am Türstock, ringe nach Luft. Das Pfeifen in meiner Lunge erinnert mich an Walgesänge. Sie spielen unser Lied, Free Willy, das Lied vom Tod – haha. Reiß dich zusammen, Madame. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.
Ich rapple mich hoch, blicke den Flur hinunter, warte einige Sekunden. Niemand zeigt sich, keine neugierige Hausfrau, kein selbst ernannter Sheriff. In Großstädten wie München ist einem nichts fremder als der eigene Nachbar. Gut für mich. Schlecht für voodoo_wulf. Er liegt immer noch regungslos am Boden, verpasst dem Teppichläufer ein unschön blutiges Batikmuster.
Schnaufend packe ich ihn unter den Achseln, schleife ihn ins Wohnzimmer, sehe mich in der Wohnung um. In der Gefriertruhe gibt es kein Eis, nur Tiefkühlerbsen – besser als nichts. Ich presse sie gegen die Schulter, ziehe Luft zwischen die Zähne, spüre das Pulsieren in meinem halb tauben Arm. Diese Geschichte wird mir meine Schulter noch Monate vorhalten.
Aus dem Wohnzimmer dringt ein feuchtes Röcheln. Ich gehe rüber, fixiere seine Arme und Beine mit Kabelbinder, richte ihn auf. Das Blut läuft in Strömen aus seiner Nase. Vorsichtshalber neige ich seinen Kopf etwas und spendiere ihm die zweite Packung Tiefkühlerbsen für seinen Nacken. Bluten ist okay, ersticken weniger.
Jetzt zum wichtigsten Part: Beweise sichern.
Ein Wisch über das Touchpad seines Laptops, und sofort verschwindet der Bildschirmschoner. Kein Passwortschutz, sehr gut. »Wer sind Sie, Herr …« Ich öffne das Mail-Programm, checke seinen Namen. Wusste ich es doch. Udo! Dann wollen wir mal sehen, wie vielen kleinen Mädchen mein lieber Freund Udo Wülfing noch seine Dienste als Privatfotograf angeboten hat.
Fünfzehn Minuten später wird sein Röcheln lauter, und ich habe immer noch nichts. Keine Bilder, keine Videos, keine Chatprotokolle, keine versteckten oder geschützten Ordner. Selbst sein Browserverlauf ist vergleichsweise harmlos.
Aber das heißt nichts.
Er hebt den Kopf, würgt, gibt schmerzverzerrte Laute von sich.
Ich suche weiter, beobachte aus den Augenwinkeln, wie er langsam zu sich kommt.
»Was … was ist passiert?«, krächzt er, streckt seine gefesselten Arme von sich, als wären sie Fremdkörper. »Fuck, tut das weh! Was ist … Hey, wer sind Sie?«
Ich reagiere nicht, reiße eine Schublade nach der anderen aus dem Schreibtisch, kippe den Inhalt auf den Boden.
»Was machen Sie da? Was soll das, binden Sie mich los!«
Kein besonders helles Kerlchen, dieser Udo. In einem Moment flirtet er online mit einem elfjährigen Kind, im nächsten würgt er an den Trümmern seines eigenen Nasenbeins, und jemand durchsucht seinen Schreibtisch. Es erfordert keine große gedankliche Transferleistung, um zwischen diesen beiden Ereignissen einen Zusammenhang zu erkennen.
»Hallo? Wer zum Teufel sind Sie?« Seine Stimme wird rauer, bekommt das klassische Timbre eines verletzten Männchens im Rückzugsgefecht. »Hören Sie auf damit. Was soll das, machen Sie mich los. Hilfe. Hilfe!«
»Schnauze«, knurre ich ihn an, gehe auf ihn zu.
Die Wut in seiner Stimme erlischt, wechselt ins Devote. »Hören Sie, ich … ich … Wenn Sie Geld wollen, ich habe nicht viel. Aber mein Portemonnaie muss in der Jacke sein, dort drüben, nehmen Sie was …«
»Ich will kein Geld.«
Seine Pupillen springen hin und her, suchen nach Hinweisen, Antworten, Sinn. Es amüsiert mich, wie verzweifelt er versucht, in meinem Gesicht zu lesen.
»Was … was wollen Sie?«
»Was will ich denn, was will ich denn, was will ich denn?«, flöte ich übertrieben amourös, beuge mich weit zu ihm hinunter, ziehe wieder meine Lolita-Schnute. »Wir können ja gemeinsam Fotos von dir machen. Du posierst, ich mache Screenshots, das wird lustig!«
Das Spiel seiner Mimik gefriert augenblicklich. Nichts regt sich, kein Atemzug entweicht seiner Lunge. Dann schleicht sich ein Anflug von Scham in seine Züge. Und der Rest kommt schwallweise hinterher: Die Schuld, die Last, die Reue – alles schießt in Rotz und Tränen und Wortbrocken aus ihm heraus. »Bitte, nein … Es tut mir leid, so unendlich leid, ich wollte das nicht, ich … ich …«
Ich hasse es, wenn sie das tun. Angewidert wende ich mich ab, durchsuche weiter den Schreibtisch, während er die alte Büßerleier herunterspult. Irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. »Wo sind die Festplatten?«, fahre ich ihn an, stemme mein Bein gegen seine Brust.
Er verstummt. Sein Blick weicht aus, sucht auf dem Parkett nach Antworten. Der gesunde Menschenverstand muss ihm sagen, dass Leugnen keinen Zweck hat. Aber wer benutzt heutzutage schon seinen Verstand? »Welche Festplatten?«, röchelt er tonlos.
»Es gibt immer Festplatten. Irgendwo müsst ihr ja den ganzen kranken Scheiß speichern. Also: Wo sind sie?«
»Ich … ich … ich schwöre, ich … ich will das gar nicht, aber es ist wie eine Sucht, eine Krankheit, ich versuch es ja, aber …«
»Schnauze!« Ich habe diese Ausreden so satt. Ich wollte es nicht, ich habe doch nur, ich bin so krank, so schrecklich krank – bla, bla. Erzähl’s deinem Seelsorger. »Wo sind die Festplatten!«
»Ich habe mir Hilfe geholt, wirklich! Ich schwör’s, ich schaffe das, ich will das alles nicht mehr, glauben Sie mir!«
Er kapiert es einfach nicht. Es reicht. Meine Antwort kommt auf Knopfdruck, ist zehn Zentimeter lang, rostfrei und verschlägt ihm die Sprache. »Wo. Sind. Die Festplatten.«
Der Anblick der Klinge gibt ihm den Rest. Kraftlos sinkt er in sich zusammen, atmet lange und schwer aus. Dann, beinahe unhörbar: »Dritte Schublade rechts. Doppelter Boden.«
Na also, geht doch. Der Einsatz von Springermessern gehört nicht unbedingt zu den Verhörmethoden, die sie uns auf der Polizeiakademie beigebracht haben. Sollten sie aber. Ich klappe das Messer wieder ein, gehe rüber zum Schreibtisch und mache mich an der Schublade zu schaffen.
Wenn man es weiß, ist das Geheimfach leicht entdeckt, bloß eine billige Sperrholzplatte, im gleichen Farbton gestrichen. Ich reiße sie heraus, kippe den Inhalt auf den Boden, verziehe das Gesicht. Keine Festplatten. Nur ein einziger kleiner USB-Stick und vier oder fünf Zettel. »Klare Grenzen e. V.« lese ich, »Hilfetelefon« und »Organisation Opferschutz«. »Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist? Melden Sie sich noch heute bei unserem Präventionsnetzwerk.« Ungläubig starre ich auf die Flyer, dann zu ihm.
Tränen strömen ihm über die Wangen, er zittert am ganzen Leib, und ich spüre, wie sich Zweifel in mein Hirn schleichen. Eine Sekunde später verbanne ich sie aus meinem Kopf. Na und? Vielleicht wollte er sich helfen lassen. Dann ist er halt kein verlogener Pädophiler, sondern ein ehrlicher Pädophiler, Gratulation, verleiht ihm einen Orden.
Wütend raffe ich alles zusammen, stopfe seinen Laptop, den USB-Stick und ein paar seiner Dokumente in meinen Rucksack. Dann bin ich wieder bei ihm. Knie nieder, nehme seinen Kopf in beide Hände, zwinge ihn, mich anzusehen. Zeit für den Abschiedsgruß.
»Ich bin da draußen«, zische ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Und ich bin jedes Mal eine andere. Wenn deine Visage noch einmal auf meinem Bildschirm erscheint, dann komm ich wieder vorbei und schneide dir die Eier ab. Ich schneide sie dir ab, und dann geh ich zu deinem Chef und erzähle ihm alles. Ich gehe zu deinen Eltern, deinen Verwandten, deinen Freunden – einfach jeder wird wissen, was du online so treibst. Hast du das verstanden? Dein Leben wird vorbei sein.«
Sein Blick flirrt, er nagt an seiner Unterlippe, will etwas sagen, bringt es nicht heraus.
»Ich weiß, wer du bist, wo du wohnst, wie du tickst, ich hab dich in der Hand!«
Seine Lider sind so weit aufgerissen, dass mich das Weiß seiner Augen beinahe blendet. Irgendwann taumeln dann doch Worte über seine Lippen. »Ssss … Sie sind nicht von der Polizei? Ich bin ich nicht verhaftet?«
Falsche Antwort, will ich sagen, werde aber abgelenkt. Meine Jackentasche vibriert, die linke. Sie hat schon seit Wochen kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Irritiert fische ich das Telefon heraus, mustere das Display. Ich erkenne die Nummer sofort. Meine Kehle wird trocken.
»Kein verficktes Wort!«, knurre ich Udo halblaut zu, räuspere mich, hebe ab. »Ja? … Ja, die bin ich … Mhm … Mhm … Morgen neun Uhr, kein Problem … Gut … Danke. Wiederhören.«
Die Verbindung wird getrennt. Geistesabwesend starre ich einfach nur geradeaus, sekundenlang, das Diensttelefon die ganze Zeit über ans Ohr gepresst, als mich Udos Stimme aus den Gedanken reißt.
»Ich bin wirklich nicht verhaftet?«, fragt er noch einmal, glotzt mich ungläubig an.
Ich senke den Kopf, mustere ihn, überlege. Bis gerade eben hätte ich ihn nicht verhaften können, denn bis gerade eben war ich keine Polizistin mehr. Doch es sieht ganz danach aus, als wäre ich wieder im Dienst.
Clara
Mittwoch, 16. Oktober, 20:26 Uhr
Dunkelheit umgibt mich, drückt mich nieder. Sie liegt auf meinen Schultern, meinen Lidern, meinem Geist. Ich schlucke. Wo bin ich? Alles so finster, kein Halt, keine Orientierung … Wie ferngesteuert klappen meine Augen auf, erfassen zunächst bloß Schlieren, stellen langsam scharf. Die Mappe, der Zettel. »Du wirst mir nie verzeihen können …«, lese ich und: »Es ist besser so.« Das ist meine Handschrift, mein Brief. Ich bin im Badezimmer, kauere am Boden, finde mich wieder zurecht. Aber es ist nicht so, wie es sein sollte.
Benommen kämpfe ich gegen die bleierne Schwere, richte mich auf, sehe mich um. Dampf füllt den Raum, ein dichter, zäher Vorhang aus Grau. Er verschmilzt mit dem Waschtisch, nimmt dem Marmor die Maserung, den Granitfliesen die Schraffur, frisst jedes Detail. Alles scheint stillzustehen, als wäre ich gefangen in einer Wolke aus Dunst. Nur in mir regt sich etwas: ein Brennen. Mein Herz pumpt wie verrückt Blut in den Kopf, lässt Wellen aus Schmerz hinter meiner Stirn branden, es pocht und hämmert und tost, aber ich nehme es hin. Kämpfen wäre sinnlos. Es ist längst zu spät.
Ein Schluck Wein wird helfen.
Ich strecke den Arm aus, stöhne auf. Wieso ist es so nass? Die Kerzen brennen nicht, ich liege nicht in der Badewanne – ich wollte es doch schön haben. Wieder strecke ich meinen Arm aus, bekomme den Rand der Wanne zu fassen, ziehe, hieve mich hoch. Wasser schwappt mir entgegen. Der Hahn – ich muss ihn zudrehen, muss verhindern … Ach, ich muss gar nichts. Einen Schluck trinken, das muss ich. Wo ist das Glas? Es ist weg. Es liegt auf dem Boden, zersplittert in tausend Teile. Es war ein teurer Wein, so ein edler Tropfen, und jetzt ist er Badewasser. Überall Wasser.
Ich schrecke hoch, reiße die Augen auf.
Der Brief!
Panisch suche ich den Boden ab. Nein! Nein, nein, nein – die lederne Dokumentenmappe hat sich vollgesogen, das Papier auch, ich muss es retten, muss die letzten Kräfte mobilisieren. Meine Arme strecken sich durch, ich taumle nach vorne, finde keinen Halt, rutsche, sehe die Fliesen auf mich zuspringen …
Die Wucht des Aufpralls knipst der Welt kurzzeitig die Lichter aus.
Als sie wieder angehen, ist alles verdreht. Meine Augen klappen auf. Ungläubig gaffe ich auf die rote Pfütze unter mir. Blut. Warum liege ich in Blut? Es quillt unter meinem rechten Handballen hervor, läuft in die Fugen, färbt alles rot, rot, überall Blut.
Plötzlich peitscht Schmerz in meinen Kopf, lässt mich aufspringen, zurücktaumeln. Ich stoße gegen eine Kante, rudere mit den Armen, segle, fliege.
Bis ich nicht mehr fliege. Bis ich tauche, hinabsinke auf den Grund der Wanne.
Schwerelos treibe ich in der Schwere. Schwimme im Verschwommenen. Ich sehe kein Blut mehr, aber schmecke es; vergieße keine Tränen, sondern ertrinke darin. Das war es also. Nicht einmal meinen Abgang habe ich auf die Reihe bekommen. Eine Scherbe hat für mich entschieden.
Ich frage mich, ob ich je eine richtige Entscheidung getroffen habe, ob überhaupt irgendetwas richtig war in meinem Leben. Vielleicht dieser Moment in der Wanne, mit Jakob, in der alten WG. Vor der Ehe, dem Ring, dem Haus. Vor all dem Leid, das ich verursacht habe. Der Schuld, mit der ich nicht mehr leben kann. Vor Marie. Mein wunderschöner Engel, mein Augenstern, meine Seele. Nicht einmal im Himmel würden wir uns wiedersehen.
Menschen wie ich kommen nicht in den Himmel.
Sie schmoren in der Hölle.
Marie
Mittwoch, 16. Oktober, 23:06 Uhr
Ich sehe meine Mama, aber meine Mama sieht mich nicht.
Das Licht ist anders, nicht wie sonst, nicht wie Frühstückslicht oder Zubettgehlicht, aber schön hell und warm – warum sieht sie mich nicht? Sie kommt auf mich zu, geht an mir vorbei, als wäre ich gar nicht da. »Hier bin ich doch«, will ich sagen, aber meine Stimme bleibt in mir drinnen. Ich greife mir an den Hals … Da ist kein Hals. Da, wo immer mein Hals war, ist nur Luft, und da, wo meine Hand ist, ist auch nur Luft. Bin ich überhaupt da? Ich seh die Mama ja, aber die Mama sieht mich nicht und der Papa auch nicht. Das versteh ich nicht.
»Mama, ich will nicht Luft sein«, sage ich stampfig, aber sie reagiert nicht, redet mit ihrer traurigen Mamastimme zum Papa: »Wenn sie nicht kommt, dann gehen wir eben ohne sie in den Himmel.«
»Wieso?«, rufe ich ganz laut. »Nein!«
Mama und Papa sind auf einmal ganz weit weg, so weit, dass meine Füße viele Schritte machen müssen, aber ich komme nicht da hin. »Nicht gehen!«, schreie ich wieder. Aber sie hören mich immer noch nicht, und es ist, als ob Mama und Papa jetzt mit dem hellen Licht zusammenfließen wie die Farben in meinem Malkasten, wenn ich den Pinsel nicht richtig ausgewaschen habe.
»Nicht«, brülle ich und strample so fest ich kann. Ich muss Mama und Papa erwischen, bevor das Licht sie auffrisst, es hat schon so viel von ihnen. Das ist gar nicht mehr die Mama, sondern nur noch ein Gesicht mit Mund und Haaren, aber ohne Mama-Gesicht, gar kein Gesicht. Und ich bin auch nicht mehr da. Bis ich doch wieder da bin. Aber anders.
Ich bin wach. Es war nur ein Traum.
Mein Kopf liegt auf dem Kissen, und in mir drin macht es bu-bumm, bu-bumm – es hopst in meinem Hals, bu-bumm, bu-bumm – wie nach dem Fangenspielen mit Papa und …
Mama.
Ich muss zu meiner Mama.
Aber mein Kopf muss schlafbetrunken sein, weil ich bin im Bett, aber alles ist verkehrt: Mister Knuddels ist weg, und Schlummerkatze leuchtet nicht, und die Decke ist nass und klebrig. Ich rolle mich von der Matratze und will durch das Zimmer laufen, aber die Wand gehört andersrum, das Fenster ist gewandert, die Tür ist nicht da, und ich stolpere und bumse mit dem Knie gegen irgendwas, das wehtut, und Mama kommt nicht pusten.
»Mama?«, sage ich mit meiner Flüsterstimme, aber Mama kommt nicht. »Mama!«, rufe ich jetzt lauter, und dann schreie ich, bis zwei Hände mich hochheben und eine unter meinen Popo wandert und die andere sich auf mein Gesicht legt. Ihre Finger sind so fest auf meinem Mund, dass ich schlecht Luft bekomme.
»Ruhig, Mami ist ja da«, sagt die Stimme, aber die ist auch nicht richtig, und jetzt weiß ich wieder, warum alles anders ist. Das ist ja gar nicht anders, sondern nur neu. Das verkehrte Zimmer war doch ein Früher-Zimmer! Genau wie Mister Knuddels und Schlummerkatze früher waren – jetzt kommt mir das alles wieder in den Kopf. Mir fällt auch wieder ein, warum Mama nicht so spricht und riecht wie Mama … Ich habe ja gar keine Mama mehr.
Meine Mama ist ohne mich in den Himmel gefahren und Papa auch. Aber das macht nichts, denn ich hab ja jetzt eine Mami, die sich um mich kümmert. Ich wünsche mir nur, sie würde so riechen wie die alte Mama. So wie die Creme, die sie mir gegen die Sonne aufgetragen hat, oder die Seife aus der lila Flasche mit den hübschen Blumen – ja, so hat meine Mama gerochen, wie zu Hause.
Die neue Mami riecht anders. Sie riecht nicht nach zu Hause, sie riecht nach muffeliger Wäsche. So wie der Keller oder … Nein, jetzt hab ich’s. Die neue Mami riecht, als hätte sie Angst.
Ganz doll Angst.
Lansky
Donnerstag, 17. Oktober, 08:55 Uhr
Die Frau sieht aus, wie ihre Stimme am Telefon klang: auftoupiert. Über ihrer solariumgegerbten Stirn thront ein platinblonder Helm, unter dem sich eine komplette Spatzenfamilie unbemerkt ein Nest bauen könnte. Beim Anblick solcher Lebendkunstwerke frage ich mich immer, woher Frauen die Zeit nehmen, morgens eine halbe Ewigkeit vor dem Spiegel zu verbringen. Andererseits habe ich heute Morgen eine Stunde lang meine Schulter getapet. Vielleicht hätte ich mich stattdessen lieber frisieren sollen.
»Ja?«, flötet mir Miss Hairspray entgegen, mustert mich von oben bis unten. Ihr Gesicht ist ein einziges Naserümpfen. »Was kann ich für Sie tun?«
»Kim Lansky, wir haben gestern telefoniert, ich habe einen Termin bei Theo.«
Ihr falsches Lächeln wechselt ins Säuerliche. »Sie meinen, bei Kriminalhauptkommissar Rizzi?«
Ich nicke.
Sie tippt. »Momentchen.«
Wir spielen ein Spiel: Sie tut so, als würde sie Theos Terminkalender checken, und ich tue so, als würde ich es glauben. Kein besonders aufregender Zeitvertreib, aber das macht nichts, ich respektiere ihr Gehabe. Vorzimmerdamen ihres Kalibers bewachen den Eingang zum Chefbüro wie Zerberus das Tor zur Hölle. So jemand ist Gold wert, wenn man nicht alle naselang gestört werden will. Was wohl ein dreiköpfiger Hund mit platinblonder Mähne beim Friseur hinblättert? Ich muss schmunzeln. Miss Hairspray muss telefonieren. Anscheinend hängt Theo in irgendeinem Termin fest.
»Kriminalhauptkommissar Rizzi verspätet sich etwas«, offenbart sie das Offensichtliche. »Sie sollen in seinem Büro auf ihn warten.«
Als ich an ihr vorbeigehe, erhebt sie sich und begleitet mich hinein, lässt mich nicht aus den Augen. Mehrere Sekunden verharren wir schweigend in Theos Büro. Dann wird es selbst dem Höllenhund zu affig. »Ich lasse die Tür lieber offen«, verabschiedet sie sich. »Hier drinnen wird es so schnell stickig.«
Ich höre ihr nach, vernehme das Knarzen des Bürostuhls und ein larmoyantes Seufzen. Kein Tastaturtippen. Wahrscheinlich lauscht sie mit spitzen Ohren, ob ich die Unterlagen ihres Herrchens durchwühle oder mir den Rücken an seinen wertvollen Sachen schubbere. Lächerlich, aber verständlich. Ich würde mir auch keinen Zentimeter über den Weg trauen.
Der Raum gleicht jedem anderen Büro in Behörden. Aktenordner in formschönen Pressspanmöbeln nebst Technik von anno dazumal, serviert auf einem abgetretenen Teppichboden in gelbstichigem Grau. Die Pocco-Domäne-DIN-Norm kaputt gesparter Amtsstuben, jetzt auch im Chefbüro.
Ich mustere die Urkunden, bleibe bei einem Foto hängen. Es muss eine relativ neue Aufnahme von Theo sein, er hat ein wenig zugenommen, vielleicht fünf oder sechs Kilo, mehr nicht. Der erste Ansatz von Grau zeichnet seine Schläfen, der jugendliche Übermut in seinem Blick ist einer gesetzten Abgeklärtheit gewichen, und die Linien, die aus seinen Augenwinkeln sprießen, haben die Verniedlichung »Lachfältchen« eigentlich nicht mehr verdient. Aber es steht ihm. Es steht ihm ausgezeichnet. Das war schon immer mein Problem mit Theo Rizzi. Ihm steht alles.
Mein Blick löst sich, wandert einen Zentimeter nach links. Seine Frau trägt ein cremeweißes Strandkleid mit geflochtenen Trägern und gerafftem Seitenbund, aber sie könnte genauso gut einen Kartoffelsack tragen, es würde ihrer Schönheit keinen Abbruch tun. Auch ihr steht alles, aber das weiß sie sicher.
»Kim!«
Seine Stimme lässt mich vor Schreck herumfahren. Zwei Blicke treffen sich, vier Mundwinkel schießen nach oben, die restliche Motorik erstarrt. Wir stehen uns gegenüber wie zwei Laiendarsteller, die ihren Text vergessen haben, und die Souffleuse hat gerade Pause. Ich schwanke zwischen klassischem Handschlag und einer männlich-festen Umarmung, verwerfe dann alles und spiele ein Ass: »Kannst du dich noch erinnern?«, frage ich, strecke ihm meine Handfläche entgegen und klimpere mit den Fingern. »Feuer.«
Er legt den Kopf leicht schief, kräuselt die Lippen und wirft einen prüfenden Blick über die Schulter. Keine Kollegen in Sichtweite. »Regen«, antwortet er zögerlich, hält dabei seine Hand über meine, klimpert ebenfalls mit den Fingern.
»Und was ergibt das?«
»Nur heißen Dampf.«
Unser schüchternes Lächeln weicht einem breiten Grinsen. Der Handschlag unserer Kindheit hat keine besonders sentimentale Bedeutung, aber es reicht, um die Souffleuse in uns zur Rückkehr zu bewegen. Los, los, umarmt euch, befiehlt sie. Wir gehorchen.
»Tut gut, dich wiederzusehen«, sagt er.
Ich sage nichts, denn es tut mehr als gut, ihn wiederzusehen. Stattdessen ziehe ich weiter Karten aus dem Nostalgie-Hut. »Wahrscheinlich haben wir jedem Knirps im Block mindestens einmal das Taschengeld abgeknöpft.«
»Selbst schuld«, antwortet er, löst sich aus der Umarmung, nimmt an seinem Schreibtisch Platz. »Ein Spiel wie Schnick-Schnack-Schnuck kann böse enden, besonders wenn man gegen dich spielt.«
Ich schmunzle. Er sagt »Spiel«, als wäre es wirklich eines gewesen. Aber Spiele haben für gewöhnlich Regeln, und der Gewinner steht nicht im Vorfeld fest. Bei uns gab es nur eine Regel: Wir gewinnen. Die Jungs im Block haben damals bloß ein dummes kleines Mädchen mit Zöpfen gesehen, das behauptete, nicht verlieren zu können. Sie haben immer Stein oder Schere genommen, ich immer Feuer, Pistole oder Atombombe. Und wenn sie dann ihr Taschengeld nicht rausrücken wollten, kam Theo um die Ecke und hat etwas nachgeholfen. Hinterher haben wir halbe-halbe gemacht. Im Grunde hätte mir Theo gar nichts geben müssen, er ist drei Jahre älter, war damals schon groß gewachsen – eigentlich war meine Rolle überflüssig. Trotzdem gab er mir immer meinen Anteil. Theo Rizzi, der faire Betrüger.
Wir schwelgen noch kurz in Erinnerungen an die schöne alte Zeit, die immer nur in Erinnerungen die schöne alte Zeit ist, bis das Gespräch versiegt. Immer wieder treffen sich unsere Blicke, prallen voneinander ab wie Billardkugeln.
Dann zeichnen Schatten sein Gesicht. »Und? Wo bist du als Letztes rausgeflogen? Abteilung Glücksspiel?«
Ich schiebe die Unterlippe vor und die Antwort trotzig hinterher. »Cybercrime. Glücksspiel war ich davor, aber da hatte ich kein Glück.« Ich lache. Er nicht.
»Beim Dezernat für Urkundenfälschung hattest du auch kein Glück, was?«, fragt er knapp, blickt betreten auf den dicken Aktenordner vor ihm. Jetzt erst bemerke ich, dass er meinen Namen trägt. »Die wollten dich in die Waffenkammer abschieben, Kim. Du würdest dort längst Pistolenläufe reinigen, wenn sich der Abteilungsleiter nicht mit Händen und Füßen gegen dich wehren würde. Er meint, man dürfe dir keinen unbegrenzten Zugang zu Waffen und Munition ermöglichen. Nicht mal das Polizeimuseum will dich als …«
»Ich hab’s kapiert«, würge ich ihn gereizt ab. »Niemand will mich. Sagst du mir auch etwas, das ich noch nicht weiß?«
Als Antwort lässt er einige Sekunden verstreichen. »Du schuldest mir etwas«, verkündet er mit tragender Stimme. »Ich musste den Polizeipräsidenten beknien, verstehst du? Ich musste meine Hand für dich ins Feuer legen – quatsch, meinen ganzen Arm, beide Arme, meinen Arsch, meine Arme und meine Karriere, nur damit er dir eine allerletzte Chance gibt. Er meinte, du wirst mir die Abteilung zerlegen, aber ich habe gesagt: Nein, das wird klappen. Kim Lansky hat sich unter Kontrolle. Kim Lansky wird eine Bereicherung für die Vermisstenabteilung sein. Wirst du eine Bereicherung für die Abteilung sein, Kim?«
Ich will antworten, weiß aber nicht, was. Zu viele Gedanken, Gefühle, Erinnerungen schwirren mir durch den Kopf. Eine davon setzt sich fest, löst ein Schmunzeln aus. »Weißt du eigentlich, dass ich hier angefangen habe? Gleich nach der Polizeiakademie. Du warst bei Rauschgift, aber ich war hier, Abteilung Vermisste und unbekannte Tote, unter Dings, äh … wie hieß er noch gleich?«
»Haidhauser.«
»Georg Haidhauser, richtig. Und jetzt, Jahre später, fange ich wieder hier an, Haidhauser ist nicht mehr da, und mein neuer Chef ist mein ältester Freund. Ist doch eine seltsame Fügung des Schicksals, nicht?«
Theo setzt ein mitleidiges Lächeln auf. »Vielleicht wärst ja du an meiner Stelle, wenn du Haidhauser nicht die Nase gebrochen hättest.«
Mein Lächeln verschwindet. »Vielleicht«, fauche ich zurück. »Aber vielleicht hätte er mir auch nicht an den Arsch fassen sollen.«
»Und was war mit den Kollegen von der Urkundenfälschung? Was hatten die gegen dich?«
Ich bohre meine Fingernägel in die Handflächen, rufe mir die Worte meiner Selbsthilfefibel in Erinnerung. Tief einatmen, ausatmen, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. »An den Vorwürfen war nichts dran«, knurre ich bloß. »Die wollten mich nur loswerden.«
»Gegen dich wurde ermittelt, Kim.«
Ich zucke mit den Schultern. »Wieder eingestellt.«
Er seufzt. »Das ist deine allerletzte Chance, Kim. Du darfst es nicht verbocken.«
Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in den letzten Jahren. So viele haben ihn mir ins Gesicht gesagt, auf so unterschiedliche Weise: mahnend, warnend, herablassend, gut gemeint, theatralisch … Aber egal, wie der Satz auch klang, ich habe ihn immer gleich aufgenommen: gar nicht. Vielleicht ist es diesmal anders. Diesmal kommt er von jemandem, der weiß, warum ich bin, wie ich bin. Er weiß es, weil er genauso war. Aber irgendwie hat Theo Rizzi gelernt, die Wut in sich zu verstecken. Weiß der Teufel, wie er das bewerkstelligt.
»Wann fange ich an?«
Theo vergräbt seinen Blick in meinem, sucht nach etwas, das vermutlich gar nicht existiert. Dann: »Vor fünfzehn Minuten.« Er zieht eine Schublade auf, knallt meine Dienstwaffe auf den Tisch. »Deinen Ausweis hat Britta. Sie zeigt dir alles.«
»Keine Hausführung vom Chef persönlich?«
»Ein andermal, ich muss deinetwegen noch den Rasen des Polizeipräsidenten mähen.« Seine Lippen lächeln. Seine Augen nicht.
Es ist Zeit zu gehen. Ich erhebe mich etwas steif, nehme meine Waffe, gehe zur Tür. Aber etwas hält mich zurück. Wieder geht mein Blick zur Wand, nicht zu den Urkunden, nicht zu der Aufnahme, sondern zu dem, was danebenhängt. Man sieht es nur noch selten, selbst in Behörden. »Redest du noch oft mit ihm?«, frage ich, ohne Theo dabei anzusehen.
Sein Blick folgt meinem zum Kreuz. »Jede Woche«, antwortet er, lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
Beide starren wir das Kreuz an. Jesus Christus starrt ins Nichts.
»Er fragt oft nach dir.«
Ich nicke bloß. Dann verlasse ich das Büro.
Britta alias Zerberus alias Miss Hairspray führt mich zu meinem Schreibtisch und gibt den Kollegen im Großraumbüro per Augenbrauentanz zu verstehen, vorstellig zu werden. Die darauf folgende Begrüßungsrunde ist ein Schaulaufen der beliebtesten Vornamen der Sechziger: Kerstin, Petra, Stefanie, Dirk, Torsten, Klaus und Holger, den ich gerne Holgi nennen darf, kommen auf Stippvisite zu mir und absolvieren einen Anstandsschwatz. Nur einer von ihnen dauert länger als zwei Minuten.
»Ingo Sagatz«, stellt sich der Kollege vor, schüttelt mir die Hand, als wäre mein Arm eine Zündschnur und ich leicht entflammbar. »Der Chef meinte, ich soll dir alles zeigen.« Er mustert mich kühl, ich ihn ebenso. Durchgeknöpftes Hemd, akkurater Seitenscheitel, beinahe transparent blasse Haut und zu viel Gebiss für zu schmale Lippen. Traumbesetzung für jeden Stasi-Thriller. Fehlbesetzung an meiner Seite.
»Alles zeigen, mhm«, murmle ich in mich hinein. »Dabei kannst du mich praktischerweise gleich ein bisschen im Auge behalten, was?«
Er lächelt leicht säuerlich, trommelt mit den Fingern über meinen Schreibtisch und übergeht meine Frage. »Ein paar Sachen deines Vorgängers sind noch da, Kugelschreiber, Notizblöcke, die Schreibunterlage, das kannst du ja sicher gebrauchen.«
»Was ist mit ihm passiert?«, frage ich, lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. »Frühpension?«
Seine Mundwinkel rutschen nach unten. »Der Kollege Krüger hatte einen Herzinfarkt.«
Kim Lansky, dein zweiter Vorname sollte »Fettnäpfchen« lauten. »Mein Beileid«, antworte ich mit belegter Stimme.
Er nickt. Dann zaubert er einen Stapel Papiere hervor. »Das sind seine letzten Fälle. Ich hab die vergangenen Wochen ein Auge drauf gehabt. Viel Spaß!« Dann zieht er ab.
Ich lasse mich in den Bürostuhl plumpsen, schiebe wahllos einige Schubladen auf und zu, probiere die Kugelschreiber auf dem Papier der Schreibunterlage aus und will mich mit der Telefonanlage vertraut machen, als plötzlich das Display aufleuchtet. Das geht schnell.
»Vermisstenabteilung, Lansky?«, melde ich mich etwas zögerlich.
Am anderen Ende ertönt eine hohe Fistelstimme. »Guten Tag, Bianca Grantzinger, ich hab die Nummer von dem Fahndungsplakat.«
Sie spricht leise, und die Geräusche in der Leitung sind so laut, dass ich sie kaum verstehen kann. Es piept und schrillt – keine Ahnung, woher sie anruft, aber die Kulisse kommt mir irgendwie bekannt vor. »Okay. Und … von welchem Plakat genau?«, frage ich holprig und notiere mir ihren Namen auf der Schreibunterlage.
»Das Plakat von dem vermissten Mädchen. Marie Lipmann. Das hängt hier schon seit Wochen.«
Hastig klemme ich mir den Hörer zwischen Schulter und Ohr, fächere den Aktenstapel vor mir auf. Böhners, Junker, Papazufolos, Özdemir … Aha, Lipmann. »Äh, bleiben Sie bitte kurz dran«, sage ich, werfe sie in die Warteschleife und überfliege die Akte.
Marie Lipmann, fünf Jahre alt, vermisst seit dem 5. Juni 2019 – also dieses Jahr, vor viereinhalb Monaten. Blond, blaue Augen, sieht aus, als wäre sie einem Walt-Disney-Reißbrett entsprungen. Keine besonderen Merkmale. Bei der Mutter wiederholt sich das Muster: Clara Lipmann, achtundzwanzig, ebenfalls blond und blauäugig, ebenfalls Disney. Besondere Merkmale: zu schön, um wahr zu sein. Bis auf einen zu kurzen Finger an der rechten Hand ist ihr einziger Makel, keine zu haben. Photoshop würde sich vor Langeweile selbst schließen bei ihren Bildern. Genauso bei Jakob Lipmann, siebenunddreißig, Typ Coverboy für den neuen Frühjahrskatalog von Barbour, wohnhaft in Bogenhausen, dem Villenviertel der Reichen und jener auf dem besten Weg dorthin. Er macht irgendwas mit Finanzen, Senior Manager bei ComCoin, einem Payment-Dienstleister, was immer das auch bedeuten mag. Und Clara Lipmann ist … war Kellnerin, alles klar. Wahrscheinlich in seinem Golfclub.
Ich bleibe bei einem Vermerk hängen. Irritiert checke ich das Telefondisplay. Keine interne Nummer. Ich räuspere mich, hole die Anruferin zurück: »Hallo? Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten – Sie sind nicht von der Polizei, oder?«
»Was? Ich? Nein!«, sagt die Fistelstimme entgeistert. »Wie kommen Sie darauf?«
Nachdenklich betrachte ich den Vermerk: F. n. ö. Bei nicht öffentlichen Fahndungen gibt es neben der Polizei nicht viele Einrichtungen, an die entsprechende Informationen weitergegeben werden. Eigentlich nur zwei. Und in der Regel bedeutet keine der beiden etwas Gutes. Erinnerungen kämpfen sich in mir hoch, traurige Souvenirs meiner ersten Monate in der Vermisstenabteilung. Manchmal reicht ein einziger Anruf, und aus einer Kartei wird eine Karteileiche. Ich schlucke. »Darf ich fragen, woher Sie anrufen?«
»Klinikum Bogenhausen.«
Erleichtert atme ich auf. Zumindest keine Bestattung. Aber einen Moment später fällt mir ein, woran mich die Geräusche in der Leitung erinnern: an meine Mutter. Sie erinnern mich an den Tag, an dem ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Und plötzlich weiß ich, dass es zum Aufatmen keinerlei Anlass gab.
»Abteilung 2«, höre ich sie sagen, während das Piepen in der Leitung zu einem wütenden Schrillen anschwillt. »Intensivstation.«
Jakob
Donnerstag, 17. Oktober, 11:00 Uhr
Dreißig Sekunden.
Drei Sekunden, bis die Tür des Fahrstuhls vollständig geöffnet ist. Zwei Sekunden bis zur Schalterleiste – ich drücke, das grüne LED-Licht umrandet die Taste –, dann weitere drei Sekunden, bis sich die Tür wieder geschlossen hat. Die Fahrt ins siebzehnte Stockwerk dauert zwanzig Sekunden. Der Fahrstuhl hält mit einem sanften Ruck, das gebürstete Chrom teilt sich, und wenn ich meinen Fuß auf den zinnoberroten Hochflorläufer der Lobby setze, sind exakt dreißig Sekunden vergangen.
Meine dreißig Sekunden.
Es ist meine Vorbereitungszeit. Ich zurre meine Rüstung fest, ziehe die Zügel straffer, lege die Waffen an, spreche mein Mantra. Nutze den Tag. Verfolge das Ziel. Geh deinen Weg. Sei der Jakob Lipmann, der alles schaffen kann. Dann bin ich bereit für den Arbeitstag. Entscheidend dabei ist, dass ich in diesen dreißig Sekunden für mich bin. Meistens bleibe ich so lange in meinem Wagen in der Tiefgarage, bis ich keine Kollegen mehr sehe, erst dann gehe ich zum Fahrstuhl. Ich will meine dreißig Sekunden für mich alleine. Wie heute.
Der Aufzug setzt sich in Bewegung. Ich schließe die Augen, zähle. Achtundzwanzig. Neunundzwanzig.Dreißig. Die Tür schiebt sich zur Seite, ich öffne die Augen. Sei der Jakob Lip…
Blut, überall Blut!
Ein Meer aus Blut, es flutet den Fahrstuhl, überströmt meine Schuhe, spritzt an mir hoch. Panisch weiche ich zurück, taumle gegen die Wand, suche die Deckenverkleidung nach einem Ausstieg ab – es muss eine Notluke geben, eine … Etwas stößt gegen mein rechtes Bein. Etwas Festes. Ich blicke hinab. Claras Körper treibt in der Wanne, sie bewegt sich nicht. Ihre Adern schimmern bläulich durch die knochenbleiche Haut. Mein Herzschlag setzt aus. Alles setzt aus. Und dann ist sie verschwunden.
Der Wahn weicht der Wirklichkeit. Bebend klammere ich mich an die Fahrstuhlwand, starre auf den zinnoberroten Läufer mit unserem Firmenemblem. Einunddreißig. Zweiunddreißig. Die Tür schließt sich wieder. Dreiunddreißig. Vierunddreißig. Ich höre auf zu zählen. Heute brauche ich länger als dreißig Sekunden, umder Jakob Lipmann zu sein, der alles schaffen kann. Sehr viel länger.