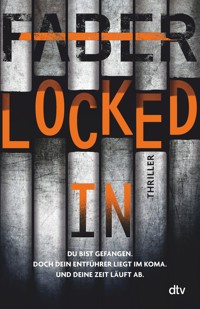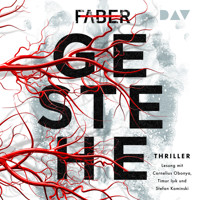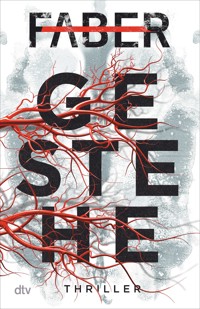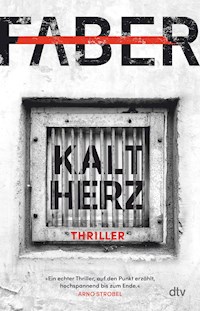9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Türen. Kein Ausweg. Als Noah spätabends die Wäsche vom Dachboden holt, hat er plötzlich ein Messer an der Kehle. Der Angreifer will in seine Wohnung, zu seiner Frau. Noah bleibt keine andere Wahl, doch dann fällt ihm ein: Die Nachbarn gegenüber sind verreist. Und er hat den Zweitschlüssel … Stunden später findet ihn die Polizei bewusstlos neben der brutal ermordeten Nachbarin. Die Tat trägt die Handschrift eines berüchtigten Serienmörders, und Noah gilt als wichtiger Zeuge. Aber sagt er die ganze Wahrheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Henri Faber
Ausweglos
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Ich laufe.
Es ist 79 Stunden und 44 Minuten danach, meine linke Wade krampft, mein Knie rebelliert, die Lippen sind spröde wie Krepppapier, aber ich laufe. Ohne Musik im Ohr, ohne Pulsmesser, ohne Wasser, Geld oder Ziel, ich laufe einfach. Weiter und weiter, durch den eisigen Regen, hinein in die sterbende Nacht. Am Horizont frisst sich die Sonne in die Dämmerung, überflutet die Stadt mit Schatten, blendet meine entzündeten Augen, doch ich sehe direkt hinein, reiße meine Lider auf und hoffe – nein, flehe, dass sie verschwinden.
Denn 79 Stunden und 44 Minuten danach sind sie immer noch da, die Bilder, tief eingebrannt in mein Gedächtnis. Ihre leichenblassen Glieder, die blutdurchtränkten Laken, der entstellte Leib. Sie verfolgen mich in jeder Minute meines Tages, vergiften nachts meine Träume, rauben mir den Schlaf.
Also laufe ich. Immer weiter. Durch Straßenschluchten, Gewerbeparks und verfallene Lagerhäuser. Ich weiß nicht, wo ich bin, weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin oder wie lange meine Beine mich noch tragen werden. Aber ich weiß, dass ich laufen muss, nicht anders kann. Denn 79 Stunden und 44 Minuten nach ihrem Tod liegt die Last schwerer auf mir denn je.
Sirenen durchdringen die Stille. Das Blaulicht hinter mir wirft meine Silhouette an die Wand. Sie wollen, dass ich stehen bleibe.
Aber ich laufe.
Noah
6 Stunden und 44 Minuten danach
Als ich die Augen aufschlage, bricht das Licht wie ein Wasserschwall über mich herein. Es durchflutet meine Netzhaut, als wollte es an meinen Pupillen vorbei direkt in meinen Schädel. Ich kann nichts fokussieren, nichts wahrnehmen, es gibt nur dieses totale, alles einnehmende Strahlen; und für den Moment, für diesen winzigen Augenblick, bin ich nichts als schwerelose, von allen Kräften losgelöste Materie. Mein erster Gedanke ist: Das war’s, ich bin tot. Dann wünschte ich, es wäre so.
Das Pochen meiner Wunden wirft mich zurück in meinen zerschundenen Körper. Wellen von Schmerz rollen durch meine Glieder und explodieren in meinem Kopf. Das strahlende Licht entfernt sich, Bewegungen zeichnen sich ab. Ich beginne zu realisieren, die Umgebung einzuordnen. Ich bin nicht tot. Das ist nicht der Himmel. Das ist auch nicht die Hölle. Es ist die Diagnostikleuchte eines Sanitäters.
Etwas drängt durch meine Kehle, vorbei an der Zunge, einfach hinaus. Schatten spritzen durch die Luft, fallen wieder auf mich herab – ich kann nicht atmen, glaube zu ersticken. Mein Kopf wird zur Seite gedrückt, Finger wühlen in meinem Rachen, der Boden vor mir bedeckt sich mit breiiger Masse. Es ist ekelhaft, riecht nach Galle. Ich schiele daran vorbei, suche Orientierung in der verzerrten Welt. Neongelbe Gestalten ragen in die Höhe, beugen sich über mich. Münder gehen auf und zu, Geräte blinken, Stiefel treten wenige Zentimeter neben meinem Kopf auf, machen aber keine Geräusche. Da ist nur Vibration, Zittern, Berührung, mehr nicht. Das Laminat knarzt nicht, Reißverschlüsse ratschen nicht, Münder bleiben stumm. Die Welt ist bloß Störrauschen.
Ich werde hochgehoben, der Horizont verschiebt sich. Mein Blick tastet die Umgebung ab, streift breite Rücken, samtgrüne Vorhänge, metallene Bettpfosten, scharlachrote Laken. Bevor ich aus dem Raum getragen werde, sind meine Augen nur noch darauf gerichtet. Das scharlachrote, feucht glänzende Laken und das leichenblasse Bein, an dem es klebt. Und mein letzter Gedanke, bevor ich wieder zurück in die Ohnmacht sinke: Vielleicht ist das doch die Hölle.
Elias
6 Stunden und 58 Minuten danach
Pete sitzt hinter seinem Schreibtisch und spült angewidert zwei Tabletten hinunter, unruhiger Magen vermutlich. Ein Kollege kommt zur Tür herein, fragt, ob er auch eine haben könne – die Nerven liegen blank. Den halben Tag schon werden die Agenten in den Verhörraum gerufen, einer nach dem anderen. Es soll einen Maulwurf geben, alle müssen sich einem Lügendetektortest unterziehen, ausnahmslos. Selbst Pete, der sich sogar eine Kugel für den Präsidenten eingefangen hat. Doch jetzt muss er wie alle anderen seine Loyalität unter Beweis stellen. Ein weiterer Agent kommt vom Verhör zurück.
»Härter als zur Beichte zu gehen«, kommentiert er geschafft, aber auch irgendwie erleichtert. Es ist so weit. Pete ist der Nächste.
Der Raum ist klein, beige-graue Wandverkleidung, vermutlich schalldicht. Um Petes Brust schlingen sich Drähte, eine Manschette schnürt ihm das Blut im rechten Arm ab. Die Verhörspezialistin überwacht den Bildschirm ihres Laptops mit Argusaugen.
Ich murmle: »Sind Sie an einem Komplott zur Ermordung des Präsidenten beteiligt?« Gleich darauf fragt die Verhörspezialistin auf dem Bildschirm das Gleiche, Pete Garrison verneint, leicht genervt.
Dann wieder ich: »Haben Sie in den letzten sechs Monaten etwas getan, was das Leben unseres Präsidenten gefährden könnte?« Die Frau am Bildschirm wiederholt es wortgleich, Pete Garrison antwortet flapsig: »Nicht, dass ich wüsste.«
Siebzehn Minuten später wird ihn Kiefer Sutherland (ich kann mir seinen Filmnamen nicht merken) mit den Testergebnissen konfrontieren: Er hat gelogen. Pete wird verdächtigt, er flieht und hat das halbe FBI und den Secret Service im Nacken, aber am Schluss stellt sich natürlich heraus, dass er unschuldig ist. Er geht in Frühpension und sagt zum Abschied: »Ich werde das hier vermissen«, woraufhin Kiefer Sutherland antwortet, dass man ihn auch vermissen werde, gefolgt von dem obligatorischen: »Pass auf dich auf.«
Ich kenne fast jeden Dialog des Films auswendig – Wort für Wort. Wahrscheinlich habe ich ihn dreißig Mal gesehen, wenn nicht sogar öfter. Dabei finde ich ihn nicht einmal gut. Eigentlich regt er mich nur auf, besonders die Szene mit dem Lügendetektor. Als ob es so einfach wäre.
Die Ergebnisse solcher Tests sagen rein gar nichts aus, sind vor Gericht nicht einmal das Papier wert, auf dem sie gedruckt werden. Aber Hollywood macht allen weis, Polizeiarbeit wäre ein Kinderspiel.
Den Verdächtigen überführen? Kein Problem, schließt ihn doch einfach an den surrenden Kasten an, und schon wisst ihr, ob er lügt. Geht nicht? Warum nicht? Kiefer Sutherland macht es doch auch.
So denken die Menschen. Sie ziehen sich diesen ganzen Blockbuster-Mist rein, dann zappen sie weiter, schalten um zu den hiesigen Nachrichten und hören: immer noch keine Spur, Ermittler tappen im Dunkeln, keine Verdächtigen, Fahndung ohne Ergebnisse. Und in ihren Köpfen spielt das alte Lied: typisch deutsche Polizei, kaputtgespart, breitarschig, streichelweich. Zahnlose Bürokraten in Uniform.
So sieht uns die Öffentlichkeit, ich weiß es ganz genau – es kann gar nicht anders sein, die meisten sind praktisch groß geworden mit diesem Schund. Den Menschen wird die Illusion einer einfachen Welt eingepflanzt, die mit der Realität niemals mithalten kann. Ich hasse das. Und ich hasse diesen Film. Trotzdem kenne ich jede Zeile auswendig.
Ich blicke auf meine Armbanduhr. Es ist kurz nach sieben Uhr morgens, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und schaue zum einunddreißigsten Mal ›The Sentinel‹ mit Michael Douglas und Kiefer Sutherland, eine andere Ablenkung gibt es nicht. Irgendwie habe ich es seit dem Umzug nicht geschafft, einen Fernsehanschluss anzumelden. Bücher besitze ich keine, Zeitschriften lese ich nicht … Ich hätte nicht einmal diese DVD, wenn sie der Vormieter nicht mitsamt dem Abspielgerät hiergelassen hätte. Aufs Revier kann ich auch nicht, weil ich mir wegen der ganzen Überstunden freinehmen musste. Was soll ich also tun?
»Wollt ihr ein Bier?«, fragt Michael »Pete« Douglas aus dem Bildschirm heraus seine Kollegen. Mein Blick wandert zum Kühlschrank, aber ich weiß, dass sich nichts darin befindet außer einer Tube Senf und einem Ersatzakku für mein …
Mein Diensttelefon läutet. Unbekannte Nummer, ungewöhnliche Zeit. Ich räuspere mich und hebe ab. »Elias Blom, Kripo Hamburg.«
»Ja, äh … Campe, ich glaube, ich hab da was für euch«, krächzt eine aufgeregte Stimme ins Telefon. Ich starre regungslos auf den Fernseher. Helikopter kreisen über Washington und suchen nach Pete. Campe? Wer zum Teufel ist Campe? Meine Ratlosigkeit scheint am anderen Ende der Leitung spürbar zu sein.
»Linus Campe, Sie wissen schon … Ihr habt mir die Nummer gegeben, falls mir etwas auffällt.«
Ich antworte nicht, stattdessen hält Kiefer Sutherland im Hintergrund eine gestelzte Rede.
Campe seufzt. »Hören Sie, Mats hat gesagt, wenn ich etwas sehe, soll ich diese Nummer anrufen, bevor ich die Zentrale verständige.«
Mats’ Name schießt in meinen Kopf wie ein elektrischer Impuls, der aber sofort wieder abebbt. Es gab in der Vergangenheit einfach schon zu viele Informanten, Kollegen oder sonstige Wichtigtuer, die meinten, sie hätten das entscheidende Puzzlestück, die heiße Spur gefunden. Am Ende war es immer eine Sackgasse.
»Es ist sieben Uhr morgens, ich habe heute meinen freien Tag. Nennen Sie mir einen guten Grund, warum ich nicht auflegen sollte?«
»Ich kann Ihnen einen Finger nennen, wenn Sie wollen.«
Der nächste Impuls, diesmal heftiger. Adrenalin schießt mir in die Blutbahn, meine Zähne malmen, meine rechte Hand beginnt zu zittern. Könnte es sein? Nach so langer Zeit? Am Bildschirm hat Kiefer Sutherland Michael Douglas im Visier. Alles, was er tun muss, ist abdrücken. Aber er tut es nicht. Er bringt es nicht übers Herz. Michael Douglas entkommt.
»Hallo, sind Sie noch dran?«, ertönt es am anderen Ende der Leitung.
»Schicken Sie mir die Adresse, ich bin gleich da«, antworte ich mit kehliger Stimme. »Und, Campe?«
»Ja?«
»Fassen Sie nichts an!«
Linda
7 Stunden und 3 Minuten danach
Ich erwache und frage mich wie so oft, ob dieser Tag der Beginn eines neuen Lebens wird oder ob er sich bloß einreiht in eine lange Serie von Enttäuschungen. Wie hat sich mein Körper entschieden? Ich fühle in mich hinein, suche nach Anzeichen: Ist da ein Spannen oder ein Ziehen, vielleicht ein Drücken?
Meine Augenlider sind immer noch geschlossen. Die Welt da draußen interessiert mich nicht, solange ich nicht weiß, was sie diesmal für mich bereithält. Es macht keinen Unterschied, welches Wetter wir haben, welche Uhrzeit, ob Geburtstag, Weihnachten, Ostern oder einfach nur ein ganz normaler Tag im Büro, egal. Mein Leben richtet sich nicht nach äußeren Umständen. Es unterwirft sich einzig und allein einer simplen Frage: Hat es geklappt, oder hat es nicht geklappt?
Die Sekunden vergehen, ich spüre immer noch nichts. Kein Stechen, kein Ziepen, keine Krämpfe, alles ruhig. Ich wage es kaum zu denken, aber … könnte es etwa sein? Könnte heute der Tag der Tage sein, das Ende meiner Odyssee? Ich spanne die Muskeln in meinem Unterleib an, drehe mich leicht, hebe die Hüfte, provoziere es. Nichts.
Hoffnung beginnt zu glimmen. Bilder kommen mir in den Sinn, an die ich nicht denken darf, Wünsche ploppen auf, die ich mir selbst verboten habe, aber warum eigentlich? Warum darf ich nicht träumen? Ich will auch hoffen dürfen, will glauben, will mich bei dem Gedanken erwischen, was wäre, wenn. Ja, was wäre, wenn? Was würde ich dann tun? Was würde ich als Erstes tun?
Ich würde aufspringen, in unser Sportzimmer stürmen und das beschissene Spinningrad einfach aus dem Fenster schmeißen. Und den Stepper gleich hinterher. Macht Platz, ihr Teufelsgeräte, ihr werdet nicht mehr gebraucht. Dieses Zimmer wird nun seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt. Springseil, Hanteln, Kettlebells, Bauchweg-Trainer, alles raus. Das würde ich tun, wenn …
Da ist doch ein leichtes Ziehen. Meine Gedanken stocken, der Silberstreif am Horizont verblasst. Mir fällt wieder ein, warum ich mir ein Hoffnungsverbot erteilt habe. Mir fällt ein, dass das Leben nicht im Konjunktiv stattfindet.
Wie ferngesteuert wandert meine Hand über meinen Bauch, schiebt sich erst unter den Saum meines Schlafanzuges, dann in mein Höschen. Was wäre, wenn gestatte ich mir noch ein letztes Mal zu denken. Dann taste ich weiter. Und sofort zerplatzen meine naiven Träumereien wie Seifenblasen.
Ich hätte es besser wissen müssen.
All die Hoffnung, bloß weil ich drei Tage überfällig war – wie bescheuert kann man sein? Ich vergrabe mein Gesicht tief in das Kissen, kneife die Augen zusammen. Ich muss nicht hinsehen, um zu wissen, dass das Blut ist zwischen meinen Fingerkuppen. Ich muss nicht ins Bad, um zu wissen, dass ich meine Tage bekommen habe. Ich weiß das alles. Es passiert nicht zum ersten Mal.
Ich bleibe also liegen. Das beschissene Spinningrad bleibt, wo es ist, die Kettlebells werden weiterhin in der Ecke verstauben, der Tag ist für mich gelaufen. Serie schauen, Essen bestellen, Zeit totschlagen – das ist der neue Plan. Morgen wiederholt sich das Trauerspiel, und dann: Thank God, it’s Monday.
Alle Welt freut sich aufs Wochenende, bei mir ist es genau andersherum. Ich freue mich auf die Aktenberge in der Kanzlei. Dort kann ich mich vergraben, kann mich eindecken mit Arbeit und Überstunden machen, bis die Putzkolonne mich rausschmeißt. Mein Chef hat keine Probleme damit, im Gegenteil. Als Wirtschaftsprüferin sind Überstunden ohnehin Voraussetzung. Mir ist es nur recht. Je mehr ich zu tun habe, desto weniger Zeit bleibt mir, um darüber nachzudenken, warum ich verdammt noch mal schon wieder nicht schwanger geworden bin.
Aber am Wochenende funktioniert das nicht. Selbst diese Branche kann sich dem Work-Life-Balance-Trend nicht gänzlich entziehen, Samstag und Sonntag ist das Office geschlossen, doppelt und dreifach alarmgesichert. »Schönes Wochenende« wünschen sich die Kolleginnen am Freitagnachmittag. »Und was macht ihr so? Wir fahren mit dem Kleinen in den Zoo, die Löwen anschauen.« Ja, fahrt nur in den Scheißzoo und zeigt dem Kleinen die Scheißlöwen. Erzählt euch lang und breit von den Erfahrungen im Kinder-Yoga-Kurs, tauscht euch aus über die familienfreundlichsten Cafés und wie süß der Spatz doch immer schläft, eingewickelt im Tragetuch, dicht an Mamas Prachtbusen. Ich sitze bloß daneben, nicke, lächle angestrengt und zähle bereits die Stunden, bis ich meine Gedanken wieder mit Jahresabschlüssen, Abschreibungen und Bilanzierungsvorschriften betäuben kann.
Bis dahin: For fuck’s sake, it’s Saturday.
Ich liege im Bett, meine Augen sind immer noch geschlossen und bleiben es auch. Kein Millimeter Licht soll zu mir durchdringen, denn jede Sekunde Tag ist eine Sekunde mehr mit meinem unfruchtbaren, verdorrten Körper. Wachsein bedeutet Frust. Schlaf bedeutet Freiheit – die Freiheit, zu träumen. Schlaf ist mein Ausweg. Also sinke ich wieder in meine Dämmerung, gleite hinab ins wattige Schwarz. Der Tag hat 24 Stunden. Je weniger ich davon wach bin, umso besser.
Elias
8 Stunden und 4 Minuten danach
Als ich in die Straße biege, erstreckt sich vor mir die gähnende Leere eines Wohngebiets in Hamburg an einem Samstagmorgen. Ungewöhnlich – kein Notarzt rast mir entgegen, keine Einsatzwagen, die sich gegenseitig blockieren, keine schaulustige Menschenmenge. Ich finde sogar einen Parkplatz. Zur Sicherheit zücke ich mein Telefon und öffne die Nachricht von diesem Campe. Heinsweg 18, ich bin richtig.
Die Straße ist nichts Besonderes, aber nett. Ein Klinkerhaus reiht sich an das nächste, keines höher als drei Stockwerke. Hier wohnen keine Banker, Ärzte oder Staatsanwälte, aber es ist auch nicht so heruntergekommen wie die Sozialgettos in Lurup oder Osdorf. Ein typisches Viertel für den Mittelstand. Lehrer, Beamte, Angestellte, solche Leute.
Ich steige aus, gehe die Straße hinauf und entdecke einen Polizeiwagen – er parkt direkt vor der Nummer 18. Trotzdem bin ich unsicher. Das Haus hat zwei Eingänge, und in Campes Nachricht stand kein Name. Verärgert hole ich erneut mein Telefon hervor, um ihn anzurufen, als plötzlich ein Streifenpolizist aus der rechten Tür taumelt, mich für den Bruchteil einer Sekunde erschrocken anstarrt und mir dann vor die Füße kotzt.
Ein Frischling, noch keine fünfundzwanzig, aber schon in Uniform. Kräftig gebaut, breiter Stand, Stiernacken. Steht wahrscheinlich Tag für Tag um fünf Uhr morgens auf, geht ins Fitnessstudio und pumpt sich die Muskeln wund, damit auch ja jeder versteht, dass er es mit einer Respektsperson zu tun hat. Knapp zwei Meter Recht und Ordnung, proteinbetrieben, testosterongesteuert, amphetaminabhängig. Und jetzt lehnt er an der Straßenlaterne und kotzt sich die Seele aus dem Leib.
Ich sollte ihn fragen, ob alles okay ist. Sollte ihm auf die Schulter klopfen, einen Kaugummi anbieten und so etwas murmeln wie: Wird schon wieder. Mats hätte das getan.
Schweigend gehe ich an ihm vorbei.
Ich bin nicht Mats.
Der Eingangsbereich ist eine tageslichtarme Kanüle zu einer noch dunkleren Treppe, auf deren erster Stufe eine Rolle Absperrband liegt. Oben im dritten Stock erwartet mich ein weiterer Streifenpolizist.
»Was ist mit Ihrem Kollegen?«, frage ich kurz angebunden, während die Treppe unter mir knarzt, als bräche sie jeden Moment zusammen.
»Mit Bernd? Ach …«, antwortet der feiste Polizist und schüttelt meine Hand eine gefühlte Ewigkeit. »Der kommt frisch von der Akademie, hat noch nie einen Tatort gesehen.«
Ich nicke bloß.
»Campe, Linus Campe«, stellt er sich vor. »Ich habe mittlerweile die Zentrale verständigt. Dorn und Köpke haben Dienst.«
»Ich kenne die Kollegen. Warum haben Sie zuerst mich angerufen?«
»Ihr Partner Mats hat …«
»Ex-Partner«, unterbreche ich ihn forsch und kann nicht glauben, dass sich diese Nachricht noch immer nicht bis zu allen durchgesprochen hat.
Campes Lippen kräuseln sich. »Ihr Ex-Partner hat mir diese Nummer gegeben und gesagt, wenn ich etwas Verdächtiges sehe, soll ich zuerst da anrufen, nicht die Zentrale.«
Ich antworte nicht, schnaube nur verächtlich aus. Mats hasste Telefongespräche, er meinte immer, dass er den Leuten beim Reden in die Augen sehen wolle.
»Mats hat gesagt, offene Ohren machen sich bezahlt«, legt Campe nach, während er verzweifelt versucht, in meinem Gesicht zu lesen.
»Sie verstehen schon, eine Hand wäscht die andere …«
»Ich verstehe, dass Sie gegen die Dienstvorschrift verstoßen haben«, entgegne ich trocken. »Ein Vergehen, das ich umgehend melden sollte.«
Campes rosiges Gesicht wird bleich. Er versucht, zumindest optisch den Eindruck eines ordentlichen Polizisten wiederherzustellen, drückt den Rücken gerade, streckt die Knie durch und zwingt seinen massigen Körper in eine aufrechte Haltung.
»Was ist hier passiert?«, fahre ich fort, lasse die Dienstvorschriften links liegen.
»Die Nachbarin aus dem Erdgeschoss hat die offene Tür entdeckt und uns angerufen. Laut ihrer Aussage ist sie gegen 6 Uhr morgens hoch auf den Trockenboden, um sich ein paar Sachen zu holen. Sie musste einen frühen Flug erwischen – Stewardess oder so. Jedenfalls sah es dort oben ziemlich verwüstet aus, sie ist dann wieder runter, hat die Tür offen stehen gesehen und 110 gewählt, weil niemand auf ihre Rufe reagiert hat«, rattert Campe im Stakkato herunter.
Ich nicke und starre an ihm vorbei in die Wohnung. »Waren Sie schon drinnen?«
»Kurz. Den Flur runter rechts, hinten im Schlafzimmer. Sieht ganz nach Ihrem Täter aus«, antwortet Campe gehorsam wie ein Schuljunge.
Schweigend trete ich durch die Tür in das Vorzimmer, das sich genauso gut in einem Schauraum von Ikea befinden könnte. Alles ist ordentlich, aber nicht zu ordentlich. Sauber, aber nicht zu sauber. Man fühlt sich sofort willkommen. Die restliche Wohnung ist wie Umblättern im Katalog. Simple Eleganz gepaart mit kreativem Chaos, aber wohlportioniert. Nichts kullert zufällig herum, alles liegt genau da, wo es hingehört. Die Fenster sind geputzt, die Pflanzen gegossen – fleischfressende Pflanzen, interessant –, kein Geschirr im Spülbecken. Aus den Bilderrahmen strahlt ein glückliches Pärchen beim Wandern, Tauchen, Essen mit Freunden. Ich fühle mich wie ein Eindringling in einer Illusion, die für andere Wirklichkeit geworden ist. Dann geht mein Blick Richtung Schlafzimmer.
Das ist mein geheimes Trostpflaster in diesem Job. Egal, welche Insel der Seligen ich auch betrete, egal, wie viele lächelnde Menschen mir aus Fotos entgegenstrahlen und mein eigenes Leben grau und trist erscheinen lassen: Am Ende fällt die Illusion immer in sich zusammen.
Die Tür zum Schlafzimmer steht sperrangelweit offen.
Galle kämpft sich die Speiseröhre empor, Schweiß dringt aus meinen Poren. Atmen. Du musst atmen, tief ein und aus. Ich schließe kurz die Augen, 21, 22, öffne sie wieder. Akzeptiere, was du siehst. Zerlege das Grauen in seine Einzelteile. Lass es nicht an dich ran. Es sind nur Informationen, Indizien, Spuren. Sieh nicht das Blutbad. Sieh, was dahintersteckt.
Okay, fangen wir an.
Die Leiche ist frisch, keinen halben Tag alt. Glatte Haut, keine Flecken, nicht die geringsten Spuren eines Verwesungsprozesses. Meine Finger zwängen sich in einen Nitrilhandschuh, den ich noch irgendwo zu Hause gefunden habe, und betasten vorsichtig den Leichnam. Die Totenstarre ist schwach ausgeprägt, der Tod kann höchstens vor sechs, sieben Stunden eingetreten sein. Das bedeutet …
»Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen?« Campes Stimme hallt aus dem Flur und unterbricht meine Gedankenkette.
Ich antworte nicht, hoffe, dass er mein Schweigen versteht. Tut er nicht.
»Kann natürlich auch ein Nachahmungstäter sein«, schwatzt er weiter, seine Stimme ist nun ganz nahe. »Stand ja in allen Zeitungen, das mit dem Ringfinger.«
»Er ist es«, murmle ich vor mich hin, zähle die Einstiche am Körper.
»Woher wissen Sie das so genau?«
Ich atme tief ein, fletsche die Zähne und lasse den Kopf hängen, als wären alle Muskeln im Nacken gleichzeitig erlahmt. Was bin ich? Die Auskunft? Anscheinend war Campe noch nie an einem seiner Tatorte, sonst würde er nicht so dämliche Fragen stellen. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, ihn wegzuschicken, entschließe mich dann aber für eine Nummer, die sich Mats einmal mit einem Kollegen erlaubt hat. Nicht besonders nett, aber … nichts aber. Es ist einfach nicht besonders nett. »Wissen Sie, warum ihn die Presse den Ringfinger-Mörder nennt?«
Campe rollt mit den Augen. »Er schneidet seinen Opfern den Ringfinger ab«, presst er ungeduldig hervor. »Das weiß doch jedes Kind.«
»Und warum weiß das jedes Kind?«
»Na, weil das in dieser Enthüllungsreportage stand, von diesem Zeitungsfritzen … David Dings, äh …«
»Kronen. David Kronen«, helfe ich ihm auf die Sprünge, obwohl ich den Namen dieses Mistkerls eigentlich nie wieder aussprechen wollte. »Der Name ›Ringfinger-Mörder‹ stammt von ihm, ein griffiger Name, finden Sie nicht?«
»Na ja, ich weiß nicht, kann schon sein«, druckst Campe herum.
»Ist doch einprägsam, Ringfinger-Mörder. Wahrscheinlich hat er sich deswegen entschlossen, die anderen Details wegzulassen.«
Schweigen. Ich spüre Campes irritierten Blick in meinem Nacken, kann die Rädchen in seinem Kopf regelrecht rattern hören.
»Welche Details?«
»Die anderen wiederkehrenden Muster des Killers, zum Beispiel das hinter Ihnen«, fahre ich fort, ohne mich umzudrehen. »Was glauben Sie, würde die Presse daraus machen? Fällt Ihnen da vielleicht etwas ein?«
»Teufel auch!« Campe schrickt zurück.
Jetzt erst trete ich zu ihm, mustere sein Gesicht, den offen stehenden Mund, den Schweiß auf seiner Stirn.
»Teufel, guter Name«, brumme ich zustimmend. »Ein anderer Kollege meinte mal, ›der Bestrafer‹ würde passen. Oder ›der Symbol-Killer‹.«
Die Sekunden verstreichen, wir betrachten die Wand, bis Campe das Schweigen unterbricht. »Was … was bedeutet das?«
»Das Zeichen? Keine Ahnung. Das weiß wahrscheinlich niemand außer dem Ringfinger-Mörder selbst. Ich weiß nur, dass es exakt so aussieht wie bei den anderen Tatorten.«
»Ist das … Blut?«, fragt Campe mit brüchiger Stimme und angewidertem Gesicht.
»Das Labor wird mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass es sich um das Blut des Opfers handelt, ja«, sage ich trocken, schlucke schwer. »Er nimmt den abgetrennten Finger seiner Opfer und hinterlässt uns damit diese Botschaft.«
»Und das da unten? Was bedeutet das?«
Ich folge Campes Blick, schüttle irritiert den Kopf. »Sie können doch wohl lesen, oder etwa nicht?«
Er mustert mich abschätzig, starrt dann wieder an die Wand, will etwas antworten, als …
»Polizei Hamburg!«
Aus dem Gang hallt eine Stimme, Campe reckt seinen Kopf in die Richtung, atmet angestrengt aus und trabt los. »Die Kollegen«, murmelt er im Vorbeigehen, aber ich beachte ihn nicht, betrachte nachdenklich den abgetrennten Finger, dann das Wort an der Wand.
Der Killer bleibt sich treu, zieht jedes Mal die gleiche Nummer ab. Zwei blutige Fingerabdrücke, direkt über dem U. Und das Wort … immer und immer und immer wieder dieses Wort.
LÜGENWEIB.
Noah
7 Stunden und 14 Minuten danach
Das Grollen ferner Geräuschwolken dringt in mein Halbbewusstsein. Es vermischt sich mit Mechanischem, Dröhnendem, ich erkenne Getriebe, spüre Beschleunigung. Kräfte drücken mich an Gestänge, ein Schrillen durchschneidet das Grollen und verwandelt sich zu etwas Bekanntem – eine Sirene. Die Geräuschwolke zerfällt in ihre Bestandteile und wird zu Summen, Piepen, Knacken. Ich erkenne immer mehr, höre das Quietschen von Reifen, hupende Autos und dann endlich Stimmen. Erst bloß Silbenklumpen, dann ganze Wörter.
»Gehirnerschütterung«, rollt es über mich herein. »Nasenbeinfraktur, distale Fraktur Mittelfinger links, vermutlich Distorsion Handgelenk, ebenfalls links.«
Steriler Geruch drängt sich mir in die Nase, die Geräusche werden prägnanter, schälen sich aus ihrem wattigen Pelz.
»Kreislauf stabilisiert sich.«
Und plötzlich spuckt mich der Kokon meiner Ohnmacht in die nackte Kälte eines Krankenwagens, Details prasseln auf mich ein. Schläuche, Drähte, Kabel, Gurte, ein Sanitäter in grotesker Pose über mich gebeugt. Was ist passiert?
»Was ist passiert?«, schreie ich automatisch, packe ihn am Arm, aber er windet sich problemlos aus meinem Griff, holt eine Spritze aus einer Schublade.
»Alles wird gut, wir sind gleich im Krankenhaus.«
Ich verstehe nicht, schreie weiter, werfe mit Wortbrocken um mich, während der Sanitäter unbeeindruckt und stoisch gelernte Handgriffe aneinanderreiht. Ampulle zu Spritze. Spritze zu Tropf. Schlauch glattstreifen. Dreißig Sekunden später gleite ich zurück ins Halbbewusste, und sämtliche Eindrücke verflüchtigen sich. Nur ein Gedanke bleibt: das scharlachrote Laken.
Als ich die Augen wieder öffne, erblicke ich eine Triangel aus grauem Hartplastik über mir. Der Krankenwagen ist einem Zimmer gewichen, beige Jalousien tauchen es in gedecktes Licht.
Bin ich wach? Ist das ein Traum?
Wärme durchströmt meine Brust, mein Geist ist träge und matt. Gedanken entstehen und werden augenblicklich davongetragen wie Sand vom Meer. Ich blicke an mir hinab, bewege die Finger und bin gleichzeitig fasziniert und irritiert. Das ist eindeutig mein Körper, mein Arm, meine Hand, aber es fühlt sich an, als wäre ich eine Puppe. Eine ungelenke Marionette, die mein Geist nicht zu kontrollieren vermag.
An meinem Finger zwickt eine Klammer, ich schnippe sie ab. Jetzt erst bemerke ich das rhythmische Piepen, das augenblicklich zu einem durchgehenden Signalton anschwillt. In meiner Halsschlagader setzt ein Trommeln ein, Blut rauscht durch mein Ohr und schießt mir in den Kopf. Eine Tür wird aufgerissen, und mein Zimmer erwacht zum Leben.
Eine Krankenschwester drängt sich in das Halbdunkel meiner Augenwinkel. Bis ich sie fokussieren kann, dauert es ein paar Sekunden. Ihre Bewegungen ziehen Schlieren nach sich, als wäre ihr Körper umhüllt von wallenden Luftwirbeln. Regungslos verfolge ich ihr Tun.
Sie hantiert an mir herum, überprüft den Infusionsbeutel, kneift die Klammer wieder an meinen Finger, hackt auf ein Tablet ein. Aus ihrem Rücken wächst eine weitere Gestalt, ein Arzt, er zückt eine Diagnostikleuchte. Wieder tanzt Licht vor meinen Augen, diesmal ist es aber nur ein gleißender Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Das Licht verschwindet, ich presse die Lider zusammen, flimmernde Tintenkleckse wandern in die Ferne. Als ich die Augen wieder öffne, sind sie verschwunden, und ich sehe den Arzt klar und deutlich vor mir.
Eine imposante Gestalt mit einem groben rotfleckigen Gesicht, dünnen Lippen und buschigen Augenbrauen, aus denen vereinzelt drahtige graue Borsten wuchern. Sein strenger Blick klebt an einem Klemmbrett, während er mich befragt. »Können Sie mich hören?«
Ich nicke.
»Wie fühlen Sie sich?«
»Schwindelig«, will ich sagen, aber Zunge und Lippen sind wie taub, bewegen sich kaum. Trotzdem scheint mich der Arzt zu verstehen.
»Mhm. Wissen Sie, wo Sie sind?«, fragt er, ohne aufzublicken, beantwortet seine Frage jedoch im nächsten Moment selbst. »Sie sind in der Eppendorfer Universitätsklinik, ich bin Doktor Reders, Ihr behandelnder Arzt. Sie haben eine Nasenbeinfraktur sowie eine Kiefergelenkdistorsion, dazu noch eine Rissquetschwunde an der linken Ohrmuschel, eine Stichwunde im Bereich des Schlüsselbeins, gebrochene Fingerknöchel, eine Prellung der Regio scap…«
Der Doktor linst über das Klemmbrett und verstummt. Seine Augen lesen in meinen. Er scheint zu verstehen, dass ich nichts verstehe.
»Hören Sie«, schnauft er und lehnt sich gegen die Bettkante. »Sie haben ganz schön was abbekommen; aber nichts, was wir nicht wieder hinkriegen. Der Schwindel kommt von der Gehirnerschütterung, auch die Lichtempfindlichkeit. Vielleicht wird Ihnen übel, und Sie können sich nicht mehr an alles erinnern, aber das ist ganz normal, die Erinnerungen kommen wieder, keine Sorge.«
»Keine Sorge«, wiederhole ich monoton, diesmal mit einem etwas gelenkeren Zungenschlag. Ich glaube, ich lächle ihn an, denn er lächelt zurück, doch als plötzlich die Tür aufschwingt, verfinstern sich seine Gesichtszüge sofort wieder.
Ein junger Streifenpolizist stürmt herein, baut sich vor mir auf, und noch ehe der Arzt und die Krankenschwester reagieren können, redet er auf mich ein, ohne sich auch nur vorzustellen. »Hallo, verstehen Sie mich? Können Sie mir sagen, was letzte Nacht passiert ist?«
»Also, hören Sie mal«, protestiert Doktor Reders und stellt sich ihm in den Weg. »Der Patient ist gerade erst erwacht. Er braucht absolute Ruhe, mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen!«
Der Polizist ignoriert ihn, redet einfach weiter auf mich ein. »Wer hat Sie angegriffen? Können Sie den Täter beschreiben? Waren es eine oder mehrere Personen?«
Der Fragenkanon prasselt auf mich nieder, trifft mich wie eine Gewehrsalve. Automatisch verkrieche ich mich in mir selbst, möchte in ein dunkles Loch, Deckel zu, aus. Was wollen die alle von mir? Warum sagt mir keiner, was hier los ist? Wieso hilft mir niemand, wo ist …
Schlagartig bin ich hellwach. »Wo ist meine Frau?«, frage ich in den Raum hinein.
Mit einem Mal ist es still, der Polizist sieht mich irritiert an.
»Ich will mit meiner Frau sprechen, holen Sie meine Frau!«, sage ich, diesmal an den Polizisten gewandt.
Der macht keine Anstalten, das Zimmer zu verlassen, steht einfach nur da. Sein Adamsapfel tritt hervor, als würge er ein riesiges Stück Trockenfleisch hinunter.
Die Anspannung überträgt sich auf mich, das Piepen des EKG-Geräts wird unruhig. »Was ist los? Ist was passiert? Wieso holen Sie nicht meine Frau?«
Der Polizist vergräbt seinen Blick jetzt in seinem Notizblock, presst die Lippen zusammen. Er scheint nachzudenken. Sekundenlang. Dann baut er sich wieder vor mir auf, breitbeinig, mit ineinandergefalteten Händen, fixiert einen Punkt neben meinem Kopf und spricht, als wäre er ein Roboter. »Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Frau tot aufgefunden wurde.«
Elias
9 Stunden und 5 Minuten danach
Die Kollegen treffen nach und nach ein. Normale Streifenpolizisten, Forensiker, die Jungs vom Erkennungsdienst, die übliche SpuSi-Truppe. Die meisten haben schon einige Jahre Erfahrung in den Knochen, Leichen gehören zu ihrem Alltag. Kalt lässt das hier trotzdem keinen. Jeder Einzelne bleibt im Türrahmen zum Schlafzimmer stehen, tritt einen Schritt zurück, ringt um Fassung. Die einen brauchen bloß eine Sekunde, die anderen ein paar mehr, je nachdem, wie viel sie schon gesehen haben – irgendwann gewinnt die Routine, und sie arbeiten einfach weiter, machen ihren Job. Aber niemanden lässt das hier unberührt. Man härtet ab, klar, aber man gewöhnt sich nicht daran, niemals.
Tatorte wie diese machen besonders betroffen. Es liegt nicht so sehr an der brutalen Unmenschlichkeit, mit der das Opfer abgeschlachtet wurde – in Hamburg gibt es genug Junkies, die auf irgendeinem irren Trip den Jackson Pollock geben und die Wände ihres Sozialbaukäfigs mit dem Blut ihrer Mitbewohner streichen. Es ist vielmehr die Umgebung. Das Opfer hängt nicht zerquetscht zwischen einem Motorblock und einer Fahrerkabine am Rande einer dunklen Landstraße. Es liegt nicht im kalten Licht einer Leuchtstoffröhre am Boden irgendeiner Raststättentoilette oder treibt mit dem Rücken nach oben im Auffangbecken einer Kläranlage. Die Leiche ist an keinem neutralen Ort. Sie ist zu Hause, in den eigenen vier Wänden, umgeben von Bildern, auf denen sie noch keine Leiche war, sondern Familienvater, Tochter, Sohn oder wie in diesem Fall: eine bildhübsche junge Frau. Leben und Tod im selben Raum – das ist die Tragödie.
Dort drüben im Ankleideraum hat sie sich angezogen, da war ihr Schminktisch, da hat sie ihre Yoga-Übungen gemacht, und hier liegt sie jetzt, abgeschlachtet mit sieben Messerstichen, gebrandmarkt als das Opfer eines Serienmörders, der schon drei weitere Frauen auf dem Gewissen hat und immer noch auf freiem Fuß ist.
Der Polizeifotograf stellt sein Stativ auf, nimmt den entstellten Körper in den Fokus, im Hintergrund das Hochzeitsbild auf dem Nachttisch – es ist eine Schande. Ich betrachte die Aufnahme eine Zeit lang. Das Opfer war eine umwerfende Braut mit perlmuttfarbenem Kleid und gletscherblauen Augen, die ihren Mann anleuchten, als gäbe es nur ihn auf der Welt. Ihr Mann …
Ich springe auf, kämpfe mich durch die Reihen der Spurensicherer. Campe lehnt am Geländer im Treppenhaus und atmet schwer. Heute ist nicht sein Tag.
»Wir müssen den Ehemann verständigen.«
»Zu spät«, schnauft er verächtlich. »Das hat der Täter bereits übernommen.«
Diesmal bin ich es, der irritiert ist. »Wie meinen Sie das?«
Campe spuckt aus, erhebt seinen massigen Körper und nimmt wieder Haltung an. »Der Mann lag am Boden, in der Küche«, antwortet er gereizt. »Er hat einiges abbekommen, aber er lebt. Die Sanitäter haben ihn abtransportiert, bevor Sie gekommen sind.«
»Es gibt einen Zeugen?«, fahre ich ihn an, kann es nicht fassen, dass er erst jetzt mit dieser Information herausrückt.
»Keine Ahnung, er war nicht vernehmungsfähig, aber ja, wahrscheinlich schon. Ich habe Bernd hinterhergeschickt, er soll ihn im Krankenhaus befragen.«
Meine Kehle ist plötzlich so trocken wie Asche, ein Schaudern läuft mein Rückgrat hinunter, breitet sich aus und fährt mir bis in die Fingerspitzen. Doch es ist keine Angst, die diese Reaktion hervorruft. Es ist Euphorie.
Der Ringfinger-Mörder hat drei, jetzt vier Frauen auf dem Gewissen, vier unschuldige Opfer, die sterben mussten. Niemand weiß, warum. Niemand konnte ihn schnappen. Und noch nie gab es einen Zeugen.
Bis jetzt.
Vorgestern vor genau drei Wochen ist es passiert. Es war ein ganz normaler Tag, ein Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Der Laden war halb leer wie meistens um die Uhrzeit, nur ein paar Jugendliche bei den Spielkonsolen, Senioren in der Haushaltswarenabteilung und die üblichen Herumstreuner, die bloß vor dem Wetter ins Warme geflüchtet sind. Seit Tagen hatte kein einziger Sonnenstrahl den nasskalten Boden Hamburgs berührt, kollektive Schwermut hing über der Stadt wie die bleiernen Nebelschwaden, aus denen sie entsprang.
Aber dann kamst du.
Du bist in den Laden getanzt wie eine Artistin zu Beginn einer Varietéshow – alle Blicke waren dir sicher. Natürlich hattest du kein Kostüm, keine Fanfaren, keine wilden Tiere an deiner Seite, aber das war auch nicht nötig. Alles, was du brauchtest, waren dein Lächeln und deine Stimme. Du hast telefoniert, ich weiß bis heute nicht, mit wem. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was du gesagt hast. Deine Stimme – dieser hinreißende Sopran – und dein Lachen haben gereicht, und sofort war die Welt eine andere.
Für dich waren es nicht die grauen Teppichschluchten eines Elektrofachmarktes, sondern die grünen Heckenlabyrinthe eines prunkvollen Lustgartens. Du bist scheinbar ziellos durch sie hindurchgeschlendert, als hättest du alle Zeit der Welt. Bis du irgendwann doch da warst, wo du hinwolltest.
Ich habe mich sofort unsterblich in dich verliebt. Und ich wusste sofort, dass du keine Ahnung von Smartphones hattest. Wie du sie in die Hand genommen hast, mit spitzen Fingern, als wären es rätselhafte Apparate aus einer fernen Galaxie. Bis dahin hatte ich gar nicht bemerkt, dass du die ganze Zeit über in ein altmodisches Nokia-Teil gesprochen hast. Allen anderen Personen deines Alters würde man sofort eine aufgesetzte Schrulligkeit bescheinigen, aber bei dir wirkte es wie das Natürlichste auf der Welt. Das war mir auf Anhieb sympathisch.
Und so lernten wir uns kennen, ich denke oft daran. Seitdem haben wir viel gemeinsam unternommen, sind herumgekommen in der Stadt. Die Restaurantbesuche, der Spaziergang im Park, diese unfassbar langweilige Warhol-Ausstellung im Museum für moderne Kunst, dann der Flohmarkt, wo mir irgend so ein Punk ausgerechnet einen schwarzen Kratzer in den Lack meines inkaorangen BMWs gemacht hat, der Nachmittag in der Bücherei – wir hatten wirklich viel Spaß zusammen.
Und jetzt sind wir wieder hier, im Shoppingcenter, ausgerechnet. Ich hasse diesen Konsumtempel, meide ihn wie die Pest, aber du bist gerne hier, besonders in den Modeläden. Du lässt deinen Blick über die Kollektionen schweifen, befühlst Stoffe, probierst, kokettierst, gibst viel Geld aus. Und ich stehe da und staune. Mein Verständnis von Mode ist begrenzt, ich habe kein Auge für Farben, Muster oder Schnitte, aber ich erkenne, dass du eines hast. Du hast eine Gabe, meine Schöne, ein besonderes Talent. Ich bewundere das.
Was ist das? Dieser Blick, diese Signale! Könnte es sein … dass wir gar nicht wegen der Kleider hier sind?
Du verschwindest alleine in Richtung Umkleiden, doch ich soll dir folgen, habe ich recht? Du hast es nicht gesagt, aber deine Augen verraten es mir, ich kann darin lesen. Du spielst ein kleines Spielchen, nicht wahr?
Ich gehe dir nach, zu den Umkleiden. Fast alle sind belegt, mein Blick wandert die Säume der Vorhänge ab und bleibt bei deinen cognacfarbenen Stiefeletten hängen. Sie stehen bewusst da. Du willst, dass ich weiß, wo du bist.
Ich starre auf den Vorhang. Ein millimeterdünner Stoff hängt zwischen mir und deinem halb nackten Körper, der gerade in das hautenge Abendkleid gleitet, das du vorhin so kritisch beäugt hast. Es steht dir sicher hervorragend. Der Vorhang schließt nicht richtig, er steht einen Spaltbreit offen, drei oder vier Zentimeter – genug, um mir Einblicke zu gewähren. Du kleines Luder, es ist so offensichtlich. Du willst, dass ich dich sehe. Zuerst reckst du mir deinen Hintern entgegen, präsentierst ihn regelrecht, lässt mich wissen, welches Höschen du trägst. Dann dieses Spiel mit deinem Spiegelbild, die Posen, in die du dich wirfst. Ich spüre, wie meine Lust anschwillt.
Ich stelle mir vor, wie ich den Vorhang einfach zur Seite schiebe und zu dir in die Kabine trete. Du schreist nicht, keinen Laut gibst du von dir, weil du mich erwartest – du wartest schon lange auf mich, nicht wahr? Du tust zwar erschrocken, atmest schneller, presst deinen Körper an die Wand, aber das ist keine Angst. Das ist Erregung. Ich strecke meinen Arm aus und streiche dir über die Wange, während du mich anfunkelst wie eine Raubkatze. Wir sprechen nicht, sagen kein Wort, das ist nicht nötig. Deine Zungenspitze tippt gegen die Schneidezähne, deine stummen Lippen formen verräterisch: Liebe mich!
Mein Finger, er wandert. Deinen Hals entlang, über dein Schlüsselbein, deinen BH, die feinen Härchen um deinen Bauchnabel – ich taste mich weiter, immer weiter, spüre die Hitze in dir hochsteigen, dein Zittern. Du bist bereit, willst unbekannte Wege gehen, neue Lippen schmecken, deine Fingernägel in fremdes Fleisch bohren. Aber du hast Angst, solche Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Schöne. Niemand beobachtet uns. Wir sind ganz alleine, nur du, ich und mein Finger, der immer weiter hinabwandert, über den filigranen Saum deines Höschens.
Ich berühre sie nicht, nein, nein, keine Sorge. Ich bin nicht einer dieser Typen; kein Mann, der sich einfach nur nimmt. Ich will, dass du bereit dazu bist. Will, dass du es willst, dass du danach verlangst, meine Hand packst und dahin führst, wo du sie haben musst. Deine Schenkel, sie beben. Die Muskeln krampfen, die Pupillen flirren, aber ich spüre genau, dass du mich aufnehmen willst, meine Schöne. Deine Lust rinnt über meine Finger, alles, was ich tun muss, ist …
»Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen?«, ertönt plötzlich eine quäkende Stimme hinter mir, und ich blicke in die Schweinsaugen einer fetten Verkäuferin. »Dahinten wäre eine Kabine frei. Wie viele Kleidungsstücke?«
DU VERDAMMTE FOTZE, MERKST DU NICHT, WIE SEHR DU STÖRST? Sie merkt es nicht. Sie hat absolut kein Feingefühl, trampelt einfach auf unserem kostbaren gemeinsamen Augenblick herum. Es hilft nichts, ich muss nachgeben, meine Schöne. Wenn die Verkäuferin bemerkt, dass ich hart geworden bin, wird sie Alarm schlagen, das darf ich nicht zulassen. Also gehe ich in die Kabine, starre auf den hässlichen Pullover, den ich mir zur Tarnung mitgenommen habe, und versuche, mich zu beruhigen, meine Erregung abschwellen zu lassen.
Alles ist gut. Wir haben alle Zeit der Welt. Vorgestern vor genau drei Wochen haben wir uns kennengelernt. Es ist eine kleine Ewigkeit, ich weiß. Aber ich kann warten, meine Schöne, und wenn es noch mal so lange dauert – egal. Der Tag wird kommen, und wir werden eins sein, da bin ich mir sicher.
Todsicher.
Elias
9 Stunden und 55 Minuten danach
Zurück im Schlafzimmer versuche ich, die Kollegen in den weißen Overalls auszublenden. Es gibt einen Zeugen, er hat einen Fehler begangen. Vielleicht ist ihm noch ein zweiter unterlaufen. Ich beuge mich über den Leichnam und betrachte die Stichwunden. Sie sind identisch mit denen der vorigen Opfer, so viel steht fest. Ich habe zwar die Fotos der früheren Tatorte nicht dabei, aber Bilder wie diese vergisst man nicht.
Fast alle Stiche sind sauber und kontrolliert ausgeführt. Keine Läsionen der Umgebung, kein ausgefranstes Gewebe – das Opfer hat sich demnach nicht mehr gewehrt, war also mit ziemlicher Sicherheit bereits tot. Es gibt wie immer nur eine unsaubere Einstichstelle: am Hals – so tötet er sie. Man erkennt an den Wundrändern, dass die Opfer noch leben. Sie winden sich, kämpfen gegen das Unabwendbare, bäumen sich ein letztes Mal auf. Bis auch die letzte Kraft aus ihren Gliedern weicht. Dann erst setzt er sein grausames Werk fort. Augen, Brüste, Bauch, Unterleib. Er schlachtet seine Opfer, sticht auf sie ein wie ein Wahnsinniger, aber führt das Messer wie ein Chirurg. Es ergibt keinen Sinn. Es hat noch nie einen Sinn ergeben.
Erneut begutachte ich die Stiche, bleibe am Hals hängen. Du warst schlampiger als sonst. Bist du abgerutscht? Hast du dich verletzt? Die Wunde ist breiter, ausgefranster, die Hautpartien sind fast schon zerfetzt.
»Dieser Bereich muss genauestens fotografiert werden«, sage ich zu irgendeinem x-beliebigen Mann neben mir, der jedoch sofort zurückkeift.
»Seh ich aus wie ein Scheißfotograf?«
Verärgert blicke ich auf und in ein bekanntes Gesicht: Kommissar Dorn. Seine Mutter muss ihm zu lange den Schnuller gelassen haben, man sieht ihn nie ohne Fluppe zwischen den Lippen, und wenn Rauchen verboten ist, nuckelt er an seinem »Silberpfeil«, wie er ihn nennt. Ein ziemlich spitzer Metallzahnstocher, von dem jeder hofft, dass er ihn sich eines Tages durch die Kehle rammt. Hinter ihm taucht Köpke auf, die beiden gibt es nur im Doppelpack. Böse Zungen behaupten, weil Köpke alleine nicht einmal aus der Polizeiparkgarage finden würde.
»Was wollen Sie überhaupt hier?«, fährt mich Dorn an, sein Zahnstocher bebt bei jedem Wort. »Ist hier irgendwo ein Sparschwein abhandengekommen? Hm? Sieht das hier wie ein Einbruch aus?«
»Ich war gerade in der Gegend«, antworte ich kühl und schiele an ihm vorbei zu Campe, der mittlerweile seine Fassung wiedergefunden hat und unnütz im Weg herumsteht. »Und dann bin ich zufällig hier hereingestolpert.«
»Zufälle gibt’s …«, leitet Dorn ein.
»… die gibt’s gar nicht«, schließt Köpke ab. »Und jetzt raus hier, oder haben Sie schon vergessen, dass Sie nicht mehr bei der Mordkommission arbeiten?«
Mit zusammengekniffenen Augen funkle ich die beiden an. Mehr kann ich nicht tun, denn sie haben recht. Seit meiner Strafversetzung in die Abteilung für Eigentumsdelikte habe ich auf solchen Tatorten nichts zu suchen. Für den Moment bleibt mir also nichts anderes übrig, als nachzugeben.
»Wie Sie meinen.«
»Wie Sie meinen«, äfft mich Dorn nach und bugsiert mich unsanft zur Seite. Ich muss sofort zum Präsidium. Auch wenn die Chance verflucht gering ist – ich muss einfach versuchen, Teil der Einsatzgruppe zu werden. Ich muss.
Als ich schon mit einem Bein zur Tür hinaus bin, vibriert es hinter mir. Jeder fasst sich automatisch an die Hosentaschen, aber schüttelt nur den Kopf. Wahrscheinlich denken alle im Raum exakt das Gleiche: Irgendwo hier läutet ein Handy – vielleicht gehört es dem Täter. Suchende Blicke wandern durch die Wohnung, Hände rücken Polster zur Seite, öffnen Schubladen, heben Zeitschriften an. Bis plötzlich …
»Linus Campe, Polizei Hamburg, mit wem spreche ich?«
Alle Augen starren auf den bulligen Kollegen in der Küche. Schweiß steht ihm auf der Stirn, während er vor sich hin stammelt. »Nein … Sie ist … Ich bin … Entschuldigen Sie bitte.«
Mit einem Satz stehe ich neben ihm, im nächsten Moment schießt Köpke um die Ecke, rutscht beinahe auf den Fliesen aus. Beide hampeln wir wie Kasper vor Campe, drängen ihn stumm, das Telefon abzugeben.
Endlich scheint er zu verstehen. »Warten Sie kurz«, formuliert er seinen ersten geraden Satz ins Telefon und umschließt dann das Mikrofon mit seiner fleischigen Hand.
»Ich … ich verstehe das nicht«, stottert er los und sieht mich mit großen Augen an. »Der Mann will seine Frau sprechen. Wie viele Männer hatte die denn?«
Noah
10 Stunden und 8 Minuten danach
Mein Körper liegt im Bett, ich liege neben mir. Meine Augen starren geradeaus, auf den Arm mit dem Patientenband, aber ich sehe durch ihn hindurch. Ich höre den Arzt keifen, den Polizisten stammeln, die Krankenschwester beschwichtigen, doch ich verstehe sie nicht, mein Gehirn kann die Informationen nicht verarbeiten. Ich bin begraben unter einer meterdicken Schicht aus Apathie.
Meine Frau ist tot.
Ich muss schlafen.
Ich muss einfach nur schlafen, tief und fest.
Schlafen, bis ich aufwache und alles vorbei ist.
Aber ich kann es nicht. Mein Körper pocht, die Leute um mich herum streiten, Tageslicht strahlt durch die Jalousie und blendet mich. Was ist passiert? Warum ist sie tot? Ich versuche, einen klaren Kopf zu bekommen, aber die Gedanken sind wirr und zäh und lassen sich nicht greifen. Ich muss rückwärts vorgehen, geordnet, strukturiert.
Der Polizist: Ihre Frau ist tot. Der Arzt: Alles wird gut. Der Sanitäter: Wir bringen Sie ins Krankenhaus. Die Wohnung, das Licht, das viele Blut. Was ist passiert? Denken, denken, ich muss denken.
Mein Name ist Noah, meine Mutter heißt Ella, mein Vater Gustav, aber er lebt nicht mehr. Ich bin Einzelkind und hatte einen Hund, den ich geliebt habe, und einen Goldfisch, den ich gehasst habe. Wir haben in Aschaffenburg gewohnt – meine Mutter wohnt immer noch dort, ich bin aus Aschaffenburg hierhergezogen, genau. Ich bin 37 Jahre alt, ich lebe in Hamburg, mit meiner Frau, im Heinsweg 18. Wir mögen die Gegend, aber die Wohnung nicht. Wir lieben die Berge, aber hassen wandern. Wir haben die ›Hamburger Morgenpost‹ abonniert und vergessen immer wieder, sie abzubestellen. Wenn uns langweilig ist, imitieren wir Filmcharaktere, und Rocky kann ich am besten, ich bin Noah …
Eine Fliege reißt mich aus meinen Gedanken, als sie auf meinem Daumen landet und sich die Beine reibt. Ich bewege mein Handgelenk, sie fliegt davon, und mein Blick wandert wieder zurück, fokussiert das Patientenarmband.
»Sie ist nicht tot!«, rufe ich plötzlich aus und strecke dem Streifenpolizisten meinen Arm entgegen.
»Ich bin Noah Klingberg, das hier ist nicht mein Name!«
Er blickt mich irritiert an, zögert, kommt dann aber näher und liest mit zusammengekniffenen Augen den Namen von meinem Band ab.
»Sie sind nicht Paul Falk?«, fragt er mit unsicherer Stimme, doch ich bin nicht imstande zu antworten. Denn jetzt fällt mir alles wieder ein.
Mein Name ist Noah Klingberg. Ich bin 37 Jahre alt, ich wohne in Hamburg. Meine Frau lebt.
Aber Emma ist tot, und es ist meine Schuld.
Linda
10 Stunden und 11 Minuten danach
Der Tag zieht an meinen Augenlidern. Ich wälze mich von links nach rechts, wehre mich gegen das Aufwachen. Mein linker Arm wandert auf seine Seite des Bettes und ertastet bloß ein kaltes Laken. Er ist schon wach? Es hilft nichts. Ich muss aufstehen. Und aufstehen bedeutet kämpfen.
Sobald ich das Schlafzimmer verlasse, kann ich mich nicht mehr hinlegen, denn aus der Küche wird es nach Tee und Brötchen duften, vielleicht liegt die Zeitung auf dem Tisch, und er hat frische Blumen besorgt. Ich werde aus dem Badezimmer kommen, er wird seinen Laptop zuklappen, mich mit seinem Dackelblick ansehen und sagen: »Guten Morgen, Schlafmütze, schöne Träume gehabt?« Und ich werde müde lächelnd nicken und mich an den Tisch setzen. Das Frühstück steht sicher schon bereit, Sojajoghurt mit Früchten, Dinkelbrötchen, mein veganer Aufstrich, Kräutertee. Er wird aus der Zeitung vorlesen oder irgendeine Anekdote erzählen, die er beim Bäcker aufgeschnappt hat, und ich werde nicken, aber nicht zuhören.
Denn ich bin in mir, Lagebesprechung. Pläne schmieden, Strategien entwickeln: Wie bekomme ich die nächsten Stunden rum, ohne in einen Weinkrampf zu verfallen? Wie rette ich mich vor diesem einen Gespräch? Seinem mitleidigen Blick, den herabhängenden Schultern. Er weiß, dass es so weit sein müsste, kennt die Daten mittlerweile genauso gut wie ich, versteht, was die roten Kringel im Kalender bedeuten, die blauen …
Aber er wird es nicht ansprechen. Noch nicht. Er wird bloß seinen treuherzigen Hundeblick aufsetzen, irgendetwas Harmloses fragen wie: »Möchtest du noch Orangensaft?« Oder: »Wie ist der Joghurt? Noch ein bisschen Honig dazu?« Und ich werde irgendetwas murmeln, aber innerlich schreie ich: ES IST MIR EGAL, WIE DER JOGHURT SCHMECKT! ICH BIN SCHON WIEDER NICHT SCHWANGER! Und eine Sekunde später wird eine andere innere Stimme zurückschnauzen. Wie kannst du nur! Du bist schuld! Er kann doch nichts dafür! Er meint es doch nur gut! Es ist wie vorprogrammiert. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, auch jetzt.
Ich liege wach im Bett und traue mich nicht hinaus, weil der Mann, den ich liebe, mit Frühstück auf mich wartet – das ist doch bekloppt. Ich muss mich zusammenreißen, Schluss, aus, ich stehe jetzt auf.
Leise husche ich ins Bad, schließe geräuschlos die Tür hinter mir, drehe behutsam den Schlüssel im Schloss. Er scheint mich nicht bemerkt zu haben, gut. Ich brauche noch einen Moment für mich alleine, um dem Tag zu begegnen.
Kritisch betrachte ich mein Spiegelbild, graublaue Augen stieren matt und müde zurück. Ein schwaches Lächeln zieht an meinen Mundwinkeln und schneidet winzige Fältchen in meine blasse Haut. Ich streife den Schlafanzug ab und mustere meinen Körper. Schmale Arme, kaum Busen, kein Arsch – absolut flach. Meine Beine sind zwei dürre Pfähle, die ein hageres Konstrukt aus Haut und Knochen balancieren. Kein Wunder, dass in so einem Körper kein Leben heranwachsen kann.
Früher haben sie mich um meine Figur beneidet, zumindest in der Schule. Einmal hätte ich mich sogar fast bei einem Model-Wettbewerb angemeldet – warum habe ich das damals eigentlich nicht gemacht? Ich denke mir heute noch manchmal: Kämmt mich, schminkt mich, hängt mir irgendeinen teuren Fetzen um den Leib, und ich laufe bei der Pariser Fashion-Week unbemerkt neben all den anderen traurigen Hungerhaken her. Ein Schmunzeln huscht über meine Lippen. Abrupt richte ich mich auf, werfe mich in verschiedene Posen, blicke übertrieben lasziv in den Spiegel, zucke aber sofort wieder zusammen. Stiche durchbohren meinen Unterbauch, erinnern mich schmerzhaft daran, weswegen ich Modelmaße habe. Ich würde sie sofort gegen eine Mama-Figur eintauschen. Cellulite, Schwangerschaftsstreifen, Schlabberhüften, Hängetitten, egal – ich nehme alles in Kauf, Hauptsache, ich bekomme dafür ein Baby.
Es vergehen einige Sekunden, bis ich mich dazu aufraffen kann, meine morgendliche Routine zu beginnen. Ich spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht, entferne die Ohropax aus meinen Ohren, will sie wie immer abspülen, halte inne. Was ist das für ein Lärm?
»Schatz!«, rufe ich, aber niemand antwortet.
Barfuß tapse ich aus dem Bad, durch den Flur in die Küche und starre aus dem Fenster. Unten stehen Dutzende Einsatzwagen, Blaulicht tanzt über die schimmernden Fassaden. Die Straße ist abgesperrt, Polizisten strömen in unser Haus, andere kommen heraus. Ängstlich laufe ich durch die Wohnung, schaue in jedes Zimmer.
»Schatz? Schatz, wo bist du?«
Er ist nicht hier. Draußen auf dem Gang werden Stimmen laut, ich haste zur Eingangstür, reiße sie auf und will wieder »Schatz« rufen, aber das Wort bleibt mir im Halse stecken.
Gegenüber steht ein großer, dürrer Mann im Türrahmen der Nachbarn. Als er mich bemerkt, stakst er auf mich zu und hält mir einen Ausweis vors Gesicht.
»Elias Blom, Kriminalpolizei. Suchen Sie jemanden?«
Elias
10 Stunden und 43 Minuten danach
Als sie zu mir in den Wagen steigt, werfe ich einen prüfenden Blick in den Rückspiegel. Niemand ist ihr gefolgt, Köpke und Dorn haben offenbar nichts mitbekommen. Dann fällt mein Blick auf ihre Socken. Links weiß, rechts beige. Den Pullover trägt sie verkehrt herum, die Frisur ist struppig. Ein schwaches Lächeln zeichnet meine Lippen, verschwindet aber sofort wieder.
»Fahren Sie«, faucht sie mich an, obwohl die Beifahrertür noch offen steht. »Na los!«
Ich nicke, verkneife mir den Hinweis, dass sie sich anschnallen soll, und steige aufs Gaspedal. Gleich nach der ersten Kurve bremst uns eine rote Ampel.
Sie protestiert. »Haben Sie kein Blaulicht?«
»Doch, aber ich darf es nicht anmachen. Das hier ist kein Notfall.«
»Kein Notfall?«, bellt sie zurück, mit weit aufgerissenen Augen. »Mein Mann liegt im Sterben, und das ist kein Notfall?«
»Ihr Mann liegt nicht im Sterben, Frau Klingberg. Er ist verwundet, aber man hat mir telefonisch versichert, sein Zustand sei stabil«, antworte ich beschwichtigend.
Es vergehen einige Sekunden, die Häuser ziehen an uns vorbei, wir schweigen. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, wie die Spannung nach und nach aus ihrem Körper weicht und ihre Augen glasig werden. Mit der linken Hand taste ich das Fach der Fahrertür nach einer Packung Taschentücher ab.
»Es tut mir leid … ich bin nur, ich kann mir nicht erklären … Was hat er nur da drüben gemacht?«, murmelt sie beinahe unverständlich in sich hinein und lehnt die Stirn gegen die kalte Scheibe der Beifahrertür. Aber nur kurz, eine Sekunde später reißt sie den Kopf zurück und presst beide Hände an die Stirn, als ob sie Angst hätte, ihr Hirn könnte erfrieren.
»Ist schon gut, ich verstehe das«, versuche ich sie zu beruhigen, als plötzlich ein Alarm losgeht.
Fluchend wühlt sie in ihrer Handtasche, drischt auf ihr Smartphone ein und holt dann etwas hervor, das mich überrascht. Solche Tablettenboxen kenne ich sonst nur aus Altenheimen, meine Großmutter hatte auch so eine. Pro Tag ein Fach voll bunter Pillen, fein säuberlich geordnet. Aber ihre Box ist leer. »Verdammt«, flucht sie und legt ihren Kopf in den Nacken.
Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, sage das Erste, was mir durch den Kopf geht. »Keine Sorge, im Krankenhaus haben die sicher etwas zur Beruhigung.«
»Nein, das sind …«, setzt sie an, überlegt es sich jedoch anders, seufzt. »Da waren bloß Nahrungsergänzungsmittel drin. Aber ich hab sie vor ein paar Tagen versehentlich ausgeschüttet und … ach, egal.« Sie verstummt und wendet sich ab, starrt lethargisch aus dem Fenster.
Eigentlich wollte ich die Autofahrt nutzen, um sie zu befragen, aber in Anbetracht ihres Zustandes scheint mir das keine gute Idee. Aber wir sind ohnehin gleich da.
Als wir im vierten Stock der Universitätsklinik aus dem Fahrstuhl treten, bemerke ich den Streifenpolizisten von vorhin sofort, meine Begleitung ebenso. Sie stürmt auf ihn zu, er will sie noch aufhalten, aber da ist sie auch schon an ihm vorbei ins Zimmer. Verwirrt glotzt er ihr hinterher, dann auf mich.
»Alles in Ordnung, äh … Bernd, richtig? Die gehören zusammen«, sage ich mit fester Stimme und blicke dabei ins Zimmer.
Da liegt er, Noah Klingberg, der wohl einzige Mensch, der den Ringfinger-Mörder je gesehen hat und noch lebt. Endlich haben wir einen Augenzeugen. Der Atem des Streifenpolizisten neben mir riecht noch immer sauer, vorschriftsmäßig betet er seinen Rapport herunter, ich höre ihm gar nicht zu. Mein Blick haftet auf dem Paar, das sich weinend in den Armen hält. Klingbergs Kopf liegt kraftlos auf der Schulter seiner Frau, als wäre er zu schwach, ihn aufrecht zu halten. Ihr Gesicht ist zum Fenster gerichtet, seines mir zugewandt. Er ist übel zugerichtet.
Mir bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit, bevor Dorn und Köpke hier aufkreuzen. Ich muss ihn so schnell wie möglich befragen.
Ich betrete das Zimmer, ziehe mir einen Stuhl heran und setze mich an das Fußende von Klingbergs Bett.
Er bemerkt meine Anwesenheit und mustert mich irritiert. Ich lächle sanft, warte einen Augenblick, räuspere mich dann. Irgendwann tippt er seiner Frau auf die Schulter und richtet sich auf.
»Guten Tag, mein Name ist Elias Blom, Kripo Hamburg.«
»Noah Klingberg«, antwortet er mit erstickter Stimme, während sich seine Frau die Tränen aus den Augenwinkeln wischt.
»Ich weiß, das ist alles sehr schwer für Sie, und es tut mir leid, dass ich Sie so schnell damit überfallen muss, aber Sie werden sicher verstehen, dass in so einer Angelegenheit jede Sekunde zählt.«
Er nickt, bewegt seinen Kopf dabei höchstens zwei Millimeter, seine Augenlider beginnen zu zucken.
»Wenn Sie vielleicht einen Augenblick nach draußen gehen könnten …«, wende ich mich an seine Frau, hole mir aber prompt eine Abfuhr ein.
»Sie denken doch nicht ernsthaft, dass ich meinen Mann alleine lasse?«, protestiert sie lautstark, funkelt mich wütend an.
»Ist schon gut, Schatz, alles wird gut«, versucht Klingberg sie zu beruhigen. Vergebens.
»Nichts ist gut, gar nichts. Sieh dich doch mal an! Du brauchst Ruhe!«
Angespannt knirsche ich mit den Zähnen, bohre meine Fingernägel in die Handflächen. Ich habe keine Zeit für langwierige Diskussionen. »Okay, Kompromiss: Sie können bleiben, aber wir machen weiter, in Ordnung?«, schlage ich vor, rede sofort weiter, sodass ihr keine Gelegenheit bleibt, zu widersprechen. »Also, können Sie mir sagen, was gestern passiert ist?«
Noah Klingberg senkt den Blick. Seine Augen werden immer glasiger, Tränen tropfen auf die Bettdecke. Er versucht, sie wegzuwischen, als wären es Krümel.
»Ich wollte doch nur noch schnell die Wäsche aufhängen«, setzt er an, aber ein Heulkrampf nimmt ihm die Stimme. Seine Frau umarmt ihn wieder, beginnt ebenfalls zu weinen, ich blicke betreten zu Boden und versuche, nicht zu ungeduldig zu wirken. Mats hätte gewusst, was in solchen Situationen zu tun ist, mit Menschen war er einfach unschlagbar. Aber ich bin nicht Mats. Also warte ich, unschlüssig. Starre zu Boden und zähle die Sekunden.
Zweieinhalb Minuten später zieht Noah noch einmal die Nase hoch, drückt seinen Rücken durch, nimmt einen Schluck Wasser, räuspert sich.
Und dann erfahre ich endlich, was heute Nacht passiert ist.
Es ist so leicht, fast schon ein Kinderspiel. Die Leute fragen nicht nach, sie schenken Glauben, sind naiv wie kleine Kinder. Alles, was ich tun muss, ist lügen. Paketdienst, bitte aufmachen – ich sage nicht einmal, welche Firma. Trotzdem surrt die Gegensprechanlage, und im nächsten Moment schnappt die Tür auf, und ich bin drin, stehe in deinem Hausflur, blicke auf deinen Briefkasten. Von oben hallt das Krächzen ungeölter Türscharniere durch den Gang. Ich stelle mir vor, wie der Bewohner auf einen Paketboten wartet. Aber ich komme natürlich nicht hoch. Ich bleibe unten stehen, fummle lautstark an den Briefkästen herum, öffne die Eingangstür und lasse sie wieder ins Schloss fallen. Dann bin ich still, kein Laut. Die Tür oben geht zu. Niemand sieht nach, wer da gekommen ist. Niemanden stört es, dass ein völlig Fremder im Haus ist – so unbekümmert sind die Menschen heute. Sie machen es mir leicht.
Ich klappere die Türen ab, entdecke aber nirgendwo Namensschilder. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock – wo bist du, meine Schöne? Im obersten Stockwerk steht eine Stahltür offen, dahinter liegt ein Trockenboden. Niemand da, absolute Stille, perfekt. Ich lasse meinen Blick über die Wäscheleinen streifen. Schweinchenrosa Kindersocken, karierte Hemden, übergroße Shirts mit lächerlichen Sprüchen, ein orangefarbener Trainingsanzug, fast der gleiche Ton wie das Inkaorange meines BMWs. Aber wo sind deine Sachen? Vielleicht diese hier? Die ausgewaschenen Jeans mit den Löchern in der Hose, hast du die nicht letztens getragen, als wir in diesem thailändischen Restaurant waren? Und diese Shirts? Sie kommen mir nicht bekannt vor, aber deine Garderobe ist breit gefächert, und sie könnten dir passen. Dieser Bademantel – hüllst du deinen feuchten Körper nach dem Duschen darin ein? Spannt sich der Stoff an deinem Hintern, wenn du dich hinunterbeugst, um deine Beine einzucremen? Öffnest du ihn manchmal kokett und posierst vor dem Spiegel, wirfst dir Küsse zu und lässt tief blicken, so wie damals in der Ankleide, als du dieses hinreißende Etwas anprobiert hast? Da, dieses Kleid! Jetzt bin ich mir sicher, du hast es doch neulich erst gekauft. Der BH daneben scheint etwas klein, aber diese Spitzen, dieser Duft – er muss deiner sein, er bringt mein Blut zum Kochen. Wie es mich erregt, wie es in mir brodelt, wie er anschwillt, wenn ich nur daran denke. Endlich bin ich dir nahe. Kann den Stoff fühlen, der sich um deine Brüste schmiegt, die ausstaffierten Polster berühren, gegen die sich deine Nippel pressen, wenn du erregt bist oder du frierst.
Ich werde hier auf dich warten, meine Schöne. Werde in der dunklen Ecke kauern und die Minuten zählen, bis du hochkommst zu mir. Wir werden eins sein.
Draußen ist es dunkel geworden, hier drinnen stockfinster. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen, geschweige denn das Ziffernblatt meiner Uhr, aber es muss nach zehn sein, bestimmt schon elf, und du bist immer noch nicht da. Wieso lässt du mich so lange warten, warum machst du das? Willst du, dass ich wütend werde? Willst du mich leiden sehen? Meine Ungeduld wird von Minute zu Minute drängender, sie frisst sich in all meine Gedanken, höhlt mich von innen aus. Aber du lässt mich verdammt noch mal hier oben verrecken.
Da, ein Geräusch. Ein Schlüssel scharrt an einer Tür, ein Riegel schnappt auf, zu, ich weiß es nicht. Versperrst du deine Pforten, oder kommst du zu mir – bist du es überhaupt? Eine Türangel quietscht, ein Schalter wird betätigt, Licht strahlt aus dem Flur herein – jemand kommt hoch, oh Gott, bitte lass es geschehen. Die Geräusche sind nahe, die Schritte auf der Treppe wenige, du kommst aus dem obersten Stockwerk, ich höre es genau. Gleich bist du bei mir, gleich werde ich dir näher sein als jemals zuvor. Zwei nackte Glühbirnen flackern auf, erhellen den Trockenboden spärlich, ein Schatten zeichnet sich ab. Aber er ist kantig und groß, die Bewegungen eckig, das Haar zu kurz. Verdammte Fotze. Du bist es nicht. Du versteckst dich vor mir in deinem Nest, entziehst dich mir!
Ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben, durchatmen, alles ist gut. Ich darf nicht die Nerven verlieren, es wird ein nächstes Mal geben. Es gibt immer ein nächstes Mal. Ich warte einfach, bis dieser Typ seine Wäsche abgenommen hat und verschwindet. Ich komme morgen wieder oder übermorgen. Vielleicht finde ich auch einen anderen Weg, um dir nahe zu sein. Aber was … Was macht dieser Dreckskerl? Er fasst deine Unterwäsche an!