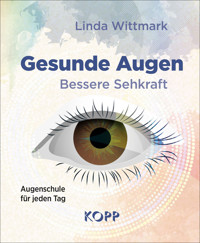
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ihr Ratgeber für lebenslange Augengesundheit!
Unsere Augen sind unsere Fenster zur Welt - doch wie oft schenken wir ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen? Ob Fehlsichtigkeit, trockene Augen oder zunehmende Sehschwäche: Viele Menschen nehmen ihre Sehprobleme einfach hin, ohne zu wissen, dass sie aktiv etwas für ihre Augengesundheit tun können. Mit diesem Ratgeber halten Sie den Schlüssel zu besserem Sehen in Ihren Händen!
Verstehen - Vorbeugen - Verbessern: Die Geheimnisse gesunder Augen
In Gesunde Augen - Bessere Sehkraft erfahren Sie alles über die Anatomie und Funktion des Auges sowie über die häufigsten Sehprobleme - von Kurzsichtigkeit über Makuladegeneration bis hin zu Augenerkrankungen wie grauem und grünem Star. Sie lernen, wie Ernährung, Stress, Bluthochdruck und Diabetes Ihr Sehvermögen beeinflussen - und was Sie dagegen tun können.
Exklusiv: 60-seitiger Sofortplan für bessere Augen
Im Kapitel »Was tun für die Augengesundheit?« stellt Linda Wittmark auf 60 Seiten einen exklusiven Sofortplan vor, mit dem Sie Augenkrankheiten ganzheitlich und effizient vorbeugen und heilen können. Dabei zeigt sie auch, welche Heilkräuter und Nahrungsergänzungsmittel unsere Augen unterstützen.
Doch dieses Buch geht noch einen Schritt weiter: Es bietet Ihnen über 25 praktische Übungen, mit denen Sie Ihre Augen gezielt stärken und trainieren können. Mit speziellen Techniken wie Palmieren, Schärfetraining oder Akupressur lassen sich Fehlsichtigkeiten oft deutlich verbessern - ganz ohne teure Operationen oder dauerhafte Abhängigkeit von einer Brille.
Ihr Weg zu einem klareren Blick - starten Sie noch heute!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. Auflage April 2025
Copyright © 2025 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Satz, Layout und Covergestaltung: Schmieder Media GmbH
ISBN E-Book 978-3-98992-103-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Einführung
EINFÜHRUNG
Unsere Augen sind nicht nur ein wahres Wunder der Natur, sondern auch immens wichtig. Der Gesichtssinn ist unverzichtbar, um unsere Umwelt wahrzunehmen. Können Sie die Straße sicher überqueren oder kommt eine Straßenbahn? Ist der Bürgersteig frei oder liegt vielleicht Sperrmüll im Weg? Ist der Joghurt im Kühlschrank noch haltbar? Doch über den praktischen Nutzen hinweg brauchen wir unsere Augen auch für Freizeitaktivitäten. Statt zu lesen, können wir auf Hörbücher ausweichen – auch wenn es ein ganz anderes Erlebnis ist. Doch wie wollen Sie stricken, fernsehen, basteln oder nähen, ohne sehen zu können?
© Shutterstock: VesnaArt
Der Gesichtssinn ist also von großer Bedeutung für unsere Sicherheit, aber auch unsere Lebensqualität. So läge es nahe, dass wir alles dransetzen, ihn zu bewahren, gar zu stärken. Leider ist genau das Gegenteil der Fall: Unsere Lebensweise, insbesondere unsere Ernährung und falsche Sehgewohnheiten tragen entschieden dazu bei, dass wir mit der Zeit immer schlechter sehen können. Nicht weiter schlimm, sagen Sie jetzt vielleicht. Es gibt doch Brillen, Kontaktlinsen und letztendlich auch Operationen. Das stimmt. Aber diese Hilfsmaßnahmen haben auch Nachteile. Genauso gut könnte man sagen: Ich muss nicht laufen können, es gibt doch Rollstühle. Leider werden wir uns der Bedeutung unserer Augen oft erst bewusst, wenn wir bereits schlecht sehen können. Dabei hängt die Gesundheit unserer Augen mit dem restlichen Organismus zusammen. Wer schlecht sehen kann und sich beim Lesen anstrengen muss, kann Kopfschmerzen bekommen. Andererseits wirken sich auch Erkrankungen wie Diabetes auf die Augen aus.
Umso wichtiger, sich dieser Zusammenhänge bewusst zu werden. Doch nicht nur das: Mit einem geeigneten Lebensstil und Übungen können Sie Fehlsichtigkeit und Augenkrankheiten nicht nur vorbeugen, sondern bereits entstandene Probleme zumindest in einem gewissen Maße wieder rückgängig machen.
Dabei möchte dieser Ratgeber keinesfalls die augenärztliche Betreuung ersetzen. Wenn Sie eine medizinische Behandlung benötigen, dann setzen Sie also bitte keinesfalls von heute auf morgen Ihre Medikamente ab. Aber auch wenn bei Ihnen eine Augenerkrankung vorliegt, können Sie – in Rücksprache mit Ihrem Augenarzt oder Ihrem Optiker – von den Tipps in diesem Ratgeber profitieren.
Im nächsten Kapitel erfahren Sie alles über die Grundlagen. Sie erhalten also einen Überblick über die Anatomie und Funktion der Augen. Darauf folgt ein Kapitel über Fehlsichtigkeit, also Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Hornhautverkrümmungen, die allesamt durch eine Brille oder Kontaktlinsen kompensiert werden können. Weshalb das nicht immer gut klappt, erfahren Sie natürlich auch. Den häufigsten Augenkrankheiten ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet. Dort erfahren Sie alles Wichtige über Grauen und Grünen Star, Makuladegeneration und Co. Vermutlich möchten Sie dann wissen, wie Sie Ihren Augen etwas Gutes tun können. Um dieses Thema dreht sich das darauffolgende Kapitel dieses Ratgebers. Es liefert Ihnen beispielsweise einen Überblick über die wichtigsten Nährstoffe für gesunde Augen. Unter anderem geht es aber auch um Stressreduktion und – ja, es tut mir leid, aber das ist wirklich nötig – Sport.
Das letzte und vielleicht wichtigste Kapitel dieses Ratgebers widmet sich ganz der Praxis, einer Vielzahl an praktischen Übungen, die Sie ohne viel Equipment und Zeitaufwand zu Hause absolvieren können. Neben Übungen nur für die Augen erwarten Sie dabei auch Dehnübungen für den Nacken. Auch wenn die Schulmedizin gesundheitliche Probleme gern getrennt voneinander betrachtet, gehört nämlich vieles zusammen. Mit Augenproblemen gehen Sie zum Augenarzt, mit Nackenschmerzen zum Orthopäden – doch das heißt keinesfalls, dass die beiden Beschwerden nicht zusammengehören.
Dieser Ratgeber möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Sie bekommen das Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen, um sich um die Ursachen Ihrer Augenprobleme zu kümmern. Insbesondere Fehlsichtigkeit, die sonst durch eine Brille oder Kontaktlinsen korrigiert wird, können Sie nämlich durchaus mit geeigneten Übungen langfristig verbessern oder gar ganz heilen.
Anatomie und Funktion des Auges
ANATOMIE UND FUNKTION DES AUGES
Das menschliche Auge ist aus anatomischer Sicht in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt: das innere Auge, das äußere Auge sowie die Augenhöhle mit den Muskeln. Sie alle tragen in einem fein abgestimmten Zusammenspiel zum Gesichtssinn bei, der es uns ermöglicht, Lichtreize wahrzunehmen und in Bilder umzuwandeln. Das äußere Auge umfasst sichtbare Strukturen wie die Hornhaut, die Bindehaut und die Lider, die das Auge vor äußeren Einflüssen schützen und gleichzeitig zur Regulierung des Lichteinfalls beitragen. Das innere Auge beherbergt komplexe Strukturen wie die Linse, den Glaskörper und die Netzhaut, wo Licht in elektrische Signale umgewandelt wird. Diese Signale werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo die eigentliche Bildverarbeitung stattfindet. Die Augenhöhle, auch Orbita genannt, schützt das Auge vor Verletzungen und beherbergt die Augenmuskeln, die präzise Bewegungen ermöglichen, damit wir unsere Umgebung scharf und räumlich wahrnehmen können. Dieses komplexe System macht das Auge zu einem der faszinierendsten Organe des menschlichen Körpers.
© Shutterstock: Jo Panuwat D
Der Aufbau des Auges
Wenn umgangssprachlich vom Auge die Rede ist, dann ist damit zumeist der Augapfel gemeint, also das kugelförmige Organ in der Augenhöhle. Bei einem erwachsenen Menschen hat der Augapfel einen Durchmesser von etwa zweieinhalb Zentimetern. 1 Doch der Augapfel ist kein einheitliches Gebilde und zum Sehen gehören noch weitere Bereiche rund um ihn herum. In seinem Innern ist der Augapfel mit dem sogenannten Glaskörper gefüllt. Er besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Die gelartige Konsistenz hat er Hyaluronsäuremolekülen zu verdanken, die an das Wasser gebunden sind. Sogenannte Kollagenfibrillen, also kleine Verbindungen von Kollagen, verleihen dem Glaskörper Stabilität.
Nach innen hin ist der Augapfel mit der Netzhaut (Retina) ausgekleidet, die den Glaskörper umgibt. Sie ist extrem lichtempfindlich und dient somit der Wahrnehmung von Licht. Obwohl die Netzhaut nur etwa 200 Mikrometer dick 2 ist, besteht sie wiederum aus verschiedenen Schichten 3 . Erkrankungen der Netzhaut, beispielsweise die Netzhautablösung, machen sich schnell durch erhebliche Beeinträchtigungen bemerkbar. An die Netzhaut schließt die Aderhaut an. Nach aktuellem Wissensstand dient sie vor allem der Versorgung des Sehorgans mit Blut und somit Sauerstoff und Nährstoffen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte die Aderhaut auch am Sehvorgang beteiligt sein. Genauere Ergebnisse dazu stehen jedoch noch aus.
© Shutterstock: Blueastro
Umgeben ist der Augapfel von der derben, etwa einen Millimeter dicken Lederhaut. 4 Sie stützt und schützt das Auge. Außerdem setzen an der Lederhaut die Augenmuskeln an, die für die Bewegungen des Auges zuständig sind. Allerdings hat sie zwei »Löcher«: An der Rückseite durchtritt der Sehnerv die Lederhaut, um ins Innere des Auges zu gelangen, zur Körpervorderseite hin wird die Lederhaut von der Hornhaut unterbrochen. Die dünne, durchsichtige Hornhaut besteht aus Kollagen und bildet eine Schutzschicht über der Iris. Ihre Aufgabe ist es, einfallendes Licht zu bündeln und auf die Netzhaut zu übertragen. Außerdem verhindert sie, dass das Auge austrocknet, und dient der Versorgung mit Nährstoffen.
In der Hornhaut befinden sich zahlreiche Nervenfasern. Dadurch ist sie sehr schmerzempfindlich und reagiert sensibel auf Verletzungen. Ist die Hornhaut unregelmäßig gewölbt, sprechen Fachleute von einer Hornhautverkrümmung, in der Fachsprache Astigmatismus genannt. Eine solche Hornhautverkrümmung kann über eine Brille oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden. Insbesondere Kontaktlinsen stellen jedoch auch einen Risikofaktor für Hornhautentzündungen dar.
Unmittelbar unter der Hornhaut befindet sich die vordere Augenkammer. Darin befindet sich Kammerwasser mit Nährstoffen für die Linse und die Hornhaut. Die vordere Augenkammer wiederum liegt über der Regenbogenhaut, auch Iris genannt. Dabei handelt es sich um den Teil des Auges, der unsere »Augenfarbe« bestimmt. Sie enthält nämlich lichtundurchlässige Farbpigmente, da sie wie eine Blende funktionieren muss. Zwei Muskeln in der Iris haben die Aufgabe, die Pupille in der Mitte der Iris, durch die Licht ins Auge fällt, weiter oder enger zu stellen. Die Augenfarbe hängt davon ab, wie viele Farbpigmente (Melanin) gebildet werden. Babys haben zunächst blaue Augen; erst im Lauf des Lebens dunkelt die Iris je nach genetischer Veranlagung nach. Welche Augenfarbe wir letztendlich haben, ist erblich bedingt.
In der Mitte der Iris befindet sich die Pupille. Dabei handelt es sich um eine Öffnung, die Licht ins Auge lässt. Diese Öffnung ist nicht immer gleich groß. Unsere Augen haben die Fähigkeit, sich an die aktuellen Lichtverhältnisse anzupassen: Bei Dunkelheit werden die Pupillen weit, um möglichst viel Licht aufzunehmen. Ist es hell, werden die Pupillen verkleinert. Doch die Weite der Pupillen hängt noch von anderen Faktoren ab. So können Gefühle wie Angst, aber auch Freude dafür sorgen, dass sich die Pupillen vergrößern. In manchen Fällen wird dies sogar augenärztlich herbeigeführt. Das Licht, das durch die Pupille einfällt, wird durch die darunter liegende Linse eingefangen und dann an die Netzhaut weitergegeben. Abhängig davon, ob wir ein nahes oder weit entferntes Objekt fokussieren möchten, kann sich die Linse anpassen.
Um die Linse verläuft ringförmig der Ziliarmuskel durch den sogenannten Ziliarkörper, der das Kammerwasser bildet. Der Muskel ist einerseits dafür zuständig die Linse so einzustellen, dass wir angemessen fokussieren können. Andererseits sorgt er dafür, dass das Kammerwasser abfließen kann und somit der Augeninnendruck im Normbereich bleibt. Zwischen Iris und Glaskörper liegt die hintere Augenkammer. Das darin befindliche Kammerwasser gelangt durch winzige Kanäle auch in die vordere Augenkammer.
Gesteuert wird der Ziliarmuskel vom sogenannten Nervus oculomotorius, der auch das Heben des Oberlids kontrolliert. Beim Oculomotorius handelt es sich um den dritten Hirnnerv. Anders als die meisten anderen Nerven im menschlichen Organismus, die dem Rückenmark entspringen, sind die Hirnnerven auf direktem Weg mit dem Gehirn verbunden.
Die Linse wird von den sogenannten Zonulafasern fixiert. Ist der Ziliarmuskel entspannt, ziehen die Fasern die Linse »stramm«, sodass sie besonders gut Objekte in weiter Ferne fokussieren kann. In angespanntem Zustand sorgt der Ziliarmuskel dafür, dass die Linse ihre natürliche, abgerundete Form einnimmt und so nahe gelegene Objekte besser fokussiert.
© Shutterstock: Pikovit
Der Sehnerv ist ebenfalls ein Hirnnerv und zwar der zweite. In der Fachsprache wird er als Nervus opticus bezeichnet. Der Sehnerv eines erwachsenen Menschen ist aus etwa einer Million Fasern aufgebaut und gut vier Millimeter dick. Er leitet die vom Auge aufgenommenen Lichtreize ans Gehirn weiter, wo die Informationen verarbeitet werden. Das eigentliche Sehen findet also nicht im Auge, sondern im Gehirn statt. Dazu aber später mehr.
Der Sehnerv ist an der Rückseite mit dem Augapfel verbunden und tritt durch die Netzhaut ins Auge ein. An dieser Stelle sind keine Rezeptoren vorhanden. Lichtreize, die auf diesen Bereich der Netzhaut projiziert werden, können also nicht wahrgenommen werden. Daher wird die Eintrittsstelle des Sehnervs auch als Blinder Fleck bezeichnet.
Das menschliche Auge weist auch einen Gelben Fleck auf. Er wird als Makula bezeichnet. Der Gelbe Fleck liegt in der Mitte der Augenrückseite auf der Netzhaut, in der Nähe des Blinden Flecks. Darin befindet sich eine Vertiefung, in der die Sinneszellen besonders dicht beieinander liegen. Somit ist die Makula der Bereich der Netzhaut, mit dem wir am schärfsten sehen. Sobald wir ein Objekt fokussieren, werden die Augen so bewegt, dass die Informationen über das fixierte Objekt auf die Makula treffen.
Geschützt werden unsere Augen durch das Oberlid. Dabei handelt es sich um eine Art »Deckel« für die Augen. Sehr helles Licht, aber auch sich rasch nähernde Gegenstände oder reizende Stoffe stellen eine potentielle Gefahr für die empfindlichen Augen dar. In solchen Fällen schließt sich das Oberlid. Doch nicht nur dann – durch regelmäßiges Blinzeln verhindert das Oberlid zudem, dass das Auge austrocknet, da es die Augenoberfläche mit Tränenflüssigkeit benetzt und diese gleichmäßig verteilt. Normalerweise findet das automatisch statt. Wir können aber auch bewusst blinzeln. Darin ähnelt dieser Vorgang der Atmung. Auch das Ein- und Ausatmen müssen wir nicht aktiv steuern, wir können es aber.
Die Augenlider enthalten verschiedene Drüsen, die unter anderem Talg- und Tränenflüssigkeit produzieren, um das Auge vor Austrocknung zu schützen. Die Tränendrüsen liegen seitlich über den Augen. Normalerweise dient die darin gebildete Flüssigkeit der Befeuchtung der Augen. Doch auch bei Traurigkeit oder Wut kommen die Tränendrüsen zum Einsatz. Gelangt ein Fremdkörper ins Auge, etwa ein Staubkorn, wird ebenfalls die Produktion von Tränenflüssigkeit angeregt, um den Eindringling auszuschwemmen.
Am Ober- und am Unterlid wachsen die Wimpern 5 , die oben etwa einen Zentimeter lang werden und dichter wachsen als unten. Auch sie dienen dem Schutz der Augen, etwa vor Fremdkörpern wie Staubpartikeln. Genau wie alle anderen Haare unseres Körpers werden die Wimpern nach einer gewissen Zeit abgestoßen und wachsen dann wieder nach.
Eine ähnliche Funktion nehmen die Augenbrauen wahr. Sie dienen insbesondere dem Schutz vor Schweiß, der andernfalls von der Stirn in die Augen laufen könnte. Darüber hinaus spielen die Augenbrauen in der menschlichen Mimik eine wichtige Rolle. Keine schlagfertige Antwort wirkt schließlich so eindrucksvoll wie eine, die von einer hochgezogenen Braue begleitet ist.
Zu guter Letzt sind da noch die Augenmuskeln, sowohl innerhalb des Augapfels als auch außerhalb. Von den äußeren Augenmuskeln haben wir gleich sechs – vier gerade- und zwei schrägverlaufende. Sie ermöglichen Augenbewegungen in jede Richtung. Die Augenmuskulatur ist aus kleinen Einheiten aufgebaut und lässt sich dadurch sehr fein steuern, sodass auch minimale Bewegungen möglich sind, beispielsweise beim Lesen. Drei verschiedene Nerven sind an den Augenbewegungen beteiligt – darunter der Oculomotorius, den Sie bereits kennengelernt haben.
Wie sieht der Mensch?
WIE SIEHT DER MENSCH?
Nun kennen Sie zwar den Aufbau des Auges. Aber wie genau sehen wir denn nun eigentlich? Die Voraussetzung dafür ist zunächst einmal Licht. Bei vollständiger Abwesenheit von Licht ist der Mensch tatsächlich blind. Doch scheint nur durch einen winzigen Spalt in der Jalousie die Straßenlaterne herein, so ist Licht vorhanden – und damit auch Reize, die das Auge aufnehmen kann.
© Shutterstock: Monkey Business Images
Licht kann aus verschiedenen Quellen stammen, beispielsweise von der Sonne, aus der Glühbirne oder vom Smartphonebildschirm. Dieses Licht gelangt dann durch die Pupille zur Linse. Sie bündelt das Licht, das im nächsten Schritt auf der Netzhaut abgebildet wird.Auf der Netzhaut befinden sich Sinneszellen. Diese lassen sich in zwei verschiedene Typen unterteilen. Sie haben unterschiedliche Funktionen, ihre Namen haben sie aber durch ihre Formen erhalten: Stäbchen und Zapfen.
© Shutterstock: Olha Pohrebnyak
Stäbchen dienen der Wahrnehmung von Helligkeit. Jedes Auge verfügt über sage und schreibe 110 Millionen von ihnen. 6 Sie enthalten ein Pigment, also einen Farbstoff, namens Rhodopsin. Trifft Licht auf die Stäbchen, zerfällt das Rhodopsin. Bei dieser chemischen Reaktion werden elektrische Impulse ausgelöst, die die Nerven erregen und auf diese Weise die Information »hell« ans Gehirn schicken. Zapfen hingegen sind für die Wahrnehmung von Farben zuständig. Im Vergleich mit den Stäbchen sind sie in Unterzahl: Pro Auge liegen »nur« sechs Millionen vor. 7 Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Bitte halten Sie durch, das ist nämlich wirklich interessant.
Wenn Sie einen Tintenstrahldrucker haben und in Ihrem Haushalt für das Wechseln der Patronen zuständig sind, wissen Sie bereits: Mit nur Rot, Gelb und Blau lassen sich alle nur denkbaren Farben drucken: Hellrosa, Dunkellila und alles dazwischen wird aus Rot, Gelb und Blau zusammengemischt. So ähnlich wie ein Drucker funktioniert das menschliche Auge.
Die Zapfen sind nämlich Spezialisten: Es gibt welche fürs Blau- und Grünsehen und natürlich auch welche fürs Rotsehen. Die einzelnen Arten von Zapfen können nämlich nicht nur strikt eine Farbe erkennen, sondern eine bestimmte Wellenlänge an Licht. So nehmen manche Zapfen Licht in den Farben Blau bis Violett wahr, manche Blau, Grün und Gelb und wieder andere gelbes und rotes Licht. Von der Funktion her sind Zapfen den Stäbchen ähnlich, nur dass sie ein anderes Pigment enthalten, nämlich Photopsin.
Aber was genau ist eigentlich mit Wellenlänge gemeint? Licht wird in Form von wellenförmiger Strahlung übertragen. Welche Farbe wir wahrnehmen, hängt von der Wellenlänge ab. An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf das Licht im sichtbaren Bereich. Es gibt aber auch Strahlung mit so großer oder kleiner Wellenlänge, dass sie für das menschliche Auge unsichtbar ist.
Das Licht mit der größten Wellenlänge, die für uns erkennbar ist, ist rotes Licht. Die kürzeste für uns wahrnehmbare Wellenlänge ist blaues Licht. Dabei sehen wir nicht alle genau die gleichen Wellenlängen. Jeder Mensch sieht ein wenig anders. Wellenlängen zwischen 400 und 780 Nanometern sind für die meisten Menschen wahrnehmbar. 8
© Shutterstock: Elena Pimukova
Die Zapfen sind auf eine größere »Menge« Licht angewiesen, um ihre Arbeit tun zu können. Mit der Dämmerung nimmt die Fähigkeit, Farben zu sehen, daher immer weiter ab. Helle und grelle Farben sind im Zwielicht noch am längsten erkennbar. Daher stammt die Empfehlung, in der dunklen Jahreszeit möglichst helle Kleidung zu tragen, um als Passant oder Radfahrer im Straßenverkehr bei Dunkelheit nicht übersehen zu werden. Bei Dunkelheit sehen wir nur noch Grautöne und Schwarz – nun haben die Stäbchen das Zepter übernommen und kümmern sich allein um den Sehvorgang.
Was beeinflusst unsere Sehkraft?
Der Aufbau der Augen ist immer gleich und auch die Funktion des Sehsinns ändert sich nicht von Stunde zu Stunde. So scheint es überraschend, dass die Sehkraft sich nicht nur innerhalb von Monaten und Jahren verändern kann. Tatsächlich ist sie eine Frage der Tagesform und kann sich sogar im Verlauf eines einzigen Tages verändern.
Dafür kann es zahlreiche verschiedene Gründe geben, von denen wir im Folgenden einige genauer beleuchten wollen. Zunächst sollten wir uns vor Augen führen, dass der menschliche Körper keine Maschine ist. So haben wir an manchen Tagen mehr, an anderen weniger Appetit, bemerken beim Sport eine schwankende Leistungsfähigkeit und haben auch nicht immer genau gleich gute Laune.
Das Sehen findet nicht isoliert statt, sondern ist ein Vorgang unter vielen im Organismus und von zahlreichen anderen Vorgängen abhängig. In den folgenden Kapiteln werden wir noch genauer betrachten, wie sich unser allgemeiner Gesundheitszustand auf die Sehfähigkeit auswirkt. Doch an dieser Stelle wollen wir uns darauf konzentrieren, Schwankungen innerhalb eines oder zumindest weniger Tage zu betrachten.
In jedem Fall gilt: Treten plötzlich Sehstörungen bei Ihnen auf, die sich nicht innerhalb kürzerer Zeit von selbst oder durch die vorgeschlagenen Maßnahmen bessern, sollten Sie sie sicherheitshalber ärztlich abklären lassen. Oft sind Schwankungen der Sehleistung harmlos. Massive Einschränkungen können jedoch, insbesondere wenn sie plötzlich auftreten, auf ein ernstzunehmendes gesundheitliches Problem wie etwa einen Schlaganfall hindeuten. Auch wenn zusätzliche Symptome sowohl am Auge als auch in anderen Bereichen des Organismus auftreten, ist ein Besuch in der ärztlichen Praxis angezeigt.
Schlecht sehen durch trockene Augen
Ein negativer Einfluss auf die Sehfähigkeit sind trockene Augen. Mögliche Ursachen dafür sind fortgeschrittenes Alter oder ein Mangel an Tränenflüssigkeit. Häufig stecken jedoch Kontaktlinsen und/oder Bildschirmarbeit dahinter. Beim Blick auf Bildschirme, sei es der PC, das Tablet oder ein Smartphone, blinzeln wir weniger. Damit die Oberfläche des Auges mit Tränenflüssigkeit benetzt werden kann, ist regelmäßiges Blinzeln jedoch zwingend notwendig. Tun wir das nicht, werden die Augen trocken. Sie sind gereizt, gerötet, jucken – und der Gesichtssinn leidet auch darunter. Wenn Sie bei längerer Bildschirmarbeit oder beim Tragen von Kontaktlinsen nur noch verschwommen sehen können, liegt das also womöglich an trockenen Augen. Abhilfe können verschiedene Maßnahmen schaffen:
Bildschirmpausen einlegen
Kontaktlinsen herausnehmen und zumindest vorübergehend auf eine Brille ausweichen
regelmäßig bewusst blinzeln
Augentropfen mit künstlicher Tränenflüssigkeit
Zugluft und Klimaanlagen meiden
Sehstörungen durch Migräne
Migräne wird häufig belächelt, als harmloser Kopfschmerz abgetan. »Stell dich nicht so an« oder »Nimm halt eine Schmerztablette« haben die meisten Betroffenen wohl schon einmal zu hören bekommen. Doch mal abgesehen davon, dass auch Kopfschmerzen schon sehr unangenehm werden können – bei Migräne handelt es sich um massive, einseitig auftretende pochende Schmerzen, die mit einer Vielzahl anderer Symptome einhergehen können. Häufig leiden Betroffene zusätzlich beispielsweise unter Übelkeit. Sehr stark ausgeprägt können sie ausfallen, wenn es sich um »Migräne mit Aura« handelt. Auch Sehstörungen sind eine häufige Begleiterscheinung von Migräneattacken.
© Shutterstock: pikselstock
Dabei handelt es sich um neurologische Beschwerden, die im Vorfeld sowie zu Beginn einer Migräneattacke auftreten können. Neben Ausfällen des Gesichtsfelds und Lichtblitzen sind sogar Sprachausfälle und eine halbseitige Lähmung möglich. Eine sofortige ärztliche Abklärung ist zwingend erforderlich. Herkömmliche Schmerzmittel wirken bei Migräne in der Regel nicht ausreichend stark. Der Neurologe oder der Hausarzt können jedoch sogenannte Triptane verschreiben. Leiden Betroffene an mehr als 10 Tagen im Monat unter Kopfschmerzen und/oder Migräne, ist eine medikamentöse Prophylaxe sinnvoll.





























