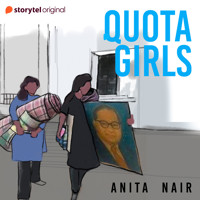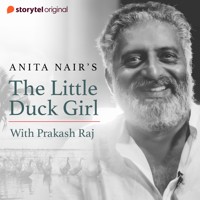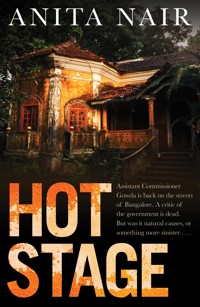Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bangalore, Indien. Der Mord an einem vermögenden Anwalt ruft Inspector Gowda auf den Plan. Das ist sein Job, und er wird den Fall lösen, egal, wem er dafür auf die Füße treten muss. Im Zuge der Ermittlung rücken Umstände in den Blick, die verschiedenste Facetten der indischen Gesellschaft berühren. Doch dann wird die berufliche Fähigkeit des Inspectors plötzlich im Privaten gebraucht – und bei diesem Fall läuft Gowda die Zeit davon. Mit ausführlichen Glossar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser intensive Verbrechensroman eröffnet mir ein Stück Indien. Auf seiner alten Royal Enfield Bullet röhre ich mit Inspector Borei Gowda durch Oberschicht-Enklaven, Konsumtempel im Schatten der Hightechwolkenkratzer, durch wimmelnde Großstadtgassen und ländlich-staubige Randbezirke: Bangalore, eine Metropole in stetem Umbruch. Es beginnt als klassische Mordermittlung, geleitet von Gowda, den seine Integrität zum Eigenbrötler und latenten Rebellen macht. Seine sarkastisch gefärbten Innenansichten zeigen die umfassende Korruption in Behörden und Machtzentralen ebenso beiläufig wie die hilflos-selbstgerechte Haltung des privilegierten Mittelstands. Und er ist bestrickend fehlbar, dieser wohlsituierte Kindskopf mit dem manchmal überscharfen Blick.
Kunstvoll verflochten mit der Ermittlergeschichte ziehen weitere Handlungsstränge auf. Anita Nair gelingen feinste Balanceakte zwischen Einfühlung und Nüchternheit, Ranzoomen und Abblenden, Fakten und Gefühlen. Sie erzählt sinnlich und empathisch, doch ohne Pathos und Klischee, sie navigiert fernab jedes Voyeurismus. Die aus der Innensicht gezeigten, krass verschiedenen Lebensrealitäten vermitteln das lebenssprühende, hochkomplexe Bild einer Gesellschaft voller Ethnien- und Kastenvorurteile, mit strikten Hierarchien, ganz eigenen Rassismen, zutiefst patriarchalen Normen und blühendem Raubtierkapitalismus: Indien heute an einem seiner dynamischsten Brennpunkte. Beim Lesen meine ich es vor mir zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Ein Fenster zur Welt, eine packende Lektüre-Reise, die keine Abgründe ausspart, sondern sie sichtbar macht, ein Geschenk an uns alle von einer Schriftstellerin, die offenbar fühlt, was sie sieht. Auch das kann Kriminalliteratur auf der Höhe der Zeit. Else Laudan
Anita Nair
Gewaltkette
Deutsch von Karen Witthuhn
Ariadne 1226
Das Böse triumphiert allein dadurch,
PROLOG
Samstag, 14. März
07:30 Uhr
Eine Wand aus Spiegeln. Darin sah er sich selbst. Ein bulliger Mann in senfgelben Leggings und einem dunkelblauen T-Shirt, das kaum bis zu den Oberschenkeln reichte. Etwas Groteskeres oder Verstörenderes hatte er noch nie gesehen. Er starrte die vielfachen Borei Gowdas an. Musik setzte ein, und der Trainer, ein hochgewachsener schlanker Mann in wie auf den Leib gegossenen Kleidern, dessen Gliedmaßen anscheinend mit Doppelgelenken am Rumpf angebracht waren, wiegte sich im Takt.
»Kommen Sie, Inspector Gowda«, sagte er. »Fangen Sie einfach an, hören Sie auf die Musik, lassen Sie sie durch sich hindurchfließen. Nur so kann man Tango tanzen. Und immer daran denken, links vor, rechts vor, links vor …«
Gowda hörte nicht mehr hin. Was zum Teufel mache ich hier, fragte er sich und die vielen Borei Gowdas im Spiegel.
Das Handy auf dem Nachttisch klingelte beharrlich. Inspector Borei Gowda fuhr hoch und tastete verschlafen nach dem Telefon. Wo war dieser hirnrissige Traum hergekommen?
Er sah auf dem Display die Zeit und riss die Augen auf. Fast acht. Wie hatte er einen Wecker verschlafen können, der zwischen sechs und sieben alle fünfzehn Minuten Krach schlug? Er musste sich gestern Abend richtig die Kante gegeben haben. Ganz entgegen seinen festen Absichten. Er seufzte.
»Hallo«, sagte er ins Handy.
»Sir, ein Anruf aus der Leitstelle. Es geht um jemanden in der Gated Community in der Nähe des Bible College. Ich glaube, Sie sollten hinfahren«, sagte Head Constable Gajendra. Im selben Moment hörte Gowda draußen vor dem Haus schon den kräftigen Motor des Bolero-Jeeps dröhnen.
»Ich bin in fünfzehn Minuten da«, sagte Gowda auf dem Weg ins Badezimmer, wo er sich mit der Zahnbürste im Mund unter die Dusche stellte. Das Trommeln des Wassers beruhigte das Hämmern in seinem Hinterkopf. In seinem müden Schädel spulten sich die Ereignisse des vergangenen Abends in grellen Farben mit Dolby-Surround-Sound ab. Er schloss die Augen. Das musste warten. Jetzt rief die Pflicht.
Head Constable Gajendra wartete bereits am Tor des Shangri La. Das war der auf einer in den Torpfeiler eingebetteten polierten Messingtafel eingravierte Name. Der Head Constable sah mitgenommen aus.
Vor dem Tor hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt. Gowda grüßte mit einem Nicken und ging auf das Haus zu. Ein kleiner dünner Mann löste sich von der Gruppe und eilte ihm nach. »Hallo, Inspector. Ich bin der Präsident.«
Gowda hielt inne, betrachtete den Mann und überlegte, ob er es mit einem Verrückten zu tun hatte. »Präsident welchen Landes?«
Der Mann wurde rot. »Präsident des Anwohner-Vereins.«
Gowda nickte. »Ah, verstehe. Ich muss Sie bitten, zurückzutreten.«
Beim Weitergehen nahm er noch den enttäuschten Gesichtsausdruck des Mannes wahr.
Zwei Constables hatten die Haustür aufgebrochen. Gowda trat ein und blieb stehen. Die Tür führte in eine Vorhalle, die an einen alten Club erinnerte. Dazu passte ein riesiger Spiegel mit Goldrahmen, unter dem etwas stand, das wie ein in der Mitte durchgesägter Tisch aussah. Bestimmt hatte das einen Namen. Urmila wüsste ihn wahrscheinlich.
Er betrachtete den Mann, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag, und schauderte. Eine Seite des Schädels war zertrümmert. Um den Kopf herum breitete sich ein Heiligenschein aus Blut aus. Daneben lag umgefallen ein steinerner Buddha. Der Marmorfußboden war zersplittert wie die Schädeldecke.
Der Mann trug dunkelblaue Crocs an den Füßen, sein T-Shirt war im Fallen nach oben gerutscht. Unterhalb der linken Rippen sah Gowda eine blau verfärbte Prellung. Durch die kurze Lycrahose war deutlich der Penis zu erkennen. Wer war der Tote? Nachdenklich kniff sich Gowda in den Nasenrücken.
Ein Stück entfernt lag ein Handtuch. Gowda bückte sich und hob es mit Hilfe seines Kugelschreibers auf. Es war feucht und roch nach Chlor. Der Mann ist schwimmen gewesen, dachte Gowda. An der Einfahrt in die Gated Community war ihm linkerhand ein blaues Schimmern aufgefallen.
»Er war gestern Abend um elf zu einer Videokonferenz mit einem Mandanten verabredet. Der Mandant hat anscheinend mehrmals vergeblich angerufen und dann eine Kollegin kontaktiert. Die konnte ihn auch nicht erreichen. Als er auch heute Morgen nicht auf Anrufe und Nachrichten reagierte, hat sie die Zentrale informieren lassen«, sagte Head Constable Gajendra.
»Wohnt er alleine?«, fragte Gowda. Ihm fiel auf, dass der Raum ansonsten unberührt wirkte. Keine umgestoßenen Möbel. Nicht mal eine Glasscherbe oder ein dreckiger Fußabdruck. Hier war niemand eingedrungen. Das Opfer hatte den Täter gekannt. So viel war klar.
»Was ist mit Handy und Laptop?«, fragte Gowda.
»Alles da«, sagte Gajendra. »Ich glaube nicht, dass hier ein Einbruch aus dem Ruder gelaufen ist.«
»Wo ist die Frau, die in der Zentrale angerufen hat?«
»Sie war letzte Nacht in Chennai. Sie hat den ersten Flug genommen und ist auf dem Weg hierher.« Gajendra drehte sich um, draußen hörte man einen Wagen halten.
Ein junger Mann und eine Frau kamen eilig den Gartenweg entlang. Gowda ging ihnen entgegen.
»Dr. Rathore, geht es ihm gut?«, fragte die Frau, während der Mann versuchte, über Gowdas Schulter hinweg einen Blick ins Haus zu erhaschen.
Gowda schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid.«
Das Gesicht der Frau verzog sich. »O Gott, o mein Gott«, flüsterte sie, die Hand vor den Mund gepresst.
»Was ist passiert, Inspector?« Die Stimme des Mannes zitterte vor Bestürzung. »Dr. Rathore hat doch immer gut auf sich aufgepasst.«
»Er war Arzt?«, fragte Gowda.
»Nein, nicht so ein Doktor. Doktor der Rechtswissenschaften«, sagte der Mann. »Können wir zu ihm?«
Gowda hob die Hand. »Nicht jetzt. Das ist ein Mordfall. Bis die Spurensicherung kommt, darf der Tatort nicht betreten werden.«
»Mord! Aber wer würde Dr. Rathore denn umbringen wollen?« Die Stimme der Frau wurde schrill.
»Irgendwer hat es jedenfalls getan. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen«, sagte Gowda.
Sie starrten ihn entsetzt an. Gowda erwiderte den Blick, er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Es war nie leicht, einen Tod mitzuteilen, ob nun durch Selbstmord, Unfall oder Mord. Polizisten und Ärzte wussten das. Es war ihr Los, sich vom Leid derer, die dem Opfer nahestanden, nicht berühren zu lassen.
»Wir brauchen ein paar Angaben«, sagte er.
Head Constable Gajendra musterte die Gesichter des Paares. Er wusste, dass Gowda das Gleiche tat.
Gowda nahm nicht an, dass die beiden etwas beitragen konnten, das nicht schon im Terminkalender des Toten stand. Die Frau hatte sich kurz im Garten umgeschaut, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Der Mann hatte in einer Ecke des großen Gartens einen Pavillon mit eingebauter Bar bemerkt und große Augen gemacht. Dr. Rathore hatte sich wohl nie mit seinen Kollegen auf einen Drink getroffen oder sie nach Hause eingeladen. Allem Anschein nach hatte er sehr zurückgezogen gelebt, Distanz gehalten zu seinen Angestellten und Partnern.
»Seine Familie?«, fragte Gowda.
»Seine Frau und sein Sohn leben in London. Sie leitet die dortige Filiale der Kanzlei«, sagte die Frau. In ihrem Ton schwang Missbilligung mit. Gowda ahnte, dass die junge Kollegin ein wenig verliebt gewesen war.
»Ich werde noch ausführlich mit Ihnen sprechen müssen«, sagte er unvermittelt.
Die Frau nickte. Tränen traten in ihre Augen. »Ich kann nicht glauben, dass …« Der Mann legte den Arm um sie.
Gowda warf Gajendra einen Blick zu, bedeutete ihm mit einer kleinen Bewegung des Kinns, die beiden wegzuschicken, drehte sich um und ging.
Police Constable Byrappa schob sich neben Gajendra. »Die Wachmänner am Tor haben Videoaufnahmen und ein Besucherregister.«
Gajendra lächelte und ging Gowda nach. »Ich glaube, der Fall wird schnell zu lösen sein«, sagte er.
Gowda sah ihn an. »Meinen Sie?«
»Ja, Sir. PC Byrappa sagt, es gibt Videoaufnahmen und ein Besucherregister. Sobald wir den Todeszeitpunkt wissen, lässt sich leicht feststellen, wer den Anwalt umgebracht hat.«
Gowda schwieg. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass es nicht so einfach werden würde. Er warf einen letzten Blick auf den toten Anwalt. Etwas nagte an ihm. Er wusste nicht genau, was. Aber es würde ihm noch einfallen.
Der kleine Mann, der sich als Präsident des Vereins vorgestellt hatte, kam mit zwei anderen Männern und einer Frau auf ihn zu. »Glauben Sie, es war die Dandupalaya-Gang?«, raunte einer der Männer.
»Die soll sich ja einsam gelegene Häuser mit wenigen Bewohnern aussuchen. Ist das nicht der Modus operandi der Gang?« Die Frau betonte den Ausdruck wie ein altkluges Kind, das ein neues Wort gelernt hat. Der dritte Mann zückte sein Handy und wollte damit knipsen.
Gowda runzelte die Stirn. »Keine Fotos.« Auf die Frage der Frau ging er gar nicht erst ein. Seit dem auf wahren Begebenheiten beruhenden Film Dandupalaya über eine Familie in einem Viertel am Rand von Bangalore, die sich mit Plündereien, Vergewaltigungen und Morden den Tag vertrieb, war besagte Gang regelrecht zum Mythos geworden. Gowda war ziemlich sicher, dass sich auch bei der Polizei Beamte fanden, die diesen Mord bequemerweise gern einem Nachfolger der Gang in die Schuhe schieben würden. Immerhin hatte es damals, vor über einem Jahrzehnt, einhundertzwölf Anzeigen gegen die Bande gegeben.
»Was glauben Sie, wer hat das getan?«, fragte der Präsident.
»Die Ermittlung läuft bereits«, sagte Gowda.
TEIL 1
Neun Tage zuvor …
Dienstag, 5. März
Dieser Geruch. Dreck, Schweiß und der Mief ungewaschener Körper in verschmutzter Kleidung, die an vielen Stellen fadenscheinig war und in Fetzen hing. Der Gestank von Verzweiflung.
Ein Geruch, den ich kannte. Ich hatte damit gelebt.
Im überfüllten Großraumabteil des 18463 Prashanto Express, der um 12:05 Uhr den Bahnhof von Bangalore erreichen sollte, waberte Verzweiflung wie eine tief hängende Wolke. Der kollektive Atem der Geschöpfe, die Sitze und Gänge besiedelten.
Ich sah mich um. Wie immer war es eine bunte Mischung. Etwa neunzig Menschen verstopften ein für zweiundsiebzig Passagiere gedachtes Abteil. Man konnte sich kaum bewegen.
Sie saßen aneinandergelehnt. Drei magere Jungs in T-Shirts und Trainingshosen. Ihre Haut hatte die Farbe von Lehm, die flachen, breiten Nasen und die vorgestülpten Augenbrauen verrieten mir, dass sie aus einem der Stammesdörfer in Odisha kamen. Jeder trug einen Bindfaden mit einem kleinen silbernen Glücksbringer um den Hals. Einer berührte den Glücksbringer, rieb mit dem Finger darüber. Er hatte Angst vor dem, was vor ihm lag, und wollte sich Mut machen.
Jeder der Jungen hielt einen Plastikbeutel umklammert. Wahrscheinlich befanden sich darin ihre gesamten Besitztümer: ein paar abgetragene Kleidungsstücke und wertlose Kinkerlitzchen, die sie bis aufs Blut verteidigen würden. Ihre Füße waren nackt und nur unwesentlich schmutziger als ihre Gesichter. Aber in ihren Mienen lag eine Entschlossenheit, die mich aufmerksam werden ließ.
Ich kannte das alles. Einst war ich wie sie gewesen.
Als ich sechs war, verkaufte mich mein Vater für tausend Rupien an einen Mann. Das war mein Preis für eine Saison. »Mit der Hälfte könnt ihr die Felder bepflanzen, der Rest wird dich und deine Familie am Leben halten, bis die Ernte reif zum Verkaufen ist. Nach der Saison bringe ich ihn zurück«, sagte der Mann zu meiner Mutter.
Mein Vater nannte den Mann Sardar, Chef, und ich sollte das auch tun. Der Mann hatte fünf Familien bei sich, darunter auch die meines Onkels, und die hatte angeboten, mich mitzunehmen. Männer und Frauen wie meine Eltern, Kinder wie ich, zwei alte Frauen, ein alter Mann und zwei Babys. Von den vielen neuen Namen und Eindrücken schwirrte mir der Kopf.
Wir nahmen einen Zug. Ich wusste nicht, wohin ich fuhr. Es war mir egal. Alles war besser als zu Hause, das wusste ich. Ich war noch nie Zug gefahren und hatte noch nie einen Hahn gesehen, aus dem Wasser floss, wenn man daran drehte. Der Mann gab mir alle paar Stunden etwas zu essen. Ich hing am Zugfenster und spürte den heißen Wind auf meinen Wangen prickeln. Ich wollte singen. Ich hatte das Gefühl, mein Horizont wäre voller Regenbögen. Hunderte davon.
An einem Bahnhof namens Kazipet stiegen wir aus, und der Mann brachte uns an einen Ort, wo Ziegelsteine hergestellt wurden. »Du spielst doch gern mit Lehm, oder?«, sagte mein Onkel mit einem seltsamen Lachen.
Ich nickte und sah mich um. Zuerst dachte ich, nicht mehr atmen zu können. Die Hitze drückte mich zu Boden, und die Luft brannte mir in Kehle und Augen.
»Hör auf zu glotzen und hilf mir«, sagte mein Onkel. Wir mussten uns eine kleine Hütte bauen, in der wir alle schlafen konnten. Mein Onkel, meine Tante, seine Schwiegermutter und die beiden Kinder, jünger als ich. Man gab uns ein bisschen Stroh und eine blaue Plane. Das würde das Dach werden – Stroh und Plastik. Die Wände mussten wir noch bauen. Wir arbeiteten leise und schnell. In jener Nacht lag ich vor der unfertigen Hütte auf der Erde und starrte in den Himmel. Es macht nichts, redete ich mir ein. Andere sind ja auch hier. Irgendwie beruhigte mich das.
Die Tage waren gnadenlos. Zuerst musste ich Kohlebrocken aneinanderschlagen, bis sie in Stücke zerfielen, mit denen man die Brennöfen füttern konnte. Dann befahl man mir, kleine Fuhren frisch geformter Ziegel zu den Trockenkammern zu schleppen. Ich musste tun, was immer mir aufgetragen wurde. Wie die anderen Kinder auch.
Ich arbeitete von früh bis spät. Zum Lohn bekam ich ein wenig zu essen und ziemlich viel Prügel. Mein Onkel schlug mich, meine Tante schlug mich, die Mutter meiner Tante schlug mich, die älteren Jungs und Mädchen schlugen mich, der Ziegeleiaufseher schlug mich … Irgendwann fragte ich mich nicht mehr, wofür ich geschlagen wurde. Ich wusste nur noch, dass in meinem Bauch ein Brennofen mit einem riesigen Schlund wütete. Er fühlte sich leer und heiß an. Ich wusste nicht, ob das Hunger war oder Angst.
Ich vergaß meinen Namen. Alle nannten mich Pathuria. Alle anderen waren auch Pathuria.
Der Zug fuhr in den Tag hinein. Bald würde der Schaffner einen flüchtigen Kontrollgang machen. Er kam selten weiter als bis an die Tür. Der Gestank aus den Toiletten und den verklebten Poren der triefäugigen, hohlwangigen Geschöpfe genügte, um noch den Mutigsten abzuschrecken. Doch ab und zu griff er sich einen Pechvogel heraus und blaffte ihn an: »Fahrkarte! Fahrkarte!«
Manchmal riss dann in der Wolke der Verzweiflung ein kleines Glücksrinnsal auf, und obwohl der Angesprochene gar kein Ticket besaß, steckte ihm ein Nebenmann oder jemand von der anderen Seite des Ganges eins zu. Und so mächtig war die Wirkung eines solchen Glücksstrahls, dass der Schaffner den guten Samariter nicht nach seiner Fahrkarte fragte. Solche Wunder konnten im Gemeinschaftsabteil vorkommen.
Manchmal jedoch verriet sich jemand. Unsteter Blick, Schweißperlen auf der Oberlippe, verkrampfter Kiefer. Der Kontrolleur war ja kein Idiot. Er sah so einem an, was er war. Klasse: Gesindel. Untergattung: Rumtreiber. Mit dem Eifer eines Hundes, der ein Nest junger Ratten aufspürt, stürzte er sich auf ihn. Bereit, ihn beim nächsten Halt aus dem Zug zu werfen, mit wütendem Geknurr und der Drohung: »Soll ich die Bahnpolizei rufen?«
Und genau da trat ich in Erscheinung. Mit einem Bündel Fahrkarten in der Tasche. Ich schob mich durch die brodelnde Masse aus Schweiß und Angst, bis ich die drei Jungs erreichte, die mit Sicherheit keine Fahrkarten hatten und keine Ahnung, was sie tun sollten.
Ich lehnte mich an einen Sitz. Die Jungs mieden meinen Blick, wie ich es vorhergesehen hatte. Starrten aus dem Fenster oder zu Boden. Schaut mich an, hätte ich am liebsten gesagt. Seht her zu mir, macht es euch und mir ein bisschen leichter.
Du bist Krishna, sagte ich mir und dachte daran, wie der Thekedar mich an der Schulter gepackt, mir in die Augen gesehen und mir meinen Namen gegeben hatte. Ich wiederholte im Kopf die Worte, die der Thekedar beim ersten Mal und seither immer wieder zu mir gesagt hat: Die, die zu mir kommen, treten heraus aus der Welt der Schatten.
Ich bestieg den Zug am Bahnhof Chipurupalle in Andhra Pradesh um 10:58 Uhr. Um diese Zeit bekam niemand irgendetwas mit. Müdigkeit lag schwer auf den Lidern und verwandelte alles Denken in einen trüben, trägen Strom. Um 11:30 Uhr würden wir in Vizinagaram sein, und der Schaffner konnte jeden Moment auftauchen. Es blieben noch ein paar Minuten, um mir die Jungs gefügig zu machen.
Sie hatten zwei Flaschen Wasser bei sich. Einer von ihnen hob eine Flasche an die Lippen. Unsere Blicke trafen sich.
»Tame kouthu asicha?«, murmelte ich auf Odiya und verbarg mit der Hand ein Gähnen. Ich spreche fünf Sprachen: Hindi, Tamil, Kannada, Odiya und Bengali, außerdem beherrsche ich einige Brocken Telugu und Englisch. In meiner Branche bringt man es zu nichts, wenn man nicht die Sprache seiner Kunden spricht, und meine kamen aus verschiedensten Teilen des Landes.
Seine Augen weiteten sich, und er murmelte dem Jungen neben sich etwas zu. Der schien der Anführer der kleinen Gruppe zu sein. Er runzelte die Stirn und beantwortete nach einer Pause meine Frage.
»Satpada«, sagte er. »Und Sie?«
»Puri«, sagte ich. Das ist meine Standardantwort für alle, die aus Odisha kommen. Ich könnte auch die Wahrheit sagen, nämlich dass ich aus Bolangir stamme, aber ich erinnere mich nicht an diesen Teil meines Lebens. Weder an meine Familie noch an mein Elternhaus oder das Dorf.
Und sollte jemand wegen Puri nachhaken, so habe ich weitere Antworten parat. Mein Zuhause lag in einer der Gassen beim Tempel. Ich sehe sie vor mir. Ein dreckiger, übelriechender schmaler Gang, in dem es von Menschen und Tieren, Rikschas und Straßenhändlern wimmelt. Der Thekedar sagte, so wäre es dort. Aber nie fragt mich jemand.
»Ich war mal am Chilka-See«, sagte ich. Es war die Wahrheit.
Einmal sind der Thekedar und ich durch die Dörfer im Süden von Odisha gefahren. Ich weiß nicht, was mir den Atem stocken ließ: die im Wasser versinkende Landschaft oder die Armut, die jedes Gesicht furchte und jedes Haus härmte.
Ich berührte den Arm des Thekedar und fragte: »Was ist hier passiert? Warum sind sie so arm?«
Er zuckte die Schultern. »Wer weiß? Überschwemmungen, Zyklone, der Bergbau, mangelnde Bildung, keine linke Partei … such’s dir aus!« Dann lächelte er ein Wolfslächeln. »Aber für uns ist es gut!«
Ich erwiderte das Lächeln. Es war beruhigend zu wissen, dass der Brunnen nie versiegen würde.
Ich sah ein Glitzern im Auge des Jungen. War es die Erleichterung darüber, jemandem begegnet zu sein, der sein Dorf kannte? »Habt ihr Fahrkarten?«, fragte ich.
Der Junge runzelte wieder die Stirn. Doch er sprach mit fester Stimme. »Ja, ja.« Er log. Wie leicht sie sich verraten. Das kleine Zögern macht den ganzen Unterschied.
»Na, dann ist ja gut. Denn am nächsten Bahnhof kommt der Schaffner, dann werden die Schwarzfahrerratten, wie er sie nennt, aus dem Zug geworfen und ins Gefängnis gesteckt. Das ist ein schwarzes Loch voll mit echten Ratten, und dreimal am Tag gibt es Prügel statt Essen. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr habt ja Fahrkarten, also könnt ihr einfach sitzen bleiben und das Spektakel genießen.« Ich zwinkerte ihm zu.
Ich hielt mich an der Metallstange fest und legte das Gesicht in meine Armbeuge. Im Stillen zählte ich. Ich brauche die Sicherheit, die Zahlen meinem Leben geben. Wahrscheinlich hat das in der Ziegelei angefangen, beim Brennen der Backsteine. Wenn wir tausend am Tag schafften, zahlte man uns achtzig Rupien. Zwanzig davon gehörten mir. So lernte ich zählen, während wir Backsteine formten.
Bei sieben hörte ich seine leise Stimme. »Dada.«
Ich blickte auf und sah ihn an. »Ja«, sagte ich langsam. Mit der tiefen Stimme eines großen Bruders, denn so hatte er mich genannt.
»Wir haben keine Fahrkarten. Was sollen wir tun?«
Ich runzelte die Stirn. »Das ist ein Problem …«
Bevor ich weitersprechen konnte, brach es aus ihm heraus: »Bitte hilf uns.«
Nachdenklich kratzte ich mich am Kopf. »Eigentlich sollten drei Freunde von mir mitkommen. Aber ihr Boss hat sie nicht reisen lassen. Also tun wir einfach so, als wärt ihr die drei Freunde, für die ich die Fahrkarten gekauft habe.«
Ich lächelte sie an. Mein bestes Krishna-Lächeln, das, wie der Thekedar sagte, eine Straße erleuchten, Eis zum Schmelzen bringen und Schlösser öffnen kann. Diese ahnungslosen Jungs aus dem Nirgendwo würden ihm nicht widerstehen können.
Die Anspannung um die Münder der Jungen löste sich. Ich wusste, sie würden mir bis ans Ende der Welt folgen.
»Da gibt es noch was, worauf ihr gefasst sein müsst«, sagte ich. Sie rissen die Augen auf.
Ich erklärte, was vor ihnen lag. So hatte es mir der Thekedar beigebracht. ›Du bist Krishna. Im Mahabharata ist er der Wagenlenker. Es ist dein Dharma, zu lenken und zu führen, damit andere wissen, was sie erwartet.‹ Es hatte damals eingeleuchtet. Es leuchtete immer noch ein. Der Thekedar sagte, ich hätte eine uralte Seele.
›Wie uralt?‹, hatte ich gefragt.
›Mindestens fünftausend Jahre alt.‹ Er hatte gelächelt.
Er sagte, ich wüsste instinktiv, wofür andere sich ihr Leben lang abmühten.
»Ihr könnt mich Dada nennen, aber für alles andere haben wir einen Thekedar, dem wir verpflichtet sind.«
Die Jungs starrten mich verständnislos an. Sie kannten das Wort nicht, und mir fiel auf Odiya das richtige Wort für Auftraggeber nicht ein. »Jamadar«, sagte ich plötzlich. »Er ist unser Boss … Ihr müsst tun, was ich sage. Nur wenn ihr mir vertraut und gehorcht, kann ich euch helfen.« Meine Stimme klang fest. Die Jungs nickten. »Zunächst mal eure Namen«, sagte ich. »Und die Namen eurer Eltern. Die spielen keine Rolle mehr. Eure Eltern heißen so, wie ich es euch sage, und vergesst ja kein Wort von dem, was ich euch jetzt erzähle.«
Sie machten Platz für mich, und ich hockte mich zu ihnen. Die meisten anderen Reisenden schliefen, vom Rumpeln des Zugs und ihrer Erschöpfung eingelullt. Doch meine Jungs waren hellwach.
Sie hörten zu.
»Bangalore ist anders, als ihr denkt …«, begann ich. Ich sah die Angst in ihren Augen, ihren geballten Fäusten, in der Anspannung ihrer Muskeln. Angst war gut. Angst gab mir Macht. Angst ließ mich herrschen.
Rekha konnte sich nicht entscheiden, was sie ihren Eltern sagen sollte. Das Märchen vom »gemeinsam Lernen« glaubte längst niemand mehr. Und sie musste nicht nur ihre Eltern überzeugen. Suraj, ihr Bruder, war genauso ein Problem. »Was sag ich zu Hause?«, lautete ihre SMS an Sid.
»Gemeinsam lernen!« Das Handy leuchtete auf. Rekha warf einen Blick darauf, während sie den Rand ihres Augenlids mit einem Kajal nachzog.
Bei ihrer ersten Verabredung hatte Sid ihr geraten, das Handy zu Hause immer auf lautlos zu stellen. »Damit sich deine Leute gar nicht erst fragen, wer dir die ganze Zeit Nachrichten schreibt«, hatte er gesagt und sie mit einem unsicheren, verlegenen Lächeln angesehen.
Es hatte sie dahinschmelzen lassen. Wie konnte man nur so fürsorglich sein? Sie kam aus dem Staunen nicht heraus. Wenn sie eine Straße überquerten, legte er seine Hand auf ihren Rücken. Wenn sie auf seinem Motorrad losfuhren, bot er ihr sein Tuch an, damit sie es sich um den Hals legen konnte. Er hatte den Rückspiegel so eingestellt, dass er sie ansehen konnte, wenn sie miteinander sprachen. Er gehörte ihr, ihr ganz allein. Und sie ihm, ihm ganz allein.
»Zieht nicht.« Ihre Finger huschten über den Touchscreen.
Die Antwort ließ ihre Augen aufleuchten. »Gender Studies Sem @ NLS.«
Das würde funktionieren. Die National Law School war ziemlich weit weg. Sie konnte sagen, sie würde bei Priya übernachten, und sich dann mit Sid zu einem ausgedehnten, entspannten Date treffen. Priya würde Verständnis haben, und Priyas Eltern würden auch nichts sagen, solange Sid sie gegen elf zurückbrachte. Und wenn Suraj sie am nächsten Morgen dort abholte, würde niemand irgendwas mitkriegen. Sie lächelte.
»Warum lächelst du die Wand an?« Plötzlich stand Suraj in der Tür.
»Su, du musst mir einen Gefallen tun. Ich muss morgen zu einem Seminar an der NLS«, sagte sie spontan.
»Mit wem gehst du hin?«
»Priya, ein paar von meinen Klassenkameraden und welchen aus der Oberstufe.«
»Und wo liegt das Problem?«, fragte er und wandte sich zum Gehen.
»Warte, Su. Das Seminar findet abends statt, ich muss also bei Priya übernachten. Aber ich weiß nicht, ob die Eltern das erlauben. Kannst du sie überreden?«
Suraj sah sie prüfend an. »Du treibst dich doch nicht mit irgendeinem Blödmann rum, oder?«
Rekha verzog das Gesicht. »Willst du mit Priya sprechen?« Sie hielt ihm das Handy hin.
Wie erwartet wich Suraj zurück. Er war in Priya verliebt, und die Aussicht, mit ihr reden zu müssen, machte ihm genauso viel Angst wie das Stechen eines Ohrlochs. Er war ein wunderbarer Bruder, aber langweilig. Nicht wie Sid, dachte sie. Eine Zeitlang war sie in Surajs Freund Roshan verschossen gewesen. Aber davon hatte Sid sie schnell kuriert.
Sie zog schwarze Leggings und eine lange, tunikaartige grüne Kurta mit weißem Paisleymuster an und machte sich auf die Suche nach ihrer Mutter, die einen Stapel Rotis auf einem Teller durchzählte. »Können wir essen?«, fragte ihre Mutter.
Rekha nickte. »Amma, ich hab morgen Abend ein Seminar.«
Ihre Mutter runzelte die Stirn. Das hörte sie gar nicht gern.
»An der NLS. Ich hab gedacht, ich könnte danach vielleicht bei Priya übernachten. Das wäre doch besser, als so spät noch nach Hause zu müssen.«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob dein Vater damit einverstanden ist …«
»Es ist aber wichtig, dass ich hingehe.« Rekha holte sich einen Teller und nahm ein Roti. Sie hatte keinen Hunger, aber mit leerem Magen würde ihre Mutter sie nicht zum College lassen.
»Ist das alles?«, fragte ihre Mutter. »Soll ich dir eine Lunchbox packen?«
Rekha schüttelte den Kopf. »Ich komme nicht spät nach Hause.«
Letztendlich regelte Suraj die Sache für sie. Er erklärte den Eltern, er würde sie übermorgen früh um halb sieben abholen, und schließlich sei Priya seit der sechsten Klasse Rekhas Freundin.
Ihre Mutter beäugte ihre Kleidung. »Das Oberteil gefällt mir«, sagte sie. »Es ist schick und anständig. Bei dem, was viele junge Mädchen heutzutage so anziehen, möchte ich am liebsten ein Bettlaken nehmen und sie darin einwickeln.«
Rekha verbarg ein Lächeln. In ihrer Tasche steckte ein kurzes rotes Top mit tiefem Ausschnitt. Sobald sie aus dem College-Tor trat, würde Sid sie in ein Einkaufszentrum fahren, wo sie sich umziehen konnte.
Sid hatte gesagt, das gehörte dazu. »Du brauchst bloß sexy auszusehen, so richtig zum Anbeißen. Diese Typen kriegen keinen mehr hoch, also mach dir keine Sorgen. Und du bekommst richtig gutes Geld, alles für ein bisschen Smalltalk. Komm schon, Rex, da ist nichts dabei. Würde ich dich fragen, wenn’s um irgendwas mit Anfassen ginge? Du weißt genau, wie eifersüchtig ich bin.«
Sie kuschelte sich noch enger an ihn und sagte: »Mmm.« Sie saßen in einem Multiplex-Kino. Aber in erster Linie, um unter einem Dupatta herumzuknutschen, während seine Hände ihre Brüste befingerten und er sie dazu zu bringen versuchte, seine Erektion zu berühren.
Sid und sie würden bis gegen sieben Uhr zusammen sein. Dann kamen drei Stunden Smalltalk mit dem Kunden, der einen späten Flug nehmen musste und zwischen sieben und zehn die Zeit totschlagen wollte. Sid hatte versprochen, in der Lounge oder im Restaurant zu sitzen, sie im Auge zu behalten und aufzupassen, dass ihr nichts passierte.
Still aß Rekha ihr Roti. Machte sie einen Fehler? Eine Wolke aus gelben Schmetterlingen flatterte in ihrer Magengrube, die sich plötzlich ganz hohl anfühlte.
Moina starrte an die Decke und dachte an den Himmel. Sie wusste nicht, was über der Decke kam – der Himmel oder ein weiteres Stockwerk. Aber sie dachte sich lieber einen weiten blauen Himmel, denn nur so konnte sie glauben, dass es eines Tages vorbei sein würde. Die andere Möglichkeit, dass sie auf alle Ewigkeit ohne jede Hoffnung in diese Hölle verdammt war, bewirkte, dass sie schreien und um sich schlagen und ihren Freiern gegen das Schienbein treten wollte. Das würde den Wächtern nicht gefallen. Und die Strafe war schlimmer als Prügel. Also lag sie da und stellte sich einen Himmel vor, an dem eine Sonne strahlte. Sie hatte vergessen, wie die Sonne aussah. Oder die Wolken. Oder die Bäume. Oder wie sich ein Windhauch anfühlte.
Der Klient war betrunken. Das konnte sie riechen. Der schale Dunst von Alkohol und sein fauliger Atem, ein von innen verdorrender Körper. Er durchdrang den alles überlagernden Mief, der sie hier umgab, sie durchzog und von ihr ausströmte – nach Sex, Schweiß, Dreck und Hoffnungslosigkeit.
Wann hatte sie zuletzt gebadet? Sie wusste es nicht mehr. Vor drei Tagen oder fünf? Zum Waschen gaben sie ihr einen kleinen Eimer mit Wasser. Er wurde in eine Ecke ihres Verschlags gestellt. Und Parfüm, mit dem sie sich besprühen sollte. Und eine Dose Puder. »Den Klienten ist egal, wie dein Gesicht aussieht, wenn sie dich ficken. Aber jeder, der hier reinkommt, glaubt, er wäre der Erste … also sieh zu, dass du nicht nach einem anderen Kerl riechst«, hatte der große Wächter gesagt, Daulat Ali. Er sprach ein bisschen Bengali, deswegen war es an ihm, ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hatte.
Klient. Ihre Augen weiteten sich. An ihrem ersten Tag hatten sie nacheinander fünf Männer gefickt. Wer oder was war ein Klient?
»Was?«, hatte er gefragt, als er ihre Verwirrung sah.
»Gaard, was ist ein Klient?«, fragte Moina.
»Mokkel.« Er benutzte das Bengali-Wort. »Alle Männer, die dich ficken. Egal, wer kommt. Ob dunkel oder hell, groß oder klein, dick oder dünn … es sind alles Klienten, und wenn nötig, sprichst du sie mit Bava an.«
»Bava?«
»Geliebter, Gatte, Herr, keine Ahnung … was macht das schon?«, hatte Daulat Ali sie angeschnauzt, ausgeholt und ihr einen Schlag verpasst, dass sie gegen die Wand fiel. Ende der Unterhaltung.
Moina hatte in ihrem Verschlag gekauert und nicht zu sprechen gewagt. Was machte es schon, der Wächter hatte recht. Sie würde sie so nennen, wie es verlangt wurde. Bava. Shah Rukh Khan. Sachin Tendulkar.
Als sie damals gebracht worden war, hatten sich Daulat Ali und zwei andere Wächter, die sie danach nie wieder zu Gesicht bekam, ihrer angenommen. Sie hatten sie hungern lassen, sie geprügelt und auf so viele Arten gequält, dass sie alles getan hätte, um in Ruhe gelassen zu werden. Dann wurde ihr die Lösung präsentiert. Sie würde eine Khanki werden müssen. Eine Nutte. Eine Hure.
Die Erinnerung an diese furchtbaren Tage ließ sie erstarren. Der auf ihr liegende Klient fühlte, wie sich ihre Muskeln um ihn herum verkrampften. Grunzend fiel er über ihr zusammen und flutete sie mit einer Nässe, die sie nur noch als etwas Klebriges auf der Innenseite ihrer Schenkel wahrnahm.
Der Klient erhob sich, zog seine Kleidung zurecht und ging. Sie blieb noch eine Weile auf dem Rücken liegen, den Kopf auf einem Arm. Mit der anderen Hand griff sie nach einem unter dem Bett liegenden Lumpen und wischte sich ab. Dann drehte sie sich auf die Seite und rollte sich zusammen. Langsam nuckelte sie an ihrem Daumen. Ma, dachte sie. Ma, wo bist du?
Hinter der Sperrholzwand ihres Verschlags erklang ein schlurfendes Geräusch. Der nächste Klient war auf dem Weg zu ihr. In ihr stieg ein Schrei auf. An den meisten Tagen hatte sie sieben oder acht. Samstags ging die Zahl nach oben, und an Festtagen zählte sie nicht mehr mit.
Daulat Ali zog das Tuch beiseite, das als Vorhang diente.
»Wie spät ist es?«, fragte sie.
Er runzelte die Stirn. »Wieso? Fickst du nach zwei Uhr nachmittags nicht mehr?«
Ein Klopfen an der Trennwand. In fünf Minuten würde ein Mann reinkommen. Der kleinere der Wächter, Muniraju, war von hier. Er sprach ein bisschen Hindi und sah ihr nie in die Augen. Seine Aufgabe war die Buchhaltung. Penibel trug er alles in ein dickes Notizbuch ein. Die Namen der Klienten, die Dauer ihres Aufenthalts und die kassierte Summe.
Einmal, ein einziges Mal, am zweiten Tag, als sie noch Willenskraft besaß, hatte sich Moina in den großen Raum hinter den vier Sperrholzverschlägen geschlichen, die bis auf ihren alle leer waren, und in dem Notizbuch geblättert. Die Schrift war ihr unverständlich, aber die Zahlen konnte sie lesen. Sie war bis dahin von sieben Männern gefickt worden, und jeder Fick hatte tausend Rupien eingebracht. Oben auf jeder Seite stand ein Schnörkel: . Sie erkannte ihn wieder, vor den Tempeln in Faridpur hatte sie so etwas schon mal gesehen.
Daulat Ali hatte sie dafür heftig geschlagen und ihr nichts zu essen gegeben. »Das ist das Kassenbuch unseres Thekedar. Wie kannst du wagen, es zu berühren?« Er hatte sie an den Haaren zu ihrem kleinen Verschlag geschleift und hineingestoßen. Dann war er mit dem Gürtel auf sie losgegangen. »Du verlässt den Raum nur, wenn ich es dir erlaube«, hatte er gesagt, während der Gürtel in ihre Haut schnitt und die Schnalle Scharten hinterließ. Hinterher gab er ihr eine Salbe, die sie auf die Wunden streichen sollte.
An den Geräuschen erkannte sie, dass zwei weitere Mädchen eingetroffen waren. Dann hörte sie eine leise, heisere Stimme. Das musste der Thekedar sein, schloss sie aus der Ehrerbietung in Daulat Alis Tonfall. Dann noch zwei Männerstimmen, die sie nicht kannte.
Das zweite Klopfen. Munirajus Zeichen, dass sie sich fertig machen sollte. Ein Klient war da.
Sie hatte einen üblen Geschmack im Mund, ihre Gudh tat weh und war wund. Bevor sie hierhergekommen war, hatte sie niemals über ihre Vagina nachgedacht. Jetzt konnte sie an nichts anderes mehr denken. Das Wundsein, die schmerzhaften Krämpfe, die Verletzung ihres Innersten. Sie setzte sich auf, griff hinter sich und hakte den BH zu. Dann ging sie zu dem Eimer in der Ecke und hockte sich darüber. Sie schöpfte etwas Wasser in die hohle Hand und wusch sich. Das Wasser war kühl und linderte den stechenden Schmerz. Sie zog den Saum ihres Lehenga bis zu den Knöcheln herunter und zupfte die Bluse zurecht. Dann griff sie nach dem Deo und sprühte sich ein.
Blieb ihr noch Zeit zum Pinkeln? Es tat jedes Mal entsetzlich weh, und ihr Körper verkrampfte sich vor Widerwillen. Nur wenn sie es schaffte, sich zu entspannen, tröpfelte der Urin heraus, und dann fühlte sich jede Sekunde an, als würden tausend Rasierklingen den Kanal aufschlitzen, durch den er floss. Das dauerte seine Zeit, und man durfte Klienten nicht warten lassen.
Das Handy klingelte, kaum dass Shastri, der Teebudenbetreiber, es dem Mann mittleren Alters ausgehändigt hatte, der es abholen kam. Es war kurz nach vier am Nachmittag.
Eine Stunde zuvor war einer von Shastris Stammkunden vorbeigekommen, in Begleitung eines anderen Mannes. Sie wollten zusammen den Bus nach Tumkur nehmen, hatte der Stammkunde gesagt, als Shastri ihnen Plastikbecher mit Tee anbot.
Der andere Mann schien nach jemandem zu suchen, er ließ das Kommen und Gehen am Majestic-Busbahnhof nicht aus den Augen.
»Gibt es ein Problem, Sir?«, hatte Shastri gefragt.
»Eigentlich sollte sich mein Schwager hier mit mir treffen«, sagte der Mann mit bekümmerter Miene. »Würden Sie mir einen Gefallen tun?«
»Was denn?«, fragte Shastri alarmiert. Was mochte jetzt kommen?
»Nichts, weshalb Sie so besorgt dreinschauen müssten.« Der Kunde lachte. »Ich schicke meinem Schwager eine Nachricht, dass er herkommen soll. Sie brauchen ihm nur das hier zu geben.« Er hielt Shastri ein kleines Päckchen hin.
»Was ist das?«
»Ein Handy. Ich kann’s Ihnen zeigen.« Der Mann öffnete die Plastikverpackung.
»Nein, nein, schon gut«, sagte Shastri. »Man kann ja heutzutage nicht vorsichtig genug sein.«
Der Mann nickte. Er drückte Shastri einen Fünfzig-Rupien-Schein in die Hand. »Mein Schwager heißt Shankar. Und ich bin Ramesh. Er wird meinen Namen nennen, damit Sie wissen, dass er es ist.«
Shastri lächelte. Der Tee kostete acht Rupien. Fünfzig Rupien für die Übergabe eines Handys, das war ein Geldregen! »Natürlich, gern. Machen Sie sich keine Sorgen!«, rief er den beiden Männern nach, als sie gingen.
Der Schwager kam erst eine Stunde später. »Stau«, sagte er, als er nach dem Handy fragte. »Und geben Sie mir einen Tee«, fügte er hinzu.
Shastri reichte ihm das Handy und schenkte gerade den Tee ein, als es klingelte.
»Ja«, meldete sich der Mann namens Shankar.
Shastri gab sich beschäftigt, während er lauschte.
»Mein Klient ist ein sehr wichtiger Mann«, sagte Shankar. »Also brauchen wir was ganz Besonderes. Gut … Sieben Uhr abends … Wie heißt du noch mal? Siddharth? Ich schicke dir eine SMS mit dem Namen des Hotels. Ein kleines Boutique-Hotel am Flughafen. Google es einfach.«
Shastri konnte sein Glück kaum fassen, als der Gast das Gespräch beendete und einen Fünfzig-Rupien-Schein auf die Theke legte. Er sah zu, wie der Mann etwas eintippte. Er tat, als sähe er nicht, wie der Mann die Abdeckung des Handys öffnete und die SIM-Karte herausnahm. Er schaute demonstrativ weg und ging auf die andere Seite seiner kleinen Bude. Er war ziemlich sicher, dass in den letzten paar Minuten irgendeine schräge, schändliche Übereinkunft getroffen worden war. Und doch hatte alles recht harmlos gewirkt.
Er sah, wie der Mann die SIM-Karte zerbrach und fallen ließ. Dann war er verschwunden.
Dr. Sanjay Rathore sah auf seine Armbanduhr. Zehn nach sechs. Sein nächster Termin stand in fünf Minuten an. Er furchte die Stirn. Hoffentlich kam der Mann pünktlich. Er hasste es, wenn man ihn warten ließ. Und es war ja nicht einmal ein Mandant. Bloß ein Mittelsmann, ein Grundstücksmakler, der ihm Zugang zum Aggregator des Stücks Land versprochen hatte, das einer seiner Mandanten unbedingt erwerben wollte. Die Uhr schlug das Viertel. Mit dem Ansetzen des Termins auf achtzehn Uhr fünfzehn hoffte er den Makler einzuschüchtern.
Das hatte er in einem Spielfilm gesehen, der letzte Woche im Flugzeug gelaufen war. An den Film oder die Reise erinnerte er sich kaum noch. Irgendwann waren all die internationalen Flüge, Orte und Filme nicht mehr auseinanderzuhalten. Doch dieses Detail hatte sich direkt in seinem Hippocampus festgesetzt. Er verabscheute Schlamperei, und wenn Leute Albernheiten von sich gaben wie: ›Behalte diese Erinnerung in deinem Herzen‹, dann wollte er sie am liebsten grob schütteln und sagen: »Das Herz behält keine Erinnerungen. Es ist bloß ein Organ, das als Pumpe dient. Erinnerungen werden im Gehirn gebildet und aufbewahrt.«
Wirtschaftsrecht war ein Schlachtfeld, und er war immer auf der Suche nach originellen Einschüchterungsmethoden für sein Waffenarsenal. Ein Termin um Viertel nach war ein brillantes Manöver. Niemand brachte es fertig, absolut pünktlich zu kommen. Das verschaffte ihm einen moralischen Vorteil, der es ihm erlaubte, den Ton des Gesprächs zu bestimmen. Und für dieses Gespräch brauchte er unbedingt einen solchen Vorteil.
Grundstücksmakler waren bösartig wie Haie und hartnäckig wie Tintenfische, unbeweglich wie Seeigel und schleimig wie Algen. Rathore sah in den goldgerahmten Flurspiegel und grinste. Ihm gefiel die Präzision seines Gedankengangs, wie er mit seiner Metaphernkette strikt beim Meer geblieben war.
Sein Blick fiel auf den Tisch vor dem Spiegel. Der steinerne Khmer-Buddha, den er aus Kambodscha mitgebracht hatte, war um fünf Zentimeter verschoben, was das Arrangement zerstörte. Die Frau, die zum Saubermachen kam, war ein schlampiges Geschöpf. Zeit, sie loszuwerden, beschloss er, während er den Buddha wieder an seinen Platz rückte. Dann betrachtete er sich nochmals im Spiegel und zwirbelte ein Haar in seiner Augenbraue.
Er war ein gutaussehender Mann mit einem markanten Gesicht aus Flächen und Schatten. Seine Brauen waren buschig, zum Ausgleich war er immer glattrasiert. Er spielte zweimal pro Woche Squash und schwamm täglich fünfzehn Bahnen. Derzeit erwog er, einen Krav Maga-Kurs zu belegen, um seine Kampfkraft zu verbessern.
Er wusste, wie er auf andere wirkte: ansehnlich, stark, fit und zu allem bereit. Nur eins konnte er nicht ändern. Er war klein. Mit seinen eins sechzig in Socken fühlte er sich immer im Nachteil, wenn sein Gegenüber ihn überragte. Große Frauen hingegen mochte er. Fand sie sexy.
Es klingelte. Er betätigte die Gegensprechanlage. »Wer ist da?«
Eine Pause, dann eine leise, heisere Stimme in klarem, akzentfreiem Englisch. »Dr. Rathore, hier ist Pujary. Ich komme wegen der hundert Morgen in Hoskote.«
In wenigen Minuten würde der Tempel nach der abendlichen Puja schließen. Er hatte sich die ganze Hinfahrt zum Tempel immer wieder entschuldigt, bis sie ihm die Hand auf den Arm legte und murmelte: »Schon gut. Wir können ein andermal wiederkommen.«
»Nein, es ist nicht gut.« Er verzog das Gesicht. »Ich weiß, dass du aus gutem Grund dorthin wolltest, und ich hätte für heute Abend keine Termine machen dürfen.«
»Gatte, halt den Mund«, sagte sie sanft.
Er sah sie an und lächelte. »Ja, Gattin.«
Sie drückte zärtlich seinen Arm. Mit acht Jahren hatten sie sich in der Schule kennengelernt. Sie die Tochter des Schuldirektors, er der Sohn des Tempelpriesters, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Latur. Seitdem waren sie zusammen, erst in der Schule, dann auf dem College. Er war dann auf die Universität gegangen, während sie zu Hause blieb und an ihrer Aussteuer arbeitete, bis er um ihre Hand anhielt. Es hatte ohnehin nie jemand anderen gegeben.
Bei einem seiner Besuche in der Heimat hatten sie sich davongestohlen, um mit dem Rad zu den Kharosa-Höhlen zu fahren. Ein Ölfleck auf der Straße brachte sie ins Rutschen – er kam mit leichten Verletzungen davon, sie war von der Hüfte abwärts gelähmt. Falls ihre Familie Einwände gegen ihn gehabt hatte, lösten sich diese in Luft auf, als er die volle Verantwortung für den Unfall und ihr Leben übernahm. Da waren sie beide erst zwanzig.
Ein Jahr nach ihrer Hochzeit waren sie nach Bangalore gezogen. Zweiunddreißig Jahre Ehe, siebenundvierzig Jahre zusammen. Sie kannte den Wuchs jedes Härchens in jeder Pore seines Körpers. Sie wusste, dass auch er so fühlte. Und das bereitete ihr Sorgen.
»Hast du das alles nie satt?«, fragte sie.
»Wieso sagst du das?« Seine Hände umklammerten das Lenkrad. »Mache ich den Eindruck?«
»Wie kann jemand wie du sein? Jeden Tag, und das ist die Wahrheit, fast jeden Tag frage ich mich, ob ich dein Leben zerstört habe, dein Glück …«
»Ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Du bist alles, was ich je wollte. Also hör auf mit dem Blödsinn«, sagte er mit einem gespielten Knurren. So hatte er sie umworben, als sie acht waren. Er der jagende Löwe, sie das verlorene Reh.
Er parkte nahe am Eingang zum Tempel. Dann hob er sie vorsichtig auf seine Arme und trug sie nach drinnen. Es war kaum noch jemand da, doch der Priester wartete auf sie.
Er setzte sie vor einer Wand auf dem Boden ab und ging zurück zum Auto, um die Opfergaben zu holen.
»Wer ist das?«, fragte einer der Gläubigen.
Ein anderer zuckte die Achseln. »Jemand, der sehr reich ist. Warum sonst wäre der Tempel so spät noch offen? Ich habe ihn und seine Frau schon ein paarmal hier gesehen.«
Pujary kam mit einer Platte voll mit Obst und Blumen, einer Kokosnuss und einem kleinen Geldbündel zurück. Der Priester machte große Augen. Was auf dem Archana-Teller lag, gehörte ihm. Das mussten an die tausend Rupien sein. Er konnte seine Freude nicht verbergen.
Der Priester nahm die Platte entgegen. Die Frau sagte zu ihm: »Bitte sprechen Sie die Archana im Namen von Sharad Pujary, Revati Nakshatra, Bharadwaja Gotra.«
Der Priester entzündete Lichter und läutete die Glocke. Er hob eine Leuchte in die Höhe und begann die Namen der Gottheit zu singen, alle einhundertacht, während er um ihre Statue herumschritt. Göttliche Mächte wurden beschworen, um Sharad Pujary Unversehrtheit, Gesundheit, Reichtum und Zufriedenheit zu bescheren.
»Glücklich?«, fragte er sie, als sie auf dem Heimweg waren.
»Wann auch nicht, mein Gatte?« Sie erwiderte sein Lächeln. »Solange du bei mir bist …«
»Ich muss morgen nach Chennai«, sagte er. Gita nickte, ohne ihn anzusehen. Sie mochte es nicht, wenn er die Stadt verließ. »Zum Abendessen bin ich zu Hause«, sagte er besänftigend.
»Um elf Uhr abends.«
»Nein, zu unserer Essenszeit. Versprochen.«
Später, nachdem sie zu Abend gegessen hatten und er sie ins Bett vor den Fernseher gelegt hatte, ging er nach unten in sein Arbeitszimmer, fuhr seinen Laptop hoch und stellte das Handy an. Er setzte sich an den Schreibtisch und schaute die Unmenge an E-Mails in seinem Posteingang und die vielen verpassten Anrufe auf dem Handy durch.
Das Telefon klingelte. Er warf einen Blick darauf und nahm ab. »Ich will weder Entschuldigungen noch Erklärungen. Gib mir einfach den Tagesbericht«, sagte er. Seine heisere Stimme blieb unverändert ruhig.
Dem Mann am anderen Ende der Leitung stellten sich die Nackenhaare auf, denn er vernahm die Drohung in Pujarys Ton.
Freitag, 6. März
Der Zug hielt mit einem Ruck, gefolgt von einem langen Stöhnen und Zittern. Gowda öffnete die Augen und starrte an die Metalldecke des Abteils, ohne sich erinnern zu können, wo er war.
Dann fiel es ihm wieder ein: der Prashanthi Express aus Bhubaneshwar auf dem Weg nach Bangalore. Er sah auf die Uhr. Halb zwölf am Vormittag. Wie lange hatte er geschlafen? Er stemmte sich auf einen Ellenbogen und spähte von seiner Schlafkoje hinab. Police Constable Byrappa war ganz in sein Handydisplay versunken, und Police Constable Devraj spielte Sudoku.
Byrappa sah auf und Gowda in die Augen. »Wo sind wir?«, fragte Gowda.
»Wir haben gerade den Cantonment-Bahnhof verlassen, Sir«, sagte Byrappa.
Gowda sah ihn fassungslos an. »Aber warum habt ihr mich nicht geweckt? Wir hätten aussteigen können.«
»Ich hab’s versucht«, murmelte Byrappa. »Aber Sie haben gesagt, ich soll die Klappe halten oder Sie würden mich zum Schweigen bringen.« Devraj bestätigte das mit einem eifrigen Nicken. »Außerdem, Sir, haben Sie im Schlaf so friedlich ausgesehen, dass wir Sie nicht stören mochten.«
Gowda stöhnte und ließ sich aufs Kissen zurücksinken. Die beiden Constables hätten eigentlich in einem Schlafsesselabteil fahren sollen, wie es ihrem Rang entsprach. Aber in dem klimatisierten Abteil, das ihm zustand, war er auf zwei unbesetzte Liegen gestoßen, hatte für ein Upgrade gesorgt und die Differenz aus eigener Tasche gezahlt. Woraufhin sich die beiden Trottel aus falsch verstandener Dankbarkeit nicht die Mühe gemacht hatten, ihn zu wecken.
Eingestiegen waren sie am Vorabend um kurz nach elf am Bahnhof Markapur Road. Bis drei Uhr früh hatte Gowda keinen Schlaf gefunden. Wieder mal eine völlig ergebnislose Reise. Und er hatte gewusst, dass es so kommen würde, noch bevor sie nach Markapur aufbrachen. Sie hatten eine Meldung über die Festnahme eines Mannes hereinbekommen, der einen Geldautomaten ausgeraubt hatte. Die Vorgehensweise ließ vermuten, dass er zu einer Gang gehören könnte, die in Gowdas Revier zwei Automaten geplündert hatte. Assistant Commissioner of Police Vidyaprasad verfügte, dass Gowda dem nachgehen und den Beschuldigten, wenn nötig, mitbringen sollte. Das hätte auch ein Sub-Inspector erledigen können, aberACPVidyaprasad hatte Gowda nicht verziehen, dass der ihn bei der letzten Ermittlung bloßgestellt hatte. Also musste Inspector Gowda mit zwei Constables im Schlepptau auf Erkundungsreise gehen. Normalerweise hätte er dagegen protestiert, aber es gab da noch etwas, worum er sich kümmern wollte. Und eine Dienstreise bot den perfekten Vorwand, um etwas anzugehen, das seit sieben Monaten auf Erledigung wartete.
Immer mal wieder kam er ins Brüten. Es war eine Serie von scheinbar zusammenhangslosen Morden gewesen, bis auf die klaffende Schnittwunde in den Kehlen der Opfer. Und als er dem Täter endlich auf die Spur kam, war es zu spät. Er brauchte nur an jenen grauenhaften Augenblick auf dem Fußboden der Fabrik zu denken, schon packte ihn die Furcht wieder wie eine kalte Klaue.
Er schloss die Augen und hielt den Atem an. Ruhig, ruhig, sagte er zu seinem wild pochenden Herz. Sieben Monate waren vergangen, aber es fühlte sich an, als wären die Ereignisse jener Nacht gerade erst geschehen. Und so würde es wohl auch bleiben, bis Sub-Inspector Santosh wieder auf den Beinen war und der Mörder endlich im Gefängnis auf seine Verhandlung wartete, statt auf Kaution auf freiem Fuß zu sein, mittlerweile als »abgängig« eingestuft.
Kurz nach zwölf kam der Zug auf Bahnsteig 3 der Bangalore City Station ruckelnd zum Stehen. Gowda zog seinen Koffer unter der untersten Pritsche hervor und eilte zur Tür. Er hatte ein pelziges Gefühl im Mund und verquollene Augen. Erst mal ein Kaffee und etwas zu essen. Bis dahin würde PC David mit dem Jeep eingetroffen sein.
Byrappa und Devraj warteten schon auf dem Bahnsteig, während Gowda sich von der Waggontür aus einen Überblick verschaffte. Nur ein paar Meter weiter befand sich die Rettungsstation von Bosco. Als sie daran vorbeikamen, warf Gowda einen Blick hinein. Der Raum war klein und vollgestopft mit einem Tisch, ein paar Stühlen und einer langen Bank. Ein Wandventilator rührte die heiße Luft um. Zwei Kinder unbestimmten Alters saßen herum, eine Frau und ein Mann redeten mit ihnen. Unter einem Stuhl schlief ein Hund.
»Die Bahn verlangt von den Bosco-Leuten dieselbe Miete wie von einem Straßenhändler. Das ist kriminell, Sir! Zwanzigtausend Rupien im Monat, habe ich gehört. Jemand sollte was unternehmen!«, empörte sich Devraj.
»Woher weißt du das?«, fragte Byrappa und betrachtete die Plakate.
»Meine Schwester arbeitet hier mit. Sie hat’s mir erzählt.«
Gowda nickte zustimmend. Sein alter Collegefreund Michael hatte ihm auch schon davon berichtet. Michael Hunt war vor sieben Monaten nach Bangalore zurückgekehrt, um ein geerbtes Haus in Whitefield zu verkaufen, und hatte sich zum Bleiben entschieden. »Was soll ich denn noch in Melbourne?«, hatte er bei einem Telefonat vor zwei Monaten gesagt. »Nein, Bob, ich muss da raus und was tun.«
Gowda hatte bei dem Wort gelächelt: Bob. »Was denn, Machan?«
Wie leicht waren sie wieder in ihre Jugendsprache aus längst vergangenen Tagen am St. Joseph’s College verfallen. Manchmal kam ihm in den Sinn, dass nur Michael und Urmila noch wussten, wie er früher gewesen war. Der große starke Basketballheld, der nie einen Korb verfehlte.
»Es gibt da so eine NGO, die sich um Kinder kümmert. Nennt sich Bosco«, sagte Michael. »Das ist nicht mehr die Stadt, in der wir beide aufgewachsen sind. Die Bosco-Leute nehmen sich gefährdeter Kinder und Jugendlicher an, von denen gibt es unglaublich viele – Kinderarbeiter, Ausgesetzte und Waisen, Opfer von Drogenmissbrauch, Opfer von sexuellem Missbrauch, Straßenkinder, Lumpensammler. Sie haben sieben Therapiezentren und sechs Auffangstationen, um an die Kinder heranzukommen. Es ist nicht einfach, das alles mit Leuten zu besetzen und am Laufen zu halten. Daher habe ich mir überlegt, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Außerdem kann ich nicht den ganzen Tag zu Hause hocken und das Essen in mich reinstopfen, das Narsamma mir alle paar Stunden auftischt.«
Gowda trommelte nachdenklich mit den Fingern auf den Tisch, während Michael ihm mehr von seiner ehrenamtlichen Arbeit erzählte. »Machan, du solltest Urmila fragen, ob sie nicht auch mitmachen will«, warf er leise ein, als Michael zwischendurch Luft holte.
Am anderen Ende der Leitung trat Schweigen ein. Beredtes Schweigen, dachte Gowda. »Alles okay zwischen euch beiden?«, fragte Michael schließlich.
»Alles gut. Aber sie hat zu viel Zeit und nicht genug zu tun«, sagte Gowda. »Außerdem würde ihr genau so etwas sinnvoll erscheinen.«
Und mir etwas Luft verschaffen, dachte er beklommen. Das Problem mit Frauen war, dass sie erwarteten, die Flitterwochen würden ewig dauern. Das Adrenalin, die Erregung, die Anrufe, die Nachrichten, die heimlichen Treffen der ersten Monate waren zu etwas Beständigerem, aber auch Gesetzterem geworden.
Urmila, das spürte er, war nicht zufrieden damit. Aber er konnte das aufgeputschte, fiebrige Teenagergebaren nicht ewig fortsetzen. »Ich bin eher ein kalter, unemotionaler Typ«, hatte er wieder und wieder beteuert.