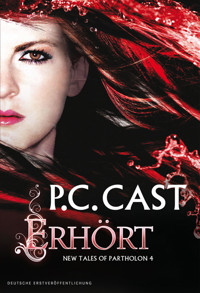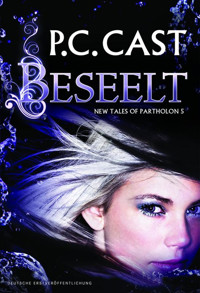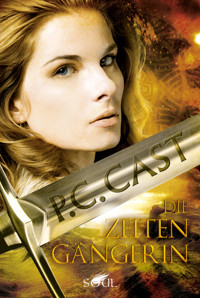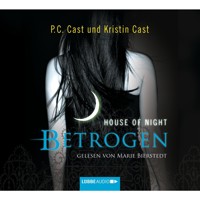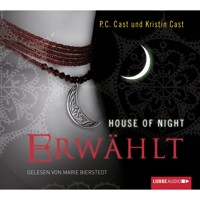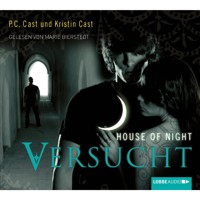9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: House of Night
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Was ist stärker: Die Bande der Freundschaft oder die Fesseln der Liebe? Neferet, die Hohepriesterin des House of Night in Tulsa, hat Rache geschworen an Zoey. Dabei ist der unsterbliche Kalona nur eine der Waffen, die sie einsetzen will. Doch Zoey hat Zuflucht bei Königin Sgiach auf der Isle of Skye vor der Küste Schottlands gefunden. Dort müssen sie und ihr Krieger Stark erst einmal wieder zu Kräften kommen. Außerdem möchte Sgiach sie zu ihrer Nachfolgerin ernennen. Warum soll sie also wieder nach Tulsa und zum House of Night zurückkehren? Nach dem Tod von Heath ist sowieso nichts mehr so wie früher. Und auch die Beziehung zu Stark könnte nicht mehr das sein, was sie einmal war. GEWECKT ist der achte Band der großen House of Night-Vampyr-Serie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Ähnliche
P.C. Cast | Kristin Cast
Geweckt/House of Night 8
Aus dem Amerikanischen von Christine Blum
Fischer e-books
Kristin und ich möchten dieses Buch allen LGBT-Jugendlichen widmen.
Nicht eure geschlechtliche Orientierung definiert euch, sondern euer Geist.
Es kann nur besser werden.
Wir stehen hinter euch.
Egal was ›sie‹ sagen: Im Leben geht es allein um Liebe –
die Liebe, auf immer und ewig.
Danksagung
Wie immer möchten wir unserer Familie bei St. Martin’s Press danken; es ist so herrlich, von ganzem Herzen sagen zu können, dass wir unseren Verlag lieben und wertschätzen!
Ein ganz lieber Gruß an unsere Agentin Meredith Bernstein, ohne die es kein House of Night geben würde.
Tausend Dank an unsere Fans – die schlausten, coolsten, BESTEN LESER IM GESAMTEN UNIVERSUM!
Und ein besonderes Dankeschön an unsere Fans daheim in Tulsa. Die House of Night Tulsa Tour mit euch war ein Riesenspaß!
Ganz herzlich danken wir Stephen Schwartz dafür, dass wir den Text seines zauberhaften Songs verwenden durften. (Jack liebt Sie auch, Stephen!)
P. S.: An Joshua Dean von Phyllis: Danke für die Zitate! Hihihihi!
Eins
Neferet
Ein unangenehmes Gefühl der Gereiztheit weckte Neferet. Noch ehe sie das gestaltlose Reich zwischen Traum und Wachen ganz verließ, streckte sie die langen, eleganten Finger aus und tastete nach Kalona. Der Arm, den sie zu fassen bekam, war muskulös, die Haut unter ihren Fingerspitzen zart, straff und appetitlich. Schon auf ihre federleichte Berührung hin rührte er sich und wandte sich ihr zu.
»Meine Göttin?« In seiner Stimme lagen Schläfrigkeit und der erste Keim neuen Verlangens.
Sie war wütend auf ihn.
Sie war wütend auf sie alle, weil sie nicht er waren.
»Verschwinde … Kronos.« Sie musste erst in ihrem Gedächtnis nach seinem lächerlichen, viel zu ehrgeizigen Namen suchen.
»Habe ich etwas getan, um Euch zu verärgern, Göttin?«
Neferet schielte zu ihm hinüber. Der junge Sohn des Erebos lag neben ihr auf dem Bett und sah sie mit offenem, willigem Gesichtsausdruck an. Seine aquamarinfarbenen Augen waren im Dämmerschein ihres kerzenerleuchteten Schlafzimmers nicht weniger eindrucksvoll als einige Stunden zuvor beim Training draußen auf dem Burghof. Dort hatte er ihr Verlangen geweckt, und auf ihren einladenden Blick hin war er bereitwillig mit ihr gekommen und hatte enthusiastisch, wenn auch vergeblich, zu beweisen versucht, dass seine Göttlichkeit sich nicht nur auf seinen Namen erstreckte.
Das Problem war: Neferet hatte schon in den Armen eines Halbgottes gelegen. Sie wusste nur zu genau, welch ein Blender dieser Kronos war.
Gelangweilt erwiderte sie seinen Blick. »Ja, atmen.«
»Atmen, meine Göttin?« Verwirrt runzelte er die Stirn, auf der ein Tattoo prangte, das eigentlich Streitkolben und Morgensterne darstellen sollte, sie aber eher an ein kitschiges Feuerwerk zum 4. Juli erinnerte.
»Du hast gefragt, womit du mich verärgert hast, und ich habe geantwortet: indem du geatmet hast. Und zwar viel zu nahe bei mir. Das hat mich verärgert. Es ist an der Zeit, dass du aus meinem Bett verschwindest.« Sie seufzte und winkte nachlässig mit der Hand. »Geh schon, los.«
Fast lachte sie laut auf, als sie das offenkundige Entsetzen und sein gekränktes Gesicht sah.
Hatte der Junge wirklich geglaubt, ihren göttlichen Gefährten ersetzen zu können? Diese Unverfrorenheit fachte ihren Zorn nur noch mehr an.
In den dunklen Ecken ihres Schlafzimmers erbebten voller Erwartung tiefe Schatten. Sie ließ sich nichts anmerken, aber sie spürte und genoss es.
»Kronos, du hast mich ein paar Stunden lang gut unterhalten und mir ein gewisses Maß an Vergnügen bereitet.« Wieder berührte sie ihn, diesmal nicht so sanft. Ihre Fingernägel hinterließen erhabene Striemen auf seinem muskulösen Unterarm. Der junge Krieger zuckte nicht zusammen und entzog ihr auch nicht den Arm. Die Berührung ließ ihn erzittern, und sein Atem beschleunigte sich. Neferet lächelte. In dem Moment, da sie ihm in die Augen gesehen hatte, hatte sie gewusst, dass dieser hier Schmerz brauchte, um Begehren zu fühlen.
»Ich würde Euch noch mehr Vergnügen bereiten, wenn Ihr es erlaubtet«, sagte er.
Neferet lächelte. Langsam fuhr sie sich mit der Zungenspitze über die Lippen, während sie ihn dabei beobachtete, wie er sie mit Blicken verschlang. »Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Jetzt wünsche ich mir von dir, dass du mich verlässt – und natürlich, dass du mich weiterhin verehrst.«
»Ich wollte, ich könnte Euch zeigen, wie sehr ich mich danach sehne, Euch noch einmal zu verehren.« Die letzten Worte waren eine verbale Liebkosung, und dann beging Kronos einen großen Fehler – er streckte die Hand nach ihr aus.
Als hätte er das Recht, sie zu berühren.
Als hätte sie ihre Wünsche seinen Trieben unterzuordnen.
Aus der Tiefe ihrer verschütteten Erinnerungen stieg ein winziges Echo ihrer fernen Vergangenheit auf – einer Zeit, die sie gemeinsam mit ihrer Menschlichkeit begraben zu haben glaubte. Plötzlich überlagerte ihre Kindheit die Gegenwart, und sie spürte die Berührung ihres Vaters und konnte sogar seinen fauligen, alkoholgeschwängerten Atem riechen.
Neferet reagierte sofort. Leicht wie ein Atemzug hob sie die Hand von seinem Arm und hielt sie, Handfläche nach außen, einem der Schatten in den Zimmerecken entgegen.
Noch weit schneller als Kronos reagierte die Finsternis auf ihre Berührung. Neferet genoss die von ihr ausgehende tödliche Kälte, vor allem weil diese die Erinnerung zurückdrängte. Fast beiläufig schleuderte sie die Finsternis auf Kronos. »Wenn es Schmerz ist, wonach dich so verlangt, so koste mein eisiges Feuer.«
Begierig drang die Finsternis in die junge, zarte Haut des Kriegers ein und verzierte den Arm, den Neferet soeben noch gestreichelt hatte, mit dünnen scharlachroten Bändern. Er stöhnte auf, doch diesmal mehr vor Angst denn vor Verlangen.
»Und nun tu, was ich dir befohlen habe. Lass mich allein. Und denk daran, junger Krieger, dass eine Göttin selbst entscheidet, wann, wo und wie sie berührt wird. Überschreite nie wieder deine Befugnisse.«
Die Hand um den blutenden Arm gekrampft, verneigte Kronos sich tief vor ihr. »Ja, meine Göttin.«
»Göttin? Drück dich genauer aus, Krieger! Ich schätze es nicht, mit unbestimmten Titeln bedacht zu werden.«
Er berichtigte sich unverzüglich. »Fleischgewordene Nyx. So lautet Euer Titel, meine Göttin.«
Ihr drohender Blick wurde weicher. Ihr Gesicht verwandelte sich wieder in eine Maske der Schönheit und Freundlichkeit. »Sehr gut, Kronos. Sehr gut. Siehst du, wie einfach es ist, mir zu gefallen?«
Gebannt von ihrem smaragdgrünen Blick nickte Kronos knapp und ballte dann die Faust über dem Herzen. »Ja, meine Göttin, meine Nyx.« Unterwürfig verließ er im Rückwärtsgang ihr Zimmer.
Wieder lächelte Neferet. Dass sie in Wahrheit keine Inkarnation von Nyx war, war unwesentlich. Tatsächlich war Neferet nicht sehr erpicht darauf, die Rolle einer fleischgewordenen Göttin zu spielen. »Das impliziert lediglich, dass ich etwas Geringeres bin als eine wahre Göttin«, sprach sie zu den um sie versammelten Schatten. Wichtig war allein, Macht zu haben – und wenn der Titel der Fleischgewordenen Nyx ihr half, Macht anzuhäufen, vor allem in Form der Söhne des Erebos, war es der Titel, den sie annehmen würde. »Aber was ich anstrebe, ist weit mehr, als im Schatten einer Göttin zu stehen.«
Bald schon würde sie für ihren nächsten Schritt bereit sein, und sie wusste, dass einige Söhne des Erebos sich überzeugen lassen würden, ihr zur Seite zu stehen. Oh, nicht so viele, als dass man mit Hilfe ihrer Körperkraft eine Schlacht gewinnen könnte, aber genug, um die Moral des Kriegerverbunds zu schwächen, indem sie Bruder gegen Bruder stellte. Männer, dachte sie verächtlich, wie leicht sind sie durch Schönheit und Titel zu blenden, und wie leicht kann man sie sich für seine Pläne gefügig machen.
Der Gedanke gefiel ihr, lenkte sie aber nicht genug ab, um ihre Rastlosigkeit zu verscheuchen. Sie stieg aus dem Bett, schlüpfte in einen hauchdünnen Seidenkimono und begab sich hinaus in den Gang. Ehe sie genauer darüber nachdachte, war sie schon auf dem Weg zu der Treppe, die in die dunkelsten Tiefen der Burg führte.
Lautlos zogen Schatten hinter ihr her, dunkle Magnete, angezogen von ihrer zunehmenden Erregung. Neferet war sich ihrer bewusst. Sie kannte ihre Gefährlichkeit, wusste, dass sie sich von ihrem Unwohlsein, ihrem Zorn, ihrer Rastlosigkeit nährten. Dennoch war es seltsam tröstlich, sie in der Nähe zu haben.
Nur einmal hielt sie auf ihrem Weg in die Tiefe inne. Warum besuche ich ihn schon wieder? Warum gestatte ich ihm auch heute Nacht, sich in meine Gedanken zu schleichen? Neferet schüttelte den Kopf, wie um die stummen Worte zu verscheuchen, und sprach in den leeren, engen Treppenschacht hinein, zu der Finsternis, die aufmerksam neben ihr waberte: »Ich besuche ihn, weil es mein Wunsch ist. Kalona ist mein Gefährte. Er wurde in meinem Dienst verwundet. Es ist nur natürlich, wenn ich an ihn denke.«
Mit selbstzufriedenem Lächeln stieg Neferet weiter die gewundenen Stufen hinunter. Es bereitete ihr keine Mühe, die Wahrheit zu verdrängen: dass Kalona verwundet worden war, weil sie ihn gefangen hatte, und der Dienst, den er ihr erwies, ein erzwungener war.
Dann erreichte sie den Kerker, der vor vielen Jahrhunderten hier unten in den felsigen Grund Capris gehauen worden war, und schritt lautlos den fackelerhellten Gang entlang. Der Sohn des Erebos, der vor dem verriegelten Raum Wache stand, konnte ein überraschtes Zusammenzucken nicht unterdrücken. Neferets Lächeln vertiefte sich. Sein entgeisterter, fast furchtsamer Gesichtsausdruck zeigte ihr, dass sie immer besser darin wurde, scheinbar aus Schatten und Nacht Gestalt anzunehmen. Ihre Laune verbesserte sich, aber nicht so weit, dass der unbarmherzige Befehlston in ihrer Stimme etwa durch ein Lächeln gemildert worden wäre.
»Geh. Ich will mit meinem Gefährten alleine sein.«
Der Sohn des Erebos zögerte nur einen Moment lang, doch die winzige Pause genügte Neferet, um sich im Stillen vorzunehmen, dafür zu sorgen, dass dieser Krieger in den nächsten Tagen nach Venedig zurückberufen werden würde. Vielleicht, weil einer ihm nahestehenden Person ein Unglück zustoßen würde …
»Priesterin, ich überlasse Euch ganz Euch selbst. Aber wisst, dass ich in Rufweite sein und sofort herbeigeeilt kommen werde, solltet Ihr meiner bedürfen.« Ohne ihr in die Augen zu blicken, verneigte er sich mit der Faust über dem Herzen – doch nicht tief genug.
Neferet sah ihm nach, wie er in dem engen Gang verschwand.
»Ja«, flüsterte sie den Schatten zu. »Ich spüre, dass seiner Gemahlin etwas höchst Unerfreuliches zustoßen wird.«
Sie strich ihren seidenen Überwurf glatt und wandte sich der verschlossenen Eichentür zu. Tief atmete sie die feuchte Kerkerluft ein und strich sich ihr dichtes kastanienbraunes Haar aus dem Gesicht, entblößte ihre Schönheit, als gürtete sie sich zum Kampf.
Auf einen Wink von ihr öffnete sich wie von selbst die Tür, und sie betrat den Raum.
Kalona lag auf der nackten Erde. Sie hätte gern ein Bett für ihn aufgestellt, doch sie musste Umsicht walten lassen. Nicht, dass sie ihn gefangen hielt – sie handelte lediglich vernünftig. Kalona musste seine Aufgabe für sie erfüllen, das war auch in seinem Interesse. Doch wenn sein Körper zu viel von seiner unsterblichen Kraft regenerierte, würde ihn das ablenken, und das wäre höchst ungünstig. Schließlich hatte er ihr versprochen, in der Anderwelt ihr Schwertarm zu sein und ihnen beiden die Unannehmlichkeit vom Hals zu schaffen, die Zoey Redbird in dieser Zeit, in dieser Realität für sie darstellte.
Neferet trat zu Kalonas Körper. Ihr Gefährte lag flach auf dem Rücken, nackt, nur in seine onyxfarbenen Flügel gehüllt wie in einen Schleier. Anmutig sank sie auf die Knie, streckte sich auf dem Lager aus dicken Tierfellen aus, das sie zu ihrer Bequemlichkeit hier hatte ausbreiten lassen, und betrachtete ihn.
Mit einem Seufzer berührte sie seine Wange.
Seine Haut war kühl wie immer, fühlte sich aber leblos an. Auf ihre Anwesenheit zeigte er nicht die geringste Reaktion.
»Was hält dich so lange auf, mein Geliebter? Kannst du nicht schneller mit diesem lästigen Kind fertigwerden?«
Wieder streichelte sie ihn; diesmal glitt ihre Hand von seinem Gesicht in seine Halsbeuge, weiter seine Brust hinab und hielt erst auf dem wohlgeformten Relief seiner Bauch- und Hüftmuskeln inne.
»Denk an deinen Schwur und erfülle ihn, damit ich dich wieder in meine Arme schließen und in mein Bett lassen kann. Bei Blut und Finsternis hast du geschworen, Zoey Redbird daran zu hindern, ihren Körper wieder in Besitz zu nehmen, auf dass sie vernichtet werde und mir der Weg offenstehe, über diese magische Welt der Moderne zu herrschen.« Verstohlen lächelnd ließ Neferet die Hand noch einmal über die schlanken Hüften des gefallenen Unsterblichen gleiten. »Oh, und natürlich wirst du dann den Platz an meiner Seite einnehmen.«
Unsichtbar für die törichten Söhne des Erebos, die sich einbildeten, sie für den Hohen Rat ausspionieren zu können, erzitterten die schwarzen spinnennetzartigen Stränge, die Kalona auf der Erde gefangen hielten, und streiften eisig Neferets Handrücken. Betört von ihrer verlockenden Kälte öffnete sie die Hand und ließ zu, dass die Finsternis sich ihr ums Handgelenk wand und kaum merklich in die Haut schnitt – nicht so, dass der Schmerz unerträglich gewesen wäre, nur so weit, um vorübergehend ihren unersättlichen Durst nach Blut zu stillen.
Da fielen Worte über sie her wie ein frostiger Sturm über einen kahlen Baum. Denk an deinen Eid …
Neferets Miene verfinsterte sich. Es war nicht notwendig, sie daran zu erinnern. Natürlich war sie sich ihres Eides bewusst. Im Austausch dafür, dass die Finsternis ihr zu Diensten war – dass sie Kalonas Körper gefangen hielt und seine Seele in die Anderwelt eingeschleust hatte –, hatte sie sich bereiterklärt, eine unschuldige Seele zu opfern, die niemals von der Finsternis befleckt worden war.
Wieder umwehten sie Worte. Der Eid hat Bestand, Tsi Sgili, selbst wenn Kalona versagen sollte …
»Kalona wird nicht versagen!«, rief Neferet, außer sich vor Zorn, dass auch die Finsternis es wagte, sie zurechtzuweisen. »Und falls doch, ist sein Geist an meinen gebunden, solange er unsterblich ist, so dass selbst sein Versagen ein Sieg für mich wäre. Aber er wird nicht versagen.« Langsam und deutlich wiederholte sie den Satz, um die Kontrolle über ihr zunehmend unbeständiges Temperament wiederzuerlangen.
Die Finsternis leckte an ihrer Handfläche. So gering der Schmerz war, sie genoss ihn und betrachtete zärtlich die schwarzen Stränge, als wären sie nichts als Kätzchen, die übereifrig um ihre Aufmerksamkeit buhlten.
»Habt Geduld, meine Lieblinge. Seine Mission ist noch nicht beendet. Mein Kalona ist immer noch eine bloße Hülle. Ich kann nur annehmen, dass Zoey weiter in der Anderwelt schmachtet – nicht voll am Leben und leider noch nicht gänzlich tot.«
Die Stränge um ihr Handgelenk erzitterten, und einen flüchtigen Moment lang war es Neferet, als höre sie in der Ferne spöttisches Gelächter.
Doch sie hatte keine Zeit, sich zu überlegen, was das Geräusch bedeuten mochte – ob es real war oder nur ein weiterer Bestandteil der sich stetig ausdehnenden Welt der Finsternis und Macht, die mehr und mehr von dem verschlang, was sie einst als Wirklichkeit gekannt hatte –, denn in diesem Augenblick verkrampfte sich Kalonas gefesselter Leib, und er rang keuchend nach Luft.
Sofort flog ihr Blick zu seinem Gesicht, und so wurde sie Zeuge des entsetzlichen Anblicks, wie seine Augen sich öffneten und nichts als blutige, leere Augenhöhlen enthüllten.
»Kalona! Geliebter!« Neferet beugte sich über ihn und nahm fahrig sein Gesicht zwischen die Hände.
Die Finsternis, die ihre Handgelenke liebkost hatte, dehnte sich in einem plötzlichen Einstrom von Macht aus, was Neferet zusammenzucken ließ, löste sich dann abrupt von ihr und gesellte sich zu den Myriaden klebriger Tentakel, die wie ein Netz pulsierend unter der Gewölbedecke des Kerkers schwebten.
Ehe Neferet einem von ihnen den Befehl geben konnte, zu ihr zu kommen – ihr eine Erklärung für ihr bizarres Benehmen zu liefern –, blitzte an der Decke ein gleißendes Licht auf, so grell, dass sie die Augen mit der Hand schützen musste.
Im nächsten Atemzug bemächtigte sich die Finsternis des Lichts, zog sich mit unirdischer Brutalität darum zusammen und fing es ein.
Kalona öffnete den Mund zu einem tonlosen Schrei.
»Was ist los? Ich verlange zu erfahren, was hier geschieht!«, rief Neferet.
Dein Gefährte ist zurückgekehrt, Tsi Sgili.
Unter Neferets Augen riss die Finsternis die gefangene Sphäre aus Licht von der Decke und trieb Kalonas Seele mit grausamem Zischen durch dessen leere Augenhöhlen in seinen Körper.
Der geflügelte Unsterbliche krümmte sich vor Schmerzen. Er presste die Hände vors Gesicht und schnappte keuchend und unregelmäßig nach Luft.
»Kalona! Mein Gefährte!« Neferet handelte automatisch, wie zu der Zeit, als sie noch eine junge Heilerin gewesen war. Sie legte ihre Hände über Kalonas, erlangte rasch und geübt den Zustand tiefer Sammlung, der vonnöten war, und sagte: »Lindere seine Qual … tröste ihn … lass seine Agonie wie die sinkende Sonne sein, die milder wird und mit einem winzigen Aufblitzen vor dem wartenden Nachthimmel hinter den Horizont entschwindet.«
Fast augenblicklich wurden die Krämpfe, die Kalona durchliefen, schwächer. Der geflügelte Unsterbliche tat einen tiefen Atemzug. Seine Hände zitterten, als er sie von seinem Gesicht nahm und fest um die ihren schloss. Dann öffnete er die Augen, und sie waren klar und scharf, von jener tiefen Honigfarbe, die edlen Whisky auszeichnet. Er war wieder voll und ganz er selbst.
»Du bist zu mir zurückgekehrt!« Einen Moment lang überkam Neferet solche Erleichterung, ihn wach und bei klarem Verstand zu sehen, dass sie fast in Tränen ausgebrochen wäre. »Du hast deine Mission erfüllt.« Sie strich die Tentakel beiseite, die sich weiter an ihn klammerten, und betrachtete sie finster wegen ihrer zähen Weigerung, von ihrem Geliebten abzufallen.
»Nimm mich von der Erde weg.« Seine Stimme war nach seinem langen Schweigen heiser, doch er sprach in sicherem Ton. »Zum Himmel. Ich muss den Himmel sehen.«
»Ja, natürlich, mein Geliebter.« Neferet winkte mit der Hand, und die Tür öffnete sich wieder. »Krieger! Mein Gefährte erwacht. Hilf ihm hinauf aufs Dach!«
Der Sohn des Erebos, über den sie vorhin so aufgebracht gewesen war, gehorchte ihrem Befehl ohne Widerrede. Neferet bemerkte, dass Kalonas plötzliche Wiedererweckung ihn zu bestürzen schien.
Neferet schenkte ihm ein beißendes, überlegenes Lächeln. Warte nur, bis du die ganze Wahrheit kennst. Sehr bald werden du und deine Gefährten eure Befehle allein von mir entgegennehmen – oder ausgelöscht werden. Genüsslich gab sie sich diesem Gedanken hin, während sie den beiden Männern aus den Tiefen der uralten Festung nach oben folgte, die steinerne Wendeltreppe hinauf, immer höher, bis sie schließlich auf der Dachterrasse anlangten.
Es war nicht lange nach Mitternacht. Der Mond hing schon tief über dem Horizont, gelb und schwer, doch noch nicht ganz voll.
»Hilf ihm auf die Bank und lass uns dann allein.« Neferet deutete auf die kunstvoll behauene Marmorbank dicht vor der Brüstung, von der aus man eine wahrhaft herrliche Aussicht über das glitzernde Mittelmeer vor Capri hatte. Doch Neferet war die Schönheit ihrer Umgebung gleichgültig. Mit einer herrischen Geste entließ sie den Krieger und entledigte sich zugleich jedes Gedankens an ihn, wohl wissend, dass er den Hohen Rat darüber unterrichten würde, dass die Seele ihres Gefährten in seinen Körper zurückgekehrt war.
Momentan spielte das keine Rolle. Damit konnte sie sich später beschäftigen.
Jetzt waren nur zwei Dinge von Bedeutung: Kalona war zu ihr zurückgekehrt, und Zoey Redbird war tot.
Zwei
Neferet
»Sprich. Erzähl mir alles klar und ausführlich. Ich möchte jedes Wort auskosten.« Neferet kniete sich vor Kalona hin und streichelte die dunklen, weichen Flügel, die lose um den Unsterblichen spielten, der auf der Bank saß, das Gesicht dem Nachthimmel zugewandt, seine gebräunte Haut vom goldenen Mondlicht überflutet. Sie versuchte ein Beben zu unterdrücken, als sie sich vorstellte, wie er sie wieder berühren würde – wie seine eisige Leidenschaft, sein gefrorenes Herz wieder ihr gehören würden.
Er erwiderte ihren Blick nicht, sondern bot sein Gesicht der Ferne dar, als wolle er in tiefen Zügen den Nachthimmel trinken. »Was soll ich dir denn erzählen?«
Seine Frage verblüffte sie. Ihre Lust verebbte, und sie hielt inne, seinen Flügel zu streicheln.
»Ich möchte, dass du mir alle Einzelheiten unseres Sieges schilderst, damit wir uns gemeinsam über deine Erzählung freuen können.« Sie sagte es ganz langsam, weil sie dachte, sein Gehirn könnte durch die kürzliche Entfernung seiner Seele noch beeinträchtigt sein.
»Unseres Sieges?«
Neferets grüne Augen verengten sich. »In der Tat. Du bist mein Gefährte. Dein Sieg ist auch der meine, so wie der meine auch der deine wäre.«
»Deine Gnade ist beinahe göttlich. Bist du während meiner Abwesenheit etwa zur Göttin geworden?«
Neferet musterte ihn genau. Noch immer sah er sie nicht an; seine Stimme war fast ausdruckslos. Sollte das eine Unverschämtheit sein? Sie tat seine Frage mit einem Achselzucken ab, beobachtete ihn aber weiterhin genau. »Was ist in der Anderwelt passiert? Wie ist Zoey gestorben?«
In dem Moment, als seine Bernsteinaugen sich endlich auf sie richteten, wusste sie, was er sagen würde, und in kindischer Verleugnung presste sie die Hände auf die Ohren und schüttelte verbissen den Kopf, während er die Worte sprach, die sich wie ein Schwertstreich in ihre Seele bohrten.
»Zoey Redbird ist nicht tot.«
Neferet zwang sich, die Hände von den Ohren zu nehmen. Sie stand auf, brachte einige Schritte Abstand zwischen sich und Kalona und starrte auf den flüssigen Saphir der nächtlichen See hinaus, ohne wirklich etwas zu sehen. Mit langsamen, bedächtigen Atemzügen bemühte sie sich, ihr brodelndes Temperament unter Kontrolle zu bekommen. Als sie sicher war, dass sie wieder sprechen konnte, ohne ihren Zorn in den Himmel hinauszuschreien, sagte sie: »Warum? Warum hast du deine Mission nicht erfüllt?«
»Es war deine Mission, Neferet. Niemals die meine. Du hast mich gezwungen, in ein Reich zurückzukehren, aus dem ich verbannt worden war. Was geschehen ist, war vorhersehbar: Zoeys Freunde sind ihr zur Seite gesprungen. Mit ihrer Hilfe konnte sie ihre zerschmetterte Seele heilen und ihre Persönlichkeit wiederfinden.«
»Warum hast du es nicht verhindert?« Sie sagte es eisig, ohne ihm den geringsten Blick zu schenken.
»Nyx.«
Der Name kam über seine Lippen wie ein Gebet – weich, tief, ehrfurchtsvoll. Ein Speer der Eifersucht durchbohrte sie.
»Was war mit ihr?«, zischte sie.
»Sie hat eingegriffen.«
Neferet wirbelte herum. Fassungslosigkeit, gemischt mit Furcht, raubte ihr den Atem. »Was? Du willst mich glauben machen, dass Nyx sich wahrhaftig in die freie Wahl der Sterblichen eingemischt hat?«
»Nein.« Kalona klang sehr müde. »Sie hat sich nicht eingemischt; sie hat eingegriffen, und das erst, als Zoey sich bereits selbst geheilt hatte. Nyx hat sie dafür gelobt. Unter anderem war es dieses Lob, das zur Rettung Zoeys und ihres Kriegers führte.«
»Zoey lebt«, sagte Neferet flach, kalt, leblos.
»Ja.«
»Dann schuldest du mir den Gehorsam deiner unsterblichen Seele.« Sie wandte sich ab und ging auf den Eingang des Treppenhauses zu.
»Wohin gehst du? Was geschieht jetzt?«
Angewidert von der unüberhörbaren Schwäche in seiner Stimme drehte Neferet sich um. Sie richtete sich hoch auf und breitete die Arme aus, so dass die klebrigen Fäden ungehindert ihre Haut liebkosen konnten.
»Was jetzt geschehen wird? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass Zoey nach Oklahoma zurückkehrt. Und dann werde ich aus eigener Kraft vollbringen, worin du versagt hast.«
»Und was wird aus mir?«, fragte der Unsterbliche ihren Rücken, als sie sich bereits wieder abgewandt hatte.
Wieder hielt sie inne und warf ihm über die Schulter einen Blick zu. »Auch du wirst nach Tulsa zurückkehren, doch wir werden nicht zusammen dorthin reisen. Erinnerst du dich nicht, mein Geliebter, dass du ein Mörder bist? Du bist für den Tod von Heath Luck verantwortlich.«
»Wir«, berichtigte er.
Sie lächelte samtig. »Nicht nach Auffassung des Hohen Rates.« Sie sah ihm in die Augen. »Folgendes wird geschehen. Du musst so schnell wie möglich deine Kraft zurückerlangen. Morgen bei Sonnenuntergang werde ich dem Hohen Rat berichten, dass deine Seele in deinen Körper zurückgekehrt ist und du mir gestanden hast, den Menschenjungen getötet zu haben, weil du glaubtest, sein Hass auf mich könnte mir gefährlich werden. Ich werde ihnen erklären, dass ich bei deiner Bestrafung Gnade walten ließ, weil du glaubtest, mich zu beschützen – dass ich dich nur mit hundert Schlägen auspeitschen und für hundert Jahre von meiner Seite verbannen ließ.«
Kalona setzte sich mit Mühe auf. Erfreut sah Neferet in seinen Bernsteinaugen Zorn aufblitzen. »Du willst ein Jahrhundert lang meine Berührung entbehren?«
»Natürlich nicht. Ich werde dir gnädig erlauben, an meine Seite zurückzukehren, nachdem deine Wunden verheilt sind. Doch auch bis dahin werde ich auf deine Liebkosungen nicht verzichten; sie werden nur fernab der neugierigen Blicke der Öffentlichkeit stattfinden.«
Seine Brauen hoben sich. Wie arrogant er doch aussah, selbst in seiner Niederlage und Schwäche.
»Wie lange erwartest du, dass ich mich unter dem Vorwand, von nicht existierenden Wunden genesen zu müssen, in den Schatten verkriechen werde?«
»Ich erwarte, von dir getrennt zu sein, bis deine Wunden geheilt sind.« Mit einer raschen, sicheren Bewegung führte Neferet das Handgelenk an den Mund und biss so tief hinein, dass ein ovaler blutiger Abdruck entstand. Dann wirbelte sie den Arm in dichten Kreisen durch die Luft, und gierig wanden sich klebrige Fäden aus Finsternis darum, vom Blut angezogen wie Blutegel. Sie biss die Zähne zusammen und zwang sich, nicht zusammenzuzucken, während die Tentakel sich eins ums andere in sie bohrten. Sobald diese einen gesättigten Eindruck machten, sagte Neferet leise und zärtlich zu ihnen: »Ihr habt eure Bezahlung erhalten. Nun tut, was ich befehle.« Sie wandte den Blick ihrem unsterblichen Geliebten zu. »Peitscht ihn hundertmal aus. Und zwar kräftig.« Und sie schleuderte die Stränge auf Kalona.
Der geschwächte Unsterbliche konnte noch die Schwingen ausbreiten und auf die Brüstung zuspringen. Die rasiermesserscharfen Fäden erreichten ihn mitten im Sprung und wickelten sich um die empfindlichen Gelenke, wo seine Flügel am Rücken angewachsen waren. Statt sich vom Dach stürzen zu können, wurde er von ihnen auf das uralte Mauerwerk der Brüstung gefesselt, und präzise und genüsslich begann die Finsternis tiefe Furchen in seinen nackten Rücken zu peitschen.
Neferet sah nur so lange zu, bis sein stolz erhobener Kopf sich entkräftet senkte und sein herrlicher Körper sich bei jedem Streich in Qualen aufzubäumen begann. »Entstellt ihn nicht für immer. Ich habe vor, mich einst wieder an seiner Schönheit zu erfreuen«, sagte sie, ehe sie ihm endgültig den Rücken kehrte und zielstrebig die blutgetränkte Dachterrasse verließ.
»Offenbar muss ich alles selbst in die Hand nehmen. Und es gibt noch so viel zu tun … so viel …«, flüsterte sie der Finsternis zu, die ihr um die Füße schmeichelte.
In den Schatten glaubte Neferet einen Moment lang den Umriss eines massiven Stiers zu erkennen, der ihr einen beifälligen Blick zuwarf.
Neferet lächelte.
Drei
Zoey
Zum hunderttausendsten Mal dachte ich, was für ein phantastischer Ort Sgiachs Thronsaal doch war. Sie war eine uralte Vampyrkönigin, die ›Große Mordklinge‹, wahnsinnig mächtig und umgeben von ihrer persönlichen Kriegergarde, den Wächtern. Mann, es hatte Zeiten gegeben, da hatte sie’s sogar mit dem Hohen Rat der Vampyre aufgenommen und den Sieg davongetragen. Aber ihre Burg war trotzdem keine vorsintflutliche Räuberhöhle mit Außenklo (igitt!). Natürlich war sie eine Festung, aber – wie man hier in Schottland sagt – eine fürnehme. Ich sag euch, der Blick aus jedem einzelnen der Fenster, die aufs Meer rausgehen (vor allem aus denen im Thronsaal) war so atemberaubend, dass ich jedes Mal dachte, das könnte nur HD-TV sein und nicht die Wirklichkeit vor meinen Augen.
»Es ist so schön hier.« Okay, vielleicht war es keine besonders gute Idee, mit mir selber zu reden, vor allem so kurz nachdem ich in der Anderwelt mehr oder weniger, na ja, nicht mehr so ganz beisammen gewesen war. Ich seufzte und zuckte mit den Schultern. »Was soll’s. Hey, Nala ist nicht da, Stark meistens ausgeknockt, Aphrodite macht mit Darius Sachen, von denen man besser nichts weiß, und Sgiach ist gerade entweder mit magischem Kram beschäftigt oder mit Seoras im Superhelden-Kampftraining. Da hab ich ja keine andere Wahl, als mit mir selber zu reden.«
»Magischer Kram oder Superhelden-Kampftraining? Ich habe nur höchst unmagisch meine E-Mails gecheckt.«
Vermutlich hätte ich zusammenzucken sollen – schließlich war die Königin praktisch aus der leeren Luft neben mir aufgetaucht. Aber anscheinend hatte dieses Zerschmettert-und-halb-wahnsinnig-Sein in der Anderwelt meine Schreckschwelle deutlich erhöht. Außerdem fühlte ich mich dieser Vampyrkönigin seltsam nahe. Klar, sie war ehrfurchtgebietend und hatte übermächtige Kräfte und so, aber in der Zeit, seit Stark und ich zurückgekehrt waren, war sie eine wichtige Konstante für mich geworden. Während Aphrodite und Darius händchenhaltend am Strand herumschlenderten und Knutschorgien feierten und Stark schlief und schlief und schlief, hatte Sgiach mir immer wieder Gesellschaft geleistet. Manchmal hatten wir geredet, manchmal geschwiegen. Schon vor Tagen hatte ich beschlossen, dass sie die coolste Frau – Vampyr oder Mensch – war, die ich je getroffen hatte.
»Das meinen Sie nicht ernst, oder? Sie sind eine uralte Vampyrkönigin, die auf einer Burg auf ’ner Insel wohnt, die niemand ohne Ihre Erlaubnis betreten kann, und Sie checken Ihre E-Mails? Das hört sich ganz schön magisch an, find ich.«
Sgiach lachte. »Oft erscheint mir die Technik viel geheimnisvoller als die Magie, das ist wohl wahr. Oh, da fällt mir etwas ein – ich habe darüber nachgedacht, wie befremdlich es ist, dass das Tageslicht deinen Wächter so extrem einschränkt.«
»Nicht nur ihn. Wobei es mit ihm im Moment schlimmer ist, weil er, na ja, halt verletzt ist.« Ich verstummte, weil ich über die Worte stolperte und nicht zugeben wollte, wie hart es war, meinen Krieger und Wächter so vollkommen erledigt zu sehen. »Das ist absolut nicht normal für ihn. Normalerweise kann er tagsüber bei Bewusstsein bleiben, auch wenn er direktes Sonnenlicht nicht erträgt. Und das mit dem Tageslicht ist bei allen roten Vampyren und Jungvampyren so. Die Sonne bringt sie um.«
»Nun, junge Königin, es könnte sich als merklicher Nachteil erweisen, dass dein Wächter dich in den Tagesstunden nicht beschützen kann.«
Ich hob eine Schulter, obwohl mir so was wie ein dummes Vorgefühl den Rücken hinunterlief. »Na ja, ich hab in der letzten Zeit gelernt, auf mich selbst aufzupassen. Ich glaube, mit ein paar Stunden Alleinsein pro Tag komm ich schon klar«, sagte ich so scharf, dass ich selbst überrascht war.
Sgiachs grüngoldene Augen ruhten auf mir. »Gib acht, dass all das dich nicht hart macht.«
»All das?«
»Die Finsternis und dein Kampf gegen sie.«
Ich dachte daran, wie ich Kalona mit Starks Schwert an der Wand einer Arena in der Anderwelt aufgespießt hatte, und mein Magen verkrampfte sich. »Muss man nicht hart sein, um zu kämpfen?«
Sie schüttelte den Kopf, und das schwindende Tageslicht fing sich in der zimtfarbenen Strähne in ihrem schneeweißen Haar und ließ sie aufglänzen wie einen Strang aus Kupfer und Gold. »Nein. Man muss stark sein. Und weise. Man muss sich selbst genau kennen und nur jenen vertrauen, die sich dessen als wert erweisen. Wenn du zulässt, dass der Kampf gegen die Finsternis dich verhärtet, wirst du die Hoffnung verlieren.«
Ich wandte den Blick ab und starrte auf die graublaue See hinaus, von der die Isle of Skye umgeben war. Die Sonne war dabei, im Meer zu versinken, und warf dabei einen zartrosa und korallenfarbenen Schimmer über den dunkler werdenden Himmel. Alles war wunderschön und friedlich und sah ganz normal aus. Wenn man hier stand, war es schwer, sich vorzustellen, dass da draußen in der Welt Böses, Finsternis und Tod lauerten.
Aber die Finsternis war da draußen, vermutlich schon tausendfach vermehrt. Kalona hatte mich nicht getötet – da musste Neferet stinksauer sein.
Nur bei dem Gedanken daran, was das bedeutete – dass ich mich wieder mit ihr und Kalona und all dem furchtbaren Bockmist, der dazugehörte, würde herumschlagen müssen –, fühlte ich mich unglaublich müde.
Ich straffte die Schultern und wandte mich Sgiach zu. »Und wenn ich nicht mehr kämpfen will? Wenn ich hierbleiben will, wenigstens eine Zeitlang? Stark ist noch nicht wieder auf dem Damm. Er braucht Ruhe, um zu genesen. Ich hab dem Hohen Rat schon Nachricht geschickt, was mit Kalona war. Sie wissen, dass er Heath umgebracht und mich in die Anderwelt verfolgt hat und dass Neferet dabei ihre Finger im Spiel hatte und sich mit der Finsternis verbündet hat. Der Hohe Rat wird schon mit Neferet fertig. Mann, eigentlich müssen die Erwachsenen sich um sie und diese miese Hölle kümmern, zu der sie mir das Leben ständig zu machen versucht.«
Sgiach gab keine Antwort. Also atmete ich ein und redete weiter. »Ich bin erst siebzehn. Und das seit knapp ’nem Monat. Ich bin eine Null in Geometrie, und mein Spanisch kann man vergessen. Ich darf noch nicht mal wählen. Es ist nicht mein Job, gegen das Böse zu kämpfen. Mein Job ist, die Schule zu beenden und hoffentlich die Wandlung zu überstehen. Meine Seele war zerborsten und mein Freund wurde ermordet. Hab ich nicht vielleicht mal ’ne Pause verdient? Wenigstens ’ne kleine?«
Zu meiner totalen Überraschung lächelte Sgiach. »Ja, Zoey. Ich glaube schon.«
»Sie meinen, ich kann hierbleiben?«
»Solange du willst. Ich weiß, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, von der Welt erdrückt zu werden. Wie du schon sagtest, hier darf die Welt nur auf meine Erlaubnis hin eindringen – und in den meisten Fällen verweigere ich sie ihr.«
»Und was ist mit dem Kampf gegen die Finsternis und das Böse und so weiter?«
»Der wird warten müssen, bis du zurückkehrst.«
»Wow. Ist das Ihr Ernst?«
»Ja. Bleib hier auf meiner Insel, bis deine Seele wahrhaft geheilt und ausgeruht ist und dein Gewissen dir sagt, dass du in deine Welt, zu deinem Leben zurückkehren musst.«
Ich ignorierte das kleine Schuldgefühl, das mich bei dem Wort Gewissen durchzuckte. »Stark darf aber auch bleiben, oder?«
»Natürlich. Der Platz eines Wächters ist an der Seite seiner Königin.«
»Apropos«, sagte ich schnell, froh, von dem Thema ›Kampf gegen das Böse und schlechtes Gewissen‹ wegzukommen, »wie lange ist Seoras schon bei dir?«
Der Blick der Königin wurde weich, ihr Lächeln vertiefte sich, und sie schien noch schöner zu werden. »Es ist nun über fünfhundert Jahre her, dass Seoras zu meinem eidgebundenen Wächter wurde.«
»Heiliger Mist! Fünfhundert Jahre! Wie alt sind Sie denn?«
Sie lachte. »Meinst du nicht, dass diese Frage ab einem gewissen Alter bedeutungslos wird?«
»Und ’s ist keine Art, eine Maid nach ihren Jahren zu fragen.«
Er hätte nichts sagen müssen. Ich hätte trotzdem gewusst, dass Seoras den Raum betreten hatte. Wenn er sich näherte, änderte sich Sgiachs Gesichtsausdruck. Es war, als würde er einen Schalter betätigen, und etwas in ihr finge sanft und warm an zu strahlen. Und wenn er sie ansah, dann sah auch er momentelang nicht so bärbeißig und zernarbt und bleib-mir-bloß-von-der-Pelle aus.
Die Königin lachte und legte ihrem Wächter so selbstverständlich und zärtlich die Hand auf den Arm, dass in mir die Hoffnung keimte, Stark und ich könnten wenigstens einen schwachen Hauch der Zweisamkeit erlangen, die diese beiden gefunden hatten. Und wenn er mich in fünfhundert Jahren noch Maid nannte, wäre das auch ziemlich cool.
Heath hätte das auf jeden Fall getan. Na ja, oder eher Mädel. Oder vielleicht auch einfach Zo – seine Zo, für immer und ewig.
Aber Heath war tot. Er würde mich nie wieder irgendwie nennen.
»Er wartet auf dich, junge Königin.«
Verdattert starrte ich Seoras an. »Heath?«
Der Krieger sah mich weise und verständnisvoll an. Sein Ton war sanft. »Aye, gewiss wartet dein Heath in fernen Tagen auf dich, doch ist’s dein Wächter, von dem ich sprach.«
»Stark! Oh, dann ist er wach. Gut.« Ich weiß, dass ich schuldbewusst klang. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht mehr an Heath zu denken, aber das war so schwer. Er war ein Teil meines Lebens gewesen, seit ich neun war – und noch keine drei Wochen lang tot. Ich gab mir innerlich einen Ruck, verneigte mich rasch vor Sgiach und wandte mich zur Tür.
»Such ihn nicht in eurem Gemach«, sagte Seoras. »Du find’st ihn beim Hain. Dort mögest du ihn treffen.«
Ich hielt erstaunt an. »Er ist draußen?« Seit seiner Rückkehr aus der Anderwelt hatte Stark sich zu schwach und elend gefühlt, um viel zu machen außer zu schlafen, zu essen und mit Seoras Computerspiele zu spielen (was übrigens ein echt schräger Anblick war – Highschool meets Braveheart meets Call of Duty).
»Aye, der Bursche ist drüber hinweg, sein Los zu bejammern, und hält sich wieder, wie’s einem wahren Wächter gebührt.«
Ich stemmte die Hand in die Hüfte und funkelte den alten Krieger an. »Er ist fast gestorben. Sie haben ihn in Scheiben geschnitten. Er war in der Anderwelt. Himmel, gönnen Sie ihm vielleicht mal ’n bisschen Ruhe?«
»Aye, nun, ’s ist nicht, als wär er in der Tat gestorben, nicht?«
Ich verdrehte die Augen. »Er ist beim Hain?«
»Aye.«
»Okidoki.«
Als ich aus der Tür eilte, holte mich Sgiachs Stimme ein. »Nimm diesen hübschen Schal mit, den du im Dorf gekauft hast. Der Abend ist kalt.«
Es kam mir etwas komisch vor, dass sie so was sagte. Ich meine, klar, auf Skye war es kalt (und meistens auch noch nass), aber Jungvampyre und Vampyre sind nicht so kälteempfindlich wie Menschen. Aber egal. Wenn eine Kriegerkönigin einem einen Befehl gibt, sollte man besser gehorchen. Also machte ich einen Umweg über das große Zimmer, in dem Stark und ich untergebracht waren, und schnappte mir den Schal, den ich über den Rand des Betthimmels geworfen hatte. Er war aus echtem Cashmere, cremefarben mit eingewobenen Goldfäden, und ich war mir nicht sicher, ob er über dem blutroten Bettvorhang nicht besser aussah als um meinen Hals.
Eine Sekunde lang hielt ich inne und betrachtete das Bett, das Stark und ich seit unserer Rückkehr teilten. Unsere Tage hatten so ausgesehen, dass ich mich an ihn gekuschelt, seine Hand gehalten, meinen Kopf an seine Schulter gelegt und ihm beim Schlafen zugeschaut hatte – mehr nicht. Er hatte nicht mal versucht, mich zu necken, ich würde mit ihm herummachen.
Mann, ist er schwer verletzt!
Innerlich wand ich mich beim Gedanken daran, wie oft Stark meinetwegen hatte leiden müssen: Zuerst war er fast von einem Pfeil durchbohrt worden, weil er den Schuss, der mir hätte gelten sollen, auf sich gelenkt hatte; dann musste er sich zerschreddern lassen und einen Teil seines Ichs umbringen, um zu mir in die Anderwelt überwechseln zu können; und schließlich war er von Kalona tödlich verwundet worden, weil er geglaubt hatte, das sei der einzige Weg, mein zersplittertes Ich zu erreichen.
Aber ich hab ihn auch gerettet, rief ich mir in Erinnerung. Stark hatte recht behalten – der Anblick, wie Kalona ihn systematisch niedermetzelte, hatte dazu geführt, dass ich meine verlorenen Teile wieder in mich zurückrief, und das wiederum war für Nyx Anlass gewesen, Kalona zu zwingen, Stark eine Spur seiner Unsterblichkeit einzuhauchen, um diesem das Leben zurückzugeben und mir die Schuld für Heath’ Tod zurückzuzahlen.
Während ich mit solchen Gedanken durch die wunderhübsch eingerichtete Burg marschierte und den Kriegern zunickte, die respektvoll die Köpfe vor mir neigten, beschleunigte ich automatisch meinen Schritt. Was dachte Stark sich dabei, sich in seinem Zustand nach draußen zu schleppen?
Himmel, ich hatte keine Ahnung, was er dachte. Seit wir zurück waren, hatte er sich verändert.
Natürlich hat er sich verändert, sagte ich mir streng und kam mir mies und treulos vor. Mein Krieger war in die Anderwelt gereist, gestorben, von einem Unsterblichen wiedererweckt und dann zurück in einen verwundeten, geschwächten Körper gezerrt worden.
Aber vorher. Vorher, kurz bevor wir in die reale Welt zurückgekehrt waren, war etwas zwischen uns geschehen. Etwas zwischen uns hatte sich verändert. Oder zumindest hatte ich das geglaubt. In der Anderwelt waren wir uns supernahe gewesen. Dass er von mir getrunken hatte, war ein wahnsinniges Erlebnis für mich gewesen. Besser als Sex. Oh ja, es hatte sich gut angefühlt. Verdammt gut. Es hatte ihn gekräftigt, geheilt, und irgendwie hatte es auch das in mir repariert, was zerbrochen gewesen war, und mir meine Tattoos zurückgegeben.
Und durch diese neue Nähe zu Stark war Heath’ Verlust erträglich geworden.
Warum also war ich so deprimiert? Was stimmte nicht mit mir?
Mann, ich wusste es einfach nicht.
Eine Mutter hätte es bestimmt gewusst. Ich musste an meine Mom denken und fühlte mich plötzlich schrecklich einsam. Klar, sie hatte Mist gebaut und sich im Grunde für ihren neuen Mann statt für mich entschieden, aber trotzdem war sie meine Mom. Ich vermisse sie, gab eine kleine Stimme in meinem Kopf zu. Dann schüttelte ich den Kopf. Ich hatte noch eine andere ›Mom‹. Meine Grandma war Mom genug für mich – nein, sogar mehr.
»Eigentlich vermisse ich Grandma.« Und dann kriegte ich natürlich Schuldgefühle, weil ich sie nicht mal angerufen hatte, seit ich zurück war. Gut, klar, ich wusste, dass Grandma spüren würde, dass meine Seele wieder da war, dass ich in Sicherheit war. Sie war schon immer wahnsinnig intuitiv gewesen, vor allem, was mich anging. Trotzdem hätte ich sie anrufen sollen.
Plötzlich fühlte ich mich total schuldig und niedergeschlagen. Ich nagte an der Unterlippe, schlang mir den Cashmereschal um den Hals und zog beide Enden über die Brust, während ich im schneidend kalten Wind die Brücke überquerte, die eine Art Burggraben überspannte. Gerade waren ein paar Krieger dabei, die Fackeln anzuzünden. Ich grüßte sie, und sie neigten die Köpfe. Dann versuchte ich, die scheußlichen aufgespießten Totenschädel zwischen den Fackeln am Weg zu ignorieren. Ehrlich. Totenschädel. Von echten Toten. Okay, sie waren alle uralt und eingeschrumpelt und es war kaum noch Fleisch dran, aber trotzdem. Bäh.
Mit sorgsam gesenktem Blick folgte ich dem aufgeschütteten Dammweg über das Sumpfgelände, von dem die Burg auf der Landseite umgeben war. An der schmalen Inselstraße angekommen, wandte ich mich nach links. Der heilige Hain fing nicht weit von der Burg an und schien sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite unendlich weit in die Ferne zu erstrecken. Dass ich ihn kannte, verdankte ich nicht der Tatsache, dass ich auf dem Weg in die Burg wie eine Leiche auf einer Bahre daran vorbeigetragen worden war. Sondern weil es mich in den letzten Wochen, während Stark sich erholte, immer wieder dorthin gezogen hatte. Wenn ich nicht mit der Königin oder Aphrodite zusammen gewesen war oder nach Stark geschaut hatte, hatte ich endlose Spaziergänge in dem Hain gemacht.
Er erinnerte mich an die Anderwelt, und dass ich diese Erinnerung zugleich unheimlich und tröstlich fand, erschreckte mich.
Trotzdem hatte ich den Hain, oder, wie Seoras ihn nannte, den Croabh, oft aufgesucht, aber immer während des Tages. Nie nach Sonnenuntergang. Nie in der Nacht.
Auch die Straße war von Fackeln gesäumt. Ihr Licht ließ die Schatten am Waldrand zucken und spendete genug Helligkeit, dass ich eine Ahnung von der moosigen, magischen Welt unter den alterslosen Bäumen bekam. Ohne das durch die Zweige sickernde Sonnenlicht sah sie anders aus – nicht mehr so vertraut. Über meine Haut lief ein Kribbeln, als schalteten meine Sinne auf höchste Alarmbereitschaft.
Wieder und wieder wurden meine Augen von den Schatten des Hains angezogen. Waren sie dunkler als normale Schatten? War etwas darin nicht so, wie es sein sollte? Ich erzitterte, und in diesem Moment fing ich im Augenwinkel eine Bewegung ein Stück voraus auf der Straße auf. Mit wild klopfendem Herzen spähte ich nach vorn und erwartete halb, Schwingen aus Kälte, Wahnsinn und Grausamkeit zu erblicken …
Aber als mir klar wurde, was ich sah, machte mein Herz eine ganz andere Art von Hüpfer.
Dort, neben zwei Bäumen, die zu einem verschlungen waren, stand Stark. Die ineinander verflochtenen Zweige der Bäume waren mit festgeknoteten Tuchstreifen geschmückt – manche davon leuchtend bunt, andere ausgebleicht, fadenscheinig und ausgefranst. Es war das reale Pendant zu dem Wunschbaum vor Nyx’ Hain in der Anderwelt, aber dass dieser hier in der ›realen‹ Welt stand, bedeutete nicht, dass er weniger großartig anzusehen gewesen wäre. Vor allem, wenn der Typ, der davor stand und in die Zweige hinaufstarrte, den erdfarbenen Plaid der MacUallis trug, auf die traditionelle Kriegerart, also mit Langdolch und Sporran und allen möglichen sexy nietenbeschlagenen Leder-Accoutrements (wie Damien sagen würde).
Ich sog ihn mit den Blicken ein, als hätte ich ihn Jahre nicht gesehen. Stark sah gesund und kräftig und einfach umwerfend aus. Ich war gerade in Gedanken zu der Frage abgeschweift, was genau ein Schotte normalerweise unter seinem Kilt trug (oder nicht!), als er sich zu mir umdrehte.
Sein Lächeln ließ seine Augen aufblitzen. »Ich kann praktisch hören, was du denkst.«
Sofort stieg mir flammende Röte in die Wangen, weil Stark ja diese Fähigkeit besaß, meine Gefühle zu spüren. »Du sollst mich doch nicht bespitzeln, außer ich bin in Gefahr.«
Sein Grinsen wurde frech, und seine Augen funkelten spitzbübisch. »Dann denk nicht so laut. Aber du hast recht; ich hätte nicht spionieren sollen. Denn das, was ich von dir empfangen hab, war alles andere als Todesangst.«
»Klugscheißer«, sagte ich, konnte aber nicht anders, als zurückzugrinsen.
»Ja, bin ich, aber ich bin dein Klugscheißer.«
Als ich ihn erreichte, hielt er mir seine Hand hin, und wir verschränkten die Finger. Seine Hand war warm, sein Griff fest und sicher. So nahe, wie ich ihm jetzt war, konnte ich sehen, dass er noch Ringe unter den Augen hatte, aber er war nicht mehr so totenblass wie die ganze Zeit zuvor. »Du bist wieder fit!«
»Ja. Hat ’ne Weile gedauert. Ich hab zwar nicht so toll geschlafen – nicht so erholsam, wie ich mir gewünscht hätte, aber es ist trotzdem, als hätte jemand einen Schalter in mir angeknipst, und ich wär endlich wieder aufgeladen.«
»Bin ich froh! Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht.« Da merkte ich erst, wie sehr das stimmte, und mir entfuhr: »Und ich hab dich vermisst.«
Er drückte meine Hand und zog mich näher heran. Sein großspuriges, neckisches Gehabe verflog. »Ich weiß. Du warst in dich zurückgezogen und verschreckt. Warum?«
Ich wollte ihm sagen, dass er sich irrte – dass ich ihm nur Raum gegeben hatte, damit er sich erholen konnte, aber die Worte, die sich in mir formten und meinen Lippen entglitten, waren ehrlicher. »Du bist schon so oft meinetwegen verletzt gewesen.«
»Nicht deinetwegen, Z. Die Finsternis hat mich verletzt, weil sie das eben macht – sie versucht den zu vernichten, der für das Licht kämpft.«
»Na ja, wär schön, wenn sie zur Abwechslung mal jemand anderen piesacken würde, damit du eine Weile Ruhe hast.«
Er knuffte mich mit der Schulter. »Als ich dir den Kriegereid geschworen hab, wusste ich, worauf ich mich einließ. Schon damals war das okay für mich, und das ist es immer noch. Und daran wird sich auch in fünfzig Jahren nichts ändern. Und Z, ich komm echt nicht sehr männlich und wächterhaft rüber, wenn du davon redest, dass die Finsternis mich ›piesackt‹.«
»Hey, ich mein’s ernst. Du wolltest wissen, was mit mir los ist. Ich hab mir einfach Sorgen gemacht, dass – na ja, dass du diesmal zu schwer verletzt worden sein könntest.« Ich hielt inne. Und da begriff ich es endlich, und ich musste mit den Tränen kämpfen. »So schwer, dass du nicht mehr gesund würdest. Dann hättest du mich auch verlassen.«
Auf einmal war Heath’ Gegenwart so übermächtig zwischen uns, dass ich halb erwartete, ihn gleich aus dem Wald treten zu sehen und ihn sagen zu hören: Hey, hey, Zo. Nicht weinen. Dir läuft immer so furchtbar die Nase, wenn du weinst. Und natürlich wurde es da nur noch schwerer, nicht zu weinen.
»Hör mir zu, Zoey. Ich bin dein Wächter. Du bist meine Königin, das ist mehr als eine Hohepriesterin, also ist unser Band noch stärker als das von einem gewöhnlichen Kriegereid.«
Ich kniff ein paarmal heftig die Augen zusammen. »Toll. Mir kommt’s so vor, als wollte das Böse mir alle wegnehmen, die ich mag.«
»Nichts kann mich dir jemals wegnehmen, Z. Das habe ich geschworen.« Er lächelte, und in seinen Augen war so viel Selbstsicherheit, Vertrauen und Liebe, dass mir der Atem stockte. »Du wirst mich niemals los, mo bann ri.«
»Gut«, sagte ich leise. Er zog mich in seinen Arm, und ich lehnte den Kopf an seine Schulter. »Ich hab dieses Verlassenwerden satt.«
Er küsste mich auf die Stirn und murmelte gegen meine Haut: »Ja, ich auch.«
»Ich glaube, die Sache ist, ich hab ’ne Menge Sachen satt. Ich bin müde und erschöpft. Ich muss mich auch wieder aufladen.« Ich sah ihn an. »Wäre es okay für dich, wenn wir hierbleiben würden? Ich – ich will einfach nicht hier weg und zurück zu … zu …« Ich zögerte. Mir fehlten die richtigen Worte.
»Zu allem – den guten und den schlechten Sachen. Ich weiß, was du meinst«, sagte mein Wächter. »Was sagt Sgiach dazu?«
»Sie hat gesagt, wir können bleiben, solange mein Gewissen es mir erlaubt.« Ich lächelte ein bisschen schief. »Und momentan erlaubt mein Gewissen es mir definitiv.«
»Für mich klingt das gut. Ich hab auch keine Lust auf das Neferet-Drama, das uns zu Hause erwartet.«
»Also bleiben wir noch ’ne Weile?«
Stark umarmte mich. »Wir bleiben, bis du den Befehl zum Aufbruch gibst.«
Ich schloss die Augen und blieb einfach in Starks Armen stehen. Es war, als hätte mir jemand eine Riesenlast von den Schultern genommen. Als er fragte: »Hey, würdest du was mit mir machen?«, kam meine Antwort sofort und unbekümmert. »Klar, alles.«
Ich spürte, wie er in sich hineinkicherte. »Bei der Antwort bin ich schwer in Versuchung, meine Frage zu ändern.«
Ich gab ihm einen kleinen Knuff, obwohl ich immens erleichtert war, dass Stark sich wieder so richtig starkmäßig verhielt. »Doch nicht das!«
»Nein?« Sein Blick wanderte von meinen Augen zu meinen Lippen, und plötzlich war darin weniger Großspurigkeit als Hunger – und etwas in meinem Magen begann zu flattern. Da beugte er sich vor und küsste mich tief und lange, was mir vollkommen den Atem verschlug. »Bist du sicher, dass du nicht doch das meinst?«, fragte er, tiefer und rauer als gewöhnlich.
»Nein. Ja.«
Er grinste. »Was jetzt?«
»Ich weiß nicht. Ich kann nicht denken, wenn du mich so küsst«, erklärte ich ehrlich.
»Dann muss ich dich noch weiter so küssen.«
»Okay.« Mir war seltsam schwindelig.
»Okay«, wiederholte er. »Aber nicht jetzt. Jetzt werde ich dir beweisen, was für ein ehrenhafter Wächter ich bin, und bei meiner eigentlichen Frage bleiben.« Er griff in den Lederbeutel, den er sich umgehängt hatte, zog einen langen dünnen Streifen MacUallis-Plaid heraus und hielt ihn so hoch, dass er im Wind tanzte. »Zoey Redbird, möchtest du deine Träume und Wünsche für die Zukunft mit mir zusammen in den Wunschbaum knüpfen?«
Ich zögerte nur eine Sekunde lang – nur so lange, wie ich den scharfen Stich von Heath’ Abwesenheit fühlte, die Abwesenheit eines Zukunftsfadens, der nicht mehr weitergesponnen werden würde –, dann blinzelte ich mir die Tränen aus den Augen und gab meinem Wächter eine Antwort.
»Ja. Ich möchte meine Träume und Wünsche für die Zukunft mit dir verknüpfen, Stark.«
Vier
Zoey
»Ich soll was mit meinem Cashmereschal machen?«
»Einen Streifen davon abreißen«, sagte Stark.
»Ganz im Ernst?«
»Ja. Ich hab meine Instruktionen direkt von Seoras. Komplett mit ein paar besserwisserischen Kommentaren, von wegen was ich denn in meinem Leben bisher so gelernt hätte und dass ich meine Hinterbacken nicht von meinen Ohrläppchen unterscheiden könnte oder so, und irgendwas à la ich wär ein Stiesel, keine Ahnung, was das heißen soll.«
»Stiesel? Wie Diesel?«
»Also, damit hat’s bestimmt nichts zu tun …«