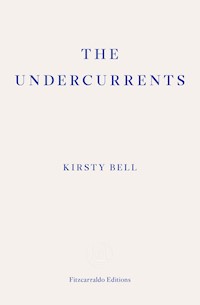Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die andere Seite der Geschichte. Diese seltene Mischung aus Memoir, Kulturgeschichte und Stadtbild ist ein Gegenentwurf zu den Berlin-Büchern der Vergangenheit. Eine elegante und bewegende Erinnerung an eine verwundete Metropole.Von ihrem Zimmer am Landwehrkanal aus hat die britisch-amerikanische Kunstkritikerin Kirsty Bell einen besonderen Blick auf die Stadt, in der sie seit 20 Jahren lebt. Ihr Augenmerk gilt nicht den Königen und den Monumenten. Es sind die Brachen, die drängenden Wasser und die besonderen Schicksale, die sie interessieren. Preußischer Militarismus und männlicher Ingenieurssinn haben Berlin geprägt, die Gewalt des 20. Jahrhunderts hat es traumatisiert. Von Walter Benjamin zu Rosa Luxemburg, von Gabriele Tergit zu Hannah Arendt und hin zu den Bewohner:innen ihres eigenen Gründerzeithauses lässt Kirsty Bell die Menschen sprechen. Noch immer ist die Stadt aus dem Takt, so wie es Bells eigenes Leben war. Doch nur deshalb kann sie Berlin zum Besseren hin erzählen.»Kirsty Bells Berlin-Betrachtung ist ein Wunder: Ein Blick aus dem Fenster – und es erschließt sich eine ganze Welt voller echter und fantastischer Geschichten.« Jan Brandt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe des vorliegenden Buches erscheint unter dem Titel
The Undercurrents. A Story of Berlin 2022 bei Fitzcarraldo Editions, London.
Die Arbeit der Übersetzer am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR« aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
ISBN 978-3-98568-005-4
eISBN 978-3-98568-006-1
1. Auflage 2021
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2021
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Schutzumschlag gedruckt im Letterpress-Verfahren
auf einem Heidelberger Cylinder, Baujahr 1954
www.kanon-verlag.de
Kirsty BellGEZEITEN DER STADTEine Geschichte Berlins
Aus dem Englischen vonLaura Su Bischoff und Michael Bischoff
INHALT
Vorspiel
I.Graben
II.Zeuge
III.Grundstück
IV.Wasserlauf
V.Sumpf
VI.Treiben
VII.Eisenbahnzeit
VIII.Jungfer
IX.Triangulation
X.Zeichen
XI.Kollisionskurs
XII.Transport
XIII.Freier Fall
XIV.Ein Zwischenspiel
XV.Stillstand
XVI.Sackgasse
XVII.Ausnahme
XVIII.Weites Feld
XIX.Neuordnung
XX.Verdrüngung
XXI.Aufstellung
Koda
Originalplan des Tempelhofer Ufers aus der Bauaktenkammer Berlin
VORSPIEL
EINE GROSSE WASSERLACHE war über Nacht auf unserem Küchenboden aufgetaucht, so leise und unerwartet, als wäre sie ein Trugbild. Leitungswasser war aus einem lecken Rohr unter der Spüle getropft und lautlos in die beiden Stockwerke unter uns hinabgeflossen. Dieser Anblick erwartete uns, als wir am Morgen des neunten Geburtstags unseres Sohnes erwachten. Das war zwar der spektakulärste, aber nicht der einzige Wasserschaden, den wir erlebten. In den Monaten vor und nach diesem Vorfall war ein Sammelsurium an Plastikeimern und Schüsseln zu einem nahezu dauerhaften, von Ort zu Ort wandernden Bestandteil unserer Wohnung geworden, den wir hervorholten, um das Wasser in unterschiedlichen Teilen unseres Heims aufzufangen. Eines Abends, es waren ein paar Monate seit der Überflutung unserer Küche vergangen, bemerkte unser ältester Sohn, dass Wasser aus der Stuckrose in der Mitte unserer Wohnzimmerdecke tropfte. Wir schauten hinauf und erblickten einen verdächtigen, sich ausbreitenden braunen Fleck, während ein Rinnsal aus dem oberen Stockwerk sich seinen Weg über unseren Köpfen bahnte. Wasser findet stets seinen Weg. Meine Söhne und ich holten abermals die Eimer und Schüsseln hervor und legten Handtücher aus, um das Wasser aufzusaugen. Es war, als wollte unsere neue Wohnung uns etwas sagen.
Unsere alte Wohnung im Osten der Stadt hatte mit ihrem paradiesisch anmutenden Verputz aus Reben, Früchten und Blumen, die sich um die Säulen ihrer Fassade rankten, nie diesen Eindruck gemacht. Dort hatten wir zehn Jahre lang gelebt – Mann und Frau, zwei Söhne, zwei Katzen. In all der Zeit war diese Bleibe trotz unserer Schwierigkeiten ständig neutral geblieben. Sie hatte uns nie ihre Anwesenheit spüren lassen oder irgendwelche verhohlenen Gefühle aufgewirbelt. Sie war nichts weiter als ein Behälter, der, wenn überhaupt, wohlwollend die Aufrechterhaltung des Status quo ermöglicht hatte. Unsere neue Wohnung, die näher bei der Schule der Jungs im Westen der Stadt lag, war von Anfang an merkwürdig. Mit ihren Belastungen und Einmischungen brachte sie ständig Warnsignale hervor, die nicht ignoriert werden konnten. Sie intervenierte und erzwang sich die Rolle eines Protagonisten.
Es gibt Dinge, die kann man sehen, und es gibt Dinge, die kann man nur spüren, die fühlt man auf eine andere Art und Weise – als Flüstern im Geiste oder als eine Schwere in den Knochen. Ein Pfropfen Zweifel hatte sich geformt und den alltäglichen Fluss meiner Gedanken bereits seit Wochen gestört. Gleich einem schmierigen Klumpen aus Abfällen hatte seine undeutliche Kontur an Klarheit gewonnen, als wir entlang der Achse der Stadt von Ost nach West zogen. Er hatte die Form des Unglücks. Und nun war er da und verstopfte meine Gedanken, während ich durch die vielen Zimmer unseres extravagant geschnittenen neuen Zuhauses wanderte. Eine kultivierte Leere im Geiste kann Kräuselungen, Strömungen und Risse ermöglichen. Sie kann Dinge an die Oberfläche zerren, die nicht gesehen werden wollen.
Jene frühmorgendliche Begegnung mit einer spiegelglatten Wasserpfütze auf dem Küchenfußboden war das eindeutige Zeichen einer Entzweiung. Etwas war über die Ufer getreten und konnte nicht länger zurückgehalten werden. Nach Jahren unterdrückter Gefühle, unterbewusst ertragen, um ein funktionierendes Familienleben aufrechtzuerhalten, war diese spontane Zurschaustellung, dieser unerbetene Ausbruch – diese Flut – ein Symbol von fast schon hysterischer Deutlichkeit. Sie bat um eine ebenso extreme Antwort, die pflichtgemäß in Form einer plötzlichen, brutalen und endgültigen Trennung dann auch kam. Eine Trennung der Familieneinheit, wobei ein Teil abbrach und die anderen drei Teile zusammenblieben. Mein Mann ging auf Dienstreise und kehrte nie wieder in unser Heim zurück.
Wasser findet stets seinen Weg. Es schlängelt sich durch die Spalten dieses alten Gebäudes. Es sickert durch glatt verputzte und gestrichene Oberflächen. Es erscheint ganz plötzlich als feuchte Schimmelstreifen hoch oben in den Ecken. Es sorgt für bröckelnden Putz an den Außenwänden. Es gab stets eine logische Erklärung, einen Grund, woran es lag. Starker Regen auf unversiegelte Dachziegel; angebohrte oder falsch verlegte Leitungen; verstopfte Abflüsse in überlaufenden Duschen. Die oben in der Dachterrassenwohnung werkelnden Bauarbeiter waren ganz offensichtlich ein schludriger Haufen. Und doch begann die Unbarmherzigkeit dieser verschiedenen Vorfälle sich bedrückend und schwer anzufühlen. Es war, als wollten die Oberflächen der Wohnung sich nicht verschließen; als würde ihre Infrastruktur nicht standhalten. Bei jedem Regen wurde ich nervös. Als die Monate vergingen, spürte ich den Drang, die Spritzer und Flecken zu kartieren, die an der Decke, den Wänden und auf dem Boden zurückgeblieben waren. Wenn ich ihre Topografie beschreiben könnte, wäre es mir dann möglich, eine Karte zu erstellen, um diese kleineren häuslichen Katastrophen zu lesen und zu verstehen?
Ich hatte das stete und unangenehme Gefühl, dass sich hinter diesen Vorfällen Vorsatz verbarg. Ein Vorsatz, der nicht auf den ersten Blick ersichtlich war, sondern durch eine Art Divination allenfalls erahnbar wurde. So wie bei der hydromantischen Methode, bei der man Kräuselungen auf der Wasseroberfläche deutet, bestenfalls vom Mondenschein beleuchtet. Als die Grenzen der Wohnung durchlässig wurden, war Eindämmung keine Möglichkeit mehr, ebenso wenig wie Schweigen. Nichts ließ sich mehr zurückhalten. Äußere Vorfälle, emotionale Wahrheiten, historische Ereignisse, all das würde einen Weg finden, auf sich aufmerksam zu machen.
Als die Wasserlache auf unserem Küchenboden auftauchte, war unsere Ehe bereits kaputt, doch sorgte dieses Ereignis für den letzten Bruch. Im Gegensatz zum steten Tröpfeln der Traurigkeit, an das wir uns beide im Laufe der Jahre gewöhnt und das wir so angenehm ignoriert hatten, war dieser Bruch gewaltig. Die Überflutung nahm eine Krise vorweg, die über die vielen Stunden des Aufwischens hinausging. Eine Krise, für die unsere Wohnung anscheinend ebenfalls Verantwortung trug und die durch ihre ureigenen Rohrleitungen auf die Spitze getrieben worden war. Ich war dankbar für dieses, so schien mir, Zeichen der Solidarität, einen Akt des Mitgefühls, der glücklicherweise keine anhaltenden physischen Schäden hinterließ. Unser eigener Holzboden trocknete schnell, und keine Spur blieb zurück. Die Wohnung unter uns, die den größten Schaden durch das Leck davontrug, war zu dem Zeitpunkt nicht vermietet und stand leer. Die gewaltigen Entfeuchter, die man dort aufstellte, um Wände und Räume zu trocknen, konnten ihrem geräuschvollen Geschäft nachgehen, ohne irgendjemanden zu stören. Im Atelier der Malerin im ersten Stock war das Wasser an der einzigen Wand hinabgelaufen, an der keine Bilder hingen. Wundersamerweise waren die riesigen Gemälde an den anderen beiden Wänden, die sie in den letzten sechs Monaten akribisch komponiert hatte, verschont geblieben. Die kugelförmige Glaslampe im Eingangsbereich des Erdgeschosses, in der sich die letzten Tropfen sammelten, wurde einfach abmontiert und ausgekippt, gleich einem Goldfischglas, das keiner mehr braucht.
»Manchmal bedeutet fließendes Wasser ein trauerndes Haus«, las ich im Internet. »Es besteht ein Überfluss an Gefühlen, die verdrängt werden müssen.« Das Bild, das sich auf der Oberfläche der Wasserpfütze formte, spiegelte nicht bloß ein zerstörtes Heim, sondern auch das Haus an sich. Das Gebäude selbst weinte diese Tränen der Trauer. Es sollte bald zu meinem bestimmenden Thema werden.
Zur gleichen Zeit, als der Wasserschaden die Wohnung heimsuchte, bemerkte ich, wie eindringlich sich mir der Blick aus meinem Fenster bot. Er schien mich anzuziehen, weg von den Schicksalsschlägen, die sich drinnen ereigneten, und hin zu einem weiten Himmel, zu Baumspitzen und Gebäuden, die sich bis zum Horizont erstreckten. Im Laufe der Arbeit in meinen vier Wänden wurde diese Konstellation zum wiederkehrenden Motiv: eine Frauengestalt am Fenster mit dem Rücken zum Betrachter, hinausschauend. Bewegungslos an dieser Schwelle verharrend, der Körper vom Geiste losgelöst, so wie das Innere vom Äußeren getrennt ist. Für das Fenster selbst bildet das Fenster die Grenze.
Die erste Fotografie der Welt, aufgenommen 1826 von Joseph Niépce, zeigte den Ausblick aus seinem Studiofenster. Man erkennt eine verschwommene Anordnung hellgrauer Flächen und Körper, in der Mitte die Schräge eines Daches. 1838, zwölf Jahre später, nahm Louis Daguerre das erste fotografische Abbild eines Menschen auf, indem er den Blick aus seinem Fenster festhielt. Eine ausladende Aussicht führt eine von Bäumen gesäumte Straße hinab, flankiert von imposanten Gebäuden, sonst aber leer bis auf zwei starre, geisterhafte Gestalten. Diese frühen Fotografien waren so etwas wie Grundlagenrecherchen; Untersuchungen wesentlicher Tatsachen, die beim Offensichtlichsten anfingen: dem Blick von innen nach außen. Eine Positionierung des Ichs innerhalb eines Ortes, eine gewisse Form der Verankerung.
Christopher Isherwood bedient sich in Leb wohl, Berlin bekanntlich derselben Herangehensweise. »Vor meinem Fenster die dunkle, ehrwürdige, gewaltige Straße«, heißt es am Anfang des Kapitels »Ein Berliner Tagebuch« aus dem Jahr 1930. Isherwood wird selbst zum Fotoapparat: »Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss, ganz passiv, ich nehme auf, ich denke nicht.«1 Doch ist die Frauengestalt an meinem Fenster nicht ganz so passiv, während sie auf das Berliner Stadtbild hinausschaut. Sie stellt sich Fragen zur Orientierung. Wie genau ist sie an diesem Ort gelandet? Und was ist das überhaupt für ein Ort, dessen Oberfläche so viele Geheimnisse zu bergen scheint?
Das Haus, in das wir im Sommer 2014 einzogen, steht am Ufer des Berliner Landwehrkanals: Mit seinen Füßen im Westen, blickt es über das Wasser hinweg in den Osten der Stadt. In Berlin, dieser Stadt der Extreme und der unterbrochenen Geschichten, sind schon die einfachen Bezeichnungen »Ost« und »West« mit ideologischer Bedeutung überfrachtet. Standorte sind im wahrsten Sinne des Wortes entscheidend. Das Grundstück, auf dem sich mein Haus befindet, lag Mitte des 19. Jahrhunderts, als es zum ersten Mal bebaut wurde, am Rande der Stadt, gerade jenseits der Zollgrenze, die das Zentrum seit gut einhundert Jahren umschloss. Doch die Achsen der Stadt wurden während der raschen industriellen Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten neu gezogen, sodass dieses Gelände einen Logenplatz auf das zentrale Schauspiel Berlins erhielt; den Mittelpunkt ihres staatlichen, journalistischen, verkehrstechnischen und weltstädtischen Lebens. Als Berlin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Besatzungszonen aufgeteilt wurde, geriet das Grundstück abermals an die öde Peripherie. Nun aber, in den frühen 2000er Jahren, nimmt es erneut eine zentrale Stellung in einer Hauptstadt ein, die sich immer noch an die Wiedervereinigung gewöhnt.
Berlins klar definierte Wohnbezirke haben jeweils ihren ganz eigenen Charakter, und obwohl dieses Gebäude offiziell in Kreuzberg steht, allerdings an dessen nördlichster Spitze, ist es nur einen Häuserzug von der Grenze zu Tiergarten entfernt und hat direkt Schöneberg im Rücken. Dieses Gebiet ist nicht gerade dicht besiedelt, sondern geräumig und voller zaghafter Lücken, zeitlicher Sprünge und ungezähmter grüner Einsprengsel. Unser Kanalufer heißt Tempelhofer Ufer, da es ursprünglich in das Dorf Tempelhof führte. Trotz der vergleichsweisen Weitläufigkeit dieser Region fällt der Blick aus meinem Küchenfenster im dritten Stock auf einen dichten Flickenteppich städtischer Geschichte. Jenseits seiner sichtbaren Bestandteile scheint jedoch noch etwas anderes am Werk zu sein: der beunruhigende Eindruck von einer Vergangenheit, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber nicht genauer betrachtet werden möchte; ein Abwärtssog, der die Gegenwart scheinbar zum Stillstand bringt.
Ich fange an, historische Fotografien, Literatur und Archivmaterial ausfindig zu machen, die ich nach Hinweisen auf diesen Ort durchkämme. Bücher über seine Architektur und die frühe Stadtentwicklung. Ein Jahrhundert alte literarische Werke, die in den Straßen um mich herum spielen. Im Internet schmerzliche Adresssammlungen aus den 1930er Jahren, die alle Häuser mit jüdischen Bewohnern auflisten. Augenzeugenberichte über die letzten Straßenschlachten des Zweiten Weltkriegs. Ich schaue mir Wim Wenders’ Himmel über Berlin an, den ich 1987 als Teenager in Manchesters Arthouse-Kino sah, als der Film zum ersten Mal lief. Nun suche ich den Bildschirm nach Orten ab, die ich kenne, und nach Ansichten, die mir aus meinem augenblicklichen Alltag geläufig sind. Es gibt sie: die Schienen, die hinter meinem Haus entlangführen, die Schwäne, die auf dem Kanal treiben, den zerstörten Bahnhof, den ich in mittlerer Entfernung aus meinem Fenster heraus sehen kann. Ich beginne, meine eigenen Erlebnisse auf diese Schichten aus Zeiten, Worten und Bildern aufzutragen. Das ist ein Anfang.
Im Sommer 2001 war ich aus New York in Berlin angelangt, eine weitere Neu-Berlinerin, wie sie jüngst zuhauf in eine Stadt strömten, die historisch von Einwanderungswellen geformt worden war. Ich war einem starken Bauchgefühl gefolgt, das jede rationale Vorsicht verdrängte, und hatte meinen Job, meine Freunde, mein Studio in New York zurückgelassen, um zu meinem deutschen Freund in seine riesige Berliner Wohnung zu ziehen. Hohe Decken, hellgrauer Linoleum-Boden, kaum Möbel und das größte Badezimmer, das ich je gesehen hatte. Ich war gut zehn Jahre nach der Wiedervereinigung hier gelandet und hatte bereits das Gefühl, zu spät zu sein. Künstler, Musiker, Schriftsteller, Filmemacher, Schauspieler und Designer waren zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren in Scharen hierhergeströmt, lebten in den verfallenen Wohnungen Berlins, richteten Ateliers ein und verwandelten jedes leerstehende Gebäude in eine Bar, einen Club oder einen Ausstellungsraum. Der schiere Platz hier war spürbare Erleichterung nach der Enge und dem Druck des Lebens in New York City. Hier gab es eine Wildnis, die zuweilen an Trostlosigkeit grenzte. So viel Leere, so viel Unsicherheit. Ich war gerade 30 Jahre alt geworden und auf der Suche nach Veränderung. Die Verfügbarkeit und die unbestimmten Möglichkeiten dieses Ortes schienen eine Offenheit zu bieten, in der man handeln konnte. Vielleicht konnte sie mir dabei helfen, mit dem Schreiben anzufangen. Ich packte zwei Koffer, suchte mir einen Untermieter für mein New Yorker Studio mit allem darin und machte mich auf den Weg, um ein neues Kapitel an diesem unbekannten Ort aufzuschlagen.
Als ich auf der Türschwelle meines Freundes erschien, lebte der gerade in der Mauerstraße nahe dem Checkpoint Charlie, genau im Zentrum der Stadt. Dieses erstaunlich triste Viertel schien jeden Zweck und Flair zu missen und wurde vor allem von umherstreifenden Touristengruppen bevölkert. Kein Baum war in Sicht. Selbst die Gebäude hier wirkten zurückgezogen, die Augen nach unten auf ihr eigenes Fundament gerichtet. Es hatte eine gewisse Ironie, in einer »Mauerstraße« zu leben, gerade in dieser Stadt, die nach dem Fall der Berliner Mauer so auf Selbsterfindung aus war, doch war die Mauer, auf die sich der Name der Straße bezog, eine andere: die Zollgrenze, die sich im 18. Jahrhundert in der Nähe befunden hatte.
Der Ausblick aus dem Schlafzimmerfenster meines Freundes wurde vollkommen von einem gewaltigen brandneuen Bürogebäude ausgefüllt, das von Philip Johnson entworfen und 1997 während Berlins Nachwende-Boom fertiggestellt worden war. Dieser riesige, aalglatte Bau hatte etwas Merkwürdiges an sich, als wäre er an den falschen Ort gesetzt worden. Es war mir damals noch nicht klar, doch war das American Business Center, wie das Gebäude hieß, auf dem Gelände der Bethlehemskirche errichtet worden, einer Kirche aus dem 18. Jahrhundert – einem der ältesten Gotteshäuser der Stadt, bis es 1943 von Bomben zerstört worden war. Ein spanischer Künstler installierte 2012 eine Stahlskulptur, die den Umriss der verschwundenen Kirche nachzeichnete. Aber als wir dort lebten, wusste ich nichts von dem verlorenen Bau, diesem fehlenden Puzzlestück. Jenes Wohnhaus war von einem ähnlichen Unbehagen und einer ähnlichen Stille umgeben wie das, in dem ich jetzt lebe. Etwas Verschwiegenem und Verrenktem. Einer unheimlichen Schwere in der Luft.
Kurz nach meiner Ankunft in Berlin verließen mein Freund und ich die Mauerstraße und zogen in das gefälligere Viertel Prenzlauer Berg im ehemaligen Osten der Stadt. In diesem bald schon von der vereinheitlichenden Kraft der Gentrifizierung umgestalteten Bezirk erfüllten wir unabsichtlich alle relevanten Kriterien. Innerhalb von sechs Monaten war ich schwanger, und wir wurden zu einer der vielen jungen Familien in der Gegend. Hier kamen unsere Kinder zur Welt, hier kauften wir unsere erste eigene Wohnung, hier schlossen wir den Bund fürs Leben und legten uns Haustiere zu. Gefangen in der ständigen Aufgabe, Arbeit und Familie nahtlos miteinander zu verbinden, wurden wir abgelenkt und verloren einander aus den Augen. Wir ließen unsere Ehe scheitern. Diese Tatsache war allerdings noch nicht offenkundig, als wir zwölf Jahre später von einem Ende der Stadt ans andere zogen, vom Zentrum Ost ins Zentrum West.
»Wer sich der eignen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muß sich verhalten wie ein Mann, der gräbt«, rät Walter Benjamin, der in Berlin geboren wurde und dort bis zum Beginn seines Exils in den frühen 1930er Jahren immer wieder lebte.2 Ist das eine Art Geomantik, die den Boden der Geschichte deuten soll? »Und gewiß ist’s nützlich, bei Grabungen nach Plänen vorzugehen«, schreibt Benjamin weiter. »Doch ebenso ist unerläßlich der behutsame, tastende Spatenstich in’s dunkle Erdreich.« Ich beginne mit dem Graben durch dieses Medium, durchkämme und durchsiebe diese Vergangenheit, ohne wirklich zu wissen, wonach ich suche. Erinnerungen aufzuspüren, die nicht die eigenen sind, ist ein schmutziges Geschäft voller Fallstricke. Aber vielleicht kann dieses Unterfangen die Durchlässigkeit eines Ortes aufklären und verdeutlichen, wie dessen Vergangenheit seine Gegenwart prägt? Deshalb fange ich am offensichtlichsten Punkt an: hier, alleine am Küchenfenster, von innen nach außen schauend.
Ich stelle mir die Aufgabe, ein Porträt der Stadt zu verfassen. Vielleicht eine unmögliche Aufgabe, aber das Haus scheint sie irgendwie anzuregen. Was nun kommt, betrifft Erinnerung, die Vergangenheit und deren Wiederherstellung, doch folge ich diesen nicht bloß auf einem einzigen Weg und schreite auch nicht Schritt für Schritt voran. Die Erinnerung an einen Ort liegt nicht flach auf einer geraden Zeitachse; sie ist synkretistisch und simultan. Sie besteht aus Ereignissen und Passagen, Stimmungen und Aufenthalten, die sich in dünnen Schichten abgelagert haben. Sie ist eine Mischung aus assimilierten Handlungen, in die Substanz der Häuser und Straßen eingebunden oder in Worten und Bildern aufgezeichnet, die sich im Laufe der Zeit ansammeln – oder sie hat gar keine greifbare Form und muss erspürt oder neu erdacht werden.
Als wir dieses Haus am Ufer des Landwehrkanals entdeckten, hielt ich das Leben am Wasser für einen Weg, um aufzutauchen. Über den Ort zu schreiben, an dem ich lebe, könnte eine Möglichkeit sein, einen Anker zu setzen und der Strömung zu trotzen. Besonders dann, wenn die Dinge, über die ich schreibe, selbst eine Sache der Strömung sind – Treibgut aus der Vergangenheit, das an den Ufern des Bewusstseins angespült wird. Aber dieses Thema – diese Stadt – verweigert sich der sauberen Eindämmung. Der Text ist ausufernd und unbändig geworden und beginnt so dem Ort selbst zu ähneln, der sich ohne erkennbare Ufer weit ausbreitet. Berlin.
Delius’ Plan von Berlin, 1850
I.
GRABEN
VOM LEBEN AUF DEM WASSER geht ein anhaltender Reiz aus. Seine Oberfläche suggeriert eine Tiefe, die es in einer städtischen Landschaft sonst nicht gibt. Einen Riss in ihrer Betonkruste und eine Erleichterung von ihrem ständig drängelnden Verkehr, dem Fluss an Menschen, den nach oben strebenden Gebäuden. Wasser liegt einfach nur da und bietet Reflexionen – des Himmels, der Bäume, der vorbeiziehenden Vögel, der seine Ufer säumenden Häuser. Ein umgekehrtes Bild der Stadt, durch die es strömt.
Aber ein Kanal ist kein Fluss; er strömt nicht wirklich. Sein Lauf ist aus der Landschaft herausgeschnitten und sein Gewässer von seinen Betonufern eingeschlossen. An manchen Tagen scheint der Kanal vor meinem Fenster sich in die eine Richtung zu bewegen, an anderen Tagen in die andere. Doch meistens liegt er still da und rührt sich kaum. Eine blaue Schleife, vom Nordosten in den Südwesten quer über die Stadt gespannt, mit einundzwanzig Brücken, um ihn an Ort und Stelle zu halten.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich als Erstes den Landwehrkanal. Er ist jedoch anders als die mir bekannten englischen Wasserstraßen. Der Manchester Ship Canal ist schmal, dreckig und tief und soll der Industrie in den Magazinen und Fabriken aus rotem Backstein an seinen Ufern dienen. Der Bridgewater Canal, an den meine Eltern meine Brüder und mich zu Wochenendspaziergängen mitnahmen, verläuft gerade und flach auf erhöhten Aufschüttungen mit einspurigen Fußwegen auf beiden Seiten. Der Regent’s Canal, den ich in meinen frühen Zwanzigern in Nord-London kennenlernte, ist ebenso schmal und bahnt sich seinen Weg durch das zugebaute Stadtzentrum. Mein Berliner Kanal ist dagegen großzügig: ausladend und von Bäumen gesäumt, ebenso breit wie die zweispurigen Fahrbahnen, die seine Ufer säumen, während er durch die Wohnbezirke der Stadt fließt. Die zweispurige Straße auf meiner Kanalseite führt direkt nach Kreuzberg, die am anderen Ufer durch Tiergarten nach Charlottenburg in den Westen.
»Berlin ist vom Kahn gebaut«, heißt es in einem alten Sprichwort, und tatsächlich wurde diese Wasserstraße nicht für den Dienst an dreckiger, rauchender Industrie errichtet, sondern vor allem für den Bau der Häuser in der Stadt. Eine Bleistiftzeichnung von Adolph Menzel, Berlins bekanntestem Künstler des 19. Jahrhunderts, die in den frühen 1840er Jahren entstand, zeigt den überfluteten Schafsgraben, wie ein Teil des Kanals damals hieß. Ein knorriger, doppelt gekrümmter Baumstamm ragt aus einem regungslosen Hochwasserteich. Ein Holzzaun hält das Wasser zur Rechten zurück, auf der Linken ist schemenhaft die Vorderseite eines Hauses skizziert.
Der Landwehrkanal folgt dem alten Schafsgraben oder »Landwehrgraben«, wie er landläufig hieß. Diese von Osten nach Westen verlaufende Schutzgrenze wurde im 15. Jahrhundert angelegt. In diesen frühen Jahren war die Landwehr, also die Verteidigung des Landes, von oberster Bedeutung, als die Kurfürsten der Hohenzollern die kleine Handelsstadt Berlin übernahmen – ein unbedeutender Ort, bis auf seine Lage als Tor zu Hamburg, der Ostsee und Osteuropa. Ihr Entschluss, ihn in ein pulsierendes Zentrum der Macht, Politik und Verwaltung zu verwandeln, wurde von einer Armee beachtlicher Größe sichergestellt. Von nun an wuchs Berlins Einfluss beständig, gefestigt durch eine Kombination aus strenger preußischer Bürokratie und nackter militärischer Gewalt. Als im frühen 18. Jahrhundert das Königreich Preußen gegründet und Berlin zu seiner Hauptstadt ernannt wurde, legte man den Lauf des Landwehrkanals fest. Er diente dazu, Flut und Hochwasser von den grandiosen Bauten des neuen Stadtzentrums fernzuhalten und an den schläfrigen ländlichen Stadtrand von Menzels Skizze zu lenken.
Wenn ich im Internet nach dem Landwehrkanal suche, tauchen zwei Dinge sofort auf. Erstens ist da ein Hinweis auf ein grausames Lied aus der Zeit der Weimarer Republik über eine im Kanal schwimmende Leiche. Zweitens ist da die Schlagzeile eines Zeitungsartikels vom 4. Januar 2009: »21-Jähriger stürzt mit Auto in den Landwehrkanal.«
Ein Foto zeigt das Heck eines schwarzen Kleinwagens, zwei Seile sind an den Hinterrädern befestigt, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Es ist nicht das erste Auto im Kanal, erfahren wir aus dem Artikel. Im Februar 2002 verpasste ein Einunddreißigjähriger eine Kurve und stürzte ebenfalls hinein. Im selben Sommer fuhr eine Zweiundzwanzigjährige mit ihrem Auto in den Kanal. Gleiches geschah einer Frau unbekannten Alters im Dezember 2006. Am 3. November 2007 lenkte eine Vierundzwanzigjährige ihren Wagen aus unerfindlichen Gründen in den Kanal. Die Frau rettete sich auf das Dach ihres untergehenden Autos und wurde von der Polizei geborgen, die sie an der Ecke Tempelhofer Ufer nahe der Schöneberger Brücke an Land brachte. Das ist fast genau vor meinem Haus. Wäre ich Zeugin dieses Unfalls geworden, hätte ich damals bereits dort gewohnt? Hätte ich die Frau gesehen, wie sie verzweifelt und triefend nass auf ihr Autodach kletterte, hilfesuchend mit den Armen rudernd, während ihr Wagen unter die spiegelglatte Oberfläche sank? Wäre ich ihr zu Hilfe geeilt? Hätte ich die Polizei gerufen, wäre ich nach unten gehastet, auf die Brücke gelaufen und hätte ihr den rot-weißen Rettungsring zugeworfen, der, allzeit für den Einsatz bereit, am gelben Geländer der Schöneberger Brücke hängt?
Erst 1840 entstanden Pläne, den Landwehrgraben in eine schiffbare Wasserstraße umzuwandeln. Diese Pläne wurden von Peter Joseph Lenné entworfen, dem gefeierten Landschaftsarchitekten, der sich der Stadtplanung zugewandt hatte. 1789 in eine Bonner Gärtnerfamilie geboren, kam Lenné 1816 jung und ehrgeizig nach Berlin. Er trat sofort eine Stelle im Dienst des Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV. an und machte sich an die Umgestaltung der Anwesen und Parkanlagen des zukünftigen Königs in Potsdam, deren steife Symmetrie er durch einen fließenden Archipel aus Seen und Inseln, vielfach gewundenen Buchten und Hainen auflockerte. Der »Landschaftsgarten«, der den Eindruck erweckte, die Natur hätte hier ihren freien Lauf, war Lennés Errungenschaft, und Wasser, wie er zu sagen pflegte, sein Hauptmaterial. Seine Vision gefiel dem Kronprinzen, der ästhetisch auf der gleichen Wellenlänge und von der Pracht und Herrlichkeit entzückt war, sodass Lenné schon bald auf den Posten des General-Gartendirektors der königlich-preußischen Gärten befördert wurde. 1838 lebte er in einer neu errichteten Villa in Tiergarten, gemeinsam mit seiner Frau »Fritzchen«, zwei alten Papageien und mehreren Generationen Neufundländern. Ein Jahr später wurde die Straße, in der seine Villa stand, in »Lennéstraße« umbenannt.
1833 begann Lenné mit der Umgestaltung des Tiergartens, dem ältesten Park Berlins. Im 15. Jahrhundert hatten die Hohenzollern-Fürsten das sumpfige Waldland zu ihrem privaten Jagdrevier gemacht. Bereits 1818 hatte Lenné den Tiergarten ins Auge gefasst, als er, gerade einmal zwei Jahre als Gehilfe des Gärtners in Potsdam tätig, am Hof einen Antrag auf dessen Umgestaltung stellte. Die verblasste Zeichnung, auf die ich in einem Katalog seiner gesammelten Werke stoße, zeigt die ursprünglich strahlenförmig angelegten Achsen des Tiergartens, verschönt durch ein Stickmuster aus Teichen, weiten Auen und sich sanft dahinschlängelnden Wegen. Solche Elemente lassen eher an ein Umherschlendern denken, das nicht auf ein Ziel oder ein steifes Promenieren ausgerichtet ist, sondern auf die sinnliche Erfahrung, aus einem dicht beschatteten Wald auf weite, sonnenbeschienene Wiesen zu treten und entlang grasbewachsener Ufer über sanft geschwungene Brücken zu wandeln. Diese Vision, ihrer Zeit voraus und ohne jede Rücksicht auf Fragen ihrer praktischen Realisierbarkeit, wurde damals auf der Stelle abgelehnt. Als Lenné 1833 jedoch eine überarbeitete Fassung einreichte, dieses Mal mit dem offiziellen Siegel der Königlichen Gartendirektion versehen, wurde sein Antrag angenommen. »Auf Befehl Sr. Majestät des Königs bin ich damit beschäftigt, den Tiergarten bei Berlin in einen gesunden und angenehmen Erholungsort für die Bewohner der Hauptstadt umzuschaffen«, erklärte Lenné sein erfolgreiches Ansuchen.1 Sein Tiergarten sollte Berlins öffentlichster Raum werden, ein »Volksgarten«, wie er es nannte, wo alle Schichten der bürgerlichen Gesellschaft sich über alle Klassen und Einkommen hinweg versammeln konnten, und das zum ersten Mal in der Geschichte Berlins.
Lennés Konzept sah vor, dem unbearbeiteten sumpfigen Terrain eine romantische, malerische Landschaft abzugewinnen. Er legte einen Großteil der Waldstücke trocken, um Platz für gewundene Fußwege zu schaffen, die sich durch Baumgruppen und duftendes Gebüsch schlängelten und den Blick auf weite grüne Wiesen freigaben, welche von Bächen durchzogen und mit Pfaden verbunden waren. Buchtenreiche Seen, übersät von kleinen Inseln und überspannt von unzähligen kleinen Brücken. Wasser und Land gingen ineinander über, bis sich kaum noch erkennen ließ, was Insel und was Festland war. Innerhalb der Grenzen des Parks entstand so der Eindruck einer sich grenzenlos dahinziehenden lieblichen Landschaft. Der Tiergarten sollte mit seinen wenigen, deutlich erkennbaren Blickachsen kein bloßer Durchgangsort werden, sondern ein Ausflugsziel an sich, ein Raum, in dem man sich entspannte und einfach nur das Erlebnis genoss, sich die Zeit inmitten der belebenden Elemente des Wassers und der Natur zu vertreiben. Lennés Vision bot gleichermaßen die Privatsphäre schattiger Abgeschiedenheit wie offene Wiesen, auf denen man zusammenkommen, sehen und gesehen werden konnte, und markierte so das Auftauchen der Freizeit in der städtischen Landschaft. Sie war ein Kontrast zum schnellen Wachstum der Stadt und ihrer industriellen Entwicklung, die zu diesem Zeitpunkt immer mehr bäuerliche Landbevölkerung zum Arbeiten in die Stadt strömen ließ.
Als ich im Sommer 2001 nach Berlin kam und in die Wohnung in der Mauerstraße zog, ging ich in den Tiergarten, um im Gras zu sitzen und in der Sonne zu arbeiten, umgeben von Spaziergängern mit Hunden, spielenden Kindern und erstaunlich unbekleideten Sonnenanbetern. Ich kämpfte mit meinem ersten richtigen Auftrag als Autorin und verfasste einhundert Wörter zählende Texte für einen Sammelband über zeitgenössische Kunst. Brauchte ich eine Pause, fuhr ich mit meinem Fahrrad die gewundenen Parkwege entlang und verirrte mich dabei jedes Mal, weil mein Orientierungssinn vom fliegenden Wechsel der Wiesen, Wälder und Gewässer irritiert war. Selbst jetzt noch, nach all den Jahren, finde ich mich dort immer noch nicht zurecht. Der Park, in dem ich mich verliere, ist Lennés Volksgarten.
Es war auch Walter Benjamins Park. Hier und im umliegenden Bezirk Tiergarten verbrachte er seine frühe Jugend. Die Wohnung seiner Familie sowie die seiner Großmutter lagen einen kurzen Fußweg vom Park entfernt, der bei ihm den Eindruck eines Labyrinths hinterließ. Einerseits war dies ein Ort, »der wie kein anderer den Kindern offen scheint«, andererseits war er »mit Schwierigem, Undurchführbarem verstellt«, mit Unübersichtlichkeit, Unzugänglichkeit und zerstörten Hoffnungen.2 Benjamins Erinnerungen sind in den dichten Nebel kindlicher Wahrnehmung gehüllt. Der Tiergarten ist für ihn unbegreiflich, ein Raum voller geheimer Ecken, von denen man gehört, die aber nie jemand gesehen hat.
Obwohl Lenné die Pläne für den Tiergarten entworfen hat, wie er bis heute existiert, beaufsichtigte er nicht deren finale Umsetzung. Frustriert von der Kleinlichkeit preußischer Beamter, die auf Papierkram herumritten, Zahlungen zurückhielten und selbst den kleinsten Abweichungen von laut den Entwürfen angekündigten Vorgängen widersprachen, legte er 1838 sein Amt nieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich sein Interesse an der Landschaftsplanung ohnehin auf die sozial orientierte Stadtplanung ausgeweitet. Eine Reise 1822 nach England, das auf der Einbahnstraße der Industrialisierung damals bereits weiter fortgeschritten war, überzeugte ihn davon, dass das Stadtleben durch Licht, Luft und Natur erleichtert werden musste. Von nun an nannte er sich »Garten-Ingenieur«. Als die Bevölkerung der Stadt wuchs und sich zwischen 1820 und 1848 auf 400 000 Einwohner mehr als verdoppelte, stellte Lenné sich eine Stadt vor, die angelegt war, diesem Druck entgegenzuwirken. 1840 präsentierte er dem Innenministerium einen Plan mit dem eindrucksvollen Titel »Projekt der Schmuck- und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgegend«. Dies war seine Vision einer üppigen Gartenstadt, die ihrer ständig wachsenden Bevölkerung entgegenkommen und für sie sorgen sollte.
Der zentrale Aspekt von Lennés großem Plan war die Kanalisierung des Landwehrgrabens. Diese würde die Sumpfgebiete im Südosten trockenlegen, den Wasserstand des geschäftigsten Teils der Spree erhöhen und ein komfortables Transportmittel für die beständig wachsende Industrie der Stadt bieten. Der Kanal sollte dem gewundenen Lauf eines natürlichen Flussbettes folgen und von Alleen mit Bäumen und Sträuchern begleitet werden. Abermals waren die Wasserstraßen Herz und Seele von Lennés Entwurf.
Mit einer Gesamtlänge von etwa vier Kilometern würde der Landwehrkanal von einer breiten, schattigen Allee mit doppelter Baumreihe flankiert werden, wobei 5518 Bäume entlang der gesamten Kanalstrecke gepflanzt werden sollten:
Auf dem Köpenicker Felde 888 Linden, bis zur Potsdamer Chaussee 1240 Linden und 1240 Rüstern, von der Potsdamer Chaussee bis zum Zoologischen Garten 534 Roßkastanien und 534 Ahornbäume, bis zur Charlottenburger Chaussee 151 Linden und 151 Rüstern, bis zur Mündung 390 Silberpappeln und 390 Bergellern.3
Eine Skizze aus dem Jahr 1846, an den Rändern zerknittert und vergilbt und mit Lennés offiziellem Siegel der Königlichen Gartendirektion versehen, zeigt zwei Möglichkeiten für die Bepflanzung am westlichen Tempelhofer Ufer, wo mein Haus später errichtet werden würde. In Aufsicht und Querschnitt sind darauf fein gezeichnete und in blassem Grün und Braun gehaltene Baumreihen sowie die Ränder von flachen Sträuchern zu erkennen. Kein Asphalt oder unaufhörlicher Verkehr, bloß ein unbefestigter Weg und friedliche Schatten, unter denen man am Ufer entlangspazieren kann.
Im September 1850 wurde der Landwehrkanal für den Schiffsverkehr eröffnet. In weniger als zehn Jahren war die ruhige, von Wasser geprägte Szenerie, die Menzel gezeichnet hatte, durch die emsigen und aktiven Wasserstraßen einer Stadt im Werden ersetzt worden.
Auf der Suche nach weiteren Zeichnungen Menzels aus dieser Periode der Berliner Entwicklung besuche ich die Bibliothek des Kupferstichkabinetts, das die Sammlung der Zeichnungen der Gemäldegalerie beherbergt, des Museums für Malerei in der Nähe des Potsdamer Platzes. Von meinem Zuhause aus ist es bloß ein kurzer Weg mit dem Fahrrad: nach links den Kanal hinauf, vorbei an zwei Brücken und über die dritte, die Potsdamer Brücke, die zum Kulturforum führt. Dieses Museumsareal wurde Mitte der 1980er Jahre entworfen, um den Teil der städtischen Kunstsammlung aufzunehmen, der in den Händen Westberlins gelandet war. Fertiggestellt wurde es allerdings erst in den späten 1990er Jahren, als die Lage in der Stadt sich bereits unwiederbringlich verändert hatte. Anders als der imposante Stahl- und Glasmodernismus der nahebei am Kanal gelegenen Neuen Nationalgalerie erinnern diese Backsteingebäude, die sich ein Stück abseits der Hauptstraße hinter den Parkbuchten an der aus dem 19. Jahrhundert stammenden St.-Matthäus-Kirche aneinanderdrängen, auf sonderbare Weise an eine Stadtverwaltung. Es überrascht mich jedes Mal, die beeindruckende Sammlung von Cranachs, Holbeins, Van Eycks und Rubens abgesondert in ihren unteren Stockwerken zu finden.
Ein Mann in einem weißen Laborkittel sitzt hinterm Schreibtisch im Magazin der Abteilung für Malerei und informiert mich darüber, dass sie dort über den gesamten Nachlass Menzels verfügen. Insgesamt mehr als 900 Zeichnungen. Was wolle ich sehen? Ich suche nach frühen Arbeiten von 1840 bis 1860, doch der Mann im Laborkittel teilt mir mit, die Sammlung sei nach Motiven und nicht chronologisch geordnet. Schwer zu sagen, nach was für Motiven ich suche. Örtliche Landschaften? Gebäude? Bäume? Vage energetische Gezeiten? Es gibt allein vier Archivboxen voller Bäume, erfahre ich von dem Laborkittel, als er in der Datenbank seines Computers nach »Landwehrkanal« sucht. Eine Zeichnung taucht unter diesem Schlagwort auf, deshalb bestellt er die Box, in der sie sich befindet. Ich schlage ein paar andere Motive vor – Architektur, Eisenbahn, Innenansichten –, und zusätzliche Boxen werden angefordert. Zehn Minuten später fährt ein weiterer Assistent im weißen Laborkittel einen Wagen mit Archivboxen aus Karton herein, von denen jede einen Stapel Zeichnungen enthält, die auf dicke Passepartouts aufkaschiert sind. Er hebt die erste Box vom Wagen und stellt sie auf dem Tisch vor mir ab. Nummer 167: Auf dem Schild steht »Leichen, Gefangene«.
Ich löse die kleine Messingschnalle und öffne die Box. Die erste Zeichnung ganz oben auf dem Stapel zeigt einen Mann, der in einem flachen Kahn kniet, seine Kleidung und sein Schnurrbart sind schwarz schattiert. Mit Hilfe von etwas, das wie eine riesige Zange aussieht, zieht er einen nackten Körper aus dem Wasser. Neben ihm befindet sich ein anderer Mann, der in schnellen Strichen gezeichnet ist und das Boot mit einer Stakstange stabilisiert. Nur der von schwarzem Haar bedeckte Hinterkopf sowie eine Schulter der Leiche, in rosa Aquarellfarbe laviert, sind über der Wasseroberfläche zu erkennen. Die Skizze ist mit einem Titel, einem Datum und einer Unterschrift versehen: »Kanal, 1862, A. M.« Darunter ist eine Detailzeichnung des Toten. Er liegt an Land zwischen Grasbüscheln, den Kopf zur Seite geneigt und die Augen geschlossen, als würde er am grünen Kanalufer ein Schläfchen halten. Die nächste Zeichnung in der Box zeigt den Kahnfahrer, der, inzwischen am Ufer, die auffällig rosafarbene Leiche unter ihren ausgestreckten Armen an Land zerrt, als wäre sie ein Stück Fleisch. Ein weiteres Blatt mit rasch hingeworfenen Skizzen hält die Bewegungen der beiden Männer fest, während sie den toten Körper des dritten heben. In der Ecke oben links steht in einer kaum lesbaren Schrift eine von Menzel hingekritzelte Notiz: »/ Ehe die Leiche ans Ufer gezogen / wurde, stand sie wahrscheinlich / durch die Strömung aufrecht / etwas schräg nach hintüber, / mit nach vorn hängendem / Kopfe«.
Diese forensische Sorgfalt mit ihrem vorfotografischen Drang, Zeugnis abzulegen, hat etwas Faszinierendes an sich. Ich stelle mir Adolph Menzel vor, einen ungewöhnlich kleinen Mann, gerade einmal 1,40 Meter groß, der, korpulent und in einen Gehrock gekleidet, am Kanal an den Stadträndern spazieren geht, in den Taschen Skizzenbuch, Bleistifte und Aquarellfarben. (Ich frage mich, ob er die Farbe zur Skizze der Leiche an Ort und Stelle hinzufügte oder ob er sie später nachbearbeitete, als er zu Hause war?) Zeichnungen in den anderen Boxen, versehen mit dem Titel »Landschaften oder Ortschaften: B«, beschreiben seinen Durst nach anderen kleineren menschlichen Dramen, jenseits der Tragödie eines Ertrunkenen.
Es mag nicht viel fotografisches Material aus diesen Zeiten geben, doch sind Menzels frühe realistische Arbeiten lebhafte visuelle Dokumente. Neben seinen bekanntesten Darstellungen – denen des Hofes König Wilhelm I., der seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV. 1861 auf den Thron folgte – gibt es zahllose Stücke mit zufälligen Szenen, die eine Stadt im Werden und seine Bewohner abbilden. In einer der Boxen liegt eine Zeichnung von 1846, auf der die St.-Matthäus-Kirche im Aufbau zu sehen ist, eben jene von Parkbuchten umgebene Kirche, an der ich auf dem Weg zur Bibliothek vorbeigekommen bin. Auf Menzels Studie wird das kastenförmige Gotteshaus von einem grob skizzierten Holzgerüst gestützt. Zahlreiche Bleistiftzeichnungen zeigen schlafende Bauarbeiter, die mit verschränkten Armen auf den Gerüstbrettern liegen und in ihren Kniehosen neben hölzernen Kübeln ein Nickerchen machen. Während ich diese auf dicke Passepartouts kaschierten Zeichnungen durchgehe, fasziniert von der Genauigkeit der von Menzel gewählten Perspektiven, erklingt das Mittagsläuten der St.-Matthäus-Kirche, und ihre Glocken hallen eineinhalb Jahrhunderte zurück.
Eine immense Vielfalt der Geschehnisse kann man in den zahllosen nebensächlichen Details entdecken, die Menzel in seinen Arbeiten festhält. Wäschewaschen, Eisenwalzen, Zugfahrten, Betten, Fahrräder, Musikinstrumente, die Landschaft jenseits der Stadtmauern. Diese Bleistiftzeichnungen, Gouachemalereien und Skizzen zeigen Menzels alltägliche Reisen, die einer mäandernden Logik der Ablenkung folgen, um herauszufinden, welche Straßen und Landwege Neues an Motiven bieten könnten, vor allem in noch unbebauten Teilen der Stadt. Hinterhöfe und Gassen, Tore und Zäune, die an verwilderte Gestrüpplandschaften grenzen, Gebiete, die sich unscharf zwischen Stadt und Land erstrecken, wo die Stadt auf der Lauer zu liegen scheint und sich wie eine Botschaft aus der Zukunft am Horizont sammelt.
»Die Menschheit schwamm im Taumel des Fortschritts und hatte fast nur noch Sinn für Eisenbahnen, Dampfschiffe und andere Errungenschaften der Technik«, heißt es in Peter Joseph Lennés Biografie, die einer seiner Nachfolger auf dem Gebiet der Landschaftsarchitektur 1937 verfasste. »Nur wenige einsichtige Männer, zu denen auch Lenné gehörte, bemühten sich, dieser Entwicklung entgegenzusteuern und der Menschheit heiligste Kulturgüter, zu denen unbedingt die deutsche Landschaft gehört, zu erhalten. […] Er wies dem Bürger wie dem Arbeiter die Arbeitsstätte, den Wohnplatz und die Erholungsgrünfläche zu, um ein organisches Gefüge der Stadt zu erhalten, aber er ahnte schwerlich das Tempo der zukünftigen ungesunden Entwicklung.«4
Auch diesmal missfiel Lennés Priorisierung der Landschaft gegenüber praktischer Effizienz den knausrigen preußischen Bürokraten. Er forderte einen höheren Wasserspiegel des Landwehrkanals, teilweise damit die Teiche und Seen im Tiergarten nicht stagnierten und den Volksgarten mit ihrem fauligen Gestank überzogen, aber auch, um die ältesten Bäume des Parks zu schützen, darunter einige achthundertjährige Eichen. Seine Empfehlungen wurden ignoriert, doch ist der Landwehrkanal trotz dieses Kompromisses eines der wenigen Elemente von Lennés ursprünglichem Stadtplan, das fertiggestellt wurde und bis heute sicht- und nutzbar ist, eineinhalb Jahrhunderte später.
Der Journalist und Schriftsteller Franz Hessel, ein enger Freund und Kollege Walter Benjamins, widmet ein Kapitel seines Buches Spazieren in Berlin aus dem Jahr 1929 dem Landwehrkanal.
Er beginnt mit einem malerischen Bild, das dem Wasserweg folgt, »aber unterwegs wandert er durch soviel Stadtidyll, daß sein Name in unserem Ohr einen sanften Klang hat«. Hessel verbrachte wie Benjamin seine Kindheit im späten 19. Jahrhundert im Bezirk Tiergarten, als der Landwehrkanal auch als »grüner Strand« bekannt war. Er bot eine Naht aus Wasser, welche die städtischen und ländlichen Merkmale Berlins miteinander verband und von Brücken überquert wurde, »die wie Gartenstege über Gartenbächen sind«.
An der Corneliusbrücke geht die Parklandschaft des Gartenufers mit grüner Brandung in die Stadtlandschaft über. Und die Atmosphäre, die in dieser Gegend den Atem von Park, Stadt und Wasser vereint, ist von zartem Farbenreichtum, wie man ihn in dem hellgrau umrissenen Berlin sonst selten findet. Kein Sonnenaufgang über den Bergen, kein Sonnenuntergang an der See läßt den, der in Berlin Kind war, die süßen Morgen- und Abendröten überm Frühling- und Herbstlaub vergessen.5
Ebendiesen Farbenreichtum und ebendiese süße Morgen- und Abenddämmerung stellte sich Lenné vor, als er 5 500 Bäume bestellte und sie entlang des Kanalufers anpflanzen ließ. Was nun, mehr als neunzig Jahre nach Hessels Hommage, bleibt, ist der Atem von Park, Stadt und Wasser. Aus meinem Fenster im Vorderhaus kann ich trotz einer zweispurigen Straße auf beiden Kanalseiten über ein Dutzend verschiedene Baumarten sehen, jede mit anderen Formen, Blättern und Grüntönen, die sich in ein anderes Gold oder Rot verwandeln, wenn der Sommer langsam verklingt. Sind das Linden? Eichen? Oder Rosskastanien? Eine erstaunliche Vielfalt von Insekten sammelt sich auf den Simsen der Fenster, die für einen Luftzug auf Kipp stehen. In den kühleren Monaten, wenn die Bäume kahl sind, gleiten helle Schwanenpärchen den Kanal hinauf. Wie für Hessel bildet dieser grüne Strand die Kulisse für die Kindheit meiner Söhne, aber auch für meine eigene tägliche Arbeit. Als wir von einem Ende der Stadt ans andere zogen, gab ich das kleine Zimmer auf, in dem ich früher schrieb, und kehrte zur komplizierten Wissenschaft der Arbeit in den eigenen vier Wänden zurück. Ich schreibe im hintersten der vier Zimmer, das auf den Kanal schaut und in dem eine Wand von oben bis unten voller Bücher steht. Ein paar Monate nach dem Einzug stellte ich den Tisch vom Fenster weg, sodass ich stattdessen auf die Bücherregale schaute. Der Ausblick lenkte mich viel zu sehr ab. Aber da war es bereits zu spät, denn er war schon zu meinem Thema geworden.
II.
ZEUGE
IM ZWEITEN SOMMER IN DER NEUEN WOHNUNG – die Jungs hatte ich für seinen Anteil an den Ferien zu ihrem Vater gebracht – entschied ich mich für einen Spaziergang am Kanalufer. Wir mussten uns noch an das neue Format unserer gerade erst zerrissenen Familie gewöhnen, und es bekümmerte mich, nun bloß noch Teilzeit-Mutter zu sein. Es hilft, eine klare Aufgabe zu haben, mit einem eindeutig definierten Anfangs- und Endpunkt, um dem Tag eine gewisse Struktur zu verleihen. Und so verlasse ich an einem warmen Vormittag im Juli das Haus, überquere die zweispurige Straße, um zum Kanalufer zu gelangen, und wende mich dort nach rechts. Den ersten Teil des Weges verlaufen das Wasser und der Weg parallel zueinander, begleitet von der oberirdischen U-Bahn, die von Pfeilern aus verschweißtem Stahl in der Luft gehalten wird. An der fünften Brücke, inzwischen mitten in Kreuzberg, biegen Straße und Schienen scharf nach links ab, während der Kanal geradeaus weiterfließt und nun ruhiger und idyllischer wirkt. Fünf Minuten später weitet er sich vor dem Krankenhaus Am Urban, wo grasbewachsene Uferstreifen in geräumige Böschungen übergehen, auf denen Leute picknicken und Pärchen am Wasserrand Flaschenbier trinken. Auf dem Wasser sammeln sich Schwäne in größeren Familienverbänden, drängen sich aneinander, schnarren oder putzen sich mit einzigartiger Hingabe die Federn. Tiefer in Kreuzberg treffen drei Wasserarme an einem Knotenpunkt zusammen, der sich auf einen dreieckigen See öffnet. Das ist das Ende des Landwehrkanals. Hier überquere ich die letzte Brücke und kehre an seinem Ostufer nach Hause zurück.
Drei Tage später gehe ich in entgegengesetzter Richtung los: das Westufer entlang, in den Tiergarten, gar durch den Zoo selbst hindurch, wo ich kurze Blicke auf Gazellengehege und Häuser mit exotischen Vögeln erhasche, und weiter nach Charlottenburg. Am Ende fließt der Kanal in einem weiteren dreieckigen Knotenpunkt in die Spree, und ich überquere das Gewässer, um am anderen Ufer nach Hause zurückzukehren. Diese Exkursionen sind mein Versuch, Zeugin zu sein und eine erlaufene Erfahrung über all das zu legen, was ich beim Studieren gedruckter Karten, bei der Suche im Internet oder beim Nachschlagen geschichtlicher Ereignisse gefunden habe. Mit dem Smartphone nehme ich Dutzende Bilder auf: von eisernen Brücken, graffiti-verschmierten Statuen, Gedenktafeln, Schienen, Bäumen und grasbewachsenen Böschungen, den auf dem Wasser versammelten Schwänen, dem stummen Wasser selbst, eingefasst von seinen engen Betonufern. Aber das Erlebnis ist, so zeigt sich, merkwürdig nichtssagend. Der Kanal und die Gehwege sind einfach nur da und werden genutzt. Die Brücken und Ufer sind nichts weiter als integraler Bestandteil des städtischen Terrains und des Verkehrsnetzes. Meine Versuche, all diese Elemente übereinanderzuprojizieren, und mein Wunsch nach einem Narrativ oder einer Offenbarung, nach einer irgendwie bedeutsamen Wegkreuzung, sind vergeblich. Der aufregendste Augenblick ereignet sich, als ich an einem beeindruckenden alten Baum am Westufer vorbeigehe, oben in der Nähe des Tiergartens. So viele Bäume dieses Alters und dieser Pracht gibt es in Berlin nicht. Von den ursprünglich 200 000 Bäumen im Tiergarten haben gerade einmal 700 die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgezeit überlebt, als das Brennholz in der Stadt knapp war. Diesem Baum gelang das: Es handelt sich um eine zweihundert Jahre alte Stieleiche, die eine Tafel eigens als »Naturdenkmal« ausweist. Ein älteres deutsches Paar kommt vorbei und schließt sich meiner Bewunderung an. »Oh, das ist ja ein Baum!«, ruft der Herr seiner Begleiterin zu.
Ein Stück den Kanal hinauf, kurz vor der Lichtensteinbrücke, wo der Wasserlauf sich durch die Anfänge des Tiergartens schlängelt, stoße ich auf eine weitere Tafel. Eine bronzefarbene Plakette im Andenken nicht ans Überleben, sondern ans Verschwinden. »Im Kampf gegen Unterdrückung, Militarismus und Krieg starb die überzeugte Sozialistin Rosa Luxemburg als Opfer eines heimtückischen politischen Mordes«, steht dort in klotzigen, erhabenen Buchstaben.
Es schwimmt eine Leiche im Landwehrkanal,
Lang se mir mal her,
aber knautsch sie nich zu sehr …
Die Leiche in diesem beliebten Lied aus der Weimarer Republik ist die von Rosa Luxemburg. Am 15. Januar, nach der gewaltsamen Niederschlagung des Spartakusaufstandes und gerade einmal zwei Wochen nach der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, wurden ihre Anführer, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, von Anhängern der rechten Freikorps festgesetzt, einer paramilitärischen Einheit, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war. Sie wurden ins Hotel Eden gebracht, eines der besten Häuser der Stadt, nicht weit entfernt von der Corneliusbrücke am Kanal.
Die Bar im Hotel Eden war eine der elegantesten in Berlin und ein berühmter Treffpunkt für Schriftsteller, Schauspieler und Künstler. »Chris, darling, du bringst mich doch bis zum Eden, oder?«, fragt Sally Bowles ein Jahrzehnt später Christopher Isherwood in Leb wohl, Berlin. »Obwohl es nur ein paar hundert Meter waren, bestand Sally darauf, ein Taxi zu nehmen. Es sei absolut undenkbar, erklärte sie, zu Fuß vor dem Eden zu erscheinen.«1
Das Eden war auch das Hauptquartier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, einer berüchtigten Einheit der Freikorps. Diese im Verborgenen operierenden Netzwerke aus Schlägern horteten aus den Beständen des Ersten Weltkriegs geschmuggelte Waffen in geheimen Lagern und waren »Zuchtstätten eines kaiserhörigen schneidigen Offizierstyps«, wie Klaus Theweleit in seinem 1977 erschienenen Buch Männerphantasien schreibt. Theweleit führt den Begriff »soldatische Männer« ein, um damit die Freikorps und ihre Erben zu beschreiben, jene »›unheilbaren Militaristen‹, die den Weimarer Regierungen immer recht gewesen waren, wenn es galt, die ›Republik‹ gegen Links zu ›schützen‹«.2 Die Regierung, die voll Sorge die wachsende Sympathie für die Kommunisten beobachtete, war bald sehr gut darin, die Augen vor einer Kugel im Kopf oder einem leblosen Körper zu verschließen, der mitten in der Nacht in den Kanal geworfen wurde.
Nach Stunden des Verhörs und der körperlichen Misshandlung im Hotel Eden fuhr man Karl Liebknecht in den Tiergarten und schoss ihm in der Nähe von Lennés Neuem See in den Rücken. Rosa Luxemburg wurde mit einem Gewehrkolben bewusstlos geschlagen, in den Kopf geschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Ihre Leiche verschwand und wurde erst Monate später entdeckt, als sie am 1. Juni 1919 im Wasser trieb. Währenddessen schaute die Stieleiche zu, eine stoische Zeugin am Ufer.