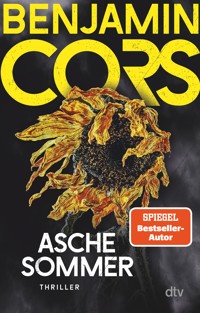Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nicolas Guerlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
BODYGUARD Dieses Wort versucht ein Sterbender an der windumtosten Küste der Normandie mit letzter Kraft in den Boden zu ritzen. Die Buchstaben sind eine Botschaft und führen zu Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen Regierung. Zur gleichen Zeit erfährt Nicolas, dass ein Anschlag auf die Feierlichkeiten in der Normandie am 6. Juni droht, dem Jahrestag der Alliierten-Landung. Ein mörderisches Spiel beginnt, das Nicolas um jeden Preis gewinnen muss, denn der Einsatz ist so hoch wie nie.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benjamin Cors
Gezeitenspiel
Ein Normandie-Krimi
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Eltern
Am Vorabend des 6. Juni 1944 unterbricht die britische BBC ihr Radioprogramm
für eine Mitteilung in französischer Sprache.
Es sind die ersten Zeilen eines Gedichts von Paul Verlaine, dem ›Herbstlied‹.
Den Herbst durchzieht
Das Sehnsuchtslied
Der Geigen
Und zwingt mein Herz
In bangem Schmerz
Zu schweigen.
Die Zeilen sind eine Botschaft an den französischen Widerstand.
Das Gedicht kündigt die nahende Invasion der alliierten Streitkräfte in der Normandie an.
Kurz darauf landen mehr als 170000 Soldaten an der französischen Küste.
Weltweit bekannt geworden ist dieser Tag als D-Day.
Die Franzosen hingegen nennen den 6. Juni 1944Le Jour J und
Le jour le plus long – Der längste Tag.
Jedes Jahr wird an der Küste der Landung der Alliierten und der zahlreichen Opfer der Kämpfe gedacht. Staatsgäste aus aller Welt reisen dafür eigens in die Normandie.
So ist es auch in diesem Jahr.
Vorspann
Der Vorhang der Nacht
Arromanches-les-Bains, Normandie
Am Vorabend des 6. Juni
Hallo, Vater.«
Der blasse Schein einer Straßenlaterne fiel durch das schmale Fenster in den Raum, der Schatten des Holzrahmens legte sich wie ein dunkles Kruzifix auf die gegenüberliegende Wand.
Sie war kahl. Keine Bücher, keine Bilder. Keine Erinnerungen. Nur ein Schattenkreuz auf einer leeren Wand.
Der Mann, der in der Tür stand, sah die tanzenden Staubpartikel, er roch die abgestandene Luft und runzelte darüber kurz die Stirn. Dann blickte er hinab auf das Bett, das im Zimmer fast den ganzen Platz einnahm. Ein Zimmer, das so eng und staubig war wie sein eigenes Leben.
Er lächelte, es war ein warmes Lächeln an einem kalten Ort.
»Wie geht es dir heute Abend, Vater?«
Der alte Mann antwortete nicht, sein leerer Blick ging zum Fenster. Ein heftiger Sturm hatte vor einer halben Stunde die Küste erreicht, ohne jede Vorwarnung. Schwere Regentropfen klatschten gegen die Fensterscheiben und die Außenwand des alten Hauses. Klamme Feuchtigkeit kroch durch das Mauerwerk, und während er am Bett seines Vaters stand, überlegte Jean Prudhomme, warum er nicht einfach das Fenster weit öffnete und das Zimmer verließ. Der Sturm würde alles fortspülen, der unablässige Regen würde diesen Raum reinwaschen.
Sein Vater hätte nichts dagegen.
Das schwankende Licht der Straßenlaterne legte sich auf die hohen Wangenknochen des alten Mannes, beleuchtete seine glänzende Haut und ließ für einen kurzen Augenblick seine matten Augen glitzern.
»Hast du Durst? Soll ich dir vielleicht ein Glas Wasser holen?«
Jean zupfte mit einer behutsamen Geste das Bettlaken zurecht. Die Decke war etwas verrutscht, so dass der nackte Fuß seines Vaters herausschaute. Er deckte ihn wieder ordentlich zu und schüttelte die beiden Kopfkissen im Rücken des alten Mannes auf.
»So ist es besser, nicht wahr?«
Draußen jagte ein Windstoß durch den Hafen, Jean Prudhomme konnte das Klappern der Schiffstakelagen hören.
Ihr Haus lag direkt am Wasser, das in diesem Augenblick von einer weiteren Böe aufgewirbelt wurde. Wellen aus Gischt und Kälte prallten gegen die Kaimauer. Jean blickte aus dem Fenster, hinüber zu dem Museum, das sich auf der anderen Seite des Platzes mit breitem Kreuz gegen den Sturm stemmte. Als wollte es die unmittelbar dahinterliegenden Häuser und Geschäfte vor dem Schlimmsten bewahren.
Er zog die Vorhänge zu. Das Schattenkreuz an der Wand löste sich auf, der Herrgott verließ den Raum.
Jean setzte sich neben seinen Vater auf die Bettkante, aus einer Steinkaraffe goss er etwas Wasser in einen Zinnbecher und führte ihn dem alten Mann behutsam an den Mund.
»Du musst trinken, Vater.«
Aber sein Vater wollte nicht.
Jean blickte ihn nachdenklich an.
»Weißt du, Vater … ich habe heute Nacht wieder geträumt. Von all dem, was passiert ist.«
Sein Flüstern war das Einzige, das in der beengten Stille des Raumes zu hören war.
»Ich will nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Das verstehst du doch, oder?«
Das Gesicht des alten Mannes blieb ausdruckslos, und einen Moment überlegte Jean Prudhomme, ob sein Vater ihm überhaupt zuhörte. Doch, er tat es. Ganz sicher. Er lauschte den Worten seines Sohnes und blickte dabei aus dem Fenster, vor dem der Wind zu hören war und das Rauschen der Brandung.
Er klatschte in die Hände.
»Genug trübe Gedanken! Du musst mir einen Gefallen tun. Und lach mich nicht wieder aus, versprochen?«
Er holte einen zusammengefalteten Zettel aus der Brusttasche seines Hemdes und setzte seine Lesebrille auf.
»Also, ich hab dir doch erzählt, dass sie mich gefragt haben, ob ich eine kurze Ansprache halten kann, morgen, am großen Tag. Morgen ist der 6. Juni, das weißt du doch, oder? Ja, verzeih, ich weiß, das würdest du nie vergessen. Nicht du, Vater, ich weiß.«
Jean räusperte sich und stand auf. Schließlich würde er morgen auch im Stehen seine Rede halten, mit durchgestrecktem Rücken und stolzgeschwellter Brust. Sein linkes Bein, das immer zuckte, wenn er allzu aufgeregt war, würde er hinter dem hölzernen Rednerpult verstecken, das er eigens in der Tischlerei vom alten Enzo hatte anfertigen lassen. Der hatte ihn angelächelt mit seinem zahnlosen Mund und dem Bleistiftstummel hinter dem linken Ohr.
»Ah, ist es für die Rede, mein kleiner Jean Petit?«
»Nenn mich nicht so, Enzo. Ich brauche ein Pult, ich zahle auch.«
»Alle nennen dich so, warum sollte ich es also nicht tun? Jean Petit qui danse, so geht doch das Kinderlied, nicht wahr, Jean? Jean Petit, der tanzt. Und du tanzt doch gerne, dort drüben in deinem Museum, wenn die Touristen weg sind und du deine Runde drehst. Ich finde, Jean Petit passt ganz hervorragend zu dir. Bis wann brauchst du denn das Pult?«
»Bis zum 6. Juni natürlich. Spätestens.«
Der alte Enzo hatte ganze Arbeit geleistet, es war ein gutes Gefühl, an dem Pult zu stehen. Es gab ihm Sicherheit, und die würde er brauchen, mehr als alles andere.
Sicherheit und Mut.
Um das zu tun, was er tun musste. Um zu retten, was ihm heilig war.
»So, ich fange an, in Ordnung, Vater? Keine Sorge, es sind nur ein paar Zeilen, der Bürgermeister meinte, dass die meisten Gäste doch sehr betagt seien. Als ob ich das nicht wüsste, also wirklich!«
Nervös kratzte er sich am Kopf und blickte auf seinen Zettel.
»Also gut, ich habe es mir so gedacht … Ach so, der Minister, von dem ich dir erzählt habe, er wird nun doch nicht kommen. François Faure. Es ist viel passiert, also haben sie das Programm geändert … Ja, es ist schade, nicht wahr. Das finde ich auch.«
Er schwitzte, aber das störte ihn ebenso wenig wie das leichte Zittern seines Beines. Er hatte einmal irgendwo gelesen, dass innere Anspannung sich oft ihren Weg bahnte, dass sie hinausdrängte, als wollte der Körper sich der aufgestauten Energie entledigen. Das Zucken eines Augenlids, die unkontrollierten Bewegungen einer Hand. Nervöses Räuspern, Schwitzen, schnelle Atmung.
Oder eben das leichte Zittern eines linken Beines.
Draußen im Wind schlug ein Fensterladen gegen die Hausfassade, er konnte das rostige Quietschen des Schildes hören, das im Wind schaukelte und auf dem der Name des kleinen Bistros stand, das sich im Erdgeschoss befand. Das Mulberry hatte noch geöffnet, aber viele Gäste würden an diesem stürmischen Abend nicht kommen.
Los jetzt.
»Guten Abend … Ich begrüße Sie alle sehr herzlich an diesem wunderbaren Ort.«
Zu zögerlich. Seine Stimme war zu schrill, sie prallte gegen die kahlen Wände seines alten Kinderzimmers, in dem jetzt sein Vater lag. Sein Vater, der sich einen Sturm wünschte und eine Rede bekam.
Jean meinte, ein Lachen zu hören. Es kam von unten, aus dem Gastraum.
Weiter, er durfte sich nicht ablenken lassen.
»An diesem Ort, der nicht mir gehört und auch nicht dieser Stadt. Er gehört nicht dieser Region, nein, er gehört auch nicht Frankreich. Dieser Ort …«
So war es besser, das Zittern in seinem linken Bein ebbte ab, sein Atem wurde ruhiger. Sein Vater wartete auf die nächsten Worte.
»… dieser Ort gehört einzig und alleine Ihnen. Denn ohne Sie, ohne Ihren Mut und ohne Ihre Bereitschaft, Ihr Leben zu riskieren, wären wir nicht hier. Nicht ich. Und auch nicht die Staatsgäste, die heute unsere Strände besucht haben, um der Soldaten zu gedenken, die hier für uns gestorben sind. Und vielleicht auch, um einfach eine gute Muschelsuppe zu bekommen.«
Jean Prudhomme blickte seinen Vater an. Er freute sich noch immer, dass ihm der Satz mit der Suppe eingefallen war.
»Wie findest du das mit den Muscheln, Vater? Ich dachte mir, das Ganze kann eine kleine Auflockerung gebrauchen. Und Maman macht wirklich eine köstliche Suppe, deswegen ist unser Bistro ja auch ausgesucht worden, nicht wahr? Wegen der Suppe.«
Sein Vater hatte keine Einwände, warum sollte er auch. Er hatte immer schon Sinn für Humor gehabt.
Jean blickte wieder auf seinen Zettel, er war fast fertig.
»Das Landungsmuseum von Arromanches möchte Ihnen mit diesem neuen Film, den wir Ihnen vorführen werden, danken. Und Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die Sie selbst geschrieben haben, vor vielen Jahren. Eine Geschichte über das Leben. Und den Tod. Vor allem aber eine Geschichte darüber, wie das Leben den Tod besiegt. Wie Sie alle, die Sie hier sitzen, den Tod besiegt haben. Und wie Sie uns das Leben schenkten.«
Womöglich waren diese Worte etwas zu pathetisch, aber Jean fand, dass es Momente im Leben gab, die eine gewisse Größe in der Wortwahl verdienten. Und der morgige Tag war sicherlich ein solcher Moment. Er war stolz, dass sie ihn gefragt hatten. Und gerade deshalb hatte er lange nach einem passenden Schlusswort für seine kurze Ansprache gesucht. Er hatte lange überlegt, lange Nächte wachgelegen.
Dann hatte er aufgeschrieben, was ihm der Wind zugeraunt hatte.
Jean Prudhomme blickte zu seinem Vater, so wie er morgen in den kleinen, abgedunkelten Kinosaal des Museums blicken würde. Niemand würde etwas sagen.
Nur er.
Mit klopfendem Herzen und stolzgeschwellter Brust.
»Der Vorhang der Nacht erhebt sich. Und was wir sehen, ist das Ende des Bösen. Und der Beginn alles Guten. Es ist Ihr Beginn. Es ist unser Beginn.«
Der Regen schlug heftig gegen das Fenster. Das Licht der Straßenlaterne brach sich im Stoff des zerschlissenen Vorhangs. Wieder war aus dem Erdgeschoss ein Lachen zu hören. Jean Prudhomme würde auf einen Knopf drücken. Der Vorhang würde sich öffnen. Das Licht würde ausgehen.
Morgen.
»Eh, Jean Petit! Bist du da?«
Draußen prallten die Wellen gegen die steinerne Hafenmauer, ein schlecht befestigtes Ruderboot hatte sich gelöst und trieb hilflos in der Dunkelheit.
»Jean Petit! Bist du oben?«
Er beugte sich zu seinem Vater und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn.
»Ich komme nachher wieder und schaue nach dir. Ich geh nur schnell runter und dann noch mal rüber ins Museum, um nach dem Rechten zu sehen.«
»Jean, wo bist du denn?«
Die Stimme des alten Enzo drang durch das Treppenhaus zu ihm herauf. Er gehörte zu denjenigen, die sich vom Sturm nicht davon abhielten ließen, das Mulberry aufzusuchen. So wie an jedem anderen Abend auch.
»Schlaf gut, Vater.«
Jean Prudhomme, der nicht Jean Petit genannt werden wollte, verließ sein altes Kinderzimmer und ging hinunter ins Bistro, wo der alte Enzo ihn angrinste.
»Ich krieg noch achtzig Euro von dir! Für das Pult.«
»Nenn mich nicht Jean Petit, Enzo, sonst kriegst du gar nichts. Ich kann es nicht leiden.«
»Ist ja gut, aber zahlen musst du auf jeden Fall, schließlich habe ich es dir auch ins Museum gebracht. Morgen wird ein großer Tag, nicht wahr?«
Das Mulberry war kein sehr großes Bistro, aber es war eben das einzige hier unten am Hafen, und Jeans Mutter war tatsächlich eine so hervorragende Köchin, dass selbst im Winter der Schankraum meist voll war. Jean wusch sich die Hände hinter dem Tresen und atmete das wunderbare Gemisch aus Kaffee, Muscheln und erkaltetem Zigarettenrauch ein, das schon immer das Mulberry ausgemacht hatte.
Ein kleines Bistro in einem kleinen Ort mit großer Geschichte. Und morgen würde ein weiteres Kapitel dazukommen.
Die Tür zur Küche öffnete sich.
»Salut, Jean, bist du bereit für den großen Tag?«
Es war, als würde der Sturm für einen Augenblick innehalten, als würden die Straßenlaternen ihre Köpfe senken, um besser durch die kleinen Fenster in das Innere des Mulberry schauen zu können.
Wenn Jean Prudhomme der neuen Kellnerin begegnete, wusste er nie, was er sagen sollte. Und so war es auch an diesem Abend, an dem er eigentlich nur kurz runtergekommen war, um seiner Mutter einen schönen Abend zu wünschen, bevor er hinüber ins Museum ging, die wenigen Meter durch den Sturm über den Platz, vorbei an dem ausgestellten Panzer und der Sturmhaubitze, die ihre Rohre nach Westen richteten.
So wie damals.
»Bonsoir, Mademoiselle Anna.«
Die junge Frau lachte und ihr schwarzes Haar tanzte für einen Augenblick auf ihren nackten Schultern. Energisch pustete sie eine widerspenstige Strähne aus der Stirn, und Jean Prudhomme erkannte einige wenige Sommersprossen, die sich auf wundersame Weise nur auf ihrer linken Gesichtshälfte abzeichneten. Zum wiederholten Mal fragte er sich, ob Schwarz ihre natürliche Haarfarbe war, und zum wiederholten Mal traute er sich nicht, sie danach zu fragen. Sie trug eine leicht zerschlissene Jeans und ein enges, am Hals verknotetes Top, das nach den zahlreichen Gängen in die Küche fleckig war.
Und obwohl sie ihn anstrahlte und dabei laut in die Hände klatschte, konnte er sehen, dass sie etwas verbarg. Eine Müdigkeit, so tief und abgründig wie das Wasser jenseits des Hafenbeckens von Arromanches.
»Hör auf mit dem Mademoiselle, lieber Jean, so jung bin ich leider nicht mehr! Einfach nur Anna reicht völlig. Also, was macht deine Rede, ist sie fertig?«
Sie verschwand kurz in der hinteren Ecke des Bistros, wo Jean an einem der runden Tische drei Männer sitzen sah, die ihre Köpfe zusammensteckten und sich angeregt, aber leise unterhielten.
»Voilà, hier ist schon mal das Brot. Die Suppe kommt sofort. Noch jemand etwas zu trinken?«
»Nein, danke, wir haben alles«, antwortete einer der Männer und nickte Jean Prudhomme zu. Die Kellnerin trat zum Tresen und holte ein Glas Weißwein hervor, an dem sie vorsichtig nippte. Als sie es wieder zurückstellte, schaute sie Jean verschmitzt an.
»Wehe, du verrätst es deiner Mutter!«
»Nein, natürlich nicht«, versicherte er ihr schnell und ärgerte sich, dass er rot anlief. Verzweifelt versuchte er, nicht auf ihr Dekolleté zu blicken.
Der alte Enzo schaute aus dem Fenster.
»Wenigstens werden morgen die verfluchten Touristen nicht hier sein. Ist alles abgesperrt. Ausnahmsweise werden sie mal nicht unsere Straßen verstopfen und sich wundern, warum es hier nicht aussieht wie in ihren blöden Kriegsfilmen aus Hollywood.«
»Ohne die Touristen hätten wir hier gar nichts, Enzo, also lass es gut sein, ich kann es nicht mehr hören. Hoffen wir lieber, dass der Sturm sich bis morgen gelegt hat, sonst wird es für die Gäste eine einzige Regenschlacht, und die werden sie auf jeden Fall verlieren.«
»Wären sie doch damals mit ihrer Kriegsflotte nur am Mittelmeer gelandet und nicht auch noch bei uns«, murmelte Enzo und griff nach einer Schnapsflasche hinter dem Tresen.
Als er Jeans Blick bemerkte, lächelte er sein zahnloses Lächeln.
»Du verpfeifst mich nicht, dann verpfeif ich die Kleine nicht.«
Jean stieß ihm sanft gegen die Brust.
»Und das ist auch besser so, Anna braucht den Job hier. Und sie macht ihn besser als alle anderen vorher.«
»Eben. Und außerdem hat sie tolle Brüste.«
»Enzo!«
»Was denn? Ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber Augen hab ich noch im Kopf. Und jetzt ab mit dir, du willst vermutlich noch mal rüber. Alles vorbereiten, für morgen.«
Der alte Enzo zwinkerte ihm zu, aber Jean Prudhomme mied seinen Blick. Er sah kurz in die Küche und winkte seiner Mutter zu, die stirnrunzelnd etwas Petersilie in einen großen Topf streute.
»Maman, ich bin drüben. Bis später.«
»Ist gut, Jean, ist gut. Oder vielleicht fehlt auch einfach nur Salz …«
»Au revoir, Mademoiselle. Einen schönen Abend noch.«
»Ach Jean, du lernst es nie«, antwortete die Kellnerin. »Aber dir auch einen schönen Abend, grüß mir die feschen Jungs. Vor allem den First Sergeant, den jungen. Er sieht ganz gut aus, findest du nicht?«
Weil Jean wieder spürte, dass er rot anlief, flüchtete er schnell aus der Küche. Er nickte den drei Männern zu und suchte in seinen Jackentaschen nach dem Schlüssel für den Haupteingang.
»Wo hab ich ihn denn nur hingesteckt …«, murmelte er.
»Linke Hosentasche.«
Überrascht hob Jean den Kopf und blickte sich um. Wer hatte da mit ihm gesprochen? Enzo saß gedankenverloren auf seinem Hocker. Dafür nickte ihm einer der drei Männer aus der hinteren Ecke des Bistros zu. Jean hatte seinen Namen vergessen.
Wie konnte er wissen …?
Aber es stimmte. Er bedankte sich und öffnete die Tür des Mulberry. Sofort schwappte ein Schwall Wasser herein, der Wind hob die schweren Vorhänge an der Tür und rauschte einmal quer durch den Gastraum.
Wollte er wirklich noch mal rüber? Er konnte auch morgen früh …
»Ab mit dir, Jean. Oder lass mich zumindest vorbei! Ich muss auch noch mal los.«
Die Kellnerin stand plötzlich direkt hinter ihm, sie hatte sich eine dunkle Regenjacke übergezogen, in der Hand hielt sie einen Motorradhelm.
»Mademoiselle Anna, was wollen Sie denn dort draußen?«, stammelte er. Für die kurze Dauer eines schaurig schönen Augenblicks überlegte er, ob sie ihn ins Museum begleiten wollte.
Aber sie hatte andere Pläne.
»Ich fahre nur schnell nach Hause, ich habe mein Fenster offen gelassen. Deine Mutter kommt kurz alleine zurecht. Lässt du mich durch?«
»Natürlich.«
Kurz darauf startete sie energisch ihren Roller, den sie unter dem Vordach an der Längsseite des Mulberry abgestellt hatte, und winkte Jean zum Abschied zu, bevor sie hinter den Häusern verschwand.
Rasch überquerte Jean den Platz des 6. Juni und stand kurz darauf vor dem Haupteingang des Museums, in dem er seit mehr als fünfzehn Jahren arbeitete.
Musée du Débarquement stand in großen Lettern auf der Außenwand.
Das Landungsmuseum von Arromanches. Vollgestopft mit Erinnerungen und Hinterlassenschaften aus jener dunklen Nacht, die sich in den längsten Tag verwandelt hatte, den Frankreich je erlebt hatte.
Le jour J – Der Tag J.
D-Day.
Dunkle Wolken schoben sich vor die wenigen Sterne, als Jean die Eingangstür des Museums aufsperrte. Drinnen empfing ihn eine merkwürdige Stille, als würde ihn im Dunkel irgendetwas oder irgendwer erwarten.
Er wollte das Licht in der Eingangshalle anknipsen, überlegte es sich dann jedoch anders und ging mit ruhigen Schritten in den Ausstellungsraum. Durch die großen Panoramascheiben sah er die aufgewühlte See, weiße Schaumkronen rollten immer wieder in Richtung Hafenmauer.
Alles war in Aufruhr.
So wie er. Aber er musste standhaft bleiben, das hier war zu wichtig.
Nach und nach machte er einige kleine Lampen an, der Raum wurde in warmes Licht getaucht. Die Glühbirnen warfen ihren Schein auf den Schaukasten, in dem ein Modell des damaligen Hafens ausgestellt war. Hier begannen tagsüber die Führungen, hier staunten die Besucher darüber, was die Welt geschaffen hatte, um den Teufel zu vertreiben.
Jean Prudhomme sah sich um und atmete die staubige Luft ein. Er nahm seine Mütze ab und drehte sich langsam im Kreis.
»First Sergeant Montgomery?«
Keine Antwort.
»Sie dürfen sich rühren, First Sergeant.«
Es blieb still. Jean Prudhomme schritt langsam an zwei ausgestellten Maschinengewehren vorbei, tiefer in das Museum hinein. Zu seiner Rechten hingen Pläne und Skizzen an der Wand, Zeichnungen von Einflugschneisen und Gefechtspositionen. Orden und Abzeichen lagen geschützt hinter Glas, von der Decke baumelte ein Fallschirm.
»First Sergeant Montgomery, ich befehle Ihnen, sich sofort zu melden!«
Jean blieb vor einem der Schaukästen stehen.
»Ich soll Sie grüßen, First Sergeant! Von Mademoiselle Anna, Sie würden sie mögen. Sie ist die neue Kellnerin, ich mag sie und … ach, was erzähle ich das, raus mit Ihnen!«
Er öffnete vorsichtig den Schaukasten und blickte dem Soldaten ins Gesicht, der vor ihm stand und sich müde auf sein Gewehr stützte.
»Ich weiß, es ist spät, Soldat. Aber Sie wissen ja, wenn die Pflicht ruft …«
Jean fing an, eine Melodie zu pfeifen, als er die mannshohe Puppe behutsam aus dem Kasten hob und vor sich auf den Boden stellte.
First Sergeant John Montgomery war damals als einer der Ersten an Land gegangen, er hatte es noch nicht einmal bis zu den Felsen geschafft, so wie Hunderte seiner Kameraden neben ihm.
Er streifte der Puppe den schweren Rucksack und das Gewehr ab, lehnte beides an die Wand und griff nach der Hand des Soldaten.
»Darf ich bitten? Und nennen Sie mich ja nicht Jean Petit, First Sergeant, hören Sie?« Fröhlich pfeifend trug er die Puppe, die einen guten Kopf größer war als er, durch den Raum, zu einer kleinen Kommode. Als er eine Schublade herauszog, kam ein alter Plattenspieler zum Vorschein.
»Ein letzter Tanz im Sturm, was sagen Sie, Soldat?«
Aber der First Sergeant antwortete nicht. Sein Blick ging hinaus in die Dunkelheit, dorthin, wo in ebenjenem Augenblick in der Ferne ein Motorroller über eine kurvige Landstraße fuhr. Der Roller folgte den Hügeln oberhalb der Küste und zog dabei eine Spur aus feuchtem Spritzwasser hinter sich her. Der Scheinwerfer blitzte zwischen den struppigen Ginsterbüschen hervor, bevor der Roller plötzlich von der Straße abbog und über einen unbefestigten Kiesweg holperte.
Kurz darauf schaltete die Fahrerin das Licht aus und fuhr im Dunkeln weiter. Sie war unterwegs, um ein Fenster in ihrer Wohnung zu schließen.
Aber das war eine Lüge.
»Bereit für den Tanz, First Sergeant? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie führen.«
Der Soldat schwieg, als Jean Prudhomme seinen Arm nahm und ihn auf seine Schulter legte.
Das Kratzen einer Nadel drang durch die Stille, gefolgt von einem Rauschen und Knacken.
»Sie haben diese Zeit nicht mehr erlebt, aber glauben Sie mir, sie hätte Ihnen gefallen, First Sergeant.«
Die Musik setzte ein, Charles Aznavour. Die ersten Töne hüpften fröhlich durch den Ausstellungsraum des Museums, und Jean Prudhomme strahlte seinen Tanzpartner an.
You are the one for me, for me, for-mi-dable!
Exakt in diesem Augenblick drehte weiter landeinwärts eine zierliche Hand den Schlüssel eines Motorrollers um. Sofort erstarb das Motorengeräusch, und eine gespenstische Stille legte sich über die regenbeladenen Bäume.
Kein Geräusch war zu hören, nur der ruhige Atem der Fahrerin.
Vorsichtig nahm die junge Frau ihren Helm ab und fluchte kurz über den strömenden Regen. Wenige Augenblicke später stand sie an einem hohen Zaun.
Es war stockdunkel, und doch fand sie das kleine Loch sofort, das sie vor einiger Zeit in den Zaun geschnitten hatte, direkt hinter dem großen Stamm einer Esche. Sie schlüpfte hindurch und folgte dem leicht abfallenden Gelände. Weiter vorne hörte sie das Rauschen der Brandung in der Dunkelheit. Sie musste kurz darauf in die Hocke gehen, um unter einigen Büschen hindurchzukriechen. Nasse Zweige klatschten ihr ins Gesicht.
Als sie die Stelle oberhalb der Felsen erreichte, die sie sich vor einigen Tagen ausgesucht hatte, zog sie ihre Waffe aus ihrem Hosenbund und entsicherte sie. Sie kauerte sich in eine Felsnische und schlang ihre Motorradjacke enger um sich. Für einige Sekunden lauschte sie in den Regen hinein.
But how can you see me, see me, see me si mi-na-ble!
»Langsam, First Sergeant, nicht zu hastig. Bleiben Sie im Takt. Das Lied gefällt Ihnen, nicht wahr?«
Gekonnt führte Jean Prudhomme den Soldaten quer durch den Ausstellungsraum, mit großen Schritten drehte er sich mehrmals um die eigene Achse. Die Lichter der Glühbirnen verschwammen vor seinen Augen, und er stellte sich vor, dass der Regen, der gegen die Scheiben trommelte, in Wahrheit unablässiger Beifall war, der niemand anderem als ihm selbst galt.
Er lachte laut auf, als er merkte, dass der Soldat sich nun bereitwilliger führen ließ.
»Sie tanzen gerne, First Sergeant, nicht wahr? Da haben Sie schön recht, auf geht’s, noch eine Runde!«
Die Musik trieb sie durch den Raum, sie tänzelten vorbei an den anderen ausgestellten Soldaten, den Fallschirmjägern und Marineinfanteristen, die staunend das seltsame Paar beobachteten. Jean war sich sicher, dass die Musik bis auf die andere Seite des Platzes zu hören war, aber das störte ihn nicht. Sollten sie ihn doch hören, ihren Jean Petit, es war ihm egal.
Morgen war der Tag, an dem alles anders werden würde, an dem er seinen Beitrag leisten würde. Für das Museum und für den Ort, in dem er aufgewachsen war und in dem er eines Tages auch sterben würde.
So viel stand fest.
Aber jetzt tanzte er, und in der Spiegelung der Panoramascheibe sah er sein eigenes Lächeln.
Pour te plaire, dans la langue de Molière! How can I lo-ve you?
Und oben in den Hügeln über dem Meer verschwand die Frau in den Schatten der Felsen. Sie griff in ihre Jacke und holte ein Nachtsichtgerät hervor. Sofort verwandelte sich die Dunkelheit vor ihr in eine grün schimmernde Landschaft, aus der die Schatten gespenstisch hervortraten. Wie die Geister toter Soldaten.
Hier an diesen Felsen waren sie gestorben, wie die Fliegen, zu hunderten.
Und jetzt saß sie hier, zusammengekauert in einer kleinen Felsnische und den Blick zum Horizont gerichtet, dorthin, wo das Meer am dunkelsten war. Nicht weit entfernt sah sie die ersten Häuser von Arromanches, die Lichter der Straßenlaternen, die schwachen Umrisse der kleinen Kirche.
Erneut lauschte sie in die Dunkelheit, aber hier oben über dem Meer war es still, abgesehen vom Regen, der unablässig auf die Erde prasselte. Dort, wo sie saß, war sie einigermaßen geschützt. Sie stellte ihr Nachtsichtgerät scharf, die Straßen und Häuser von Arromanches rückten näher, bekamen deutliche Konturen. Aus Schatten wurden Formen, aus schwachen Umrissen klare Linien.
Sicherheitsbeamte vor dem Museum. Polizeikräfte in den Nebenstraßen.
Und hier oben sie selbst. Die junge Frau holte tief Luft und streckte sich, als sie eine Bewegung wahrnahm.
Jemand kam aus dem Museum heraus, schloss die Tür hinter sich sorgfältig zu und überquerte hastig den Platz. Sie konnte sehen, wie er auf das Mulberry zulief, einigen Beamten zunickte und dann zu einem Fenster im ersten Stock blickte.
Was sie nicht sehen konnte, waren Jean Prudhommes Gedanken, die um seinen Vater kreisten, der dort oben in seinem Bett lag und den er nicht enttäuschen durfte.
Die junge Frau in der Felsnische griff nach ihrem Handy und wählte eine Nummer. Der Wind wurde schwächer, der Regen nahm ab.
Der Sturm ging. Die Ruhe kam.
Nach dem dritten Läuten nahm jemand ab. Sie sprach mit ruhiger Stimme, in dem Wissen, dass der Mann am anderen Ende es doch besser wusste.
Sie war nervös.
Als ihre Stimme zwischen den Felsen erklang, hob sich der Vorhang der Nacht.
»Hier ist Julie. Es kann losgehen.«
Teil eins
FORTITUDE
Kapitel 1
Champagne-Ardenne
Sechs Monate zuvor, Neujahrstag
J-157
Nicolas Guerlain wartete.
Zehn Sekunden. Zwanzig Sekunden.
Eine Minute. Zwei Minuten.
Lange genug, um sicher zu sein, dass er sich nicht täuschte. Und kurz genug, um sich einen letzten Rest an Misstrauen zu bewahren gegenüber diesem Augenblick, der ihm doch tatsächlich eine gewisse Zufriedenheit unterjubeln wollte. Und das ohne erkennbaren Grund, ein Umstand, der ihn misstrauisch machte.
Ich bin grundlos zufrieden, dachte er. Er hatte schlimmere Zustände erlebt.
Viel schlimmere.
Nicolas spürte den Anflug eines Lächelns im Gesicht, es fühlte sich ungewohnt an. Vermutlich, weil es genau das war, ungewohnt. Er lehnte den Kopf gegen die Scheibe, spürte einen eisigen Windhauch, hörte das Geräusch der Rotorblätter. Das Lächeln blieb, weigerte sich zu gehen. Und er fand sich damit ab, ohne jedoch zu vergessen, wie brüchig das Eis war, auf dem er stand. Fast konnte er bereits hören, wie das Eis gefährlich knackte. Für Nicolas war das plötzliche Einsinken in kaltes Wasser immer miteingerechnet, auf Momente wie diesen folgte mitunter tiefe Dunkelheit.
Er öffnete die Augen und blickte hinab in die Tiefe. Weit unter ihm waren die Bäume und Sträucher mit Raureif bedeckt, auf dem mäandernden Fluss war eine dünne Eisschicht zu sehen.
Über Nacht hatte es geschneit, das neue Jahr empfing sie in diesem Teil des Landes mit einer eisigen Umarmung. In weiter Ferne erahnte er die sanft ansteigenden Hügel eine Gebirges, die Luft war klar und die Sicht an diesem Morgen außergewöhnlich gut.
Der Schatten ihres Hubschraubers huschte mit einem leichten Zittern über die Landschaft. Er wanderte über einsame Straßen und verlassene Gehöfte, folgte dem Lauf der Marne und übersprang ein kleines Wäldchen, Bäume mit schneebedeckten Häuptern. Kein Auto war zu sehen, kein Mensch schien in diesen frühen Stunden des neuen Jahres unterwegs zu sein.
Dabei ist es gerade jetzt wunderschön, dachte Nicolas, während sein Blick nach vorne ging, dem Ziel ihrer Reise entgegen.
Sie waren vor einer knappen Stunde in Le Bourget gestartet, dem kleinen Flughafen im Nordosten von Paris. Balthasar Pesac war nur wenige Augenblicke nach dem Start eingeschlafen und seitdem nicht wieder aufgewacht. Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft hatte Flugangst, allerdings wussten das nur seine engsten Freunde und Mitarbeiter.
Und der Personenschützer, der ihm vor zwei Monaten zugeteilt worden war.
Es schien, als habe der Mann, der nun rechts neben Nicolas saß und leise schnarchte, sein eigenes Mittel gegen die Flugangst gefunden. Den Schlaf.
Er hatte Nicolas ausdrücklich verboten, ihn zu wecken, solange sie nicht am Ziel waren.
»Wenn Sie nicht wollen, dass ich neben Ihnen in Tränen ausbreche, anfange zu schreiten oder gar zu beten, was ich offen gesagt sonst nie tun würde, dann wecken Sie mich nicht, einverstanden?«
»Natürlich, Monsieur.«
»Gut, vielen Dank, Nicolas. Und Sie sollten vielleicht auch mal ein Auge zutun, schlafen Sie eigentlich auch manchmal? Ich meine, oben in der Luft wird schon niemand auf den Landwirtschaftsminister schießen, oder? Was meinen Sie?«
»Man weiß nie, Monsieur le Ministre. Aber schlafen Sie ruhig, der Flug wird nicht lange dauern.«
Nicolas mochte Balthasar Pesac, er war ein in sich ruhender, gelassener Politiker, der es kurz vor dem Ende seiner Laufbahn doch noch auf einen Ministerposten geschafft hatte. Pesac war pflegeleicht im Umgang und befolgte Nicolas’ Anweisungen, wenn es um Fragen der Sicherheit ging. Und er machte sich augenscheinlich nicht viel aus der bewegten Vergangenheit seines Personenschützers.
»Dass ich überhaupt einen Personenschützer brauche, ist doch ein Witz, wer sollte mich ermorden wollen? Hochseefischer? Kamikaze-Angler? Biobauern? Die schmeißen mit Kuhkacke, die können Sie auch nicht abwehren, Nicolas. Aber es schadet auch nicht, wenn Ihr Dienst Sie ausgerechnet an mir testet. Denn so ist es doch, oder?«
»Monsieur, mein Dienst ist zuständig für die Sicherheit der französischen Regierung und ihrer Gäste, er testet nicht …«
»Hören Sie auf, Nicolas, ich bin nicht blöd«, hatte Pesac ihn unterbrochen. »Ein Landwirtschaftsminister braucht keinen Personenschützer, jedenfalls hatte keiner meiner Vorgänger einen. Man möchte Sie wieder in den Dienst einführen, langsam, nur nicht zu schnell. Also erst mal beim gemütlichen Pesac, da ist das Risiko denkbar gering, dass Sie wieder etwas anstellen. Und dagegen ist doch nichts einzuwenden, nicht wahr?«
Doch, hatte Nicolas gedacht. Denn die Arbeit im Ministerium in der Pariser Rue de Varenne hatte einen entscheidenden Nachteil, den auch der pflegeleichte Pesac nicht wettmachen konnte.
Es passierte nichts.
Gar nichts.
Balthasar Pesac besuchte Messen und Fachvorträge, ließ sich Weingüter und Schweinezuchtanlagen zeigen. Er reiste zu Krabbenfischern und Muschelanlagen, speiste mit Hühnerbaronen und Pferdezüchtern.
Er führte das sehr angenehme, aber eben auch sehr ereignislose Leben eines Ministers, der zwar geschätzt, aber nicht wirklich ernst genommen wurde. Am Rande des Kabinettstisches ließ es sich gut aushalten.
Nicolas Guerlain jedoch hatte für diese Langeweile keine Verwendung und darüber hinaus auch keine Zeit.
Er hatte Besseres zu tun.
»Monsieur Guerlain, ich glaube, da vorne ist es.«
Der Hubschrauberpilot deutete aus dem Fenster, dorthin, wo zwischen all dem Weiß eine kleine schwarze Rauchsäule in den stahlklaren Himmel wuchs.
»Was machen die da?«, murmelte Nicolas und prüfte den Sitz seiner Dienstwaffe, die er am Gürtel unter seinem Jackett trug.
»Remy, wo landen wir?«, fragte er den Piloten.
»Direkt auf der Straße, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Bei dem vielen Schnee kann ich nicht erkennen, ob der Feldboden geeignet ist.«
»In Ordnung, aber nicht direkt vor der Absperrung, halten Sie Abstand.«
»Einverstanden. Wir landen in zwei Minuten.«
Die Nationalstraße N44 pflügte sich in leichten Kurven durch den gefrorenen Boden. Südlich von Châlons-en-Champagne waren schon bei normalen Witterungsverhältnissen nur wenige Autos unterwegs. Nun jedoch lag die Straße gänzlich verlassen vor ihnen.
Die Rauchsäule kam näher, sie stieg senkrecht auf, kein Windstoß veränderte ihre Richtung. Das gleichmäßige Geräusch der Rotorblätter hatte den Minister an Nicolas’ Seite vollends eingelullt, mit leicht geöffnetem Mund und nach hinten gekipptem Kopf hätte er auch gut als Toter durchgehen können.
»Monsieur le Ministre, wir landen gleich.«
Mehr brauchte es nicht, das wusste Nicolas mittlerweile. Kein Rütteln an der Schulter, keine wiederholten Weckversuche. Balthasar Pesac war ein alter Hase, und als solcher wusste er, wann er schlafen konnte. Und wann nicht.
Er öffnete die Augen und schluckte kurz, als er hinab auf die verschneite Landschaft der Champagne blicke.
»In Ordnung. Gleich ist es geschafft, sehr gut. Schön ist es ja von hier oben, das muss ich sagen. Wie bei mir zuhause in den Pyrenäen, nur ohne Berge.« Er gähnte laut.
»In einem Jahr sitze ich auf meinem Hof und geh mit meinen Hunden spazieren, und …«
»… die Luft riecht nach Wildschweinwurst und spanischem Wein«, ergänzte Nicolas mit einem wissenden Lächeln.
»Und Sie haben versprochen, mich dann zu besuchen! So, wollen wir? Der Premierminister erwartet sofortige Maßnahmen, die Bande muss sofort die Straße räumen, und das wird sie auch. Ist es kalt draußen?«
»Sehr, Monsieur.«
»Dann bleiben Sie im Hubschrauber, Remy. Es reicht, wenn zwei frieren.«
Kurz darauf setzte der Hubschrauber behutsam auf dem schneebedeckten Asphalt der Nationalstraße auf, der Pilot schaltete den Motor aus, und die Rotorblätter kamen langsam zum Stehen.
Für einen kurzen Augenblick war es still.
Von seinem Sitz aus konnte Nicolas in einiger Entfernung eine alte Scheune erkennen, vor der ein verlassener rostiger Traktor stand.
»Monsieur, offenbar sind wir die Ersten, die Abgeordneten aus Reims sind noch nicht da. Und weitere Sicherheitskräfte sehe ich auch nicht. Vielleicht sollten wir warten.«
»Auf keinen Fall, die brauchen wir nicht. Wir machen das jetzt alleine, Sie und ich. Ich hole die Bauern von der Straße, und Sie passen auf, dass keiner mit Kuhmist wirft. Wo kommen wir denn da hin, einfach so eine Nationalstraße zu sperren?«
»Also gut. Aber bitte warten Sie kurz, Monsieur.«
Nicolas öffnete die Tür und sprang hinaus in die schneidende Kälte. Sein Atem hing für einen Moment als eisiger Hauch in der Luft. Er umrundete den Hubschrauber und half dem Minister beim Aussteigen. Aus Richtung der Bauern war hämisches Lachen zu hören, als Pesac mit seinem Kopfhörer kämpfte, den er vergessen hatte abzusetzen.
»Lacht nur«, murmelte er, »am Ende lache ich. Und dabei kitzelt der Duft von Wildschweinwurst und spanischem Wein meine Nase.«
»Auf in den Kampf«, sagte er dann zu Nicolas. »Und gucken Sie freundlicher, sonst können wir gleich wieder zurückfliegen, und der Premierminister versetzt mich an die belgische Grenze. Und glauben Sie mir, Sie wären dann mit von der Partie.«
Der Pilot hatte den Hubschrauber etwa hundert Meter vor der Straßensperre aufgesetzt, auf die Nicolas und Balthasar Pesac nun zuliefen. Der Minister trug einen dicken Wintermantel und versteckte sein Kinn hinter einem roten Schal. Nicolas konnte sehen, dass er dennoch fror.
Als er nach vorne blickte, runzelte er die Stirn. Denn das, was die Polizei in ihrer Meldung eine »kleinere Straßensperre« genannt hatte, entpuppte sich als wahrhaftige und übergroße Blockade.
»Sind die denn wahnsinnig?«, murmelte Pesac neben ihm, und Nicolas musste sich eingestehen, dass ihm ein ähnlicher Gedanke gekommen war.
»Offenbar«, sagte er laut und tastete nach seiner Dienstwaffe, eine Bewegung, die er nach all den Jahren als Personenschützer gar nicht mehr bewusst wahrnahm.
Als sie näher kamen, sahen sie beide, dass die Landwirte, die hier protestierten, stapelweise Autoreifen mit ihren Traktoren angekarrt und auf einen Haufen geworfen hatten. Hunderte davon blockierten die Fahrbahn und bildeten eine riesige Wand, hinter der nun deutlich mehr Bauern hervorkamen, als dem Ministerium gemeldet worden waren.
»Verdammt, ich dachte, es wären nur etwa ein, zwei Dutzend Landwirte«, raunte Pesac Nicolas zu.
»Oui, Monsieur. Und ehrlich gesagt gefällt mir diese Situation nicht besonders.«
»Was soll schon passieren?«, murmelte Pesac. »Die Polizei müsste jeden Augenblick da sein.«
Nicolas blickte zu den Männern hinüber.
»Das sind mindestens sechzig Bauern«, sagte er und bemerkte, wie einige der Landwirte Pesac und ihn mit ihren Handys filmten.
Er dachte für einen kurzen Augenblick, dass es nach Benzin roch, aber der Gedanke löste sich so schnell auf wie sein Atem in der kalten Luft.
Einer der Bauern trat aus der Gruppe hervor und blickte Pesac hämisch an.
»So, schickt die Regierung also ihren unwichtigsten Mann zu uns? Was sollen wir davon halten, Monsieur Pesac?«
»Ich bin der zuständige Minister, ich denke, ich bin genau der richtige Mann für Sie, Monsieur …«
»Und für was genau sind Sie zuständig, Monsieur le Ministre? Für Erpressung und Ausbeutung? So wie es Ihre Regierung seit Jahren mit uns Bauern macht? Die Milchpreise, der fallende Getreideabsatz, meinen Sie das, wenn Sie sagen, Sie seien verantwortlich? Dann allerdings, Monsieur Pesac, sind Sie bei uns tatsächlich richtig. Oder wir bei Ihnen.«
Hinter ihm schlugen einige Bauern mit den langen Stielen ihrer Mistgabeln auf den Boden, und Nicolas sah mit einigem Erstaunen, dass immer noch Landwirte hinter der Reifenabsperrung hervorkamen. Seitlich davon standen jetzt mehrere Heuballen in Flammen, jemand hatte einen Reifen dazugeworfen. Schwarzer Qualm stieg in den Himmel.
Nicolas machte einen Schritt nach vorne, er stand jetzt direkt neben dem Minister. Seine Blicke flogen zwischen den Demonstranten hin und her. Er musterte jedes Gesicht, versuchte die Absichten der Männer einzuschätzen und ihre Wut zu ermessen. Er blickte auf die Hände, die sich zu Fäusten ballten, und horchte auf das Scharren der schweren Stiefel auf dem Asphalt.
Noch war die Lage friedlich. Aber das musste nicht so bleiben.
Pesac stand alleine gegen mittlerweile fast achtzig Landwirte.
»Hören Sie«, erhob jetzt der Minister seine Stimme, »was auch immer Ihr Anliegen ist, wir werden es besprechen, so wie wir es immer tun. Unsere Regierung kennt den Wert der Landwirtschaft für Frankreich sehr wohl, Sie sind das Rückgrat …«
»Lügner!«
»Du laberst nur rum, Pesac!«
Einige Bauern hatten offenbar das Warten auf den Minister damit verbracht, sich Mut anzutrinken. Jetzt standen sie ihm gegenüber, pöbelten ihn an, und Nicolas konnte sehen, dass Pesac verunsichert war.
Die Stimmung kippt, dachte Nicolas. Er merkte, wie seine Atmung sich verlangsamte. Er wurde ruhig, während sich um ihn herum eine nervöse Anspannung breitmachte, eine Eigenschaft, die ihm bei seinen vielen Einsätzen schon oft geholfen hatte.
Sein Handy klingelte.
»Jedes Jahr wird es für uns schwerer, unsere Höfe zu erhalten und die Maschinen abzubezahlen«, schrie der offensichtliche Anführer Pesac ins Gesicht. »Und was macht ihr? Nichts! Ihr seht zu, wie wir verrotten, aber damit ist jetzt Schluss!«
»Genau! Recht hat er! Schluss damit!«
»Hören Sie mir zu«, versuchte Pesac zu beschwichtigen. »Bei allem Respekt vor Ihrer schwierigen Lage, Sie haben nicht das Recht, eine Nationalstraße zu sperren, nicht mit Ihren Maschinen und auch nicht mit diesem Stapel Reifen.«
Stiefel scharrten, die Bauern kamen näher.
Nicolas griff nach seinem Handy, ohne den Blick von den Landwirten abzuwenden. Seine rechte Hand lag jetzt auf dem Rücken des Ministers.
Ich bin da, sollte sie signalisieren.
»Monsieur, wir sollten gehen«, flüsterte Nicolas, dann nahm er den Anruf entgegen.
Neben ihm wurde Pesac sichtlich unruhig.
»Was soll denn das, meine Herren, ich bitte Sie …«
»Ja, was ist, Remy?«, fragte Nicolas. Es war der Pilot.
»Achtung, hinter Ihnen!«, schallte es aus seinem Telefon.
In einer fließenden und blitzschnellen Bewegung drehte sich Nicolas um und zog mit der rechten Hand seine Dienstwaffe.
Sie mussten sich in dem tiefen Graben seitlich der Straße versteckt haben.
Und jetzt kamen sie heraus.
»Rufen Sie die Polizei, Remy!«
Es waren etwa zehn weitere Bauern, die sich leise von hinten näherten, einige hatten Knüppel in der Hand, andere Spaten.
Sie waren keine zehn Meter entfernt, und ihre Absicht war eindeutig.
Das hier war keine Straßensperre.
Es war auch kein Protest.
Das hier war eine Falle.
Und jetzt schnappte sie zu.
»Okay, wir beruhigen uns jetzt alle …«, setzte Nicolas an, aber er erkannte schnell, dass die Zeit des Redens vorüber war. Er wurde übertönt vom Johlen der Menge vor dem Reifenstapel.
»Mein Gott, die spinnen doch!«, schrie Pesac auf, als direkt vor ihren Augen zwei Landwirte einen kleineren Heuballen entzündeten und ihn in Richtung Autoreifen rollten.
»Oh, Scheiße«, murmelte Nicolas.
Hinter ihnen hatten die zehn Bauern sie fast erreicht. Wenn er nicht sofort etwas unternahm, würden sie in exakt zehn Sekunden eingekesselt sein.
Mit einem lauten Zischen entzündeten sich die ersten Reifen, die offenbar vorher mit Benzin übergossen worden waren. Seine Nase hatte ihn nicht getäuscht, nur hatte er sie ignoriert.
Schwarzer Rauch stieg auf, das Feuer spiegelte sich in Nicolas’ Sonnenbrille.
Das hier war nicht gut. Alles ging zu schnell.
»Monsieur le Ministre, es tut uns leid, wir behalten Sie erst mal bei uns, bis jemand wirklich auf uns hört«, rief der Wortführer. Seine rote Wollmütze war verrutscht, eine große Narbe zierte seine Stirn, sie verlief direkt über der linken Braue.
»Mir tut es auch leid«, sagte Nicolas ohne Vorwarnung, packte den Minister am Arm und zog ihn mit einem heftigen Ruck an sich.
»Monsieur Pesac, ich bin bei Ihnen. Es wird sich alles regeln. Aber Sie müssen jetzt machen, was ich sage.«
»Was soll das sein, ich …«, stammelte der mittlerweile völlig verängstigte Minister.
»Laufen Sie. Jetzt!«
Ohne Vorwarnung riss Nicolas einem Bauern seinen Knüppel aus der Hand und schleuderte ihn auf einige Männer, die seitlich von ihnen vor der Böschung standen, die hinab in den Straßengraben führte. Der Knüppel traf einen von ihnen mitten im Gesicht, Blut spritzte auf seinen Nebenmann, der mit seinem Handy die ganze Szene festhielt.
Nicolas stürmte los, den Minister zerrte er einfach hinter sich her.
»Springen Sie!«
Nicolas riss Pesac mit aller Kraft hoch, als sie von der Straße in den Graben hinabsprangen, während hinter ihnen wütende Schreie ertönten.
»Holt ihn euch, Männer!«
»Er darf nicht entkommen!«
Nicolas und Balthasar Pesac rutschten einen kleinen Abhang hinunter und landeten kurz darauf auf den hartgefrorenen Schollen eines Ackers. Hinter ihnen loderte mittlerweile der gesamte Reifenberg, der Rauch ließ sie beide husten.
»Verdammt!«, fluchte der Minister, für mehr blieb ihm keine Zeit, denn schon zerrte ihn Nicolas wieder hoch und trieb ihn über einen kleinen Feldweg fort von der Straße.
»Kommen Sie schon, wir müssen Sie in Sicherheit bringen!«
»Sie haben doch eine Waffe!«, keuchte der Minister, während Nicolas mit wachsender Besorgnis registrierte, dass einige Bauern ihre Traktoren gestartet hatten. Andere liefen ihnen hinterher. Und sie waren verdammt schnell.
»Ich hätte natürlich auf die Bauern zielen können, Monsieur. Der Premierminister hätte sich bestimmt über die Handyvideos gefreut«, antwortete Nicolas nur und blickte sich um.
Der Weg führte in einem weiten Bogen über das Feld. Er hielt Pesac mit der linken Hand am Arm fest, als dieser auf einer vereisten Pfütze ausrutschte.
»Diese Arschlöcher«, fluchte der Minister und schlitterte heftig rudernd neben Nicolas über den hartgefrorenen Boden. »Der Minister flieht vor den Bauern, wie sieht denn das aus?«
»Besser als von den Bauern als Geisel genommen zu werden, Monsieur.«
»Das hätten die nicht gewagt!«
»Oh doch, das hätten die. Sie hatten alles vorbereitet, offenbar haben sie nicht mehr viel zu verlieren.«
Nicolas blickte auf die vor ihnen liegenden weißen Felder und suchte nach einem Ausweg, während hinter ihnen die ersten Traktoren von der Straße holperten und die Verfolgung aufnahmen.
Ihnen blieb nicht viel Zeit.
Vereinzelt warfen Bäume ihre Schatten auf den makellosen Schnee, eine Vogelscheuche streckte ihre dürren Arme aus. Drei Krähen hatten sich auf ihren Schultern niedergelassen und begleiteten das Schauspiel, das sich ihnen bot, mit hämischen Blicken.
Noch immer war auf der N44 kein Auto zu sehen, der schwarze Rauch, der von den Reifen aufstieg, wurde dichter, der Himmel verdunkelte sich.
Nicolas hörte bereits das wilde Keuchen einiger Bauern, die behände über die Ackerfurchen liefen.
»Wo wollen Sie hin, hier ist nichts!«, rief Pesac, er atmete mittlerweile schwer.
»Dorthin«, antwortete Nicolas und zeigte geradeaus.
Der Weg endete in etwa hundertfünfzig Metern Entfernung an der alten Scheune, die er zuvor vom Hubschrauber aus gesehen hatte. Dahinter waren in der Ferne die ersten Häuser von Aulnay-l’Aître zu sehen, einem kleinen Dorf, das sich in die verschneiten Hügel der Champagne schmiegte.
Bis dorthin mussten sie es schaffen, und Nicolas wusste auch, wie.
»Kommen Sie, beeilen Sie sich.«
Die Scheune kam nur langsam näher, aber auch die Bauern hatten jetzt offenbar Mühe, auf dem vereisten Boden voranzukommen.
Als Nicolas sich umblickte, sah er in einiger Entfernung Remy, der vor seinem Hubschrauber stand und verzweifelt zu ihnen herüberblickte.
»Wo bleibt die Polizei?«, schimpfte Pesac.
»Die kommt bestimmt gleich.«
»Gleich ist zu spät!«
Allerdings, dachte Nicolas und atmete erleichtert auf, als ihre Füße wieder Asphalt berührten.
Sie hatten die Scheune erreicht …
… genau wie die etwa zehn Traktoren, die sich von der anderen Seite dem kleinen Gehöft näherten, mit röhrenden Motoren und spatenschwingenden Bauern auf den Fahrersitzen. Sie mussten einen anderen Weg gewählt haben, der zwar länger, aber dafür leichter zu befahren war.
Heimvorteil, dachte Nicolas und zog den Minister hinter die Scheune, auf der Suche nach einem Gefährt, mit dem sie fliehen konnten.
Wie etwa einem rostigen alten Traktor, der verlassen neben dem verschlossenen Scheunentor stand.
»Aufsitzen, Monsieur le Ministre! Vielleicht haben wir Glück und … Scheiße!«
Nicolas starrte ungläubig auf den alten Traktor, der mit Sicherheit gewillt gewesen wäre, sie nach Aulnay-l’Aître zu bringen, wenn nicht jemand den gesamten Motorblock ausgebaut hätte.
Endstation.
»Und jetzt?«, rief Pesac verzweifelt.
Hinter ihnen tauchten mehrere schnaufende Bauern auf, während einige Meter vor ihnen die ersten Traktoren zum Stehen kamen.
Der Mann mit der roten Wollmütze stand von seinem Fahrersitz auf und winkte zu ihnen herüber.
»So, Schluss jetzt, wir sind zu alt für Spielchen. Monsieur Pesac, Sie haben nichts zu befürchten. Sagen Sie Ihrem Bodyguard, er soll seine Waffe wegstecken, er schießt ja doch nicht.«
»Personenschützer, du Trottel«, zischte Nicolas mit zusammengekniffenen Zähnen. »Ich bin Personenschützer, kein Bodyguard, das ist ein Unterschied.«
Er blickte sich um, auf der Suche nach einem Ausweg.
»Die filmen ja immer noch!«, flüsterte Pesac neben ihm, und tatsächlich sah nun auch Nicolas, dass einige Bauern auf den Traktoren ihre Handys in die Luft hielten.
Sie hatten sie voll im Visier.
»Nein!«, rief Nicolas laut. »Solange ich einen Minister beschütze, wird er weder festgehalten noch entführt, noch verletzt. So leid es mir tut. Und jetzt entschuldigen Sie uns!«
Nicolas packte den Minister am Arm und schob ihn vor sich durch eine Art Seitentür in die Scheune, die er während der kurzen Ansprache des Anführers entdeckt hatte.
Kaum waren sie drin, knallte er die Tür zu und schob einen schweren Holzbalken davor. Wütend hämmerten von draußen mehrere Bauern gegen das Holz.
Nicolas atmete kurz durch und blickte sich um.
»Und jetzt?«, fragte Pesac. »Wollen wir hier warten, bis die Polizei kommt?«
»Ich befürchte, die Zeit haben wir nicht, Monsieur le Ministre.«
Im Halbdunkel der Scheune konnten sie kaum etwas erkennen. Die Umrisse mehrerer vergammelter Heuballen schälten sich nur langsam aus dem Dämmerlicht, die Überreste eines Hühnerstalls, dazu mehrere rostige Anhänger und … der ausgebaute Motorblock eines alten Traktors, der draußen im Schnee stand, leblos und vollkommen unnütz.
Nicolas hörte, wie einige Bauern die Scheune umrundeten, auf der Suche nach einem weiteren Eingang. Jemand rüttelte am großen Tor, das Holz knarzte bedenklich.
Dieser Ort war nicht als Festung geeignet. Sie mussten fort von hier.
»Was machen wir jetzt?«, fragte der sichtlich aufgewühlte Minister wieder.
»Kommen Sie mit«, sagte Nicolas und trieb Pesac tiefer in die Scheune hinein, vorbei an leeren Obstkisten und durch dichte Spinnweben hindurch. Durch einen Spalt in der Bretterwand sahen sie die Silhouetten der Bauern, die draußen offenbar nach etwas suchten, um das Tor aufzubrechen.
Nicolas vermutete, dass sie in Kürze einfach mit einem der Traktoren durch das Tor brechen würden.
»Was ist das?«, fragte Pesac plötzlich.
Er stand vor einer großen Plane in der hintersten Ecke der Scheune. Ein mächtiger Gegenstand zeichnete sich darunter ab.
Etwas, das groß war und breit. Zu breit für einen Traktor.
Sie standen beide vor der Plane und blickten einander an.
Hinter ihnen rüttelte jemand heftig an der kleinen Seitentür.
»Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht haben wir ausnahmsweise mal Glück«, sagte Nicolas. Er griff nach der Plane und zog sie mit einem Ruck zur Seite. Der Staub vieler einsamer Jahre wirbelte durch den Raum, während im diesigen Licht nach und nach sichtbar wurde, was sich unter der riesigen Plane verbarg.
Pesac hustete laut, der Staub kroch ihnen in die Nase.
Durch die Bretter der Außenwand lugte die weiße Wintersonne, ein heller Strahl ließ das Ungetüm vor ihren Augen leuchten.
Nicolas stand mit geöffnetem Mund davor, immer noch hielt er eine Ecke der Plane in der Hand. Sein Gesicht war mittlerweile von Staub bedeckt.
»Das ist nicht euer Ernst«, murmelte er.
Pesac hingegen schien sich zum ersten Mal an diesem Tag wirklich zu freuen.
»Oh, das ist mal eine Entdeckung«, rief er. »Ich hoffe, der Schlüssel steckt. Es wäre zu schade, das hier nicht auszuprobieren.«
Hinter ihnen röhrte der startende Motor eines großen Erntetraktors.
Sie kamen.
»Brecht das Tor auf!«, schrie jemand mit heiserer Stimme.
Aber das war nicht mehr nötig, denn Nicolas und Balthasar Pesac kamen bereits heraus.
In voller Fahrt, mit wilder Miene und entschlossenem Blick.
Als sie von innen das große Tor der Scheune durchbrachen und mit einem lauten Krachen das Holz splitterte, blieb den Bauern nichts anderes übrig, als zur Seite zu springen, um nicht von der Maschine überrollt zu werden, die eben noch unter einer verstaubten Plane vor sich hin gedämmert hatte. Einige von ihnen hechteten panisch von den Sitzen ihrer Traktoren und krachten auf das harte Eis zwischen den Ackerfurchen. Andere wiederum blieben wie angewurzelt stehen und blickten ungläubig auf das, was ihnen das neue Jahr als Schauspiel bot.
»Scheiße, was ist das?«, fragte einer der Landwirte und blickte zu dem Mann mit der roten Wollmütze, der aus einem unerfindlichen Grund lächelte, während er als Einziger hoch oben auf seinem Fahrersitz sitzen blieb.
»Das, mein Lieber ist eine de Havilland 82. Ein Jagdflugzeug der Royal Air Force, gebaut zwischen den Weltkriegen. Ich hatte gehört, dass der alte Claude, Gott hab ihn selig, einen alten Doppeldecker in seiner Scheune hat. Und die alte Dame scheint tatsächlich noch zu funktionieren!«
Es war ein fast unwirklicher Anblick, der sich den verdutzten Bauern inmitten der verschneiten Winterlandschaft bot. Der alte Doppeldecker rumpelte mit einem infernalischen Lärm aus der Scheune, wobei sein linker Flügel ein Stück der Außenwand herausriss.
Auf dem Vorplatz verlor Nicolas, der am Steuer saß, für einen Augenblick die Kontrolle über das Flugzeug, so dass das Heck, das in den verblassten Farben der Royal Air Force gestrichen war, gegen einen der Traktoren stieß.
»Versperrt ihm den Weg!«, rief einer der Bauern und rappelte sich mühsam auf.
Aber es war bereits zu spät.
Die Maschine holperte über die harten Ackerfurchen, bis Nicolas sie unsanft auf den hartgefrorenen kleinen Weg navigierte, wo das schlanke Flugzeug sofort Fahrt aufnahm.
»Halt still, Miststück!«, fluchte er, während er versuchte, den ruckelnden Stahlkörper auf Kurs zu halten.
»Alles in Ordnung bei Ihnen, Monsieur le Ministre?«
Er hätte sich die Frage sparen können.
Balthasar Pesac kniete auf dem hinteren Sitz und winkte laut jubelnd den zurückbleibenden Bauern zu. Er hatte in der Scheune eine braune Pilotenmütze gefunden und sie sich übergezogen. Die dazu passende Fliegerbrille ließ ihn aussehen wie eine etwas beleibte Stubenfliege, die aufgeregt auf ihrem Platz herumhüpfte und sich diebisch freute.
»Adieu, meine lieben Freunde! Es war mir ein Fest! Nicolas, Sie haben es geschafft, mein Gott, Sie sind ein Teufelskerl!«
Nicolas hingegen kämpfte mit der zuckenden und altersschwachen Lenkung der Maschine und versuchte, sie einigermaßen gerade auf dem Feldweg zu halten. Wenn sie auf einen der vereisten Äcker gerieten, konnte es schnell vorbei sein mit ihrer Flucht.
»Sie haben gesagt, alles wird gut, und so ist es auch, alles ist gut! Mein Gott, was für ein herrlicher Tag, ich …«
»Monsieur, bitte setzten Sie sich hin, die Maschine ist ohnehin nicht leicht zu lenken!«
»Ach was, das schaffen Sie schon, wir könnten doch jetzt abheben, oder? Was sagen Sie, Nicolas? Fliegen Sie uns nach Hause! Meine Flugangst ist mit Sicherheit kuriert!«
»Ich kann leider nicht fliegen, Monsieur le Ministre.«
»Oh, schade, das ist bedauerlich!«
Pesac wandte sich zur Scheune um, wo die Bauern noch immer unschlüssig vor dem offenen Tor standen.
»Au revoir! Wir sehen uns in Paris, ihr …«
»Monsieur! Festhalten!«
Nicolas versuchte noch auszuweichen, aber es war zu spät.
Der Aufprall kam fast ohne Vorwarnung, und er war hart.
Ein einzelner Begrenzungsstein, der womöglich seit Jahrzehnten ungestört an dieser Stelle geruht hatte, ragte einige Zentimeter zu weit auf den Feldweg heraus.
Gerade genug, um den rechten Reifen, der ohnehin kaum Luft enthielt, aufzuschlitzen und das gesamte Heck mit einem gewaltigen Ruck bei voller Fahrt zur Seite ausbrechen zu lassen. Nicolas war machtlos, als ihm der Steuerknüppel förmlich aus den Händen gerissen wurde und die ganze Maschine ins Schlingern kam.
Nach einigen Metern verlor er völlig die Kontrolle, der Doppeldecker schoss auf den Acker hinaus und rammte sich kurz darauf mit einem lauten Aufheulen des Motors in den hartgefrorenen Boden.
Der Motor erstarb augenblicklich, über den Feldern wurde es still.
Nicolas wischte sich ein wenig Blut von der Stirn, er war bei dem Aufprall gegen das Armaturenbrett geknallt. Es war wohl nur eine Platzwunde, er würde vielleicht eine kleine Narbe davontragen.
Endlich eine, die man sehen kann, dachte er.
Als er über sich ein Krächzen hörte, blickte er nach oben und sah drei Krähen, die über dem Flugzeug ihre Kreise drehten.
Für einen Moment kam es ihm vor, als würden sie sich vor Lachen die Bäuche halten.
»Monsieur le Ministre, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Nicolas drehte sich um, aber von Balthasar Pesac fehlte weit und breit jede Spur. Der kleine Sitz hinter ihm war leer. Dort, wo der Minister eben noch siegestrunken den Bauern gewinkt hatte, lag jetzt nur noch eine braune Fliegermütze.
»Scheiße!«
Nicolas sprang von der Maschine und blickte sich um.
Alles war weiß, Schnee und Eis ruhten in ihrer ganzen Vergänglichkeit vor ihm auf den weitläufigen Feldern.
Als er die Maschine umrundete und die Spur aus Dreck und Matsch sah, die ihr Unfall hinterlassen hatte, hörte er plötzlich ein Geräusch.
»Mmmhhh! Mmmmhhhh!«
Balthasar Pesac lag bäuchlings hinter dem Doppeldecker. Sein Gesicht hatte sich tief in den Schnee gegraben, seine Hände suchten verzweifelt nach Halt. Er war offenbar völlig orientierungslos.
Nicolas musste unweigerlich lächeln.
»Mmhhh! Helfen Sie …«, drang Pesacs Stimme gedämpft zu Nicolas.
»Ich bin schon da, Monsieur le Ministre!«, rief er und half Pesac vorsichtig auf die Beine. Erschöpft, aber auf wunderliche Weise immer noch mit einem breiten Grinsen im Gesicht, lehnte sich der Minister gegen den Bauch des Flugzeuges und tätschelte das Metall.
»Sie haben der alten Dame viel zugemutet, mein lieber Nicolas.«
»Und Sie hätten sich setzen sollen, im Stehen waren Sie zudem eine prima Zielscheibe, Monsieur le …«
»Seien Sie still, Nicolas. Meinen Sie wirklich, die schießen auf mich? Nein, die wollten mich festhalten, damit sie endlich Gehör finden. Und wissen Sie was, ich kann die sogar ein bisschen verstehen. Europa macht nicht immer nur Gewinner aus uns.«
Das Geräusch mehrerer Motoren durchbrach die winterliche Stille über den Feldern.
»Sie kommen«, sagte Pesac und blickte erschöpft zu Nicolas. »Und jetzt? Was machen wir jetzt? Warum lächeln Sie?«
Nicolas deutete hinüber zur Scheune. Sie war verlassen.
Die Traktoren waren fort, ebenso die Bauern, die ihnen hinterhergelaufen waren. Als wären sie nie da gewesen.
Nur der große Reifenstapel brannte noch immer und schickte schwarze Rauchschwaden in den Himmel.
Pesac kratzte sich am Kopf.
»Wo sind die alle hin?«
»Keine Ahnung, vermutlich nach Hause.«
»Dabei stehen wir hier und können nicht weiter. Sie hatten uns.«
»Oui, Monsieur le Ministre. Aber die dort hinten haben uns auch.«
Pesac drehte sich um und blickte über die Felder hinweg, wo hinter einer durchaus amüsierten Vogelscheuche die ersten Häuser von Aulnay-l’Aître zu sehen waren.
Ein knappes Dutzend Polizeifahrzeuge warfen ihr blaues Licht auf den weißen Schnee, während sie in voller Fahrt über die Feldwege auf sie zukamen.
Pesac klopfte Nicolas auf die Schulter.
»Na endlich, da kommt die Kavallerie, wir haben es geschafft! Und eines sage ich Ihnen: Ihren Einsatz heute vergesse ich Ihnen so schnell nicht.«
Das hoffe ich, dachte Nicolas, während er sich etwas Schnee von der Hose klopfte.
Das hoffe ich wirklich.
In diesem Augenblick vibrierte sein Handy kurz in der Innentasche seines Anzuges. Die Nachricht, die ihn ohne Vorwarnung an diesem unwirklichen Ort erreichte, war von seinem Vater und bestand aus nur drei Wörtern.
Wir müssen reden.
Kapitel 2
Normandie
Vier Tage später
J-153
Die Perlmuttküste war an diesem Morgen in zarte Pastelltöne getaucht, ein winterliches Gemälde in einem verblichenen Rahmen. Es war still, nicht einmal das heisere Krächzen einer Möwe war zu hören, hoch oben in der klirrend kalten Luft. Der feine Sandstrand lag völlig unberührt da. Aber das änderte sich schlagartig, als eine junge Frau fröhlich die Böschung herunterlief und ihre Arme in die Luft warf.
»Schau dir das an, Philippe! Keine Menschenseele, wir sind die Ersten am Strand! Wer als Erster am Wasser ist! Komm schon, Philippe!«
»Auf keinen Fall! Claire, warte …!«
»Na los, du Feigling! Oder hast du Angst, deine schicke blaue Uniform zu versauen? Immerhin könntest du hinter mir auf die Nase fallen! Und zwar weit hinter mir, kleiner Philippe!«
»Ich bin älter als du, und hier sollten wir auf keinen Fall …«
Aber es war zu spät.
Mit einem lauten Juchzen sprang Claire Cantalle, Polizeianwärterin der Police Nationale in Caen, eine kleine Anhöhe hinunter, landete im weichen Sand und rannte los. Für einen kurzen Moment schien es, als würden Himmel und Meer sich erschrecken, das Gemälde begann zu wackeln. Als säße der Nagel, an dem es befestigt war, schlecht in der Wand.
Mit großen Schritten überquerte Claire den hellen Sandstreifen, übersprang einen kleinen Bachlauf und rammte ihre Stiefel in den klammen, harten Sandboden. Kleine Krebse flohen mit seitlichen Ausfallschritten, verwundert über so wenig Respekt an diesem frühen Morgen.
Denn dies war nicht irgendein Strand.
Dies war Omaha Beach.
Jedes Sandkorn an diesem Ort hatte mehr Blut aufgenommen, als ein ganzes Meer jemals reinwaschen konnte.
Heftig keuchend tauchte Claire ihre rechte Hand in das eiskalte Wasser. »Ist das kalt! Philippe, komm, wir ziehen uns aus und gehen baden, was hältst du davon?«
Ihr glockenhelles Lachen drang durch die Luft, und für einen kurzen Augenblick überlegte Philippe Pasquale, ob die junge Polizeischülerin es ernst meinte. Zuzutrauen wäre ihr es.
Claire war erst seit kurzem bei der Police Nationale, und doch hatte sie bereits mehr Wirbel gemacht als jeder andere in einer ganzen Ausbildungszeit.
Also hatte der dicke Bruno beschlossen, sie jetzt rauszuschicken. Um Ruhe vor ihr zu haben.
Der dicke Bruno, das war Bruno Bogdalic, der Leiter des Commissariat in der Rue de la Fresnaye.
»Sie fahren zum amerikanischen Friedhof und schauen sich das an. Da ist vermutlich nichts dran, nur Schmierereien. Aber die brauchen das für ihr dämliches Protokoll. Und Sie wiederum brauchen Erfahrung, da kann so eine Landpartie nicht schaden. Und nehmen Sie Claire mit, bitte!«
Und da stand er nun, an einem der geschichtsträchtigsten Orte des Landes, und seine junge Kollegin plädierte für Nacktbaden im Meer.
»Claire, es reicht, wir haben zu tun!«
Aber Claire hörte ihn nicht, sie fischte einen kleinen Krebs vom feuchten Sandboden und betrachtete ihn mit großen Augen.
»Gehst du mit mir schwimmen? Du kannst auch die Kälte besser ab, wette ich.«
Der Krebs antwortete nicht, was Claire für einen kurzen Moment verwunderte. Dies waren ihrer Meinung nach der ideale Ort und die ideale Zeit für sprechende Krebse.
»Weißt du, mein Kollege dort hinten ist ein sehr eifriger Beamter, jetzt schon, mein Gott, stell dir vor, er ist noch nicht mal dreißig! Ich meine, ganz im Ernst, wie will er denn werden, wenn er mal richtig alt ist? Also, jedenfalls, er nimmt diesen Auftrag hier sehr ernst … und ich glaube, er hat im Geschichtsunterricht immer gut aufgepasst, er hat irgendwas von irgendeinem Overlord erzählt, weißt du, wer das ist? Ich jedenfalls nicht.«
»Claire!«
Sie verdrehte die Augen.
»Siehst du, was ich meine? Nun gut, pass auf dich auf, das nächste Mal erzählst du mir was aus deinem Leben, ja?«