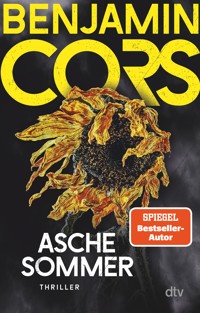Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nicolas Guerlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Küste im Sturm, ein Meer in Flammen Die malerische Hafenstadt Barfleur ist berühmt für ihre Muscheln, die frisch aus dem Meer auf die Teller in ganz Frankreich gelangen. Jetzt aber kämpfen die Fischer um ihre Existenz: Denn die weltbekannten »Blondes de Barfleur« sind spurlos verschwunden und niemand weiß warum. Immer öfter entlädt sich die Verzweiflung der Seeleute in blindem Hass. Hat auch der Anschlag auf einen örtlichen Kapitän damit zu tun? Als wenig später ein Mann an Land gespült wird, dessen Körper übersät ist mit Brandmalen, spitzt sich die Lage zu. Nicolas, der in dem beschaulichen Küstenstädtchen eigentlich Urlaub machen wollte, erkennt schnell, dass an der felsigen Küste des Cotentin ein brutaler Mörder sein Unwesen treibt …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benjamin Cors
Flammenmeer
Ein Normandie-Krimi
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Katrin, Mia und Ella
Sanft tauchen die Ruderblätter in das Wasser ein, gleiten glatt hinein wie ein Skalpell in nackte Haut. Der erste Schnitt, von ruhiger Hand geführt, ein erstes Eindringen in ein Meer voller Unschuld. Die Oberfläche krümmt sich, es entstehen Wölbungen, und kurz scheint es, als könnte die Haut sich wehren, als wäre das Wasser fähig, jedes Eindringen zu verhindern.
Und doch gibt es kein Zurück, der Schnitt wird gesetzt, über dem Wasser liegt ein gleißendes Licht, hell wie der Schein einer Lampe über dem Seziertisch. Alles ist offenbart, das Mysterium des Lebens versteckt sich nicht länger vor der Dunkelheit. Es kommt zum Vorschein, was so lange unerforscht war, verborgen unter den Narben, unter einer zerstörten Haut, die viel zu erzählen hat und nichts zu verzeihen.
Konzentrische Kreise bilden sich, glitzerndes Wasser tropft vom Holz der Ruder, Muskeln spannen sich.
Es ist noch kalt an diesem Morgen, draußen auf dem Meer. Das Wasser fließt zurück, nur kurz bleibt es aufgewühlt, die Kreise verebben, die Oberfläche beruhigt sich.
Bis zum nächsten Ruderschlag, der ebenso präzise ist wie jener zuvor. Voller Rücksicht auf die eben noch unberührte Oberfläche. Und doch müssen sie sein, diese Schnitte, diese Narben, sie erzählen ein ganzes Leben, hier draußen.
Ein paar Schläge noch, alles fließt, ist eins, das Wasser, die Haut, der Tod darunter. Als würden sich für wenige Augenblicke kleine Fenster öffnen, die in die Dunkelheit blicken lassen, die dort lauert, fernab des neuen Tages.
Weitere Kreise entstehen und verschwinden, der Atem verschmilzt mit der kalten Luft, alles kommt zusammen, langsam sinken die Ruder, der Kopf berührt das warme Holz.
Die Augen sind geschlossen. Und Flammen steigen empor.
Sie züngeln am Körper, fließen durch Venen und Adern, es ist ein brennendes, loderndes Feuer, es zischt, wenn es auf Schweiß trifft, auf die salzigen Tropfen auf der Haut. Das Feuer bricht sich Bahn, es sucht sich seinen Weg, kein Ozean kann es stoppen, während das Boot beruhigend auf dem glatten Wasser liegt.
Das Herz brennt, eine Fackel inmitten des Körpers. Jedes Haar bäumt sich auf, heiße Hände auf der Haut, die brennt … bis es vorbei ist.
Und es ist genau dieser Augenblick, wenn das Feuer erlischt, in dem die Angst endlich stirbt.
Der Körper löst sich vom Holz des Bootes, die Haut ist rein jetzt, und die Narben sind geheilt. Stille liegt wieder auf dem Wasser, die Oberfläche glatt wie die Haut eines Neugeborenen.
Bereit, erneut durchstoßen zu werden, um dem Feuer Raum zu geben.
Aber nicht jetzt. Jetzt berühren die Ruderblätter wieder sanft das Wasser.
Das Boot bahnt sich seinen Weg zurück an die Küste. Mitten durch ein loderndes und alles verzehrendes Flammenmeer.
Am Anfang …
Kapitel 1
Cap de la Hague
Normandie
Am Anfang ist das Licht, das noch brennt.
Am Ende der Welt.
Schwach nur, flackernd, inmitten tiefster Dunkelheit. Der Schein, den die kleine Signallampe noch zu werfen imstande ist, verliert sich in der Finsternis, er wird geschluckt von der Gischt und vom Sturm, der ringsherum tobt, wie er es lange nicht mehr getan hat. Denn dies ist der Ort, an dem er wüten kann, hier an den Klippen, die schärfer sind als jede Klinge. Hier, wo in den Tiefen ein Monster lauert, dessen Namen die Menschen nur leise auszusprechen wagen.
Raz Blanchard. Der weiße Strom, der alles mit sich reißt.
Sand und Steine. Schiffe und Menschen.
Das Krachen von Holz ist zu hören, das Stöhnen der Planken, wenn der Sturm sich wieder über das Schiff hermacht, mit kaltem Griff und brutaler Gewalt. Der Mast erzittert und mit ihm das Licht an seiner Spitze. Es scheint, als wäre es das letzte Zeichen von Leben an diesem unglückseligen Ort, am Fuße der Klippen.
Und doch gibt es jemanden, der dem Monster in der Tiefe zu entkommen scheint. Es ist ein Mann, er klebt in den Felsen, mehr tot als lebendig. Ohne jede Hoffnung, weil in der Finsternis die Klippen vor ihm wie eine unbezwingbare Wand erscheinen. Er ist ein Schiffbrüchiger, dem das feste Land die Rettung noch verwehrt. Für einen Augenblick übertönt sein Schreien das Fauchen des Sturms, er ist getrieben von Schmerz und Verzweiflung. Seine Hände suchen nach Halt, seine Füße ziehen sich Stück für Stück aus dem Wasser, sie rutschen aus, das Meer frohlockt, es greift nach ihm. Seine Haare kleben wie Seetang an seinem Kopf. Er zittert vor Kälte, schreit erneut, sein Wollpullover ist vollgesogen mit Wasser und Blut, weil die scharfkantigen Felsen längst ihre Arbeit verrichten. Er schafft es wieder einige Zentimeter weiter, raus aus den Tiefen, irgendwie.
Die nächste Welle, die auf ihn einprügelt, schiebt ihn hoch, endlich. Ein kleiner Vorsprung in der Wand, sein Oberkörper zieht sich über Risse und Kanten, der Sturm brüllt seine dunkelsten Drohungen, während unter ihm erneut das Krachen von Holz zu hören ist.
Es geht zu Ende.
Der Mann lässt sich in eine Nische fallen, die Augen weit aufgerissen. Sein Oberkörper hebt und senkt sich. Er ist am Leben, gerade noch.
Als wollte die See ihn nicht haben.
Das Licht auf dem Mast wird schwächer, es flackert, die nächste Welle rollt heran, sie begräbt das Schiff unter sich.
Die »Angèle«. Sein Schiff.
Nie hätte er hinausfahren dürfen in dieser Nacht. Der Mann verflucht sich für seine Gier, verflucht den Augenblick, in dem er weich geworden ist.
Stöhnend kracht der Rumpf des Schiffes gegen die Felsen, Gestein bohrt sich in die Schiffswand, schlitzt sie auf, reißt dem Boot das letzte bisschen Leben aus dem Leib. Das Deck ist von salziger Gischt überspült, Taue, Kisten, Netze aus den Verankerungen gerissen. Die Tür zur Steuerkajüte schlägt im Sturm hart gegen die Wand, der Holzrahmen ist längst zersplittert, die Scheiben sind längst zerborsten.
Der Mann sucht nach etwas, sein Blick fliegt über das Deck. Aber keine Seele stemmt sich mehr gegen das Schicksal, das die Raz Blanchard zum Spielball ihrer Kräfte gemacht hat.
Die nächste Welle kommt, der nächste harte Schlag. Der Mast schwankt, für einen Moment droht alles zu kippen, hinein in die Tiefen, die hier am Fuße der Klippen voller Abgründe sind und ohne Hoffnung.
Er kriecht noch ein Stück weiter in die Nische hinein. Zitternd greift er nach kleinen Vorsprüngen, versucht, sich festzuhalten, sein Körper ist schwer und durchnässt.
Immer weiter prügelt der Sturm auf ihn ein. Er will emporsteigen, fort aus dieser Hölle, die Wand hinauf, Stück für Stück. Noch aber fehlt ihm die Kraft, also blickt er schwer atmend hinaus auf die dunkle See und auf das Schauspiel, das sie ihm bietet.
Er weiß genau, wo er ist.
Am Ende der Welt.
Die Raz Blanchard treibt zwischen der Kanalinsel Alderney und der äußersten Spitze des Cotentin das Wasser vor sich her, mit unbändiger Kraft. Eine Strömung, die am Meeresgrund alles mit sich reißt, die Wellen zu brüllenden Monstern werden lassen kann. Ein weißer Strom des Verderbens, gefürchtet von den Fischern, den Seglern und auch den Frachtern, deren Kapitäne alle Geschichten gehört haben. Die erfundenen und auch die wahren. Jene über die Wracks am Meeresgrund, über die Geister längst verstorbener Schmuggler und auch jene über die böse Aura dieses Weltenrandes, wo der Leuchtturm des Cap de la Hague steht, draußen im Meer, auf seiner Klippe, als letzte Bastion.
Aber diese Nacht ist anders. Und dieser Sturm auch.
»Finis Terrae«, murmelte der Mann leise, als ein Blitz über das Meer kracht und für einen kurzen Augenblick den Himmel erhellt. Das weiße Band zuckt die Küste entlang, entlang an den Klippen, am Nez de Jobourg und schließlich weiter nach Osten, nach Cherbourg und Barfleur.
Sein Barfleur.
Er kennt alle Geschichten über die alten Schmugglerpfade, die oberhalb der Klippen am Meer entlangführen und über denen in der salzigen Luft die Möwen ihr schnatterndes Schauspiel darbieten. Er kennt die Fanggründe im Osten, wo er zuhause ist, er kennt jeden kleinen Hafen entlang der Nordküste, jede Bucht und jeden Strand.
Und deshalb hätte er nicht rausfahren dürfen.
Denn am Ende der Welt hat sich jetzt ein Tor geöffnet, und jedes Leben verschwindet darin, verschluckt von einer gurgelnden See. Auch seine »Angèle« ist endgültig verloren, er kann sehen, wie immer mehr Wasser ins Innere strömt, alles hebt und senkt sich, wie ein sterbender Körper, der sich aufbäumt, angesichts des Unausweichlichen.
Und dann sieht er ihn.
Den Jungen.
Der Mann wischt sich Regen, Schweiß und Blut aus den Augen, blinzelt mehrmals und richtet sich auf.
Und er sieht, dass alles verloren ist.
Die schmale Gestalt, die zwischen der Reling und der großen Spule am Heck festklemmt, bäumt sich nicht mehr auf. Gelbe Hochseestiefel stecken in einem Gewirr von Tauen und Netzen, eine Hand hängt leblos über der Reling. Blut fließt unter einer dichten Strickmütze hervor, die den Aufprall gegen den harten Rand der großen Spule nicht hatte abmildern können. Immer wieder reißen Wellen an dem Körper, wollen ihn fortspülen, ihn in die Tiefe hinabziehen. Aber wie eine Makrele, die sich in ihrem Todeskampf im Netz der Fischer verkeilt, schlingen sich die feingliedrigen Seile mit jeder Bewegung nur noch fester um ihr Opfer.
»Nein! Noah! Noaaaah!!«
Der Mann schreit, gegen die Wellen, gegen den Sturm, gegen den Tod. Schwankend steht er auf, klammert sich an das rutschige Gestein, verliert fast den Halt, aber er schreit weiter, immer weiter.
Die Wellen schließen sich über der »Angèle«, das Meer zieht sie in den gierigen Schlund am Fuße der Felsen. Alles wird mitgerissen. Der Junge ist schon nicht mehr zu sehen.
Eine Ewigkeit und noch viel länger kauert der Mann in der Nische im Stein, weinend, mit allen Kräften am Ende. Schließlich traut er sich hinaus in den Wind, er brüllt die Gezeiten an, während seine Hände nach Halt suchen in den Ritzen. Seine Füße arbeiten sich vorwärts, nach oben, nur nach oben.
Bis er den Rand erreicht.
Feuchtes Gras empfängt ihn, die Kälte der Erde an seinem Gesicht, er kann die Brandung spüren, weil der Boden unter ihm erzittert.
Der Herzschlag des Monsters.
Keuchend, weinend, den Blick in die Wolken, die dort oben toben und sich selbst zerfetzen wie ein zweites Schlachtfeld. Am Cap de la Hague ist der Kampf noch immer im vollen Gang, die Heerscharen haben sich noch nicht zurückgezogen. Es ist, als hätten die Elemente ihre Krieger losgeschickt, das Wasser, die Luft, die Erde.
Und das Feuer.
Eine Flamme schält sich aus der Dunkelheit, direkt über seinem Gesicht. Sie kommt aus den Schatten, ist plötzlich da, ihr flackernder Schein erhellt sein Gesicht.
Hoffnung. Auf Rettung, auf Heilung.
Auf Vergebung, vor allem.
Ein Gesicht schiebt sich in sein Blickfeld, dunkle, tiefe Augen, die ihn anblicken.
Die Flamme senkt sich – tiefer, immer tiefer.
Bis sie dicht über ihm schwebt, ruhig jetzt, abwartend.
»Bitte«, flüstert der Mann mit der letzten Kraft, die ihm bleibt. »Mein Schiff. Der Junge. Ich wollte nur …«
Die Flamme geht aus.
Hände packen ihn, zerren ihn nach oben, er kann sich nicht wehren, da ist keine Kraft mehr, seine Beine knicken weg.
Jemand hält ihn, mit festem Griff.
Jemand gibt ihm Halt.
»Danke«, murmelt der Mann. Er sucht die Augen unter der Kapuze, er sucht das Gesicht, das verborgen ist, tief in den Schatten dieser Nacht. Und für einen kurzen Moment denkt er, dass der Gott der See ein Einsehen hat.
Aber es gibt keinen Gott der See. Nur einen Gott des Feuers.
Und als der Griff sich lockert, als die Hände, die ihn halten, ihn fast sanft nach hinten stoßen, als er kippt, zurück in die Hölle unter ihm, da versteht er: Dieser Sturm wird sich nicht mit einem Opfer begnügen. Und diese Nacht wird es nicht bei einem Toten belassen.
Sein Schrei wird verschluckt vom Wind und vom Regen, sein Körper verschlungen von der Brandung, die ihn dankbar aufnimmt und ihn hinausträgt, zu seinem Schiff, seiner »Angèle«, wo er hingehört, dorthin und nirgendwo anders.
Kapitel 2
Cherbourg
Ein halbes Jahr später
Festungsstadt am äußersten Ende der Normandie. Legendärer Seehafen der französischen Marine. Ausgangspunkt für Weltensegler und Knotenpunkt für die Fähren nach Großbritannien und Irland. Und bei der Auflistung der regenreichsten Städte des Landes jedes Jahr auf den vorderen Plätzen vertreten. Leider völlig zu Recht.
Cherbourg.
Luc Roussel schlug den Kragen seines Mantels hoch und schnippte fluchend eine Zigarette auf den Boden. Der Regen kam jetzt von vorne, was die vierte Richtungsänderung in den vergangenen zehn Minuten bedeutete. Es war keine Sturmflut, die sich in den ersten Morgenstunden über das Hafenbecken schob, sondern vielmehr ein steter Strom feinster, perlenartiger Tropfen, die der Wind über die Kaimauer blies, bis in ihr Versteck hinein. Und das schon die ganze Nacht hindurch.
Es war eine verdammte Katastrophe.
Anfangs hatten sie hinter einer flatternden Pergola Schutz gefunden, die jedoch nach einer Stunde so durchnässt gewesen war, dass sie ein kräftiger Windstoß aus der Verankerung gerissen hatte. Sie hatten sich mit aufeinandergestapelten Holzpaletten beholfen, aber das Wasser suchte sich seinen Weg. Und fand ihn auch.
»Ich habe sicher schon Schwimmflossen zwischen den Zehen«, fluchte Roussel und duckte sich, als ein weiterer Windstoß ihm den Regen direkt ins Gesicht blies.
»Und was passiert: Nichts! Ich meine, wir stehen uns hier seit halb drei in der Nacht die Beine in den Bauch und außer Regen ist nichts, verdammt nochmal!«
Im Hintergrund ragten Lastenkräne in den nur langsam heller werdenden Himmel, stählerne Kolosse, die in zwei Stunden wieder mit dem Be- und Entladen der Frachter beginnen würden, rumpelnd und schwankend. Entlang des Hafenbeckens warfen vereinzelte Straßenlaternen ihr gelbliches Licht auf die Wellen, auf denen eine Handvoll Fischkutter schaukelte.
Auch die beiden Männer, die neben Roussel hinter den Kisten hockten, schienen sich längst mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben. Kurz nach Schichtbeginn hatten sie noch ab und zu ein Wort gewechselt, sich über den Auftrag unterhalten oder über ihre Arbeit, wenig später waren sie verstummt.
Die zwei jungen Polizisten waren aus der Stadt herbeordert worden, ohne Rücksicht auf freie Tage, der Dienstplan war außer Kraft gesetzt. Leicht zitternd kauerten sie hinter den Paletten und blickten ab und zu durch ihre Nachtsichtgeräte am Hafenbecken entlang. Nicht mehr lange, und sie konnten wieder normale Ferngläser benutzen, aus den grünlich schimmernden Umrissen der Nacht würden sich die Hafenanlagen und die Baracken auf der anderen Seite des Beckens schälen. Wenn ihnen nicht der Nebel dazwischenkam, der in ersten Fetzen vom Meer in die Stadt getragen wurde.
»Na klar, das fehlt uns gerade noch«, murmelte Roussel missmutig.
»Hier ist Kaffee.«
Eine Frau betrat den Verschlag, erleichtert griffen Roussel und die beiden jungen Beamten zu den dampfenden Bechern, die sie mitgebracht hatte.
»Und, nichts Neues?«
Valerie Colin stellte sich direkt neben Roussel und blickte über das trübe Wasser zum Grund ihres nächtlichen Versteckspiels. Dem Trawler mit der Registrierungsnummer CH548807.
Ein Hochseeboot, geeignet für den Fischfang in den offenen Gewässern weit draußen vor der Küste des Cotentin, wo sich britische und französische Fanggründe vermischten. Die große Spule am Heck war rostig, das gewaltige Netz aufgerollt und bereit für eine weiteren Einsatz in den dunklen Gewässern des Ärmelkanals.
Aber CH548807 war, anders als vorhergesehen, noch nicht aufgebrochen. Wie so viele Fischer entlang der Küste hätte die Besatzung noch in der Dunkelheit den Hafen von Cherbourg verlassen sollen. Aber von den Männern fehlte jede Spur.
»Ich sag euch, irgendwas stimmt da nicht«, murmelte Roussel und blickte hinüber zu den anderen Positionen, wo weitere Mitglieder der eigens zusammengestellten Sonderermittlungseinheit im Verborgenen warteten. Es gab es vier verschiedene Teams, insgesamt knapp zwanzig Polizeibeamte des Commissariat von Cherbourg, dessen Leiterin nun neben Roussel stand, deutlich angespannt und übermüdet.
Und dennoch war Valerie Colin für ihn immer noch der beste Grund, im Regen von Cherbourg zu stehen. Sie kannten sich seit vielen Jahren, hatten sich jedoch zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Bis eine Festnahme in Deauville Roussel in ihr Revier geführt und eine neue Verbindung zwischen der Côte Fleurie, wo er das Commissariat leitete, und Cherbourg, ihrem Einsatzgebiet, geschaffen hatte.
Er betrachtete sie aus den Augenwinkeln, während sie mit ihrem Nachtsichtgerät die Auffahrtsstraße zum Hafengelände im Blick behielt. Sie war Anfang fünfzig, hatte schulterlange gelockte braune Haare und trug unter dem Regenmantel einen weiten Wollpullover.
Valerie Colin leitete das Commissariat seit fünf Jahren, davor hatte sie auf der Straße gearbeitet, so wie Roussel.
Sie waren beide vom gleichen Schlag. Und für einen kurzen Moment dachte er darüber nach, ob sie wohl mit ihm auf die erfolgreiche Aktion anstoßen würde. Sofern sie denn erfolgreich wäre.
»So langsam frieren meine Füße ein«, murmelte er.
Der Fischtrawler lag noch immer unbewegt in den Schatten der Hafenmauern, umgeben vom brackigen Wasser, auf dem er dümpelte.
Valerie blies den Dampf aus ihrer Kaffeetasse.
»Ich habe dir gesagt, zieh dir warme Sachen an. Und damit meinte ich auch Sachen, die vor Regen schützen. Hier regnet es nicht immer, aber meistens. Aber gut, ihr Typen aus Deauville seid halt die Sonne gewöhnt, den roten Teppich und die breiten Sandstrände. Alles weit weg gerade, oder?«
Roussel sah sie erst mürrisch an, dann lächelte er.
»Ihr Mädchen aus Cherbourg tut immer so hart, aber wenn es nicht nur regnet, sondern auch stürmt, dann verzieht ihr euch nach drinnen.«
Roussel nahm einen Schluck, der Kaffee brannte kurz in seiner Kehle und ließ ihn für ein paar wertvolle Sekunden in dem Glauben, dass die Nacht fast geschafft wäre. Dabei waren die frühen Morgenstunden immer die kältesten, auch jetzt, Anfang April, wo der Winter zwar vorüber war, aber der Frühling seine Zurückhaltung noch längst nicht abgelegt hatte.
Schon gar nicht hier, wo der endlose Atlantik näher war als die Autobahn nach Paris.
»Du hättest jedes Commissariat kriegen können, Valerie«, grummelte er. »Ich habe deine Wahl nie verstanden. Und ich komme aus dem Norden, ich kenne Nebel und Regen. Aber das hier: Das ist …«
»Das ist Cherbourg, und ich liebe es. Wir stellen die besten Regenschirme her, und das sagt doch schon alles.«
Drei Wochen war es her, seit Roussels Team im Hafen von Deauville einen ähnlichen Trawler wie den, der vor ihnen im Hafenbecken lag, festgesetzt hatte. Die Besatzung war mittlerweile wieder auf freiem Fuß, nur der Kapitän saß in Untersuchungshaft.
Und er hatte geredet. Roussel hatte zugehört und schließlich Valerie Colin angerufen. Und nun standen sie hier und warteten.
Es dauerte eine weitere knappe Stunde, bis sich das erste Licht des neuen Tages allmählich über die Stadt legte, hinter dem Fährterminal wurde der Horizont sichtbar, und mit ihm die bittere Aussicht auf eine erfolglose Nacht. Roussel streckte sich, er spürte seine Gliedmaßen wie Fischgräten, die quer in seinem Körper zu stecken schienen.
»Das wird nichts mehr«, sagte er leise zu Valerie. Sie schauten beide über das Hafenbecken, das Funkgerät, das sie auf einem rostigen Tisch unter ihrem Unterstand abgelegt hatten, schwieg seit einer halben Stunde.
Funkstille über Cherbourg.
Mehrere dutzend Augenpaare, die aus unterschiedlichen Positionen den Trawler beobachteten. Und das seit Stunden. Ein mobiles Einsatzkommando, das in einer der Lagerhallen wartete. Dazu vier Scharfschützen auf den Dächern der umliegenden Fabrikgebäude.
Es war das große Besteck, und sie durften es nicht verbocken.
»Schon seltsam«, sagte Roussel zu Valerie. »Wir sind im 21. Jahrhundert. Und doch machen wir das, was vor Jahrhunderten schon unsere Kollegen gemacht haben.«
»Wir sind nur besser ausgestattet, immerhin haben wir Nachtsichtgeräte.«
»Mit denen wir bislang nichts gesehen haben!«
Sie schmunzelte und nahm einen weiteren Schluck Kaffee.
»Aber du hast schon recht. Ich meine: Schmuggel. Das klingt nach Piraten und Rumfässern, die nachts über die Planken gerollt werden.«
Roussel wusste, dass der Schmuggel zwischen Frankreich und England an den Küsten des Cotentin tatsächlich eine jahrhundertealte Tradition hatte – aber bis vor drei Wochen hätte er niemals gedacht, dass er selbst auf Schmugglerjagd gehen würde. Doch die veränderte politische Lage in Großbritannien hatte so einige Irrungen mit sich gebracht, und der Schmuggel zollpflichtiger Waren war eine davon. Immer wieder waren in den vergangenen Monaten kleinere Schiffe festgesetzt worden, die den Kanal überquerten: mit Zigaretten, Waffen und Drogen an Bord. Selbst Antiquitäten oder Medikamente waren keine Seltenheit, zwischen der Südküste Großbritanniens und der Normandie war ein reger Handel entstanden.
Aber erst der festgenommene Kapitän in Deauville hatte sie auf die richtige Spur gebracht. Es gab tatsächlich so etwas wie ein Netzwerk, das seinen Mittelpunkt hier oben auf dem Cotentin zu haben schien. Eine kleine, unscheinbare Einheit, die Spediteure und Zwischenhändler schmierte, die Fischer und Hafenmitarbeiter kontrollierte.
Und in dieser Nacht, die gerade zu Ende ging, wollten sie die wichtigsten Hintermänner festsetzen. Sofern sie denn kamen. Denn bislang lag CH548807 noch immer auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Still wie ein toter Fisch.
Es war kurz vor halb sechs, als das Funkgerät auf dem Tisch knisterte.
»Achtung, Bewegung auf der Zufahrtsstraße.«
Valerie war schneller als Roussel, sie schnappte sich das Funkgerät und antwortete mit knappen Worten.
»Ein Lastwagen?«
»Positiv.«
»Welche Aufschrift?«
»Ein Möbelhaus. Zwei Männer im Steuerhaus.«
»Das sind sie. Es geht los.«
Der Regen hatte etwas nachgelassen, an den Wänden der Lagerhallen, die das Hafenbecken auf der Ostseite umgaben, glitzerte das Wasser im Schein der Straßenlaternen. Roussel spürte sofort, wie das Adrenalin sich in seinem Körper bemerkbar machte, wie die Anspannung stieg und er sofort auf Betriebstemperatur war. Die Kälte der Nacht war augenblicklich vergessen.
Valerie stand jetzt unter Strom, immer wieder sah sie Richtung Zufahrtsstraße, die zum Kai führte, an der der Trawler festgemacht war.
»Fahrzeug nähert sich Position 2.«
»Position 2 übernimmt. Bestätige: Zwei Personen. Ob andere im Laderaum sind, ist nicht zu sehen.«
»Ist eine unserer Zielpersonen im Lastwagen?«
Valerie sprach mit ruhiger Stimme in ihr Funkgerät. Es blieb für einen kurzen Moment ruhig, bis das Gerät knackte.
»Negativ.«
»Scheiße!«
Sie hieb mit der Faust auf den Tisch.
»Warum ist keiner aus dem engen Kreis dabei? Es ist eine wichtige Fuhre!«
»Warten wir erstmal ab«, beruhigte Roussel sie. Immer noch war es dunkel rund um das Hafenbecken, die Lichtflecken der Laternen auf dem Wasser zitterten leicht, als ein Windstoß über das Meer fuhr.
»Der Regen hat aufgehört«, bemerkte Roussel erstaunt.
Er löste den Knopf seines Holsters und straffte sich. Er liebte diesen Augenblick, kurz bevor sich eine Ermittlung ihrem Höhepunkt näherte. Wenn die Anspannung zu greifen war, wenn Polizisten unerbittliche Jäger wurden.
Jäger, deren Beute jetzt auf die Zufahrtsstraße einbog, rumpelnd und in hohem Tempo.
Der Lastwagen war weiß und hatte die rote Aufschrift eines Möbelhauses an der Seite. Es war ein 7,5-Tonner, der genug Platz für mehrere Kisten mit zollpflichtiger Ware bot.
Zigaretten, gefälschte Pässe. Und Waffen.
Das waren die Informationen, die sie hatten.
Der Lastwagen hielt direkt vor dem Trawler.
»Alle warten, kein Zugriff. Ich wiederhole: kein Zugriff. Wir warten, bis sie auf dem Boot sind.«
Valerie schob die Nachtsichtgeräte beiseite, die sie vor sich abgelegt hatte, sie waren jetzt sinnlos. Erste Nebelschwaden zogen durch das Hafenbecken, sie mussten die Augen zusammenkneifen, um alles scharf sehen zu können.
»Einer der Männer steigt aus.«
»Da ist tatsächlich keiner derjenigen dabei, auf die wir warten«, sagte Roussel, als er durch sein Fernglas blickte.
Valerie atmete durch und warf dann ihren Pappbecher in den Dreck. Dann starrte sie wieder auf die andere Seite des Hafenbeckens, wo jetzt auch der zweite Mann aus dem Fahrzeug gestiegen war.
»Auch nicht«, murmelte sie.
Beide Männer sahen sich nervös um. Der Beifahrer zog an einer Zigarette und fuhr sich mehrmals durch die dunklen Haare.
»Hübscher Kerl, gehört aber nicht zur Familie«, kommentierte Roussel unnötigerweise.
»Das sehe ich selbst, verdammte Scheiße.«
»Vielleicht hintendrin.«
»Ja, du mich auch, Roussel.«
Es knisterte in Valeries Funkgerät.
»Der Beifahrer geht um den Lastwagen herum. Wir haben freies Schussfeld.«
»Zweite Person kommt ebenfalls nach hinten.«
Roussel wusste, dass die Scharfschützen auf einem der Nebengebäude lagen, er beneidete sie nicht um ihre exponierte Position angesichts des Dauerregens, der bis eben noch geherrscht hatte.
Aber sie brauchten keine toten Unbekannten, sie brauchten Informationen. Denn auch ohne jemanden aus dem engsten Kreis: Die Aktion durfte nicht schiefgehen.
Aber sie ging schief.
Roussel wusste es in dem Augenblick, in dem der Beifahrer die Ladeklappe des Lastwagens öffnete und Schreie zu hören waren. Schreie, die über das Wasser zu ihnen drangen wie ein verzweifeltes Wehklagen.
»Da sind weitere Personen!«
»Kein Zugriff! Hört ihr, wir warten ab!«
»Es sind Kinder dabei. Ich bestätige, Frauen und Kinder. Eins ist jetzt von der Ladefläche gesprungen. Zielperson eins hält es fest.«
»KEINZUGRIFF!«
Valerie brüllte in ihr Funkgerät, während Roussel versuchte, von seiner Position aus den Überblick zu behalten. Die Schreie wurden lauter, es herrschte Tumult und Chaos an der Heckklappe.
Sie hatten sich nicht getäuscht, die Ware war tatsächlich am Kutter mit der Aufschrift CH548807 angekommen wie vereinbart. Aber es waren keine Waffen, und schon gar keine Zigaretten. Es waren Menschen.
Flüchtlinge, die alles taten, um nach England zu kommen, eine stundenlange Fahrt in einem LKW war da noch das wenigste. Und die illegale Überfahrt auf einem Fischtrawler nur unwesentlich schlimmer.
»Scheiße«, sagte Roussel, »die haben das Boot an Schlepper verkauft.«
Wieder knisterte es in Valeries Funkgerät.
»Es sind schätzungsweise fünfzehn Personen. Mehrere Kinder. Neben den beiden Fahrern offenbar zwei … ich korrigiere, drei Männer, die im Laderaum dabei waren. Insgesamt also fünf Zielpersonen.«
»Wir warten!«
Roussel konnte die Rufe der Menschen hören, die Befehle der Männer, die hektisch in Richtung des Bootes zeigten.
»Waffe! Der Beifahrer hat eine Waffe gezogen!«
»Bleibt ruhig!«, zischte Valerie in ihr Funkgerät.
»Er bedroht einen der Flüchtlinge. Bitte um Freigabe! Wir wissen nicht, ob er …«
»Ich sagte: kein Zugriff!«
Roussel trat aus ihrem Versteck, er stand jetzt direkt an der Kante des Hafenbeckens, mit gezogener Waffe, ohne dass er gewusst hätte, auf wen er sie richten sollte.
Auf der anderen Seite herrschte das völlige Chaos.
»Achtung, unbekannte Person läuft weg! Ich wiederhole: Unbekannte Person läuft weg. Es handelt sich um einen der Flüchtlinge, was sollen wir …«
»Waffe gehoben! Wir müssen sofort handeln!«
Valerie stand jetzt neben Roussel in der feuchten Luft, ihre braunen Haare flatterten im Wind, während sich in ihrem Blickfeld die Arbeit mehrerer Monate in Luft aufzulösen drohte.
»Scheiße, mach keinen Blödsinn!«, murmelte sie.
Sie konnten sehen, wie der junge Mann hektisch herumbrüllte und sich verzweifelt durch die Haare fuhr. Wie er seine Waffe erst senkte und sie dann wieder hob. Wie er den Flüchtenden ins Visier nahm.
»Valerie …«
»Freigabe erteilt«, sagte sie leise in ihr Funkgerät.
»Verstanden. Freigabe erteilt.«
Ein Schuss peitschte durch den frühen Morgen. Der Mann wurde herumgewirbelt, getroffen von einem der Scharfschützen. Er stolperte, fing sich aber wieder und riss seine Waffe erneut hoch.
»Mann, lass die Waffe fallen!«, schrie Valerie hilflos über das Hafenbecken. Aber es war zu spät. In blinder Panik begann der junge Mann um sich zu schießen.
Eine Frau wurde getroffen und fiel zu Boden.
Ein zweiter Schuss aus der Ferne.
Der Schlepper wurde nach hinten geschleudert und sackte auf dem nassen Asphalt zusammen. Um ihn herum panische Schreie.
»Zweite Waffe!«
»Zugriff! Zugriff!«
»Personen ausschalten! Ich wiederhole, Personen ausschalten!«
Durch den Nebel hindurch konnte Roussel die Umrisse der Frauen erkennen, die sich zu Boden warfen, auf ihre Kinder, während die Schlepper ihre Waffen zogen und alles ins Visier nahmen, getrieben von Angst und dumpfer Wut.
Sie hatten einen simplen Auftrag gehabt. Einen Lastwagen mit »Ware« zum Boot zu bringen. Und jetzt brach die Hölle auf Erden los, und keiner der vier Männer kam auf die Idee, die Waffe niederzulegen.
Sie hatten keine Chance.
Drei weitere Männer fielen durch die Kugeln der Scharfschützen. Nur der Fahrer schaffte es zurück in die Kabine, startete den Motor und raste mit dem Lastwagen den Kai entlang. In Richtung Meer.
»Es sind noch Personen drin! Wagen aufhalten!«
Zwei Männer sprangen von der Laderampe des rasenden Fahrzeugs und schlugen hart auf den Asphalt, Schüsse peitschten durch die Luft, die Reifen des LKW wurden von Kugeln durchsiebt. Nach etwa hundert Metern kam der Lastwagen zum Stehen, und der Fahrer hob die Hände.
Dann war alles vorbei, auch wenn noch immer Schreie zu hören waren. Aus den unterschiedlichen Richtungen kamen Beamte gelaufen, mit gezogenen Waffen, sie kreisten die Menschen ein, die sich in den Armen hielten, weinend und zitternd angesichts der Geschehnisse. Das grelle Licht eines Scheinwerfers flammte auf, mehrere Polizeifahrzeuge bogen auf die Zufahrtsstraße ein.
Valerie Colin machte ihr Funkgerät aus und blickte für einen Augenblick stumm auf das Chaos.
»Schöne Scheiße«, sagte sie schließlich und fuhr sich müde übers Gesicht.
Durch den immer dichter werdenden Nebel drang das Zucken der blauen Polizeilichter zu ihnen.
»Einen haben wir. Mal sehen, was wir aus ihm rauskriegen.«
Valerie zuckte mit den Schultern.
»Das ist irgendein Söldner, der vermutlich nicht mal seinen richtigen Auftraggeber kennt. Aber klar, besser als nichts.«
Sie wandten sich vom Hafenbecken und auch vom Fischtrawler mit der Kennung CH548807 ab, dessen Deck in diesem Augenblick von einigen Beamten gesichert wurde. Sie würden nichts finden, bereits zu Beginn der Nacht hatten sie sich vergewissert, dass niemand an Bord des Trawlers war. Die Besatzung war untergetaucht, die Schlepper hätten die Überfahrt selbst in die Hand genommen.
Aber nun würde es keine Überfahrt geben.
Der Einsatz am Hafen von Cherbourg war ein Erfolg, so würden sie ihn jedenfalls den ermittelnden Behörden und der Öffentlichkeit erklären.
Aber jeder kleine Fisch hatte hinter sich noch einen größeren – und der war ihnen heute nicht ins Netz gegangen.
Kapitel 3
Barfleur
Am nächsten Tag
Der alte Mann, der am Rande des Hafenbeckens saß, blinzelte in die flach über dem Wasser stehende Sonne. Er setzte einen ersten Pinselstrich, seine Hand war ruhig, und auf seinem Gesicht lag ein Lächeln, das er sich für genau diesen Augenblick aufgespart hatte. Zufrieden betrachtete er das zarte Blau, das den Grundton seines Kunstwerks bilden würde.
Er hatte vorher noch nie gemalt.
Tatsächlich saß an diesem Morgen in Barfleur kein erfahrener Künstler vor dem funkelnden Wasser, auf dem die Boote im Hafenbecken schaukelten. Es war kein Profi, der im Angesicht der hinter ihm aufgereihten Basalthäuser ein weiteres seiner unzähligen Hafenbilder malte. Es war vielmehr ein blutiger Anfänger, der im hohen Alter beschlossen hatte, dass genau dies eine wunderbare Beschäftigung sein könnte: Am Meer sitzen, die aufgeweckten Silbermöwen am Himmel über sich, eine kleine Staffelei, die Farben, die Pinsel direkt vor sich und dahinter die preisverdächtige Kulisse von Barfleur, jenem glitzernden Juwel des Cotentin.
Die bunten Fischerboote, die an langen Tauen am Kai befestigt waren, trieben auf dem Wasser, die Kirche von Saint-Nicolas wachte über den fernen Horizont, bereit, die Glocken läuten zu lassen, wenn Gefahr drohte. Einige Meter weiter wuchteten zwei Männer Körbe mit frisch gefangenem Kabeljau, mit Seebrassen und sogar einigen Tintenfischen auf die Mole, wo bereits die ersten Köche der umliegenden Restaurants standen und fachsimpelten.
Ein weiterer Pinselstrich, verwegen nahezu, so vieles ließ sich im Internet erlernen, in nächtelanger Recherche, weil der alte Mann nach einem längeren Klinikaufenthalt nichts anderes zu tun gehabt hatte.
Auf der anderen Seite des Hafens rangierte ein Laster, ein Jugendlicher saß auf einer kleinen Mauer in der Sonne, Kopfhörer auf den Ohren. Als er seinen Blick auffing, winkte der alte Mann ihm zu, wobei etwas blaue Farbe auf sein Hemd spritzte.
»Jaja, ich hätte einen Kittel anziehen sollen«, sagte er zu sich selbst und nahm einen Schluck Kaffee aus einer Tasse, die auf einem Schemel neben ihm stand. Er war bestens ausgestattet für seinen Ausflug an die Küste, für sein ganz persönliches Abenteuer, eine Reise ans Ende der Welt.
»Ich setz mich dahin und fange einfach an. Nennt mir einen guten Grund, der dagegenspricht. Und damit eins klar ist: Ein gerade überstandener Herzinfarkt ist genau das Gegenteil – nämlich ein ziemlich gutes Argument dafür!«
Der Geruch von fangfrischem Fisch mischte sich mit dem von warmem Kaffee. Ein weiterer Strich, etwas entschiedener diesmal, dort, wo das Wasser des Hafens dunkler wurde, wo es hinausging ins offene Meer, in die tiefen Gewässer vor der Küste des Cotentin. Aus dem alten Transistorradio zu seinen Füßen erklang eine Melodie, der alte Mann schmunzelte, beugte sich hinunter und drehte die Lautstärke voll auf, so dass das Lied auf der Terrasse des kleinen Cafés hinter ihm gut zu hören war.
»Du bist dran, Bodyguard!«
Nicolas Guerlain saß am kleinen Tisch des »Café du Port«, vertieft in die regionale Tageszeitung, sein Gesicht von der Morgensonne beschienen. Vor ihm lagen die letzten Krümel eines gerade aufgegessenen Croissants, hoffnungsvoll beäugt von zwei Tauben, die vor der Terrasse des Cafés über die Mole stolzierten. Zu seinen Füßen hatte sich Rachmaninoff auf den Holzplanken ausgestreckt, ein brauner, zotteliger Mischlingshund, der nur ab und zu ein Auge öffnete, um den alten Mann am Wasser zu betrachten, der sein Herrchen war und viel mehr als das.
Nicolas blätterte um und sah Richtung Hafenbecken, hinter dem sich Barfleur wie eine kunterbunte Postkarte ausbreitete. Eine Postkarte, von der er jetzt schon wusste, an wen er sie schicken würde.
»Noch einen Kaffee?«, fragte in diesem Augenblick die junge Besitzerin des »Café du Port«, bevor sie ihm einen Espresso mit warmer Milch hinstellte, ohne auf seine Antwort zu warten.
Vielleicht war das Leben genau deswegen so einfach derzeit, dachte sich Nicolas für einen Augenblick. Weil ihm jemand einen Kaffee hinstellte, ohne zu fragen, ob er ihn überhaupt wollte. Und weil wenige Meter neben ihm ein alter Freund erste Pinselstriche machte, ohne sich darum zu scheren, ob er es konnte oder nicht.
Und natürlich, weil jemand mit ihm in eine Wohnung am Meer zog, sie mit ihm einrichtete, Möbel kaufte, eine Zukunft plante, auf die er sich mehr freute als auf alles andere.
»Hey, Bodyguard! Bist du eingeschlafen? Du bist dran!«
Nicolas lächelte die Frau an: »Sie müssen entschuldigen, er ist etwas aufgekratzt. Kein Wunder, er redet seit Wochen von nichts anderem. Und jetzt ist er hier: Als Vincent van Gogh der Normandie. Der neue Claude Monet, nur ohne Seerosen, dafür mit einem alten Hund und einem Radio, das ausschließlich Jacques Brel und Dalida spielt.«
Die junge Frau sah zu Tito, Nicolas’ altem Nachbarn aus der Place Sainte-Marthe in Paris.
»Was gibt es Schöneres?«, sagte sie mit einer angenehm hellen Stimme. »Wenn man sich etwas vorstellt, es unbedingt möchte und es dann tatsächlich in die Tat umsetzt. Ich kann verstehen, dass er sich großartig fühlt, und ich denke, sobald er meine Croissants probiert hat, wird er noch begeisterter sein! Ich bin übrigens Élodie, mit Formalitäten haben wir es in Barfleur nicht so.«
»Freut mich, Élodie. Ich bin Nicolas. Und du hast in jedem Punkt recht. Vor allem mit den Croissants.«
»Ich hol noch welche.«
Er sah ihr hinterher, sie nickte einer Frau und einem Mann zu, die an einem Tisch im Innenraum des Cafés saßen und sich unterhielten. Nicolas konnte sehen, wie die Frau ab und zu hinaus auf die Straße blickte, während sie ihren Tee trank. Sie trug einen grünen, etwas abgetragenen Rock und eine beige Bluse, darüber einen Strickpullover. Nicolas schätzte sie auf Mitte fünfzig, sie erschien ihm unruhig, immer wieder wanderte ihr Blick die Mole am Hafen entlang.
Der Mann war einige Jahre älter, er hatte weißes Haar und einen Dreitagebart. Vor ihm stand eine kleine Espressotasse.
»Sagt einfach Bescheid, wenn ihr noch was braucht, Gabin«, sagte Élodie im Vorbeigehen zu dem Mann, als sie einen Korb mit Croissants nach draußen brachte.
Er nickte ihr freundlich zu, schien aber mit den Gedanken woanders zu sein. Nicolas konnte sehen, wie er immer wieder den Kopf schüttelte, während die Frau auf ihn einredete. Er trug den typischen dunkelblauen Wollpullover der Fischer, seine Hände waren groß und rissig.
»Hör auf mit dem ständigen Beobachten«, murmelte Nicolas sich selbst zu. Es war eine Berufskrankheit, die ihn seit vielen Jahren begleitete, das ständige Beobachten, das Sehen und Einordnen, das Abwägen und Einschätzen einer Situation.
»Das ist wirklich ein wunderschöner Ort für ein Café, Élodie«, sagte er, als die junge Cafébesitzerin zu ihm nach draußen kam. »Ein kunterbuntes Bilderbuch. Es könnte sein, dass ich von jetzt an öfter hier sitze.«
Am Hafenbecken vor ihnen zog Tito, der Nicolas hierher ans normannische Ende der Welt geschleppt hatte, grummelnd sein Handy aus der Jackentasche und tippte mühsam eine Nummer in das Display.
»Du bist jederzeit willkommen«, antwortete Élodie. »Die Saison hat noch gar nicht richtig begonnen. Jetzt im April ist es noch ruhig hier.«
Sie zog sich einen Stuhl heran und setzte sich kurz neben ihn. Nicolas nippte an seinem Café, brach sich ein Stück Croissant ab und blickte über das Wasser, während Élodie den Kopf in den Nacken legte und die Sonne genoss. Er schätzte sie auf Ende zwanzig, aber ihre Augen waren müde, sie war blass.
»Ist Barfleur ein gutes Pflaster?«, fragte er. »Ich meine für ein Café, lohnt es sich? Ich vermute, du kannst nicht oft in der Sonne sitzen.«
Sie drehte sich zu ihm um und lauschte für einen Augenblick der Melodie aus Titos Transistorradio.
»Keine Ahnung, ich werde es wohl herausfinden müssen. Ich habe dieses Café erst vor einigen Wochen übernommen, es wird meine erste richtige Saison. Ich habe mich in den Ort verliebt, als ich mit meinem Freund hier Urlaub gemacht habe. Der Freund ist Vergangenheit, das Café die Zukunft, strahlend schön und zugleich der Grund für einen hübschen Schuldenberg bei der Bank. Also iss ordentlich Croissants, Nicolas, damit ich nicht wieder zurückmuss in die Vogesen, denn da ist es sogar im Sommer nass und kalt.«
»Zu Befehl«, sagte Nicolas und tunkte sein Gebäck in seinen Café Noisette. Er würde später am Strand Laufen gehen, um die Folgen seines ausgiebigen Frühstücks zu bekämpfen.
Der Fischer am anderen Tisch hatte sich von der Frau verabschiedet, er schob sich eine Wollmütze auf den Kopf und nickte Élodie zu, als er ging.
»Julie!«
Tito hielt das Handy dicht ans Ohr gepresst, seine knarzende Stimme drang zu ihnen herüber, und sofort hob Rachmaninoff den Kopf. Der Hund war vernarrt in Julie, in den ersten Wochen nach ihrer Rückkehr waren sie und Nicolas mit Rachmaninoff Stunde um Stunde durch die Pariser Parks gelaufen, an der Seine entlang und die Treppen rund um Montmartre hinauf. Mit jedem Schritt hatten Julie und er sich mehr gefunden, hatten die Nähe genossen und die Distanz vergessen, die so viele Jahre und so viele Erlebnisse zwischen sie geschoben hatten.
»Hör zu, Julie, dein Bodyguard ist gerade beschäftigt, er flirtet mit der Cafébesitzerin, sie ist ein hübsches Ding, das muss ich schon sagen. Jedenfalls: Er nimmt das Spiel nicht ernst, du solltest ihn zum Teufel jagen! Nein, nicht wegen der Kellnerin, wegen der Musik! Wer keine Zeit für Musik hat, hat auch keine Zeit für die Liebe, verstehst du das? Und jetzt hör zu …«
Tito drehte an seinem Transistorradio die Musik etwas lauter und hielt sein Handy an den Lautsprecher. Nicolas hatte das Lied längst erkannt, und er wusste, dass auch Julie kein Problem damit haben würde.
»Ein Strich für dich«, murmelte er und sah sie vor sich, die Farbrolle in ihrer Hand, die Fußleisten abgeklebt. Julie packte ihre gemeinsame Zukunft an, mit festem Griff und der tiefsitzenden Entschlossenheit, der Vergangenheit keine Rolle mehr in ihrem Leben zu gewähren.
»Das ist einfach«, sagte Élodie neben ihm, »Alain Souchon. ›Rive Gauche‹.«
Nicolas lächelte.
»Nicht schlecht. Du könntest bei ihm einsteigen. Seit Jahren schon macht er sein persönliches Musikquiz, keine Minute ohne seine Chansons. Ich nehme an, ich habe schon dutzende Male gegen ihn verloren. Wobei er schwächer wird.«
»Wir werden alle schwächer mit dem Alter«, sagte sie und nickte dem Fischer zu, der jetzt aufgestanden war und ein letztes Wort mit der Frau im grünen Rock wechselte.
Ein Wagen fuhr langsam an der Mole vorbei, zwei Männer saßen darin, die zu ihnen herüberblickten.
»Und wen ruft er an, eine weitere Mitspielerin?«, fragte Élodie.
»Julie. Meine … Lebensgefährtin.«
Nicolas spürte sein Unbehagen, bevor er das Wort ausgesprochen hatte. Es blieb sperrig und klebrig, es hinterließ einen schalen Beigeschmack.
Lebensgefährtin. Freundin. Große Liebe.
Sie war Julie. Und er war Nicolas. Und damit war alles gesagt.
»Natürlich ist das Souchon!«, hörte er Titos Stimme. »Aber nicht mal das kriegt er hin, dein Bodyguard. Natürlich nenne ich ihn so, wie soll ich ihn sonst nennen? Banause? Ja, ich sag ihm, dass du gerade an ihn denkst, mein Gott, was für eine Zeitverschwendung!«
Der alte Mann stopfte sein Handy zurück in die Tasche und griff zu seinem Pinsel. Rachmaninoff hatte mittlerweile seinen angestammten Platz zu seinen Füßen wieder eingenommen.
Der Wagen war weitergefahren, der Fischer, den Élodie Gabin genannte hatte, legte einige Münzen auf den Tisch und verließ das Café. Durch den Hintereingang, wie Nicolas unbewusst bemerkte. Auch die ältere Frau war jetzt aufgestanden und blickte zu ihnen hinaus.
»Junge Leute«, grummelte Tito, »keine Ahnung von Musik, aber ans Meer ziehen wollen, was ergibt das für einen Sinn?«
»Und du bist tatsächlich Bodyguard?«, fragte Élodie. »So wie Kevin Kostner?«
Nicolas stellte seine Tasse ab.
»Ich war einer. Also nicht Kevin Kostner. Aber Personenschützer, ja.«
»Ist das nicht das Gleiche wie Bodyguard?«
Nicolas hatte diese Frage schon so oft gestellt bekommen.
»Ich beschütze den Menschen, nicht den Körper. Die Person.«
»Verstehe. Und diese Personen, das waren Prominente?«
»Auch. Aber eher Politiker, langweilige alte Männer in dunklen Anzügen, die auf Veranstaltungen zu lange Reden halten und danach noch länger Smalltalk machen, bevor es endlich nach Hause geht. Glaub mir, da ist wenig Aufregendes dran.«
»Ich finde, das klingt ziemlich aufregend!«, sagte Élodie, während sie aufstand und sich eine Haarsträhne hinters Ohr strich.
Nicolas musste kurz an Julie denken.
»Hast du schon mal … ich meine, das wirst du bestimmt oft gefragt … hast du …«
»Schon mal mein Leben riskiert? Nein, nicht wirklich.«
Nicolas war selbst überrascht, wie schnell und einfach ihm diese Lüge über die Lippen gekommen war. Aber diese Antwort war die einzig richtige, auch wenn die Wahrheit eine völlig andere war. Für einen sehr kurzen Augenblick rauschten einige Bilder der vergangenen Jahre durch seinen Kopf: Der Leuchtturm und der Kampf um das Leben von Noemie. Chausey, die Nacht im Wasser, in der er dem Tod mehr als nur nah gewesen war. Vieux-Port, das Dorf am Fluss der Ängste, wie die Presse es getauft hatte. Die Landungsstrände in der Normandie, Julie und er in einem alten Bunker, der Staatspräsident in Fesseln, die Waffe eines Wahnsinnigen auf ihn gerichtet.
Zu knapp, all das.
Und irgendwann würde das Pendel zur anderen Seite ausschlagen. Das Glück würde weiterziehen und ihn zurücklassen. Ihn und Julie.
Und genau deswegen saß er hier, in der frühen Morgensonne am Hafen von Barfleur. Um das Glück zum Bleiben zu überreden.
Während Élodie hinter ihren Tresen ging, verließ die Frau in dem grünen Rock das Café über die Terrasse. In einiger Entfernung wendete der Wagen, der eben vorbeigefahren war, und bog in eine Seitenstraße ab.
Im Innern des Cafés erklang das Klappern von Tellern.
»Vielen Dank, Luca, stell es einfach hier ab. Und das hier kann in die Küche.«
Ein junger Mann war aus einer Schwingtür neben dem Tresen gekommen, mit einem Stapel Teller in der Hand. Nicolas schätzte ihn auf Anfang zwanzig, er war schmächtig und nicht sonderlich groß. Seine feinen Gesichtszüge verschwanden fast unter der Baseballkappe, die er trug. Er rief Élodie etwas zu und deutete in Nicolas’ Richtung. Die junge Frau warf ihm einen Lappen hinterher, als er wieder in der Küche verschwand.
Kurz darauf kam Élodie wieder nach draußen und wischte die Tische ab.
»Ohne Luca würde hier nichts gehen, ich bin froh, dass ich ihn habe. Er stand vor zwei Wochen plötzlich vor der Tür, auf der Suche nach einem Job. Ich liebe ihn jetzt schon, auch wenn er nicht viel spricht.«
»Manchmal hat man vielleicht einfach nichts zu sagen«, antwortete Nicolas und leerte seine Kaffeetasse.
»Und der Maler dort drüben, der ist jetzt deine Schutzperson?«, fragte Élodie.
»Gewissermaßen«, antwortete Nicolas. »Eigentlich hat er mich gezwungen, nach Barfleur zu kommen, aber wenn ich ehrlich bin, war das eine gute Idee. Ich darf es ihm nur nicht sagen, sonst muss ich womöglich noch als Modell herhalten.«
»Wenn es ein Akt wird, sag mir vorher Bescheid«, sagte sie und lachte, während sie seine Tasse wegräumte. Nicolas musste angesichts dieser offenkundigen Botschaft schmunzeln.
»Jedenfalls: Willkommen in Barfleur«, sagte Élodie jetzt in ernsterem Ton. »Die Kirche dort drüben heißt übrigens wie du: Saint-Nicolas. Du passt also ganz gut hierher.«
»Da bin ich mir sicher.«
»Und das Lied, das jetzt gerade im Radio kommt, ist übrigens von Nicolas Peyrac, den habe ich schon immer gemocht.«
»Verdammt, du bist wirklich gut. He, Tito!«
»Stör mich nicht, Bodyguard! Ich bin Künstler, ich brauche Ruhe!«
»Hier ist eine neue Mitspielerin, sie heißt Élodie, und sie hat schon zwei Striche.«
Nicolas schaute über das Hafenbecken hinaus aufs Meer, wo in der Ferne einige Segel zu erkennen waren. Die Flut schwappte gegen die Mole, ein schmales Sportboot tuckerte langsam in die Hafeneinfahrt und suchte sich seinen Liegeplatz. Zahlreiche Boote trieben in der Mitte des Beckens, an langen Tauen mit dem Ufer verbunden. Gestern Abend, bei einem Spaziergang durch die Dunkelheit, hatte Nicolas gesehen, wie sie bei Ebbe auf dem schlickigen Boden gelegen hatten, wie weiße Schildkrötenpanzer, die auf das Wasser warteten. Die Fischkutter, von denen es in Barfleur noch eine Handvoll gab, waren hingegen direkt an der Mole festgemacht, auf den Decks schrubbten Seeleute jetzt den Dreck weg, stapelten Kisten und überprüften die großen Heckspulen, mit denen draußen auf dem Meer die schweren Schleppnetze eingeholt wurden.
Nicolas überlegte, was er mit seinem freien Tag anfangen sollte, denn ganz offensichtlich brauchte Tito ihn doch nicht so dringend, wie er ihm vor einigen Wochen weisgemacht hatte.
»Ich bin ein alter Mann, Nicolas. Ich brauche Hilfe mit der Staffelei, mit dem ganzen Zeug. Und Julie braucht mal ein paar Tage für sich, immerhin habt ihr demnächst ja genug Zeit zusammen. Was für eine bescheuerte Idee, ans Meer ziehen zu wollen. Aber gut, in Barfleur kannst du schon mal sehen, wie es sich anfühlt, dieses Meer. Stinkt alles nach Möwenscheiße, das sag ich dir.«
»Ich komme aus der Normandie, Tito. Ich kenne das Meer.«
»Du kennst gar nichts, Bodyguard.«
Also hatte er ihn begleitet, hierher, an die Küste des Cotentin, wo die Winde rasten und das Licht sich wie nirgendwo sonst auf die Buchten legte, auf die Klippen und auf die unzähligen kleinen Häfen rund um Cherbourg.
»So was Blödes«, hörte er plötzlich Élodies Stimme, »sie hat ihre Jacke vergessen.«
Nicolas drehte sich zu der Cafébesitzerin um, die gerade dabei war, den Tisch abzuwischen, an dem die Frau eben noch gesessen hatte. In der Hand hielt sie eine graue Regenjacke. Titos Lamentieren hatte ihn derart abgelenkt, dass er gar nicht mitbekommen hatte, in welche Richtung sie verschwunden war.
»Die hing über dem Stuhl«, murmelte Élodie und hielt die Jacke in ihren Händen »Es ist nicht sehr warm, sie wird sie brauchen.«
Nicolas stand auf und ging zu der jungen Frau hinüber: »Kennst du die Frau, kommt sie öfter hierher?«
Gedankenverloren schüttelte Élodie den Kopf.
»Sie war zum ersten Mal hier. Gabin, der kommt ab und zu hierher, um einen Kaffee zu trinken, aber sie habe ich vorher noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, das ist meine erste Saison.«
Nicolas sah den Quai Henri Chardon hinunter, der zwischen den Steinhäusern von Barfleur und der Mole am Hafenbecken in Richtung der Kirche führte. Er konnte eine Handvoll Menschen erkennen, die am Wasser entlangschlenderten und Fotos machten, Sonnenstrahlen funkelten auf dem Wasser zwischen den kleinen Motorbooten. Rechts von ihnen machte das Becken einen Knick, die Straße bog in Richtung Hinterland ab und verschwand zwischen dem Zeitungsladen und einer Crêperie, deren Läden zu dieser Stunde noch geschlossen waren, aus seinem Blickfeld.
»Eigentlich kann sie nicht weit sein«, sagte er zu Élodie. »Ich schau mal, ob ich sie finde.«
Nicolas schnappte sich die Jacke, sprang mit einem Satz über die kleine Holzbalustrade, die die Terrasse des »Café du Port« von der Mole trennte. Er versuchte, sich an den Augenblick zu erinnern, in dem die Frau kurz zuvor das Café verlassen hatte, während er sich umsah. Mit schnellen Schritten ging er am Becken entlang, sein Blick glitt über die grauen Granithäuser, die kleinen Geschäfte und das angrenzende Restaurant, aus dessen Küche es bereits jetzt nach frischem Hummer und Weißwein roch. Einige frühe Touristen schlenderten am Wasser entlang und blickten voller Vorfreude auf die ausgestellten Speisekarten der Restaurants.
»Was ist denn jetzt schon wieder?«, rief ihm Tito hinterher. »Mein Gott, er rennt schon wieder rum wie so ein Irrwisch, man könnte meinen, er kann gar nicht mehr langsam gehen. Nicolas!«
Zwischen zwei Häusern führte ein kleiner Durchgang tiefer in die Stadt hinein, fort vom Hafen, von den Kuttern.
Er hätte den schmalen Spalt fast übersehen, wenn sich am anderen Ende nicht die schmale Silhouette der Frau abgezeichnet hätte.
»Hey, warten Sie! Madame!«
Sie ging sehr zügig, ein Wunder, dass er sie noch entdeckt hatte. Als sie sich kurz zu ihm umdrehte, konnte er ihren müden und gehetzten Blick sehen, die Handtasche an ihren Körper gepresst. Als sie ihm etwas zurief, war ihre Stimme so brüchig, dass er sie kaum verstehen konnte.
»Nicht … bleiben Sie dort.«
Nicolas betrat den Durchgang und wurde sofort von kühlerer Luft umschlossen. Seine Augen brauchten einen Augenblick, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen.
Die Frau mit den kurzen grauen Haaren war keine dreißig Meter entfernt, sie blickte ihn vom anderen Ende der Passage aus an. Hinter ihr war das Licht wieder heller, die Sonne strahlte warm auf den Asphalt.
»Bitte …«, sagte sie und machte eine Bewegung auf ihn zu. »Bitte nicht.«
Nicolas verlangsamte seinen Schritt und hob die Hände.
»Ich wollte nur … Sie haben Ihre Jacke vergessen. Die möchten Sie bestimmt wiederhaben.«
»Bleiben Sie stehen!«
Die Frau drückte ihre Handtasche nun noch fester an sich. Immer wieder schaute sie hinter sich in die Sonne, als wartete sie auf etwas.
»In Ordnung, ich bleibe stehen. Aber ich möchte Ihnen wirklich nur Ihre Jacke zurückgeben. Sie haben sie im Café liegenlassen.«
Nicolas hielt die Jacke hoch.
»Vielleicht wollen wir uns wieder auf die Terrasse setzen, auf einen Tee. Was halten Sie davon?«
Sie schüttelte mit dem Kopf, die Lippen jetzt fest aufeinandergepresst.
»Brauchen Sie Hilfe? Bitte … Sie müssen nur nicken. Vielleicht kann ich …«
»Nein!«
Mit einer plötzlichen explodierenden Wut schrie die Frau ihn an, er solle nicht näher kommen. Ihre Fingerkuppen waren weiß, weil sie mit solcher Kraft ihre Tasche an sich drückte.
Das Geräusch eines heranrasenden Wagens am Ende der Passage ließ Nicolas aufhorchen.
Sie machte einen Schritt nach vorn, auf ihn zu. Ihr starrer Blick, ihre Körperhaltung, das Zittern ihres linken Arms – sie wirkte völlig verstört.
Schließlich legte sie den linken Zeigefinger auf ihre Lippen, schloss für einen Moment die Augen, als würde sie Kraft sammeln, für all das, was nun folgen würde und als würde sie Nicolas zeigen wollen, dass es nichts Gutes war. Und auch nie mehr gut werden würde.
Der Wagen, den Nicolas vor wenigen Minuten noch am Hafen gesehen hatte, hielt mit quietschenden Reifen hinter ihr. Es war ein alter Mercedes, die Beifahrertür wurde aufgerissen, und ein junger kräftiger Mann in Jeansjacke packte die Frau und beförderte sie ohne Rücksicht in den Fond des Wagens. Nicolas war losgerannt, er sprintete durch die Schatten des schmalen Ganges.
Aber er kam zu spät.
Der Mann in der Jeansjacke sprang zurück in den Wagen und schlug zweimal auf das Armaturenbrett. Der Motor heulte auf, und der Mercedes jagte davon, die Rue Saint-Nicolas entlang.
Nur drei Sekunden später schoss Nicolas im vollen Lauf aus der Passage auf die Straße, wo die Sonne ihn sofort blendete – und er gerade noch rechtzeitig den Laster bemerkte, der aus der anderen Richtung die Rue Saint-Nicolas entlangfuhr, zu schnell und ohne Rücksicht auf Menschen, die aus kleinsten Gassen herausgestürmt kommen könnten. Wild hupend und mit schlingernden Reifen brauste der LKW im letzten Augenblick und um Haaresbreite an ihm vorbei.
Nicolas stand für einen Augenblick schwer atmend mitten auf der Straße und blickte dem alten Mercedes hinterher. Der Wagen, der die Frau mitgenommen hatte, bog scharf links ab und verschwand kurz darauf aus seinem Sichtfeld.
»Was bitte war das denn gerade?«, murmelte er und bemerkte, dass er immer noch die Jacke in der Hand hielt, dessen Besitzerin auf sehr merkwürdige Weise verschwunden war. Als er sich schließlich umdrehte, um zurück zu Tito zu gehen, nahm er am anderen Ende des Durchgangs, wo er selbst eben noch gestanden hatte, einen Schatten wahr.
Nicolas blinzelte gegen die Sonne und hob die Hände vor die Augen.
Es war der Umriss eines Mannes, er war nicht sonderlich breit, die Schultern hingen etwas herab. Er stand dort und beobachtete ihn. Womöglich hatte er es die ganze Zeit schon getan. Nicolas machte einen Schritt nach vorn und trat erneut in den kühlen Schatten der schmalen Gasse. Aber bevor sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, war der Mann am anderen Ende verschwunden.
Als er kurz darauf wieder die Mole und das Hafenbecken erreichte, kreisten die Möwen um die Fischerboote, und der kleine weiße Leuchtturm auf der anderen Seite strahlte wie ein heller Docht vor den grünen Hügeln des Umlandes. Barfleur funkelte, die bunten Schiffsrümpfe schaukelten gelassen auf dem Wasser, als hätten sie sich für Titos erste Versuche absichtlich in Szene gesetzt. Und nichts deutete darauf hin, dass dieser Ort etwas anderes als friedvoll sein könnte.
»Und, wen hast du diesmal gerettet, Bodyguard?«, klang die Stimme seines alten Nachbarn zu ihm herüber.
»Niemanden, Tito. Niemanden.« Nicolas sah nachdenklich ein letztes Mal in Richtung der kleinen Gasse, die jetzt in den Schatten der Häuser lag.
Élodie stand auf der Terrasse ihres Cafés und begrüßte Fahrradfahrer, die ihre Satteltaschen in einer Ecke abstellten und sich erschöpft auf zwei Stühle warfen. Sie zuckte mit den Schultern, als sie Nicolas den Kopf schütteln sah. Sicher würde die Frau sehr bald zurückkommen und ihre Jacke holen. Und der Zwischenfall würde für ihn schnell zu einer unbedeutenden Erinnerung verblassen.
Und doch hatte Nicolas das Gefühl, dass die Wellen im Hafenbecken höher geworden waren, dass ein Wind aufkam, vom Meer her, der die kleinen Boote schaukeln ließ und die Taue strammzog.
Als würde etwas Dunkles an dieser Stadt zerren, fest und unnachgiebig.
Kapitel 4
Hätte Nicolas geahnt, welche Rolle der Lastwagen noch spielen würde, der ihn soeben fast überfahren hätte, er wäre sofort umgedreht. So schnell ihn seine Beine trügen, wäre er gerannt, und seine Rufe wären zwischen den jetzt schon sonnengewärmten Granitmauern in der Rue Saint-Nicolas zu hören gewesen, die seinen Namen trug, und das womöglich nicht ohne Grund. Weil er bereits in diesem Moment etwas hätte aufhalten können, das schon in kurzer Zeit unaufhaltsam werden würde.
Vermutlich hätte er die ganze Welt in Bewegung gesetzt, nur um den 7,5-Tonner noch zu erreichen, um den Fahrer aufzuhalten, und sei es nur für eine Sekunde. Weil eine Sekunde so viel ausmachen konnte.
Aber wie hätte er ahnen sollen, dass dieser winzige Augenblick alles hätte verhindern können? Wer hätte es ihm sagen sollen, welche Stimme hätte sich flüsternd aus den Schatten erheben können, wer ihn warnen?
Da war nur der Wind, der vom Hafenbecken in den schmalen Durchgang blies, der Geruch von fangfrischem Fisch und das Motorengeräusch eines zurückkehrenden Kutters. Tito, der eine neue Farbe anmischte, den Hund zu seinen Füßen. Élodie, die ihn nur kurz verwundert ansah, während sie einem Touristenpaar zwei Stühle in die Sonne rückte.
Keine Wolke schob sich vor das milde Licht, seine eigene Vorahnung wurde erstickt vom Bilderbuchanblick des Hafens, von den schlanken Rümpfen der Sportboote auf dem glitzernden Wasser, das aussah, als bestünde es aus Myriaden feinster Kristalle.
Barfleur funkelte, und jeder fiel darauf herein.
Auch Nicolas, der sich erinnern würde an diesen Moment, eines fernen Tages. Und der jetzt kurz durchatmete, sich umsah und dann zurück zu seinem Tisch auf der Terrasse des »Café du Port« ging – während nur zweihundert Meter entfernt der weiße Lastwagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Quai Henri Chardon einbog. Der Fahrer riss sein Lenkrad mit einer Hand herum, um rechts in die Rue Saint-Thomas Becket zu kommen und von dort auf die D902, raus aus der Stadt.
So schnell er konnte. Weil er es eilig hatte und weil die Stimme an seinem Ohr schrill und zornig war.
»Es ist mir eben nicht völlig egal, Roman! Es ist mir verdammt nochmal nicht egal, wenn du nebenher noch Geschäfte machst! Ich sitze hier mit deinem Sohn, kapierst du das?«
Er kapierte es nicht nur, er hörte es auch. Sechs Wochen war der Kleine erst alt, er schrie wie am Spieß, gefühlt die ganze Nacht und den ganzen Tag. Aber Fakt war eben auch: Als Roman gehört hatte, dass sein Kumpel einen Laster zu verkaufen hatte, da hatte er zugegriffen.
»Melanie, jetzt hör mir doch mal zu, es ist wirklich nur ein kleiner Umweg, und …«
»Du hast mir versprochen, dass das aufhört, Roman! Versprochen!«
Roman wischte sich den Schweiß aus den Augen, es war stickig in der Fahrerkabine, die Klimaanlage war defekt, zudem klemmte die Fahrertür. Von alldem hatte er beim Kauf nichts bemerkt, aber es war egal. Er hatte sich selbstständig gemacht, er hatte seinen eigenen Laster. Ein 7,5-Tonner, der nur ihm gehörte und mit dem er Aufträge von Speditionen und Handelsketten annehmen konnte. Um Geld zu verdienen, für Melanie und für den Kleinen.
»Ich bin fast schon in Cherbourg«, log er, während er noch mehr Gas gab und ein Sportplatz links an ihm vorbeiflog. »Die werden überhaupt nicht merken, dass ich noch einen kleinen Umweg an die Küste mache. Und wir brauchen das Geld, also beruhig dich jetzt. Siehst du, der Kleine ist auch ruhig, es wird alles gut, Melanie. Ich schaffe das.«
Er hörte sie in ein Taschentuch schniefen und sah sie vor sich, im abgedunkelten Kinderzimmer, den Kleinen auf dem Arm, draußen die Rufe der Nachbarskinder in den betonierten Innenhöfen am Rande von Caen.
Als die Straße wieder gerade wurde, angelte er mit der freien Hand nach einer Dose und nahm einen kräftigen Schluck eines Energydrinks. Im Rückspiegel wurden die Häuser von Barfleur immer kleiner, während sich vor ihm die weiten Äcker des Hinterlandes ausbreiteten.
»Pass auf dich auf, ja?«, sagte Melanie leise, bevor er auflegte. Roman öffnete quietschend das Seitenfenster und beförderte einen Zigarettenstummel nach draußen. Die Luft war kühl, in der Ferne entdeckte er zwei Störche, die sich von den Feldern erhoben, mit majestätischem Flügelschlag.
Während er Tocqueville durchquerte und kurz darauf Saint-Pierre-Église, sah er vor seinem inneren Auge immer noch den Mann, der ohne jede Vorwarnung aus der Seitengasse in Barfleur gekommen und den er fast überfahren hatte. In letzter Sekunde hatte er doch noch das Steuer herumgerissen und wie durch ein Wunder war nichts passiert.
»Das hätte mir gerade noch gefehlt«, murmelte Roman und nahm einen weiteren Schluck aus seiner Dose. Sein Handy auf dem Beifahrersitz klingelte, er sah erneut Melanies Namen auf dem Display und stöhnte.
»Mein Gott, was will sie denn schon wieder? Ich kann es doch auch nicht ändern … Melanie? Hör zu, ich fahre, ich habe noch keine Freisprecheinrichtung.«
»Entschuldige … ich wollte nur … es lässt mir keine Ruhe.«
»Was lässt dir keine Ruhe?« Roman steuerte seinen Lastwagen an einem Mopedfahrer vorbei, er war viel zu schnell und der Abstand zu gering. Im Rückspiegel sah er den Mann wütend gestikulieren.
»Die Ladung.«
»Was ist mit der Ladung?«
»Weißt du, was es ist. Ich meine, die Kisten, die sie dir geben …«