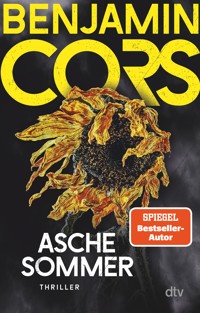9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gruppe 4 ermittelt
- Sprache: Deutsch
Er spielt die Rolle deines Lebens Zwei ehrgeizige Ermittler, ein hochintelligenter Serienkiller – ein unerbittlicher Wettkampf gegen die Zeit. Bereits am ersten Arbeitstag steht das Ermittlerduo Jakob Krogh und Mila Weiss vor einem Rätsel. Am Rande einer Ermittlung stoßen sie auf die Leiche einer älteren Frau, die nachweislich nach ihrem Tod noch lebend gesehen wurde. Wie ist das möglich? Kurz darauf wird ein junger Student in seiner Wohnung gefunden, auch er war nach seinem Tod offenbar noch an der Uni. Aber damit nicht genug: An beiden Tatorten werden Krähen gefunden, ausgehungert und versehen mit einer unheilvollen Botschaft. Jakob und Mila jagen mit dem Team der neuen Gruppe 4 einen Geist, der jeder sein könnte: der Nachbar, der Kollege, der eigene Freund … und jemanden, der noch lange nicht bereit ist, die Zeit der Krähen zu beenden. Benjamin Cors begibt sich auf neues Terrain: Härter, blutiger, spannender – ein atemberaubender Thriller des Bestseller-Autors
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Jakob Krogh und Mila Weiss stehen vor einem Rätsel: Wie kann es sein, dass ein Mordopfer nach dem Tod noch lebend gesehen wird? Die Zeichen mehren sich, dass die beiden mit ihrem Team der Gruppe 4 – einer Einheit zur Aufklärung von Serienstraftaten – es mit einem skrupellosen und hoch intelligenten Killer zu tun haben. Und er scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Als eine weitere schrecklich zugerichtete Leiche gefunden wird, ist beiden klar, dass der Täter noch längst nicht genug hat. Die Zeit der Krähen hat erst begonnen.
Benjamin Cors
Krähentage
Gruppe 4 ermitteltBand 1
Thriller
»Die Krähen schrei’n
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt.
Bald wird es schnei’n –
Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!«
Friedrich Nietzsche
TEIL I
GEBURT
Die Schritte der alten Frau schleiften über den Asphalt. Ihre abgewetzten Schuhe schoben sich durch den Dreck, vorbei an Pfützen, in denen sich die Fassaden der Wohnblöcke spiegelten. Über ihr das Grau des Himmels, aschfahl und leergeweint. Tagelang hatte es auf die Stadt niedergeregnet. Zwischen Schnee und Regen wurde alles zu Schmutz, hier am Rande der Stadt. Wo die Häuser höher waren als die Träume der Menschen.
Den Blick auf den Gehweg gerichtet, schlich sie durch die Kälte, ihr Atem ging leise. Sie durfte nicht stolpern, nicht fallen. Ihr Körper wäre zu schwach, sie würde nicht mehr aufstehen, nicht in diesem Leben. Ihr Mantel war dünn, sie zog die Schultern ein, den grauen Schal fest um sich gewickelt. Der Wind pfiff zwischen den Betonburgen, wo die Kälte sich eingenistet hatte, seit November schon.
Die Frau lief weiter, das rechte Bein leicht nachziehend. Ihr stumpfes graues Haar steckte bis auf wenige Strähnen unter einer Wollmütze. Ihren Einkaufstrolley zerrte sie hinter sich her wie ein erlegtes Tier. An der Endstation der Straßenbahn warteten die ersten Schichtarbeiter.
Und niemand beachtete die alte Frau.
Bald wieder war das rostige Quietschen ihres Trolleys das einzige Geräusch weit und breit. Sie wanderte weiter durch die tote Landschaft, vorbei an einem Sonnenstudio, einem Hundesalon.
Sie schnaufte, als sie die Straße überquerte. Weiter vorne flackerte Licht in einem Hauseingang, ein vergessener Einkaufswagen stand auf einem Parkplatz. Sie blieb stehen, blickte in das schmutzige Antlitz dieses neuen Tages. Atmete ein, spürte die kalte Luft in den Lungen. Sie schloss die Augen, lächelte.
Gestern hatte sie Geburtstag gehabt.
»Guten Morgen, Frau Nowak!«
Sie war vor dem Gebäude mit der Nummer 87 angekommen, ein gesichtsloser Block, der sich über ihr erhob wie eine dunkle Bedrohung. Zwölf Stockwerke, sie wohnte im zweiten, wo die Sonne selten hinkam. Aus den Briefkästen quollen Werbebroschüren, neben der Tür lagen Zigarettenstummel auf dem Boden. Eine junge Frau hielt ihr die Tür auf, sie lächelte, in der Hand hielt sie eine offene Thermoskanne. Der Dampf verlor sich schnell in der Luft.
»Sie sind aber früh unterwegs, Frau Nowak. Soll ich Ihren Trolley hochbringen?«
Die alte Frau hustete in ihren Schal, wandte sich ab, entschuldigend hob sie die Hand.
»Es geht schon … danke.«
»Sind Sie sicher? Sie sollten sich bei dem Wetter etwas Wärmeres anziehen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen später einen Wintermantel vorbeibringen. Ich habe noch einen von meiner Mutter, die braucht ihn ja jetzt nicht mehr.«
Die junge Frau hatte eine orangefarbene Winterjacke an, die braunen Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie trug Ohrenwärmer und Fingerhandschuhe und pustete in die Thermoskanne, um etwas von der warmen Luft abzubekommen. Frisch und aufgeräumt plapperte sie sich in diesen Tag hinein.
Und die alte Frau dachte sich, dass nicht alles so grau war wie die Wohnblöcke um sie herum.
»Vielen Dank, wirklich«, sagte sie mit dünner Stimme. »Aber ich komme zurecht. Sie müssen bestimmt los.« Ihr letzter Satz ging in einem neuerlichen Husten unter.
»Also gut, Frau Nowak. Aber ich komme die Tage mal vorbei, in Ordnung? Ich bring auch Kuchen mit.«
»Das ist sehr nett«, murmelte die alte Frau und schlüpfte durch die Tür. Als sie drinnen auf den Aufzugknopf drückte, blickte die junge Frau auf ihre Uhr und winkte zum Abschied: »Auf Wiedersehen, Frau Nowak.«
Kurz darauf schlossen sich die Fahrstuhltüren. Die Innenseiten waren übersät mit Botschaften, mit Edding auf das Metall gekritzelt oder mit etwas Scharfem hineingekratzt. Obszöne Grüße, eindeutige Aufforderungen … Sie schloss die Augen, atmete die stickige Luft der Kabine ein und lockerte den Schal. Es ruckelte kurz. Im Spiegel war eine alte Frau zu sehen. Sie hatte etwas Rouge aufgelegt, dazu Lippenstift, um den Hals trug sie ihre Lieblingskette, weiße Perlen mit einem goldenen Verschluss.
Im zweiten Stock war das Licht im Gang defekt, bereits seit einer Woche, sie schlurfte vorbei an den Türen, hinter denen andere Menschen wohnten, mit anderen Leben, aber ähnlichen Aussichten. Direkt neben ihr wohnte seit einem halben Jahr die junge Frau, die sie unten getroffen hatte. Auf dem Klingelschild stand: M. Tschorpik. Marie. Oder Mareike?
Sie schüttelte den Kopf, kramte nach dem Schlüssel in der Außentasche ihres Mantels. Die Kälte, die sie mitgebracht hatte, zog durch die Flure. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, öffnete und zog den Trolley hinter sich über die Schwelle.
Drinnen roch es muffig, aber das machte ihr nichts aus. Für einen kurzen Moment lehnte sie sich an die Innenseite der Wohnungstür, atmete tief ein, während sie den Mantel ablegte und die engen Schuhe auszog.
Sie kicherte.
»Ich habe Brötchen mitgebracht!«, rief sie, und ihre Stimme klang plötzlich kräftiger.
»Und es hat tatsächlich niemand etwas gemerkt.«
Sie bekam keine Antwort, also ging sie die wenigen Schritte in die Küche und stellte ihren Trolley ab. Sie begann leise zu summen, während sie den Kühlschrank öffnete und die Butter herausholte, ein Messer aus der Schublade nahm und die Kaffeemaschine anschaltete.
»Ich habe auch Bohnenkaffee gekauft, richtig guten. Er wird dir schmecken, viel besser als deiner.«
Sie schaltete ein kleines Transistorradio auf der Fensterbank ein, ein Schlager ertönte, und Fröhlichkeit purzelte durch den Raum. Hinter der Scheibe schälte sich der Tag aus der Nacht heraus. Sie summte weiter, macht das Radio wieder aus, sang ein altes Lied, während der Kaffee blubberte und sie die Butter auf den Brötchen verstrich.
»Die Marmelade ist selbst gemacht, aber das weißt du ja.«
Zwei Teller auf einem Tablett, dazu Tassen, die bereits Sprünge hatten, aber auch das machte ihr nichts aus. Zucker, zwei kleine Löffel, der Duft des frisch gebrühten Kaffees stieg ihr in die Nase.
Jetzt, ohne ihren Mantel, ohne die Schuhe, fühlte sie sich besser. Sie streckte sich, dann ging sie mit dem Tablett ins Wohnzimmer zum Couchtisch, strich sich ihren braunen Rock glatt, setzte sich auf die Vorderkante des Sessels und schenkte Kaffee ein.
Eine Tasse für sich.
Und eine Tasse für die alte Frau, die ihr gegenübersaß.
Jede ein Stück Zucker. Sie rührte in beiden Tassen um. Dann nahm sie einen Schluck.
»Ah, der ist wirklich köstlich. Er wärmt die Glieder, du wirst sehen.«
Sie lehnte sich im Sessel zurück und sah sich um. Das Wohnzimmer mit dem Bücherregal, zwei Schneekugeln mit Schneemännern, daneben einige gerahmte Bilder. Die Enkelkinder, drei, sie lebten weit weg. Der Tisch am Fenster, darauf das Kreuzworträtsel und die Lesebrille. Dahinter Gardinen, links daneben der Fernseher, er wurde nur selten benutzt.
Alles war an seinem Platz. So wie es sein sollte.
»Du lebst ein schönes Leben«, sagte sie leise.
Sie bekam keine Antwort.
»Wir leben beide ein schönes Leben.«
Dann beugte sie sich vor und betrachtete den Geburtstagskuchen, der auf dem Couchtisch stand. Er war trocken geworden. Er stand schon seit gestern hier, sie hatte ihn nicht abgedeckt. Sie pickte einige Krümel vom flachen Teller und schob sie sich in den Mund, behutsam, um ihren Lippenstift nicht zu verschmieren.
»Er schmeckt noch immer.«
Sie nahm einen weiteren Schluck Kaffee und runzelte die Stirn.
»Ich habe den Kuchen extra für dich gebacken, du hast ihn kaum angerührt. Und jetzt sagst du kein Wort. Also wirklich, das nenne ich mal undankbar. Und von den frischen Brötchen willst du wahrscheinlich auch nichts.«
Nachdenklich schaute sie Richtung Decke, als sie mit sanfter Stimme weitersprach: »Schokoladenkuchen. Den magst du am liebsten. Ich habe es in einem Brief gelesen, von deiner Tochter. Sie würde dich gern öfter sehen. Aber sie schafft es nicht. Die Arbeit, die Kinder, du weißt schon. Ich habe alle ihre Briefe gelesen, die Postkarten auch. Aber ich fürchte, du bist ihnen egal. Wir beide sind ihnen völlig egal. Das ist die traurige Wahrheit.«
Ihre Stimme war leise, aber sie veränderte sich mit jedem Satz. Sie wurde immer tiefer.
»Weißt du, dort draußen schleichen die Menschen durch ihr Leben. Sie schauen nicht nach links oder rechts, sie blicken in den Spiegel und sehen nur sich selbst. Und sie glauben, dass sie glücklich sind. Aber das sind sie nicht, verstehst du?«
Die alte Frau ihr gegenüber auf dem Sofa trug ebenfalls einen braunen Rock. Und einen beigen Pullover. Ihre Fingernägel waren schlecht lackiert.
So wie ihre.
Die Haare waren grau und kurz, sie trug etwas Rouge auf den Wangen, die Frau auf dem Sofa. Sie war blass, bis auf die Flecken.
Sie sahen sich beide so ähnlich. Als wären sie ... ein und dieselbe Person.
»So, was wollte ich doch noch … ach ja.«
Sie stand auf, stemmte die Hände in die Hüften und atmete tief ein. Mit festen Schritten ging sie ins Bad und kam mit einem kleinen Spiegel zurück. Sie drehte ihn in der Hand, kurz kam ihr Gesicht darin zum Vorschein, um dann wieder zu verschwinden. Sie lächelte, betrachtete sich, die aufgemalten Falten am Hals und neben den Augen, dann die Nase.
»Gut gemacht, Frau Nowak«, sagte sie leise, dann ging sie zum Sofa und setzte sich neben die andere Frau. Sie legte ihren Kopf auf deren Schulter, genoss für einen Moment die Stille im Raum. Schließlich richtete sie sich auf, reckte ihr Kinn und hielt den Handspiegel vor ihre beiden Gesichter. Zwei alte Frauen, die Haut voller Lebensspuren, die die Zeit in die Körper gemeißelt hatte. Die Haarfarben waren nahezu identisch, ebenso das Make-up, beide trugen einen kleinen Ring am rechten Ohr.
Sie drehte sich zu ihr und gab ihr zärtlich einen Kuss auf die Wange, die kalt war und schlaff.
»Niemand hat etwas gemerkt«, flüsterte sie in ihr Ohr. Sie zupfte ihr einen Fussel vom Rock.
»Sie sind alle so blind, niemand schaut genau hin. Selbst die junge Frau unten an der Tür nicht. Ein bisschen Husten, ein bisschen Wegdrehen … es ist so einfach.«
Sie fuhr der Frau mit dem Finger übers Gesicht, Kuchenkrümel blieben zurück. Dann glitt ihre Hand weiter hinab, zum Hals, zu den Schultern, wieder hoch zu den Haaren, die sie sanft streichelte.
»Es hat sich gelohnt«, sagte sie. »Ich habe es so sehr genossen. Dein Leben. Deine Welt. Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Die Bäckerin hat mir die Tür aufgehalten, kannst du dir das vorstellen? Tschüss, Frau Nowak, hat sie mir hinterhergerufen. Bis morgen. Niemand schaut genau hin.«
Sie legte den Spiegel auf den Couchtisch und fuhr mit der Hand über ihren eigenen Rock. Dann über den der Frau neben ihr.
»Wie gut, dass du zwei davon im Schrank hattest.«
Schließlich stand sie auf und stellte sich ans Fenster, hinter dem der neue Tag begonnen hatte, trist und müde, so wie die Tage zuvor. Zwischen den Häusern führten Menschen ihre Hunde aus oder umgekehrt. Eine leere Zigarettenpackung wurde vom Wind in ein Gebüsch geweht, sie würde dort liegen bleiben bis in alle Ewigkeit, weil niemand sich hier für irgendetwas interessierte. Und schon gar nicht für eine alte Frau, die Irene Nowak hieß, obwohl sie eine von ihnen war und deshalb genauso unsichtbar wie alle anderen hinter ihren Türen und ihren Balkons.
Aber immerhin, sie führte ein Leben.
Ein Leben, das ihm gehört hatte, für zwei Tage.
Die schönsten zwei Tage seit Langem.
Irene Nowak, geboren in dieser Stadt. Mutter und Großmutter, verwitwet und vergessen am Rande ihres Lebens.
Und er hatte sie zum Leben erweckt.
Langsam zog er sich die Perücke vom Kopf. Dann das Haarnetz darunter. Behutsam nahm er die braunen Kontaktlinsen aus den Augen, das falsche Gebiss aus dem Mund. Er zog den Pullover aus und auch den Rock. Die Strumpfhose zum Schluss. Er spürte, dass die Schminke auf seinem Gesicht trocken und rissig wurde.
Es war Zeit, es zu beenden. Sosehr er es auch bedauerte.
Hinter ihm kippte die alte Frau zur Seite wie eine Schaufensterpuppe. Sie lag auf ihrem Sofa, roch jetzt streng.
»Auf Wiedersehen, Frau Nowak«, sagte er. »Sie hatten ein schönes Leben.«
WAS DU LIEBST, LASS FREI
Die See war unruhig. Ein Rollen ging durchs Wasser, ein Stampfen kam aus der Tiefe empor. Schaumkronen hatten sich gebildet, die ausfransten, dort, wo die Kämme brachen.
Es lag ein Fauchen in der Luft, wenn die Wellen meterhoch an ihm vorbeispritzten. Er hatte gelernt, die Augen zu schließen, während seine Arme im unermüdlichen Rhythmus das Wasser teilten, so lange, bis sie brannten.
Jakob Krogh schwamm in diesem Meer, seit er ein Kind war. Er kannte die Tücken der Strömung, das Zerren an den Beinen. Kraftvoll pflügte er durch das Wasser. Der Neoprenanzug lag eng um seinen Körper, durch die Schwimmbrille sah er den Horizont, wenn er seinen Kopf aus dem Wasser hob und kurz zur Seite legte, um Luft zu holen. Kleine Bläschen tanzten vor seinen Augen, als er wieder eintauchte und die See ihn zurückholte. Er dachte an Mariella, die bestimmt schon auf der Terrasse stand und aufs Meer hinausblickte, in eine Wolldecke gehüllt und mit einer Tasse Tee in der Hand. Filip schlief wahrscheinlich noch. Er lächelte. Vielleicht war sein Sohn auch schon wach und griff jetzt nach Mariellas Hand. Sie beide waren seine Heimat, und dieses Haus am Meer war ihre Trutzburg. Dort zu sein, mit ihnen, war ein Geschenk, und er würde es bewahren, auch wenn er heute fortmusste.
Über ihm segelte eine Küstenseeschwalbe am grauen Himmel. Sein Neoprenanzug verschmolz mit dem dunklen Wasser.
Er holte tief Luft und tauchte hinab in die Tiefe. Er spürte kurz den Luftzug an seinen Füßen, dann umschloss das Wasser ihn vollständig. Er arbeitete sich voran, senkrecht nach unten, mit kräftigen Zügen und geschlossenen Augen. Er merkte, wie das Wasser noch kälter wurde, wie die Tiefe nach ihm griff.
Und dann war er da, wo nichts mehr war. Und wo nichts mehr zählte. Wo alles sich auflöste: Gedanken, Absichten, Ängste und Hoffnungen. Alles wurde eins, graue Unendlichkeit.
Hier war nur er: Jakob Krogh, zweiundvierzig Jahre alt. Am Ende eines langen Jahres, in dem er gekämpft hatte. Mit dem Tod seines Vaters, mit der Schwere seiner Gedanken und dem Verlust seiner Zuversicht. Und erst jetzt, tief unten im Meer, wusste er, dass alles gut werden würde.
Als sein Herz härter pumpte und die Luft knapp wurde, ließ er sich langsam nach oben treiben.
»Ich muss los, kommt ihr?«
Jakob räumte einen Tretroller unter das Vordach und hob den schwarzen Koffer in seinen Wagen. Er schloss die automatische Heckklappe und drehte sich zum Haus. Wolken schoben sich über dem Meer zusammen. Er betrachtete den Giebel, den er im vergangenen Herbst repariert hatte, die zwei Holzstufen hinauf zur Terrasse, die das gesamte Haus umgab. Es lag an einem sanften Hang, inmitten der Dünen, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Das Reetdach hatten sie erneuert, die Fenster waren frisch gestrichen. Er liebte alles an diesem Ort: die Sonne auf dem Parkett, die Schatten der vorbeiziehenden Wolken an den Wänden, wo Mariella Bilder aus der Galerie aufgehängt hatte und Familienfotos.
»Mariella!«
»Wir kommen!«
Sein Sohn war noch im Schlafanzug, er rieb sich müde die Augen. Die dunklen Haare, die er von seiner Mutter geerbt hatte, waren verwuschelt, in der Hand hielt er ein Blatt Papier.
»Du kannst nicht gehen ohne Filips Geschenk«, sagte Mariella, und wie immer war es, als brächten ihre warme Stimme und der Singsang, wenn sie Deutsch sprach, die kalte Luft zum Vibrieren. »Er wollte es unbedingt noch fertig malen.«
Jakob nahm seinen Sohn hoch und fuhr ihm durchs Haar.
»Was hast du für mich, Filip?« Er drückte ihm einen Kuss auf die Wange, sein Sohn sträubte sich.
»Du kratzt, Papa!«
Jakob lachte.
»Ich dachte, wenn er etwas länger ist, dann kratzt er nicht mehr. Sagt zumindest Mama. Dann hat sie mich also angelogen, oder?«
Er streckte seinen linken Arm aus und drückte Mariella an sich, sie war frisch geduscht, roch nach Shampoo.
»Ich mag deinen Bart«, sagte sie und strich ihm zärtlich über die Wange. »Sieh zu, dass du schnell wieder zurückkommst.«
»In zwei Wochen, und danach versuche ich, jedes Wochenende hier zu sein. Aber ich muss erst mal starten, und du weißt …«
»Ich weiß …«, flüsterte sie und sah ihn an. »Ich weiß sehr viel, Polizeioberkommissar Krogh.«
»Aber hoffentlich nicht alles«, sagte er und gab ihr einen Kuss. »Und noch bin ich nur Kommissar.«
»Papperlapapp, sie haben es dir doch schon zugesagt.«
Mariella liebte dieses deutsche Wort, sie verwendete es, wann immer sie konnte.
»Das war vor meiner Auszeit. Komm, wir schauen uns lieber das Bild an, Filip, was ist das? Unser Haus? Bin ich das?«
»Das ist Mama«, sagte sein Sohn. »Und ich spiele da unten am Strand, siehst du?«
»Ja, das sehe ich. Das ist ein schönes Bild.« Jakob betrachtete das gemalte Haus. Braune Linien, ein Schornstein, aus dem es rauchte, sogar ein Vogel war zu sehen, direkt neben der Sonne. Zwei Strichmännchen davor, eine Wasserlinie, vor der Filip sich dargestellt hatte, mit einem eckigen Eimer in der Hand.
Seine ganze Welt auf einem Bild.
»Ich werde es im Büro aufhängen, versprochen. Komm, gib mir auch einen Kuss, ich muss jetzt los.«
»Tschüss, Papa.«
Er blickte seinem Sohn hinterher, als er nach drinnen rannte und ihm kurz darauf durch das Wohnzimmerfenster fröhlich zuwinkte. Dann drückte er Mariella fest an sich.
»Wann fahrt ihr zu deinen Eltern rüber?«
»Vermutlich morgen. Ich will nach Szczecin, wegen der Bilder.«
»Es wird bestimmt ein großer Erfolg. Und ich werde da sein, um mit dir zu feiern.«
Sie blickte ihn ernst an, während er mit den Fingern über ihr Haar strich.
»Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Jakob Krogh.«
Langsam löste sie sich von ihm und betrachtete ihn.
»Du siehst gut aus. Bereit für einen Neustart.«
»Bin ich auch. Dank dir.«
»Dank uns. Es wird alles gut werden. Und jetzt komm, wir sagen es gemeinsam:
»Co kochasz, niech darmo.«
»Was du liebst, lass frei.«
»Jeśli chodzi o powrót, to do Ciebie.«
»Kommt es zurück, gehört es dir.«
»Na zawsze.«
»Für immer.«
Der Wagen rollte vorbei an kahlen Feldern, an Äckern, über die der Wind fegte. Die Landstraße war kerzengerade, wie ein Strich, der ihn immer weiter fortführte von seinem Haus am Meer. Jakob streckte sich hinter dem Lenkrad, er spürte noch die Anstrengung des Schwimmens. Als er sich kurz im Rückspiegel betrachtete, war er sich mit einem Mal nicht mehr so sicher, ob Mariella recht hatte.
War er bereit, wieder einzusteigen? Die neue Aufgabe würde seine ganze Kraft in Anspruch nehmen, er würde unter Beobachtung stehen und liefern müssen, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Jakob Krogh war wieder im Dienst, in neuer Funktion, aber mit der gleichen Hingabe und Leidenschaft wie vor seiner Auszeit. Das wurde von ihm erwartet. Sie hatten eine neue Einheit gebildet, sie würden ihm die Leitung übertragen, gemeinsam mit einer neuen Kollegin. Die Mittel, die sie bekommen hatten, würden in anderen Abteilungen fehlen, sie würden von Anfang an argwöhnisch beäugt werden, wenn nicht gar behindert. Und selbst die Presse war skeptisch, er hatte die Artikel gelesen.
Er bog ab auf eine größere Straße, Richtung Autobahn. Die Stadt, in der er wieder arbeiten würde, war noch weit entfernt. Dennoch sah er sie deutlich vor sich, ihre Abgründe, in die er tiefer eintauchen würde als je zuvor.
Polizeikommissarin Mila Weiss hatte ihren Wagen in der hintersten Ecke des Besucherparkplatzes abgestellt. Regentropfen klatschten auf das Autodach, als würde jemand den Himmel über ihr auswringen.
Sie zog die Nase hoch, ihr blauer Mantel war feucht, und der graue Wollschal lag schlaff um ihren Hals. Für einen Augenblick betrachtete sie den Ausschnitt ihres Gesichts im Rückspiegel, die kurzen braunen Haare, den Schwung ihrer rechten Augenbraue. Die rot geränderten Augen, die Tränen.
»Ach, Scheiße!«
Milas Blick fiel auf die Uhr am Armaturenbrett. In drei Stunden würde die Pressekonferenz beginnen, und sie wollte vorher noch das Team kennenlernen.
Sie kramte in der Handtasche auf dem Beifahrersitz.
»Mist, verdammt, wo ist denn jetzt …«
Schließlich fand sie eine Packung Taschentücher und beseitigte, so gut es ging, die Spuren der Aufregung. Der Besuch war ein kompletter Fehlschlag gewesen, sie hätte es wissen müssen. Ihre Erwartungen waren viel zu hoch gewesen, ihr Plan, gleich beim ersten Mal den Durchbruch zu schaffen, lächerlich.
»Du bist so dumm«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. »Aber du wirst lernen. Und weitermachen.«
Das Geräusch vorhin, als die Eisentür ins Schloss gefallen war, hatte wie ein Schlusspunkt geklungen. Sie war durch den Matsch auf dem Parkplatz gerannt und hatte im Auto schreiend auf das Lenkrad eingeprügelt. Aber es war kein Schlusspunkt gewesen. Zu dieser Erkenntnis hatte sie der Wutausbruch immerhin gebracht.
Mila Weiss, siebenunddreißig, erfahrene Ermittlerin mit einer Aufklärungsquote, die sich sehen lassen konnte. Zumindest in Wien war sie sehr erfolgreich gewesen, aber nun war sie hier, zurück in Deutschland. Sie hatte sich auf die Stelle beworben, weil sie die Richtige dafür war. Und auch, weil sie nicht mehr weinen wollte auf diesem Parkplatz und an diesem Ort, der hinter dem geschlossenen Tor lag.
Ihr Handy klingelte. Mila blickte auf das Display.
Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase, holte tief Luft und starrte durch die Windschutzscheibe, wo hinter einer kleinen Böschung die Straße lag, die zurück in die Stadt führte. In eine Stadt, die sie noch kaum kannte, in der sie aber leben und arbeiten würde. Weil sie es so gewollt hatte.
»Mila? Hier ist Jakob. Wo erwische ich dich gerade?«
Sie hörte Musik im Hintergrund und Fahrgeräusche, offenbar saß er ebenfalls im Auto. Er hatte erwähnt, dass er mit seiner Familie am Meer wohnte, jetzt fuhr er vermutlich gut gelaunt und voller Tatendrang in die Stadt.
»Guten Morgen«, sagte sie kühl und griff nach dem Kaffeebecher in der Mittelkonsole. »Bist du rechtzeitig da?«
Sie wusste, dass er versuchen würde, das Ignorieren seiner Frage zu deuten. So viel hatte sie während der Telefonate, die sie in den vergangenen Wochen geführt hatten, schon über ihn gelernt. Jakob Krogh war verdammt gut in seinem Job.
»Ich bin extra zeitig losgefahren«, sagte er. Er klang beschwingt und entschlossen.
»Es gibt nicht weit vom Präsidium ein kleines Café«, fuhr er fort. »Eher eine Bar. Das Charlies. Wollen wir uns vielleicht da treffen? Ein schneller gemeinsamer Kaffee vor der Pressekonferenz. Wir könnten uns kurz absprechen, was meinst du?«
Mila blickte auf die Uhr, sie wollte noch mal in ihre Wohnung, duschen, sich umziehen. Sich sammeln.
»Ich kann es nicht versprechen. Ich versuche es.«
»Prima. Dann bis später, Mila.«
Sie drückte ihn weg, ohne sich zu verabschieden. Dann fuhr sie rückwärts aus der Parklücke und zur Ausfahrt. Dabei kam die Eisentür wieder in ihr Blickfeld und der Durchgang zum Wachhaus, in dem sie sich vorhin angemeldet hatte.
Die lange Backsteinmauer glitt an ihr vorbei, als sie beschleunigte. Einige Krähen kamen von einem nahe gelegenen Stoppelfeld herbeigeflogen, eine Vogelscheuche, die um diese Jahreszeit ohne Auftrag war, steckte im Boden. Es gab keine Ernte zu schützen, keine hungrigen Vögel zu vertreiben, alles war matschig.
Dazu die feuchte Kälte, die in jede Ritze kroch. Sie drang an die einsamsten Orte vor und auch zu den Menschen, die man für viele Jahre weggesperrt hatte, hinter der schweren Eisentür. Und die dennoch freier waren als die Frau, die sich jetzt eine Zigarette anzündete und sich fragte, wie ihr erster Tag in dieser Stadt wohl verlaufen würde.
Das Charlies hatte sich nicht verändert. Als Jakob die Glastür aufzog und die Bar betrat, reagierte sein Körper sofort. Auf die Gerüche, das diffuse Licht und auf den Anblick der langen Bar, an deren Ende eine enge Wendeltreppe nach oben in die erste Etage führte, wo es weitere Sitzplätze gab. Eine Welle von Erinnerungen überrollte ihn, er meinte das Lachen seiner Kollegen zu hören, die Trinksprüche und das Fluchen, weil das eigene Blatt mal wieder schlechter war als das der anderen. Wie früher war die Wand zu seiner Linken kahl, der Putz blätterte ab, darunter war der nackte Beton zu erkennen. Seine Sohlen blieben kurz am Boden kleben, offenbar wurde nach wie vor nur jeden zweiten Tag gewischt. Die Panoramascheibe war beschlagen, auf der niedrigen Bank davor lagen zwei Kissen, eine Zeitung, ein Aschenbecher stand darauf. Das Rauchen war auch im Charlies längst nicht mehr erlaubt, aber wie kleine Relikte aus einer vergangenen Zeit standen überall Aschenbecher herum.
»Ich bin sofort da!«
Die Stimme kam aus dem Raum hinter der Bar. Langsam ging Jakob an Nierentischen vorbei, an grauen, beigen und roten Stühlen. Ein Bataillon an Spirituosen war hinter der Bar aufgebaut, dazu die Zapfanlage, die Charlie eigens aus Brighton mitgebracht hatte. Hier im Charlies waren Geburtstage gefeiert worden, hatten neue Kollegen ihre Feuertaufe durchlebt. Jeder, der hierherkam, trug sein Päckchen. Dinge, die man nicht vergessen konnte, Dinge, die der Job nun mal mit sich brachte.
Das Charlies war ein Ort des Trostes, wenige Straßen vom Präsidium entfernt.
Es war seine Heimat gewesen, lange bevor er Mariella kennengelernt hatte.
»Ach nee, wen haben wir denn da?«
Charlie stand in der Tür hinter der Bar, in den Händen einen Pappkarton mit Gläsern. Er stellte ihn ab und wischte sich die Hände an einem Spültuch ab.
»Ich werd verrückt. Wenn das nicht Jakob Krogh ist, der verlorene Sohn. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du schon mal fröhlichere Farben an, mein Lieber. Kaffee? Schwarz nehme ich an, wenn ich dich so sehe.«
Jakob blickte in den Spiegel gegenüber. Schwarze Hose, schwarzer Rollkragenpullover, darüber eine dunkelgraue Jacke. Sein Bart zeigte Spuren von Grau.
»Du hast zugenommen, Charlie. Treibst du keinen Sport mehr?«
»Geht dich nichts an, Bulle. Hier, ich habe neue Bohnen, beste Ware, probier den mal.«
Jakob setzte sich auf einen der Barhocker, wischte mit der Hand die Krümel weg und trank einen Schluck.
»Nicht schlecht.«
»Nicht schlecht? Du kannst gleich wieder gehen, mein Lieber. Was machst du überhaupt hier, ich dachte, du schaust den ganzen Tag aufs Meer?«
Jakob zog einen der Aschenbecher zu sich heran, es war nur ein Reflex, denn er rauchte längst nicht mehr. Er betrachtete Charlie, der im speckigen Pullover hinter der Bar stand und Gläser einräumte. Sein Gesicht war etwas aufgedunsen, die Haare waren dünner geworden.
»Siehst ungesund aus, Charlie.«
Der massige Mann rollte mit den Augen.
»Bist du zurückgekommen, um mir eine Predigt zu halten?«
Jakob hob seine Tasse und prostete ihm zu.
»Tut mir leid. Es ist schön, dich zu sehen.«
Der Barbesitzer hob ein halbvolles Wasserglas in seine Richtung und schaltete die Anlage ein. Jakob war nicht zuletzt wegen der Musik so oft hier gewesen. Menschen wie Charlie wussten intuitiv, welcher Song den Raum zum Klingen brachte. So war es damals gewesen, in den lauten Zeiten. Und so war es jetzt, in den leisen.
Days like this. Van Morrison.
Jakob trank seinen Kaffee und sah auf die Uhr. Mila würde hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Charlie sah ihn nachdenklich an, bis sie beide lächelten.
»Es tut verdammt gut, dich zu sehen. Komm her, lass dich umarmen.«
Der Barkeeper drückte ihn an sich.
»Ist ja kaum was dran an dir, mein Gott. Wie willst du da mit aller Kraft wieder einsteigen?«
Jakob lachte.
»Also, erzähl schon«, sagte Charlie. »Wie ist es dir ergangen? Was hast du gemacht?«
»Das ist eine verdammt gute Frage, das wüsste ich auch gern. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, Jakob Krogh?«
Jakob erkannte die Stimme sofort. Er drehte sich um und sah zuerst die schweren Bikerboots, die die enge Wendeltreppe herunterkamen. Dann verwaschene Jeans, die der Mann sich gerade zuknöpfte, das Cordhemd und schließlich das Holster, in dem seine Dienstwaffe steckte.
»Da geht man einmal kurz pissen, und wenn man zurückkommt, sitzt die Vergangenheit am Tresen. Machst du mir auch einen Kaffee, Charlie?«
»Kommt sofort.«
Das Lächeln und auch die Selbstsicherheit, mit der Lasse Callsen die Wendeltreppe heruntergekommen war, waren Jakob noch sehr vertraut. Kein Wunder, denn genau wie er kannte Lasse jeden Quadratzentimeter in dieser Bar, er hatte schon auf jedem Stuhl gesessen und war öfter in weiblicher Begleitung als allein aus dem Charlies getaumelt.
Er sah aus wie immer, eine Zigarette hinters Ohr geklemmt, die er anzünden würde, sobald er aus der Tür war, ein markantes Gesicht, breite Schultern und ein noch breiteres Grinsen.
»Jakob Krogh. Kaum zu glauben.«
»Lasse Callsen. Wen man nicht alles trifft, und das gleich am ersten Tag.«
»Du hättest dich mal melden können.«
»Habe ich aber nicht. So wie du.«
Jakob erhob sich, um den Kollegen zu begrüßen.
»Mein Gott«, sagte Lasse, jetzt mit leiser Stimme. »Du siehst aus wie einer, der was mitgemacht hat. Und trotzdem, du hättest anrufen können, dann hätten wir eine ordentliche Willkommensparty steigen lassen!«
Sie setzten sich an den Tresen, und Jakob hatte plötzlich das seltsame Gefühl, nie aufgestanden zu sein von diesem Hocker. Er zog die Zigarette hinter Lasses Ohr hervor und drehte sie zwischen den Fingern.
»Ich … es ist in Ordnung, wie es war. Ich hätte es nicht geschafft, von hier aus.«
Lasse nickte.
»Dein Vater, ist er …«
»Er ist gestorben. Er ist dann endlich irgendwann gestorben, und es war gut so. Es war ein langer Weg, wirklich hart. Krebs ist nicht schön. Es war richtig hässlich. Aber am Ende war es gut.«
»Wann ist er gestorben?«
»Im Sommer.«
Lasse holte sich die Zigarette zurück und steckte sie wieder hinters Ohr.
»Ich habe versucht, dich zu erreichen, damals. Aber irgendwie … du bist richtig von der Bildfläche verschwunden. Ich meine, wir wussten alle, dass es schlecht steht um den alten Krogh. Einige von uns kannten ihn ja noch. Gab es keine Trauerfeier oder so was? Ich habe mich erkundigt, niemand im Präsidium wusste etwas.«
Jakob drehte den Aschenbecher in der Hand und machte das Feuerzeug an.
»Er wollte es so«, sagte er, während er die Flamme vor seinen Augen tänzeln ließ.
Lasse streckte sich und blickte auf die Uhr.
»Und jetzt? Ich habe gehört, du sollst die neue Einheit leiten. Ganz schöner Kaltstart, ehrlich gesagt.«
Jakob legte das Feuerzeug zurück auf den Tresen und nickte.
»Aber irgendwann muss ich ja wieder anfangen. So ein Haus am Meer will auch bezahlt werden.«
»Aber gleich so eine Aufgabe, Respekt. Hör zu, ich muss leider los. Lass uns bald wieder treffen, heute Abend vielleicht? Ein paar Bier auf die alten Zeiten, was meinst du?«
»Hört sich gut an. Warte, mein Handy …«
Während Lasse Charlie zwei Münzen auf den Tresen legte und seine Jacke holte, zog Jakob das Telefon aus der Tasche und lächelte, als er Mariellas Nummer sah. Als er ranging, hörte er Filips Stimme: »Hallo, Papa, ich bin’s!«
»Hallo, mein Kleiner. Was gibt’s? Wie geht’s dir?«
»Gut! Papa, weißt du, wo mein Hase ist?«
»Dein Hase? Den hattest du heute Morgen doch im Arm.«
Jakob schaltete den Lautsprecher ein und legte das Handy auf den Tresen, um einen Schluck Kaffee zu nehmen. Lasse stand jetzt neben ihm und lächelte.
Lasse flüsterte ihm über die Kinderstimme hinweg zu: »Filip? Wie alt ist er jetzt?«
»Vier.«
»Wahnsinn.«
»Papa, ich finde ihn aber nicht.«
»Dann schau mal in der Kiste neben deinem Bett. Vielleicht hast du ihn da wieder reingelegt.«
»Ja!! Da ist er. Danke und tschüss, Papa!«
»Tschüss, Filip!«
»Du musst sie mir beide mal vorstellen, unbedingt«, sagte Lasse.
»Mach ich. Ich habe gehört, du bist gar nicht mehr in der Mord?«
Sein alter Kollege schüttelte den Kopf.
»Wirtschaftskriminalität. Ich wollte mal was anderes machen, die Dinge etwas ruhiger angehen lassen. Und womöglich wird da ein höherer Besoldungsrang frei, ich rechne mir was aus. Mach’s gut, sag Bescheid wegen heute Abend. Mann, tut das gut, dich wieder hierzuhaben. Ist alles ein bisschen langweilig geworden ohne dich.«
Jakob steckte sein Handy wieder ein und warf ebenfalls einen Blick auf die Uhr. Es wurde langsam zu spät für einen Kaffee mit Mila.
In diesem Moment war ein kalter Luftzug zu spüren.
»Schöne Frau, kommen Sie nur rein«, hörte er Lasses Stimme. »Dies ist die Heimat der verlorenen und wiedergefundenen Seelen. Ich bin Lasse. Und Sie sind …«
»Ich bin verabredet. Danke.«
Jakob drehte den Kopf und sah, dass Lasse der Frau die Tür aufhielt. Er hatte es sich nicht verkneifen können, sie anzusprechen. Und er konnte es ihm nicht verübeln, denn Mila Weiss war eine attraktive Frau. Sie trug einen blauen Mantel und einen langen grauen Schal, dazu Jeans und weiße Sneaker. Die kurzen Haare hatten das gleiche Braun wie ihre Augen. Sie war sichtlich genervt und schenkte Lasses Avancen keine Beachtung. Während sie ihr Handy aus der Manteltasche fischte und einen Anruf entgegennahm, drehte Lasse sich zu Jakob um und gab ihm ein Zeichen, das man nur auf eine Weise interpretieren konnte. Sein Kollege war schon immer ein Freund der Abwechslung gewesen und vergaß dabei auch gerne mal die Zeit. Jetzt wartete er lässig an die Wand gelehnt darauf, dass die Frau im blauen Mantel ihren Anruf beendete. So schnell würde er nicht aufgeben.
»Hier ist Mila Weiss. Was gibt es?«
Eine längere Pause, in der Mila zuhörte, während ihr Blick zuerst durch den Raum wanderte, dann an Jakob und schließlich an Lasse hängen blieb, der ihr direkt gegenüberstand. Der Polizist griff in seine Innentasche, holte einen Kugelschreiber heraus und kritzelte seine Handynummer auf einen Bierdeckel, den er von einem der Tische geangelt hatte.
Mila hörte immer noch zu, sie unterbrach ihren Gesprächspartner nur mit kurzen Fragen.
»Wie alt?«
»Wie lange ist das her?«
Lasse hielt ihr mit einem Lächeln den Bierdeckel hin, sie nahm ihn und lächelte zurück. Durchaus charmant, fand Jakob. Sie hielt kurz die Hand vor das Telefon und wandte sich an Lasse.
»Könntest du deinen Namen noch hinschreiben? Gern mit Nachnamen. Ich bin Mila. Mila Weiss.«
Sie sprach weiter in ihr Handy, während sie den Bierdeckel erneut entgegennahm und das Geschriebene betrachtete.
»Vielen Dank, liebe Kollegen, wir machen uns auf den Weg. Und noch etwas: Ich bräuchte eine Personenabfrage. Moment, ich habe hier den Namen: Callsen. Lasse mit Vornamen. Ja, ganz genau. Ja, ich weiß, dass er Polizist ist. Genau, den meine ich. Könnten Sie eine Anzeige aufsetzen? Belästigung einer Beamtin. Nein, das ist kein Scherz.«
»Wie bitte, was soll denn …?« Lasse starrte sie an, aber Mila lächelte nur und reichte ihm den Bierdeckel zurück.
»Danke, ich brauche ihn nicht mehr … Alles klar, Kollege, ich werde das dann unterschreiben, wenn ich im Büro bin.«
Jakob musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Lasse starrte Mila immer noch mit offenem Mund an.
»Was heißt hier ›Belästigung einer Beamtin‹«, zischte er und trat einen Schritt auf sie zu. »Ich kann dir gleich mal zeigen, was Belästigung ist …«
Aber Mila Weiss zuckte nicht zurück, im Gegenteil.
»Ja? Wie würde das aussehen? Sag schon. Ich freue mich drauf, das alles aufzuschreiben. Komm schon, Lasse Callsen. Oder verzieh dich, du wolltest doch gehen, oder?«
Er starrte sie wütend an, ehe er sich an ihr vorbeischob und fluchend durch die Tür verschwand. Mila drehte sich zu Jakob um.
»Wir müssen los.«
Mit diesen Worten begann der erste gemeinsame Tag von Jakob Krogh und Mila Weiss als gemeinsame Leiter der neu gegründeten Gruppe 4, der Sondereinheit für komplexe Serienstraftaten.
VERWANDLUNG
Licht an.
Die Glühbirnen knistern. Surrend entsteht ein Kranz aus warmem Licht. Jenseits dieses gleißenden Rahmens ist es dunkel. Kein Lichtstrahl dringt in den Raum. Alle Ritzen sind abgeklebt, der Vorhang zugezogen, weil alles draußen bleiben muss.
Alle Lügen. Und alle Wahrheiten auch.
In der Mitte des Spiegels schält sich ein Gesicht aus der Dunkelheit. Es ist sein Gesicht, auch wenn er noch Mühe hat, es willkommen zu heißen.
Es hat feine Linien, wie mit Tusche gezeichnet. Hohe Wangenknochen, auffällige Wimpern, geschwungene Lippen, die Haut ist blass und weich. Die langen Finger, die ihren Platz auf der Ablage vor dem Spiegel suchen, bewegen sich zart und fließend. Ein schlanker Hals, schmale Schultern, die die Last dieser Welt niemals tragen könnten.
Elias.
Ein Kratzen ist zu hören, hinter ihm, in der Dunkelheit.
Er ist nicht allein. Er war es nie.
Wie oft hatte er vor dem Spiegel gesessen, den Blick ins Unendliche gerichtet, so lange, bis seine Augen brannten? So lange, bis er sich selbst auflöste und nicht mehr wusste, auf welcher Seite sein wahres Ich saß. Saß er womöglich hinter dem Spiegel und blickte auf sich selbst, umgeben von Pinseln und Quasten, von kleinen Tiegeln, von Schminkkästen und Perücken an der Wand?
Das Kratzen hinter ihm wird lauter.
So wie damals.
Er erinnert sich noch an das erste Mal. Plötzlich waren sie da.
Die Vögel.
Schlugen mit dem Schnabel gegen das Holz. Kratzten mit ihren Krallen über das Dach. Tock, tock.
Und irgendwann zeigten sie sich, kamen zu ihm herein. Starrten ihn an aus wässrigen Augen, in denen das Mitleid zu schwimmen schien und auch die Häme.
Böse, dunkle Tiere.
Sie waren seine einzigen Besucher.
Er räuspert sich, sieht seinen Kehlkopf zucken. Die Stimmbänder sind noch belegt, es braucht immer seine Zeit, um Leben abzustreifen, um die Stimme, die ihm so vertraut geworden ist, zum Verstummen zu bringen.
Und um daraus eine neue erwachsen zu lassen.
»Guten Tag.« Er kann sie noch hören. Und spüren. Die alte Frau, die eben noch mit dem Einkaufstrolley durch ihr Viertel schlurfte. Und die ihren Geburtstagskuchen nicht anrühren wollte.
»Ich nehme drei Brötchen, bitte.«
Schwach ist die Stimme und leise. Wie die Stimme eines Menschen, der am Ende seines Lebens angekommen ist.
»Einen schönen Tag noch. Einen … schönen … Tag … noch.«
Es ist ihm wichtig, dieses Abschiednehmen. Das Loslassen eines fremden Körpers, das Abstreifen einer alten Haut. Er weiß: Selbst wenn alles gestorben ist – der Körper, der Geist und auch die Seele –, dann ist da immer noch eine Melodie in seinem Kopf, die sich verwebt mit dem nächsten heiseren Krächzen im Hintergrund. Aber sie muss verstummen, für immer. Platz machen für etwas Neues. Und deshalb spricht er diese letzten Sätze. Bis da nichts mehr ist und er loslassen kann.
Der Vogel bewegt sich, will raus. Aber er lässt ihn nicht. Als er sich umdreht zu ihm, blicken ihn diese Augen wieder an. Wässrig, umrahmt von dunklem Gefieder.
»Mein Name ist Irene Nowak. Ich habe heute Geburtstag.«
Tock, tock.
»Mein Name ist Irene Nowak. Ich habe …«
Der Schnabel hackt gegen den Käfig. Das Schlagen eines Flügels, kraftvoll und bestimmt.
»Mein Name ist Irene Nowak.«
Es ist Zeit für neues Leben.
»Mein Name ist …«
Licht aus.
Die Glühbirnen knistern. Der Spiegel wird von Schwärze verschluckt und mit ihm sein Gesicht, sein Blick, die langen Finger und auch die helle Haut.
Das Bild ausgelöscht. Nur noch die Stimme bleibt.
Eine dunkle, kräftige Männerstimme. Es ist nicht seine eigene. Noch nicht.
»Guten Tag. Mein Name ist Ben Richter.«
Tock, tock.
»Guten Tag. Mein Name ist Ben Richter. Ich studiere Jura im fünften Semester. Ich bin vierundzwanzig Jahre alt. Und ich bekomme bald Besuch.«
WUT
Jakob steuerte seinen Dienstwagen durch den Verkehr, und es kam ihm vor, als würde er durch seine eigenen Erinnerungen fahren: die Fassade des Bahnhofs, der Übergang in Richtung Altstadt, der Kanal und die geschwungene Brücke mit den Laternen. Er nahm die Auffahrt zum Ring. In der Ferne war das hoch aufragende Gebäude der Universität zu sehen, gleich rechts die Flutlichtmasten des Stadions. Er kannte diese Stadt wie seine Westentasche, und doch war es, als müsste er sich vergewissern, dass alles noch an Ort und Stelle war. Der Stadtpark mit der Mühle und dem See, um den er frühmorgens so oft gelaufen war, um den Kopf freizukriegen. Die Stadtmauer, etwas weiter hinten die Shisha-Läden und Studentenkneipen, dann die Bars entlang der Straße, die jetzt breiter wurde, als sie sich dem Stadtrand näherten. Jakob öffnete das Fenster ein wenig und sog die kalte Luft ein, als könnte er so die Eindrücke in sich aufnehmen.
Mila hatte ihren blauen Mantel auf die Rückbank des Wagens geworfen und telefonierte wieder. Sie trug verwaschene Jeans und einen grauen Strickpullover. Er war ihr über die rechte Schulter gerutscht, darunter blitzte ein weißes Shirt hervor. Die Waffe steckte rechts in einem Gürtelholster. Jakob betrachtete sie aus dem Augenwinkel.
Sie sah müde aus. Sie kam ihm vor wie ein Seil, zum Zerreißen gespannt, ihr Blick war hart, ihre Stimme angespannt.
»Nein, es geht nicht anders. Der Kollege Krogh und ich sind unterwegs zu einem Tatort. Ja, das ist unsere Aufgabe, deswegen bin ich geholt worden, Herr Staatsanwalt. Nicht, um Pressekonferenzen zu geben, ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie das besser können als ich.«
Jakob lächelte belustigt.
»Ja, Herr Staatsanwalt, mir ist bewusst, wie wichtig die Pressekonferenz für das Präsidium … natürlich … glauben Sie mir, ich würde es mir auch anders wünschen.«
Sie rollte mit den Augen, als sie zu Jakob hinübersah. Dann runzelte sie kurz die Stirn, lehnte den Kopf ans Fenster und reichte ihm das Handy.
»Sattmann. Er will dich sprechen.«
Er nahm das Telefon und nickte Mila beruhigend zu.
»Hier ist Krogh.«
»Verdammt, Jakob, was soll der Mist? Wir hatten eine Pressekonferenz anberaumt, um deine neue Einheit vorzustellen. In Kürze habe ich hier zehn Journalisten sitzen, sogar das Fernsehen kommt.«
»Es ist nicht meine neue Einheit, ich leite das Team gemeinsam mit Mila. Und wie sie bereits gesagt hat …«
»Ist mir völlig egal, was sie sagt, Jakob. Ich will, dass du mich in solchen Fällen anrufst, nicht sie. Sie ist die Neue, du bist mein Ansprechpartner. Und das mit der Pressekonferenz ist ein großer Mist.«
Dirk Sattmann war seit fünf Jahren leitender Staatsanwalt in der Stadt, ein aufstrebender und ehrgeiziger Beamter, der genau wusste, wo oben und unten war. Der Jakob vor einiger Zeit das Du angeboten hatte, bei einer Gartenparty in seinem Haus, draußen am See. Er war ihm nicht unsympathisch, ein kluger Kopf und jemand, der auch mal über sich selbst lachen konnte. Und gerade deswegen war es in den Folgejahren nicht immer leicht gewesen, die notwendige Distanz zur Staatsanwaltschaft zu halten.
»Hör zu«, sagte Jakob, während er in eine schmale Waldstraße einbog, an deren Ende ihr Ziel lag. »Ich denke, auch dir ist am Erfolg des neuen Teams mehr gelegen als an einer guten ersten Pressekonferenz. Wir sind jetzt gleich in der Siedlung, wir informieren dich, sobald wir mehr wissen. Aber Mila hat recht: Dafür wurde sie geholt. Und ich auch. Es ist der dritte Raubüberfall innerhalb kurzer Zeit, jede Minute zählt, das weißt du genau. Wir haben es hier mit einer Serie zu tun, und genau deshalb gibt es die neue Einheit. Ich glaube nicht, dass ich dich an zurückliegende Fälle erinnern muss, in denen Verbindungen zwischen einzelnen Verbrechen schlicht nicht gesehen wurden. Damit das nicht mehr passiert, sollen wir …«
»Ja, ist ja gut«, unterbrach ihn Sattmann mit einem Knurren. »Aber ich will Ergebnisse sehen. Und zwar schnell.«
Jakob gab Mila das Handy zurück. Sie schwiegen auf der Fahrt durch den Wald. Links und rechts der regennassen Straße verliefen Radwege, eine Bushaltestelle, die hier völlig deplatziert wirkte, kam in Sichtweite. Schatten huschten zwischen den knorrigen Stämmen umher, weil der Wind die Laubkronen durchschüttelte. In der Ferne konnte man die ersten Häuserblöcke der Siedlung erahnen.
»Per du mit dem Staatsanwalt, das macht es bestimmt einfacher.«
Mila hatte den Mantel zu sich nach vorne gezogen und verstaute ihr Handy in einer Innentasche.
»Manchmal kommt man aus bestimmten Sachen nicht mehr raus«, antwortete Jakob. »Sattmann ist schon okay. Klar, er hat vor allem sich selbst im Blick, aber er setzt sich auch für seine Leute ein.«
»Vor allem für dich?«
Jakob atmete tief ein.
»Hör zu, Mila, wir haben es uns beide nicht ausgesucht. Aber ich bin mir sicher, dass wir zwei …«
»Schon gut«, sagte sie und winkte ab. »Lass uns diesen Teil überspringen, wir teilen uns nachher im Präsidium einen Kaffee am Automaten, schwören uns ewige Blutsbrüderschaft, und das Team wird gut arbeiten, wir haben ausgezeichnete Leute ausgesucht. Also du. Das hoffe ich zumindest.«
»Ich habe dir angeboten, dabei zu sein.«
»Ich war in Wien.«
»Das ist richtig, du warst in Wien.«
Als sie aus dem Wald auftauchten, bauten sich vor ihnen die Häuser der Siedlung auf. Graue, eckige Kolosse, bis zu zwölf Stockwerke hoch, vor Jahrzehnten in den harten Boden gerammt. Die Straßen waren verwaist, die Menschen waren entweder bei der Arbeit oder hatten sich zurückgezogen hinter ihre Gardinen und Satellitenschüsseln.
Hinterm Wald war ein Synonym für alles Abgehängte. Für Menschen mit schlecht bezahlten Jobs, ohne echte Perspektiven, aber immerhin mit dem besten Glasfaseranschluss der Stadt. Jakob erinnerte sich an die Werbeplakate für die Siedlung, die mit der Möglichkeit gelockt hatten, digital von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei waren die meisten Menschen, die hier lebten, entweder arbeitslos oder sie hatten Jobs, die sie nicht von zu Hause aus erledigen konnten. Sie waren Verkäufer und Handwerker, Busfahrer und Schichtarbeiter: Was diese Leute brauchten, waren bessere Löhne und eine gute Verbindung in die Stadt. Das schnelle Internet half vor allem den Kindern, die stundenlang zockten.
Mila sah aus dem Fenster, an den Fassaden empor und zu den Balkons hinauf, auf denen Getränkekisten standen oder leere Pappkartons, vermutlich von Elektronikmärkten. Schließlich drehte sie sich zu Jakob um.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Ich will es hinkriegen, das Ganze hier. Mein Abschied aus Wien war … schwierig. Jetzt bin ich hier, und ich will es gut machen.«
»Das wirst du, Mila«, sagte er und parkte den Wagen am Fuße eines Hochhauses. »Wir werden es beide gut machen. Und wenn ich es nicht schaffe … Ich kenne – wie du gerade erfahren hast – den leitenden Staatsanwalt ganz gut. Wenn nichts mehr geht, mache ich so ein Männer-Ding, keine Ahnung, einen Segeltörn oder meinetwegen leihe ich mir einen Bagger und grabe etwas um.«
Sie lachte kurz, dann schaute sie durch das Seitenfenster nach oben.
»Das ist unser erster Fall«, sagte sie. »Wir sollten ihn nicht versauen.« Mit diesen Worten öffnete sie die Tür des Wagens und trat hinaus in die Kälte.
Hausnummer 87 befand sich in einem von drei Blöcken, die am östlichen Rand der Siedlung standen. Eine Bushaltestelle vor der Tür, Müllcontainer, aus denen geplatzte gelbe Säcke hervorlugten, ein Basketballkorb an einer Wand, das Netz war längst herausgeschnitten. Zwölf Stockwerke gestapelte Trostlosigkeit.
Jakob ließ seinen Blick über die Fassade wandern: Gardinen und gekippte Fenster, aus denen der Qualm einer Zigarette oder der neugierige Blick eines Rentners nach draußen drang. Er drehte sich einmal langsam im Kreis, wollte das ganze Bild in sich aufnehmen, bevor sie gleich eintauchen würden ins Innere dieses Ortes.
Mehrere Einsatzfahrzeuge waren auf dem kleinen Parkplatz abgestellt, Beamte in weißen Overalls kamen aus dem Treppenhaus, holten Equipment aus den Autos, ein Fotostativ, Plastikfolien und Boxen, in denen später Beweisstücke verstaut werden würden.
»Jedes Verbrechen hat seine Logistik«, murmelte Jakob, während einer der Männer kurz stehen blieb und sie misstrauisch anstarrte. Er hielt eine Kiste mit weißen Overalls in den Händen.
»Wievielter Stock?«, fragte Mila, ohne sich mit einer morgendlichen Begrüßung aufzuhalten. Der Mann runzelte die Stirn, während hinter ihm zwei Streifenpolizisten aus dem Haus traten und davor stehen blieben.
»Und Sie sind wer?«, fragte der Mann mit der Kiste. Er war kleiner als Jakob, trug eine randlose Brille und eine graue Mütze. Sein Atem dampfte in der kalten Luft.
»Der Brötchenservice«, sagte Mila und hielt ihm ihren Dienstausweis vor die Nase. Jakob tat es ihr gleich.
Der Mann sah kurz auf die Ausweise, dann lächelte er knapp.
»Ah, die neue Einheit. Erster Tag? Na dann, herzlich willkommen in der Stadt, liebe Kollegin. Ich hätte Ihnen lieber einen Blumenstrauß zu Begrüßung überreicht, aber stattdessen«, er deutete mit dem Kinn in Richtung der Eingangstür, »biete ich Ihnen einen First-Class-Tatort, das ist doch auch schon mal was.«
Der Mann wandte sich an Jakob.
»Jakob Krogh. Schon viel gehört, obwohl ich erst seit einem halben Jahr im Präsidium bin. Willkommen. Und auf eine gute Zusammenarbeit. Hier, nehmt euch jeder einen Satz Klamotten, ich nehme doch an, ihr kennt das Prozedere: frischer Tatort, weiße Overalls, Überzieher, Badekappe, das ganze Programm. Ich bin Roland Gerber, KTU-Bereitschaftsdienst. Wir waren vorhin die Ersten hier, nach den Streifenkollegen natürlich. Ist nicht schön dort drinnen, aber ihr werdet es selbst sehen. Ach so: Die Wohnung liegt im zweiten Stock.«
Mila und Jakob nahmen sich jeweils eine Plastiktüte aus der Kiste, rissen sie auf und zogen sich um. Mila musterte die beiden Streifenpolizisten, die neben der Tür standen und sich unterhielten.
»Kollegen?«
Die Beamten unterbrachen ihr Gespräch sofort und blickten Mila fragend an.
»Guten Morgen«, sagte einer der beiden. Er war groß und breitschultrig und hauchte immer wieder in seine Hände, um sie zu wärmen.
»Verdammt kalt immer noch«, sagte er freundlich, nur um schnell zu begreifen, dass Mila nicht an einem Plausch unter Kollegen interessiert war.
»Warum ist das Haus nicht abgesperrt?«, blaffte sie ihn an, während sie sich in den Overall zwängte.
»Wie bitte?«
»Das Haus«, sagte sie genervt. »Dieses hier, vor dem wir stehen. Hier kommen gleich Leute raus, andere kommen rein, wir müssen mit allen reden, wir müssen ihre Personalien aufnehmen, an ihre Türen klopfen. Hat einer was gesehen, etwas gehört …?«
»Werte Kollegin«, unterbrach sie der Polizist. »Machen Sie sich mal keine Sorgen, wir haben alles vorbereitet und …«
Mila zog sich die weiße Haube auf und funkelte den Mann an.
»Vorbereitet, ja? Das freut mich, wirklich. Wir werden der Presse nachher sagen, dass ein Serientäter hier in der Siedlung sein Unwesen treibt, dass er bereits zwei Frauen brutal überfallen hat und dass dort drinnen eine dritte Frau schwer verletzt wurde. Und wenn dann die völlig berechtigte Frage kommt, was wir denn zu tun gedenken, um die Menschen zu schützen, dann werden wir sagen: Keine Sorge, wir haben alles vorbereitet.«
Jakob, jetzt ebenfalls im weißen Overall und die Überzieher für seine Schuhe bereits in der Hand, sah, wie die beiden Streifenkollegen einen Blick tauschten und dann Mila musterten, die mit finsterer Miene vor dem Eingang zum Treppenhaus stand.
»Ich kenne Sie noch gar nicht«, sagte der Jüngere der beiden, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte. Er hatte seine dunkelblaue Wollmütze abgenommen und fuhr sich durch die strubbeligen rötlichen Haare. Er war etwa Anfang dreißig und kam Jakob bekannt vor. Allerdings kamen ihm alle Streifenpolizisten, mit denen er bei der Arbeit zu tun hatte, mehr oder weniger bekannt vor, ohne dass er sich jeden Einzelnen einprägte. Man nickte sich kurz zu während einer Ermittlung am Tatort, man unterhielt sich, wechselte einige unverbindliche Worte, stand nebeneinander an der Essensausgabe der Kantine oder sah sich bei der Abschiedsfeier eines Kollegen. Und er war mehr als ein Jahr fort gewesen, weit weg vom Dienst.
»Sie sind neu in der Stadt«, sagte der Polizist und ging mit einem Lächeln auf Mila zu. »Keine Sorge, wir werden das Gebäude jetzt absperren. Wir wollten warten, bis alles reingetragen wurde, aber das ist ja jetzt der Fall. Hat uns gefreut. Und willkommen zurück, Kollege Krogh.«
Der junge Mann nahm den anderen Streifenbeamten beiseite, der Mila immer noch finster anstarrte.
»Komm schon, Torben, lass gut sein. Es ist kalt, und da drinnen wird es nicht wärmer für die beiden. Viel Erfolg bei den Ermittlungen.«
»Ist das dein normales Vorgehen?«, fragte Jakob, als sie nebeneinander die Treppe hochstiegen und dabei ihre weißen Latexhandschuhe überzogen.
»Was meinst du?«
»Na, du schaffst es innerhalb kürzester Zeit, jede Menge Kollegen von deiner herzlichen Art zu überzeugen. Vorhin im Charlies, als Lasse …«
»Er hat mich angebaggert. Ich kenne diese Typen, die denken, sie seien Cowboys, die nur ihr Lasso rausholen müssen, um die dummen Kühe von der Weide zu holen. Ich habe keine Zeit für Wildwest-Spiele.«
»Alles klar, Pocahontas.«
»Lass den Quatsch, Jakob«, zischte sie.
Sie erreichten den zweiten Stock und standen vor einem langen Gang, von dem mehrere Türen abgingen. Da einige Deckenlampen defekt waren, hatte jemand Halogenstrahler aufgestellt, Kollegen der Spurensicherung waren bereits auf der Suche nach Fußabdrücken und anderen Beweisen.
»Hey«, sagte Jakob zu Mila und hob beide Hände. »Ich bin auf deiner Seite. Wir sind ein Team, ich habe nur einen Spaß gemacht.«
»Ist ein super Ort für Späße, wirklich. Zwei überfallene Frauen in den vergangenen zwei Monaten, jetzt die dritte. Alle drei werden brutal geschlagen, gefesselt und gedemütigt. Du weißt ganz genau, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis unser Mann zum Mörder wird. Du siehst es mir also nach, wenn ich ein anderes Mal lache.«
Mila hatte sich ihre Überzieher über die Schuhe gestreift und lief durch den Gang, ohne auf Jakob zu warten. Er beeilte sich, ihr zu folgen. Über ihren Köpfen flackerte eine Deckenlampe, das unregelmäßige Ticken der kaputten Leuchte begleitete sie bis zur offenen Wohnungstür.
Drinnen waren Stimmen zu hören, Kollegen der Spurensicherung schoben sich an ihnen vorbei. Einige erkannten Jakob und nickten ihm freundlich zu.
»Morgen, Krogh. Willkommen zurück.«
»Danke.«
»Du warst lange weg.«
»Jetzt bin ich wieder da.«
Jakob blinzelte, während seine Augen sich an das trübe Licht gewöhnten, Staub tänzelte in den schwachen Lichtstrahlen, die zwischen den Lamellen der Küchenjalousie hindurchdrangen.
Es kam ihm seltsam vor, dass sich die dunklen Monate, die hinter ihm lagen, mit so wenigen Worten treffend zusammenfassen ließen. Er war lange weg gewesen. Jetzt war er wieder da. Ende der Geschichte. Und der Beginn einer neuen, hier, im Haus mit der Nummer 87, am Rande der Siedlung hinter dem Wald. Sein erster Tatort nach mehr als anderthalb Jahren. Er spürte, wie in seinem Kopf Gedanken und Instinkte ihre Rollen tauschten, wie er eintauchte in sein altes Ich.
Sein Blick wanderte über das Geschirr auf dem Küchentisch, die Brotkrumen, das benutzte Messer. Die Butter in der Schale war weich und gelb, ein Frühstücksei aufgeschlagen, der Dotter längst vertrocknet. Die Flecken an der Tapete im Flur, die kleinen Blutspritzer, die die Spurensicherung mit Filzstift markiert hatte. Ein Handy auf einer Kommode, ein Paar Sneaker auf dem billigen Laminatboden. Eine orangefarbene Winterjacke am Haken an der Tür.
Jakob schloss kurz die Augen, fast meinte er, die Angst des Opfers riechen zu können. Er drehte sich noch mal zur Tür und drückte außen auf die Klingel. Ein schepperndes Geräusch drang durch die Wohnung, die Kollegen zuckten zusammen und drehten sich irritiert zu ihm um. Aus dem Wohnzimmer war eine röhrende Stimme zu hören.
»Auf so eine bescheuerte Idee kann nur einer kommen! Werft ihn sofort aus der Wohnung, das ist ein Tatort und kein Spieleparadies, Krogh!«
Jakob lächelte, als er Milas Stirnrunzeln wahrnahm. Sie war im Gespräch mit einem Kollegen und machte sich Notizen. Er ging an der kleinen Küche vorbei und warf durch die geöffnete Tür einen Blick in das Badezimmer. Der Duschvorhang lag auf dem Boden, die Stange hing diagonal über der Wanne. Der Spiegelschrank war halb aus der Verankerung gerissen, jemand hatte mit roher Gewalt gewütet. Jemand, den sie schnellstmöglich aufspüren mussten, wenn sie nicht gleich zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit eine herbe Niederlage einstecken wollten.
Dann betrat er das Wohnzimmer. Dort standen ein kleiner Esstisch, ein Sofa und ein Fernseher auf einem Sideboard. In einer Nische befand sich ein Arbeitsplatz mit Laptop. Das Display war zersplittert, mehrere Tasten waren herausgebrochen. Eine Weinflasche hatte einen roten Rand auf dem Teppich unter dem Couchtisch hinterlassen. Bücher waren aus einem Regal gerissen, der Inhalt einer Handtasche lag verstreut auf einem Stuhl und dem Boden.
Einer der vier Männer im Raum stand nun auf, klopfte sich den Staub vom weißen Schutzanzug und reichte Jakob die Hand.
»Kleiner Scherz zum Wiedereinstieg, mein Lieber? Mir ist fast das Herz stehengeblieben beim verdammten Scheppern der Klingel.«
Er drückte die Hand des Mannes, der deutlich größer war als er.
»Hallo Björn.«
»Hallo Jakob, da bist du also wieder. Gut siehst du aus, ein bisschen schmaler geworden, ein bisschen blasser. Offenbar gab es da, wo du warst, zu wenig Licht und zu wenig gutes Essen. Aber das kriegen wir wieder hin. Bist du heute Abend schon verabredet?«
Jakob nickte zwei anderen Männern zu, die in ihren Schutzanzügen Oberflächen nach Fingerabdrücken absuchten.
»Ich treffe Lasse im Charlies. Komm gern dazu.«
Björn Thomsen war der Leiter der Gerichtsmedizin, sie hatten gemeinsam bereits einige Ermittlungen entscheidend voranbringen können, hatten Ergebnisse diskutiert, Schlüsse gezogen. Wann immer es seine Zeit zuließ, begab sich Thomsen persönlich zum Tatort, und Jakob war überzeugt, dass die bislang ungeklärten Überfälle auch ihm zu schaffen machten, dass auch er nach Antworten suchte. Zumal die Brutalität des Täters offensichtlich zunahm.
Thomsen war Mitte fünfzig, groß, trug einen weißen, gepflegten Vollbart, was ihm in Verbindung mit dem weißen Schutzanzug die Aura eines weisen Magiers gab. Der Blick aus seinen eisgrauen Augen senkte sich auf Jakob. Er betrachtete ihn eindringlich, seine Hände lagen dabei auf Jakobs Schultern.
Mila war inzwischen zu ihnen getreten, das Wohnzimmer schien durch die Anwesenheit von nun insgesamt sechs Menschen immer weiter zu schrumpfen. Neben Jakob, Thomsen und den beiden anderen Kollegen der Spurensicherung befand sich noch ein weiterer Mann im Raum. Er stand mit dem Rücken zu ihnen am Fenster und telefonierte. Er mochte zwei Meter groß sein, trug eine grüne Bomberjacke, der Schädel war kahlrasiert. Seine Stimme allerdings stand im krassen Gegensatz zu dieser Erscheinung. Sie war sanft und melodisch, mit einem klaren Akzent aus dem hohen Norden.