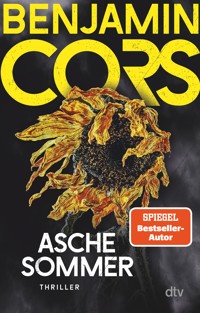19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nicolas Guerlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Drei Fälle für Nicolas Guerlain, den toughen Personenschützer mit einer Vorliebe für Chansons und dem Herzen eines großen Liebenden. Temporeich, hochspannend, atmosphärisch: Die ersten drei Fälle für den charismatischen Personenschützer Nicolas Guerlain. Strandgut: Ein unverzeihlicher Fehler vor den Augen der Weltöffentlichkeit: Für den jungen Personenschützer Nicolas Guerlain wird ein Auftrag zum Desaster, als er vor laufender Kamera den Mann zu Boden schlägt, den er eigentlich beschützen sollte. Er wird strafversetzt, ausgerechnet in seine alte Heimat, den Badeort Deauville in der Normandie. Dort aber spült das Meer seltsame Dinge an Land – und für Nicolas beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit … Küstenstrich: Drei Morddrohungen in nur einer Woche am Zaun eines exklusiven Anwesens in der Normandie. Jemand hat es ganz offenbar eilig, den Eigentümer der Luxusvilla, einen zwielichtigen Adeligen, zu töten. Verhindern soll dies Nicolas Guerlain, einer der besten Personenschützer des Landes. Doch noch bevor er Bekanntschaft mit seiner Schutzperson machen kann, stößt Nicolas auf eine Leiche: Vom Pont de Normandie hängt eine leblose Gestalt. Und das ist erst der Anfang … Gezeitenspiel: BODYGUARD. Dieses Wort versucht ein sterbender Mann an der Küste der Normandie mit letzter Kraft in den Boden zu ritzen. Die Buchstaben sind eine Botschaft und führen zu Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen Regierung. Zur gleichen Zeit erfährt Nicolas, dass ein Anschlag auf die Feierlichkeiten in der Normandie am 6. Juni droht, dem Jahrestag der Alliierten-Landung. Ein mörderisches Spiel beginnt, das Nicolas um jeden Preis gewinnen muss, denn der Einsatz ist so hoch wie nie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1437
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Strandgut
Ein unverzeihlicher Fehler vor den Augen der Weltöffentlichkeit: Für den jungen Personenschützer Nicolas Guerlain wird ein Auftrag zum Desaster, als er vor laufender Kamera den Mann zu Boden schlägt, den er eigentlich beschützen sollte. Er wird strafversetzt, ausgerechnet in seine alte Heimat, den Badeort Deauville in der Normandie. Dort aber spült das Meer seltsame Dinge an Land – und für Nicolas beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …
Küstenstrich
Drei Morddrohungen in nur einer Woche am Zaun eines exklusiven Anwesens in der Normandie. Jemand hat es ganz offenbar eilig, den Eigentümer der Luxusvilla, einen zwielichtigen Adeligen, zu töten. Verhindern soll dies Nicolas Guerlain, einer der besten Personenschützer des Landes. Doch noch bevor er Bekanntschaft mit seiner Schutzperson machen kann, stößt Nicolas auf eine Leiche: Vom Pont de Normandie hängt eine leblose Gestalt. Und das ist erst der Anfang …
Gezeitenspiel
BODYGUARD. Dieses Wort versucht ein sterbender Mann an der Küste der Normandie mit letzter Kraft in den Boden zu ritzen. Die Buchstaben sind eine Botschaft und führen zu Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen Regierung. Zur gleichen Zeit erfährt Nicolas, dass ein Anschlag auf die Feierlichkeiten in der Normandie am 6. Juni droht, dem Jahrestag der Alliierten-Landung. Ein mörderisches Spiel beginnt, das Nicolas um jeden Preis gewinnen muss, denn der Einsatz ist so hoch wie nie.
Benjamin Cors
Mörderische Normandie I (3in1-Bundle)
Strandgut Küstenstrich Gezeitenspiel
Strandgut
Kriminalroman
Für Katrin
C’est un peu décevant, Deauville sans Trintignant
Es ist ein wenig enttäuschend, Deauville ohne Trintignant
Vincent Delerm, 2002
Teil einsEbbe
Deauville
Im Herbst 1967
Antoine Bazin war ein gewissenhafter Mensch. Er war nie voreilig, stets dachte er zuerst nach, bevor er handelte. Weil dies oft eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, galt Bazin bei den wenigen Menschen, die ihn wirklich kannten, nicht unbedingt als besonders schnell. Aber eben als sehr gewissenhaft, und er selbst fand, dass dies wesentlich wichtiger war. Denn eine schnelle Entscheidung war selten die richtige. Eine gewissenhafte Entscheidung blieb hingegen, ob richtig oder falsch, doch immer gewissenhaft. So sah er das.
Und daher war er verblüfft, wie sehr er an jenem Abend von sich selbst überrumpelt wurde. Nach mehr als zehn Jahren als Croupier im Casino von Deauville traf er eine Entscheidung, die nicht nur schnell war, sondern auch grundlegend falsch. Und eben überhaupt nicht gewissenhaft. Aber als er das bemerkte, war es bereits zu spät, und am Ende der Nacht war Antoine Bazin tot.
Der Mann kam gegen dreiundzwanzig Uhr an seinen Tisch. Er war nicht sehr groß, eher jung als alt, was aber aufgrund seines etwas gedrungenen Körpers schwer einzuschätzen war. Bazin hatte das unbestimmte Gefühl, ihn schon einmal gesehen zu haben. Zwei andere Croupiers saßen mit ihm am Tisch, und noch ein weiterer, es war an diesem Abend Bécaud, etwas abseits auf einem leicht erhöhten Holzstuhl.
Er hätte wissen müssen, dass sein Fehler nicht unbemerkt blieb. Mit Bécaud war nicht zu spaßen, das galt für Spieler wie für Croupiers.
Bazin hatte dem Mann, der jetzt zwei Stühle neben ihm einen frei gewordenen Platz einnahm, zuerst auf die Hände geschaut. Das tat er immer bei einem neuen Spieler, und aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie die anderen Croupiers den Neuen ebenfalls musterten. Oben auf seinem Sitz beobachtete auch Bécaud in diesem Moment misstrauisch jede Bewegung des Gastes. Der Croupier aber, der dem neuen Spieler am nächsten saß, war nun mal er, Bazin. Erst im Laufe der Nacht würde ihm klar werden, dass der Fehler, den er gemacht hatte, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt unvermeidlich gewesen war.
Bazins Tisch stand im linken Teil des großen Saals. Das Licht der Kronleuchter spiegelte sich auf den Gläsern und Zigarettenetuis der acht Spieler und wurde von dort auf den Roulettetisch geworfen. Ein stetes Murmeln schob sich durch den Raum, begleitet vom feinen Klicken der Kugel, die erst zögernd, dann zielsicher auf der 24 landete, gefolgt von den kurzen und präzisen Ansagen des Croupiers.
»24, schwarz, Pair und Passe, gerade und in der zweiten Hälfte des Tisches. Mittleres Dutzend.«
Ein Schieber glitt über den Filz und sammelte die Einsätze ein, während gleichzeitig die Gewinne in fließenden Bewegungen ausgeteilt wurden. Kein Jeton gelangte an eine falsche Stelle.
Die Hände des Mannes lagen auf dem Tisch wie zwei Stücke totes Fleisch.
Hände, die sich wenig bewegten, waren schwer zu lesen. Und Antoine Bazin war einer der Besten, wenn es darum ging, Hände zu lesen, die Absichten ihres Besitzers am Trommeln der Finger zu erkennen, am nervösen Verschieben eines Eherings. Gepflegte Hände, zitternde Hände. Schweiß, Unruhe, Gelassenheit. Eine Transversale, das Setzen auf eine Querreihe aus drei Zahlen, als maximales Risiko. Die Bereitschaft zur Unvernunft. Ein Kolonnen-Spieler. Passe und Manque, den ganzen Abend. Oder ein Cheval, das Setzen auf zwei nebeneinanderliegende Zahlen. Hohes Risiko. Auszahlungsquote 17:1. Bazin brauchte oft nur wenige Augenblicke, um seine Spieler im Kopf zu sortieren. Er schob sie in Schubladen, im gleichen Rhythmus, wie der Schieber die Jetons von ihnen wegholte. Er gab ihnen Namen und Bezeichnungen, sortierte sie in eine bestimmte Reihenfolge und änderte diese, wenn ein Spieler sich vom Tisch erhob. Bazin räumte gerne auf, und die Gedanken an sein langweiliges Leben außerhalb des Casinos kamen dabei in seinem Kopf stets weit nach hinten. Er durfte gar nicht erst an das viele Geld denken, das in Form von Jetons vor ihm lag. Ein neues Leben an einem anderen Ort, weniger trostlos. Es lag jeden Abend vor ihm, dieses Leben, und er sortierte es, stapelte und ordnete es nach Größe und Farben.
Und er gab es aus den Händen, jedes Mal.
Aber immerhin, er räumte auf, das gefiel ihm. Nur wenn jemand diese Aufräumarbeiten behinderte, sie ins Stocken gerieten, brachte ihn das aus der Ruhe. Und genau das geschah gegen dreiundzwanzig Uhr, als jener Mann sich an seinen Tisch setzte, beim Kellner einen Wodka bestellte und seine toten Hände auf den grünen Filz legte. Antoine Bazin gab ihm den Namen Schnitzel.
Er hasste Unordnung.
Sie verursachte Schmerzen am ganzen Körper, sie ließ ihn fahrig werden und unkonzentriert. Roulette hatte eine Ordnung, so wie Bazins Leben eine Ordnung hatte. Es gab siebenunddreißig Felder, es gab Rot und Schwarz, Pair und Impair. Passe und Manque waren nicht hinterfragbar. Links, rechts, Mitte. Dazu Reihen und Blöcke. Wer Roulette spielte, der musste sich an eine perfekt komponierte Ordnung halten, so wie sich Bazin an den Weg hielt, den die rollende Kugel des Lebens ihm zugewiesen hatte. Seine kleine Wohnung an der Hauptstraße von Blonville lag auf der linken Seite, Hausnummer 29. Impair, Passe. Drittes Dutzend. Er wohnte im zweiten Stock, rechts. Pair, Manque. Mittlere Kolonne. Sein Klingelschild war rot. Wenn er auf dem Weg zur Arbeit die Hauptstraße überquerte und etwas vergessen hatte, kehrte er niemals einfach um. Lieber würde er drüben ankommen, sich umdrehen und wieder zurückgehen.
Keine Unordnung.
Erst recht nicht, wenn es um Geld ging.
Unter all den Unmöglichkeiten, die das Leben ihm aufbürden konnte, war demzufolge ein unsortierter Haufen Jetons die größte aller denkbaren Katastrophen. Bazin musste sich zwingen, nicht über den Tisch zu greifen, um die Jetons zu ordnen. Immerhin lag dort ein beträchtlicher Wert, einschließlich mehrerer eckiger blauer Jetons. Das Schnitzel musste zuvor an einem anderen Tisch groß abgeräumt haben.
Bazin schwitzte. Er dachte an die Baustelle in seiner Straße, sein Bus hatte einen Umweg fahren müssen, und er war heute Morgen von der falschen Seite nach Hause gekommen. Links war rechts.
Unordnung. Er hätte ahnen müssen, dass dieser Tag kein guter werden würde.
Die Hände des Mannes waren grobschlächtig, sie sahen aus wie das ausgefranste Ende seiner mittlerweile erkalteten Zigarre. Vor ihnen der Haufen, in all seiner perversen Unordnung. Bazin schluckte.
»Faites vos jeux.«
Der Fehler geschah etwa zwei Stunden später. Aus dem Hügel war ein Berg geworden, und Bazin verabschiedete jeden Jeton, den er in Richtung des Mannes werfen musste, mit einem mitleidigen »Au revoir«.
Seine Schicht würde in dreißig Minuten enden.
9, rot, Impair. Manque, dritte Kolonne.
Ein selbstgefälliges Schnaufen von links, und Bazin wusste, wohin er gleich wieder sehr viel Geld würde schieben müssen. Das Schnitzel leerte mit einem Grinsen sein viertes Glas Wodka und wartete auf die Jetons. Er hatte eine Transversale gesetzt, auf 7, 8 und 9. Quote 11:1. Und obwohl Bazin ihm den Stapel fein geordnet hinüberschob, ließ der Mann die Jetons einzeln auf den Haufen fallen. Schließlich schob er seinen Stuhl nach hinten, stand auf und warf Bazin, ohne ihn dabei anzusehen, einen großen blauen Jeton zu. Dann blickte er auf die Uhr und murmelte: »Müsste längst fertig sein, die Schlampe.«
Er war mittlerweile sichtlich angetrunken.
In einer geschmeidigen Bewegung, die man nach mehr als zehn Jahren am Tisch beherrschen musste, hatte Bazin den Jeton mit der rechten Hand aufgegriffen, schob ihn über den Filz in seine linke Hand und ließ ihn von dort in einen für das Trinkgeld vorgesehenen Schlitz in der Tischplatte verschwinden. Er nickte dem Mann zu, der sich aber bereits abgewandt hatte.
Da war er. Der Fehler.
Antoine Bazin hatte an diese Hände denken müssen, an den unsortierten Haufen vor seinen Augen und an sein eigenes Leben, das ohne jede Ordnung wäre, wenn seine Mutter einmal sterben würde. Ein neues Leben bekam man nicht für einen eckigen Jeton. Aber vielleicht ein wenig Ablenkung. Letztendlich aber fällte er seine Entscheidung, ohne vorher wirklich darüber nachzudenken. Und ohne gewissenhaft zu sein.
Das schimmernde blaue Rechteck lag noch immer unter seiner linken Handfläche. Ein kleiner runder Jeton war dafür ungesehen im Schlitz verschwunden. Als er kurz darauf von einem anderen Croupier abgelöst wurde, bemerkte er, dass der Stuhl von Bécaud leer war.
Wenig später verließ Antoine Bazin das Casino durch den Personaleingang, draußen regnete es leicht, und die Straßenlaternen standen mit gesenkten Köpfen auf dem Pont des Belges. Ihr mattes Licht reichte kaum hinab zu den dunklen Wassern der Touques. Anfangs ging er noch etwas zaghaft, dann jedoch mit festem und zielgerichtetem Schritt hinüber auf die andere Seite des Flusses, der nicht weit von hier ins Meer mündete. Die Straßen waren menschenleer, der Wind trieb den Nebel von der Mündung herein, vorbei an den Platanen und den Fischerbooten, die an Seilen befestigt auf die Flut warteten. Eine Möwe schaukelte schlafend in der Mitte des Flusses, und Bazin überlegte kurz, ob er nicht doch lieber den Nachtbus nach Blonville hätte nehmen sollen. Linie sieben. Rot, ungerade, in der ersten Hälfte. Erste Kolonne. Aber dann dachte er an das ausgefranste Ende einer erkalteten Zigarre, an fleischige Hände, die ein Wodkaglas erwürgten, und an das Bündel Geld in der Innentasche seines eigenen billigen Mantels.
Bazin hatte die Entscheidung, hinüber nach Trouville zu laufen, sorgsam getroffen. Er hatte sich den blauen Jeton verdient, weil er den Anblick des Mannes ertragen hatte. Ein Stammkunde hatte sich für ihn den Jeton an der Kasse auszahlen lassen. Der Mann war eine treue Seele und ihm außerdem etwas schuldig. Bazin wusste, dass andere Croupiers ähnlich vorgingen, um ihren Stundenlohn zu erhöhen. Für ihn selbst war es das erste Mal, und er schämte sich dafür, genau wie für seinen Wunsch, das Geld im »Kakadu« auszugeben. Immerhin, er wollte es dort mit Bedacht einsetzen.
Er bog rechts ein in die Avenue du Président, ein Wagen tastete sich an ihm vorbei durch die Nacht. Er würde nach Janine fragen. Janine war jünger als er, aber nicht zu jung. Sie roch angeblich gut, sein Bruder war Stammkunde im »Kakadu« und hatte von ihr erzählt. Antoine Bazin war nirgendwo Stammkunde, außer im Zimmer seiner Mutter, die er tagsüber pflegte.
Er würde Janine bestimmt mögen, hatte sein Bruder gemeint und dabei höhnisch gelacht. Rote Haare, weiße Haut. Sollte Janine nicht da sein, würde er wieder gehen. Das hatte er mit sich selbst beim Verlassen des Casinos vereinbart. Sie befand sich nach Angaben seines Bruders altersmäßig ungefähr in der Mitte des dritten Dutzend. Vielleicht zweiunddreißig, Pair und Passe. Quote 35:1. Der nächste Bus nach Blonville fuhr in einer halben Stunde. Noch konnte er ihn erreichen.
Als Bazin hinter sich Schritte hörte, blieb er stehen.
Die Touques gluckste zufrieden unterhalb der Brüstung. Der Nebel hatte sich mittlerweile bis auf Höhe des Kopfbahnhofes vorgeschoben, der auf der anderen Seite des Flusses kaum noch zu erkennen war. Er starrte in die Dunkelheit, konnte aber nichts sehen. Dabei hätte er schwören können, dass da Schritte waren. Weiter vorne erahnte er in einiger Entfernung das flackernde Licht über dem Eingang des »Kakadu«. Vor dem Haus konnte er eine Silhouette erkennen. Er räusperte sich, um die Stille zu vertreiben.
Als er sich umdrehte, sah er aber wieder nur die Schatten der Häuser und in der Ferne das schwankende Signallicht eines Kutters. Er nahm seine Brille ab, durch den Nebel begannen die Gläser zu beschlagen. Sein eigener Atem hing verloren in der Luft. Er dachte an Bécauds leeren Stuhl. Hatte er etwas mitbekommen? Aber wenn ja, hätte das Casino ihn nicht sofort festgehalten, kaum dass er den großen Saal verließ? Andererseits, Bécaud hatte ihn schon immer im Blick gehabt, ihn argwöhnisch beobachtet.
»Bazin, behalte deine Finger in der Nähe meiner Augen, dann werden wir beide die besten Freunde«, raunte er ihm immer wieder zu.
Ein blauer Jeton unter der Hand. Ein runder Jeton im Schlitz. Er drehte sich um und ging hastig in Richtung des Lichts, die Nacht verschluckte das Echo seiner Schritte.
Die Silhouette blickte ihn höhnisch an.
»Da hat es aber jemand eilig! Lange nicht mehr zum Zug gekommen, was?« Der Mann schnippte Asche von seiner Jacke. Er stand auf der obersten Stufe, direkt vor dem Eingang, und blickte auf Bazin herab.
»Guten Abend, ich möchte gerne …«
»Schon klar, was du willst. Aber so läuft das hier nicht. Warum sollte ich dich reinlassen?«
Bazin stammelte etwas, er fühlte sich unwohl. Er dachte an Janine. Eine andere wollte er nicht. Der Mann war größer als er, ein gewaltiger Brustkorb zeichnete sich unter der Sportjacke ab. Sein kahlrasierter Kopf glänzte im roten Neonlicht. Er grinste wie das Schnitzel, das soeben mit einer Transversale viel Geld gewonnen hatte.
»Ich kann bezahlen …« Bazin ahnte, dass er das nicht hätte sagen sollen, aber er fror, und der Nebel umhüllte ihn von allen Seiten.
»So, so, der Herr kann bezahlen. Beim Roulette gewonnen, oder was?«
Ihm wurde heiß, und er wollte wieder umkehren, aber die Dunkelheit hinter ihm hinderte ihn daran. Er dachte an die Schritte und nahm einen Schein aus seiner Innentasche, streckte ihn dem Mann entgegen und räusperte sich.
»Ah, das nenne ich mal ein gutes Argument!« Der Mann in der Sportjacke schob sich zur Seite und schlug Bazin lachend auf die Schulter. »Willkommen im ›Kakadu‹, das warme Zuhause für Gewinner und solche, die es gerne wären!« Ein schallendes Lachen begleitete Bazin nach drinnen.
Er nahm den Hut ab und öffnete den schweren Samtvorhang.
Janine hieß in Wirklichkeit Isabelle, und ihre echten Haare waren nicht rot, sondern durchzogen von einer aschblonden Müdigkeit. Die Arbeit im »Kakadu« hatte ihre Haut fahl werden lassen, um ihre Augen zeichneten sich die langen Nächte ab. Mittlerweile brauchte sie zwischen zwei Kunden ein paar Minuten länger, um sich aufzuhübschen. Es war daher nicht gerade von Vorteil, dass ihr Gast in ihrem Arm eingeschlafen war. In zwanzig Minuten würde Bruno an die Tür klopfen und sie auffordern, nicht herumzutrödeln.
Sie flüsterte leise Bazins Namen, es war an der Zeit. Außerdem wollte sie sich auf gar keinen Fall dem Gedanken hingeben, wie es wäre, in einem normalen Bett, einem normalen Zimmer, einem normalen Leben. Sie nahm einen Schluck Weißwein, der auf dem Nachttisch stand. Er ist nett, dachte sie. Ein netter, unscheinbarer Mann.
»Allez, Antoine, wachen Sie auf!«
Bazin murmelte etwas, drehte sich schlaftrunken um und griff nach einem Kissen. Janine kniff ihn in die Seite und blickte auf die Uhr. Noch zehn Minuten, verdammt.
»Raus jetzt, Bruno wird stinksauer, wenn ich nicht gleich wieder bereit bin!« Hastig begann sie, sich anzuziehen.
»Doppelt …«, murmelte Bazin, aber sie hörte ihm nicht zu, während sie nach ihrem Rock griff.
»Los! Hören Sie!«
»Ich habe das Doppelte bezahlt. Wir haben Zeit.« Bazin setzte sich jetzt mühsam auf, tastete nach seiner Brille und lächelte sie verlegen an. »Ich dachte, vielleicht … Also, wir könnten doch einfach liegen bleiben, oder?«
»Sie haben das Doppelte gezahlt? Warum haben Sie das nicht vorher gesagt, ich hätte Ihnen …«
»Nein, nein …«, stotterte er. »Ich wollte nur die Zeit. Einfach nur … die Zeit.«
Sie setzte sich wieder auf die Bettkante und blickte ihn unschlüssig an. Draußen flackerte die Neonanzeige und warf rote Linien auf ihr Gesicht.
»Was meinen Sie mit Zeit?«
»Wir haben noch genau zwei Stunden«, sagte Bazin und dachte an schwarz, Pair, Manque. Gewinnchance 2:1, er und sie. Und an diesen Bruno, der hinter der Bar gestanden und nach seinem Geld gegrabscht hatte. Er stand auf und zog sich an, um ihr zu zeigen, dass er sie nicht nackt wollte. Er hasste seinen schlaffen Körper und fühlte sich angezogen deutlich wohler.
»Und was machen wir jetzt, reden? Karten spielen?« Janine war immer noch verblüfft.
»Was du willst.«
Zwei Stunden. Sie zündete sich eine Zigarette an und ging ans Fenster. Der Nebel war noch dichter geworden, aber es wurde allmählich heller. Der Tag würde bald beginnen, und sie konnte mit einiger Mühe die Umrisse eines kleinen Fischkutters erkennen, der seinen Bug langsam Richtung Flussmündung drehte. Sie öffnete das Fenster einen kleinen Spalt.
Bazin hatte mittlerweile seine Hose und sein Hemd angezogen und setzte sich auf den roten Plüschsessel in der Ecke. Seine Hände spielten nervös mit dem halbleeren Weinglas, er hatte eigentlich gar nicht so viel trinken wollen. Er blickte durchs Zimmer. Das große Bett, der Spiegel, die Tapeten, die in den Ecken abgewetzt waren. In der linken oberen Ecke war ein Schimmelfleck zu sehen, hinter einem gelben Paravent stand ein kleiner Tisch mit Schminksachen. Er schloss die Augen und hörte das Geräusch eines eckigen blauen Jetons, der durch den Schlitz im Tisch hinabfiel. Er würde seiner Mutter Blumen kaufen. Einen großen Strauß Lilien vielleicht. Zwölf Lilien, Pair, Manque, dritte Kolonne. Weiß wie die Null.
Als er die Augen öffnete, kniete Janine direkt vor ihm. Er merkte, dass sie zitterte.
»Antoine. Sie müssen mir einen Gefallen tun.«
Als er das nächste Mal auf die Uhr blickte, blieben ihnen noch siebzehn Minuten. Schwarz. Ungerade. Fast in der Mitte des Tisches, am schwersten mit dem Schieber zu erreichen. Die 17 war keine gute Zahl, aber das war egal, denn dies war ein guter Moment.
Er spürte Janines warme Finger in seiner Hand und einen leichten Salzgeschmack auf den Lippen. Er hörte die Möwen hoch über ihnen und das leise Tuckern eines Bootes, das sich aus dem Hafen hinausschob auf die offene See. Er konnte den Sand zwischen den Zehen spüren und die aufsteigende Unruhe in seinem Innern. Siebzehn Minuten, das war nicht viel. Das Meer lag flach vor ihnen, wie der Spiegel über einem Tisch hinter einem gelben Paravent. Der Horizont hatte sich aufgelöst.
Sie waren durch den Hinterausgang des »Kakadu« geschlichen, wie zwei Diebe in der Nacht. Mit klopfendem Herzen hatte Bazin sie bei der Hand genommen und war mitten hineingelaufen in den Nebel. Die ersten Seeleute waren in den Straßen zu sehen, auf dem Weg zum Hafen. Die Flut kam mit schnellen, feuchten Schritten, und als sie über den Pont des Belges liefen, konnten sie sehen, wie ein blauer Kutter mit dem hübschen Namen Notre Dame de Grâce sich bereit machte, auszulaufen.
Meine Dame, dachte Bazin.
»Lassen Sie uns an den Strand gehen«, hatte Janine ihm in ihrem Zimmer zugeflüstert, ihr Atem ging schnell. »Ist es ruhig dort, jetzt um diese Zeit?«, hatte sie gefragt und ihn mit großen Augen angesehen.
»Janine, du weißt, dass du nicht raus …«
»Bitte! Ich will das Meer sehen. Und die Stille.«
Im engen, muffigen Zimmer des »Kakadu« hatte er es noch als seltsam empfunden, dass sie meinte, Stille hören zu können. Hier draußen am Strand verstand er es.
Bruno durfte sie auf keinen Fall sehen, Janine hatte panische Angst vor ihm. Aber offenbar war ihre Sehnsucht nach dem Meer größer.
»Er bringt uns um, wenn er erfährt, dass ich mit Ihnen abgehauen bin«, hatte sie geflüstert, während sie die Treppen hinabstiegen. Seltsamerweise dachte Bazin, dass ihm das egal war. Er hatte nichts zu verlieren in dieser Nacht.
Er hatte das Licht ausgemacht, als sie Janines Zimmer verließen, er machte immer das Licht aus, wenn er einen Raum verließ. Antoine Bazin war gewissenhaft. Dass ein dunkles Zimmer Verdacht erregen konnte, daran hatte er nicht gedacht.
Der Nebel hatte sich etwas gelichtet, als sie in Deauville die Rue Mirabeau entlangliefen. Hinter ihnen entstand noch etwas zögerlich das erste Licht des Tages. Von Bruno keine Spur, offenbar hatte keiner ihren kleinen Ausbruch bemerkt.
Und jetzt blieben ihnen nur noch vierzehn Minuten. Pair, Manque, zweites Dutzend. Sie würden rennen müssen, wieder zurück über die Touques, aber es war zu schaffen. Und es war es wert gewesen.
Sie hatten die hölzernen Planches von Deauville überquert, die berühmte Strandpromenade mit den grünen Türen, und die Schuhe ausgezogen, als sie den Sand erreichten. Janine hatte seine Hand fest umklammert und angefangen zu weinen. Er wusste nicht warum, aber er wollte vor allem, dass sie seine Hand nicht losließ.
Das Wasser hatte sich aus der Dunkelheit herausgeschält. Ein grauer Vorhang, der sich langsam hob. Bazin schaute auf die Uhr. Er räusperte sich leise.
»Janine, wir müssen zurück.«
Sie drehte den Kopf und schaute ihn an. Dann wischte sie sich über die Augen und lächelte.
»Antoine Bazin. Du bist ein guter Mann. Und jetzt los!« Sie lachte hell auf. Dann rannten sie zurück Richtung Promenade.
Bazin keuchte bereits heftig, als sie die Planches erreichten. Aber dass sie ihn geduzt hatte, machte ihn froh.
Im Nachhinein wusste er nicht, was er zuerst bemerkt hatte.
Das Geräusch.
Oder die Fußabdrücke.
Aber das Nachhinein war auch nicht besonders lang.
Er wusste nur, dass er auf das beleuchtete Casino geblickt hatte, das immer wieder ein erhabenes Gefühl in ihm auslöste. Das große Casino von Deauville. Es waren nur wenige Schritte von dort bis zur Promenade, auf der sie nun entlanghasteten.
In zwölf Minuten mussten sie zurück sein im »Kakadu«.
Zu dieser frühen Stunde waren nicht einmal Hundebesitzer unterwegs, die grünen Holztüren der Umkleidekabinen waren geschlossen, ein vergessener Sonnenschirm lag einsam in einer Ecke.
»Allez, Antoine!«
Bazin blieb stehen. Da war ein Wimmern. Leise, kaum hörbar. Gerade hatten sie abbiegen wollen, die Planches verlassen, um durch die Straßen der Stadt wieder zurückzulaufen. Bazin rang nach Atem, er war es nicht gewohnt, zu rennen.
Janine hörte es jetzt auch.
Unschlüssig blickte sie zu ihm. Die Fußabdrücke begannen kurz hinter der Umkleidekabine von June Alysson. Der Name der Broadway-Schauspielerin war mit schwarzer Farbe auf das weiße Geländer geschrieben. Links daneben stand der Name Douglas Fairbanks jr. Es folgten Tony Curtis und Jean Nebulesco. Dutzende bekannter Schauspieler und Regisseure waren an den Kabinen verewigt, sie alle hatten das Festival von Deauville besucht. Bazin hatte einige von ihnen im Casino gesehen, aber da er sich nicht fürs Kino interessierte, hatte er die Namen und Gesichter schnell wieder vergessen.
Das Wimmern wurde lauter. Zögernd gingen sie an den Umkleidekabinen entlang, Janine hatte wieder seine Hand genommen. Ihnen war nicht entgangen, dass die Fußabdrücke noch feucht waren. Frisch.
Und dass sie eine rötliche Farbe hatten.
Die Konturen der Fußsohlen waren mit jedem Schritt besser zu erkennen, die Zehen zeichneten sich deutlich auf dem Holz ab. Es waren die Fußspuren einer Frau. Bazin wollte sich räuspern, aber mehr als ein trockenes Schlucken gelang ihm nicht. Es wurde heller um sie herum. Ein neuer, grau melierter Tag hatte begonnen.
Die Frau saß zwischen Rock Hudson und Shelley Winters, und an ihren nackten Beinen trocknete das Blut nur langsam. Sie hatte den Rücken an die grüne Holztür gelehnt und atmete ruhig.
»Mon Dieu!«, flüsterte Janine. Bazin merkte, dass er den Atem anhielt.
Die Frau hat keine Schuhe dabei, war das Erste, was ihm durch den Kopf ging. Vielleicht, weil er selbst seine Schuhe noch in der Hand hielt, er hatte sie erst an der Straße anziehen wollen, wo kein Sand mehr war. Sie war jung. Manque, gerade eben im letzten Drittel, schätzte er. Die dunklen Haare lagen strähnig auf ihren Schultern, der knielange Rock war hochgerutscht. Auf dem Wollmantel waren zahlreiche Blutflecke zu sehen.
»Ist sie tot?«
Bazin hatte noch nie eine Tote gesehen, schon der Anblick von so viel Blut ließ ihn schwindelig werden. Langsam ging er auf die Frau zu, ihre rechte Hand hatte einen blutigen Abdruck auf Rock Hudsons weißem Geländer hinterlassen.
Ihre Lippen bewegten sich unmerklich.
Die Augen waren geschlossen, der Kopf leicht nach links gekippt. Bazin ließ Janine los und beugte sich zu der Frau hinab. Das Blut begann die Holzplanken zu verfärben.
»Da Da Da Dabadabada …«
Es war eine Melodie. Kaum hörbar versuchte die junge Frau, eine Melodie zu flüstern, und für einen kurzen Moment kam Leben zurück in ihren Körper. Sie lächelte.
»Hören Sie mich? Sollen wir Hilfe holen?«
Was für eine idiotische Frage, Bazin verfluchte sich selbst. Janine würde denken, er sei ein Feigling. Er suchte nach einer Handtasche, einem Portemonnaie. Und er ertappte sich dabei, dass er auch nach einer Waffe suchte, bei so viel Blut musste doch …
»Da Da Da Dabadabada …«
Ihre Augen waren noch immer geschlossen, Blut tropfte von ihren Beinen auf das Holz. Bazin fühlte sich hilflos und dachte an das Casino. Das war am nächsten, er würde zum Casino laufen und Hilfe holen.
Janine hatte sich jetzt ebenfalls zu der Frau hinuntergebeugt, offensichtlich machte ihr das viele Blut weniger aus. Sie hielt ihr Ohr ganz dicht an den Mund der jungen Frau.
»Janine, wir müssen Hilfe holen.«
»Ich kenne diese Melodie«, sagte sie leise. »Ich habe sie schon einmal gehört, und ich weiß auch wo.«
Bruno hatte sie vor einigen Monaten mit ins Kino genommen, sie hatte ihn deswegen tagelang angefleht, ihm versprochen, noch mehr zu arbeiten, noch mehr Geld für ihn zu verdienen, wenn er sie nur ein Mal ins Kino gehen ließe. Sie hatte in der letzten Reihe gesessen und leise geweint, während er sich draußen an der Bar ein Bier gönnte. Ein großer samtener Vorhang hatte sich gehoben, das Licht im Saal war erloschen, und sie hatte noch tagelang diese Melodie im Kopf gehabt.
Die Stimmen hörten sie beide gleichzeitig. Sie drangen von weit weg leise durch die feuchte Luft und vermischten sich mit dem noch müden Krächzen der Möwen.
»Sie muss doch … irgendwo … Scheiße!«
Bazin wollte aufstehen, um nach Hilfe zu rufen, als jemand seine Hand festhielt. Er spürte eine klebrige Flüssigkeit auf seiner Haut und erschauerte. Die junge Frau hatte ihre Augen weit aufgerissen, und er blickte in ein so tiefes Blau, dass er dachte, darin ertrinken zu müssen, wenn sie ihn weiterhin so anblickte. In ihrem Blick lag nackte Angst.
»Keine Angst, da kommt Hilfe«, flüsterte er. Er wusste nicht, warum er noch immer leise sprach.
»Weg …« Die Frau versuchte sich aufzurichten, sie zitterte, und Bazin bemerkte, wie erschöpft sie aussah.
Entleert.
Die Stimmen kamen näher.
»Sie müssen weg … schnell!« Es war kaum mehr als ein Flüstern, das ihre Lippen verließ, aber sie sprach die Worte mit einer solchen Härte aus, dass Bazin es mit der Angst zu tun bekam. Unschlüssig blickte er Janine an.
»Bitte … weg.«
Ein leichter Wind war aufgekommen und trug die letzten Fetzen Nebel hinaus aufs Meer, wo dieser sich in vollkommener Stille auflösen würde. Bazin konnte zwei Umrisse erkennen. Breite Umrisse, die die Planches entlangeilten und ab und zu die Tür einer Umkleidekabine aufrissen. Er griff Janine bei der Hand und zerrte sie einige Meter weiter zu einer geöffneten Kabinentür. Auf dem weißen Geländer stand in schwarzer Schrift der Name Rita Hayworth.
Innen war es muffig und feucht, es gab kaum Platz für sie beide. Janine zitterte in seinem Arm, und Bazin dachte, dass sie gerade eine hilflose Frau im Stich gelassen hatten. Aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie selbst in Gefahr waren. Er wollte die Tür ganz zuziehen, aber sie klemmte. Durch einen kleinen Spalt fiel mattes Licht herein, und er konnte den Körper der Frau in einigen Metern Entfernung sehen. Sie hatte sich wieder an die grüne Tür gelehnt. Ihr Atem ging schnell.
Nach einigen Sekunden waren sie da.
Bazin hörte ihre Schritte auf dem Holz. Es waren zwei Männer.
»Da ist sie, die verdammte Hure.« Bazin musste Janine den Mund zuhalten, als eine Hand klatschend im Gesicht der verletzten Frau landete.
»Lass gut sein, wir müssen hier weg.«
»Verdammt, sie blutet wie ein Schwein. Was fällt dir ein, du blöde Kuh!«
Bazin konnte die Männer nicht sehen. Er versuchte, den Atem anzuhalten.
»Komm, wir müssen weg.«
Zwei Hände griffen den schlaffen Körper und zerrten ihn hoch. Die Frau wimmerte, aber es war nicht das Wimmern, worauf Bazin achtete. Er sah auch nicht das Blut, das vom Mantel tropfte und für lange Zeit das Holz verfärben würde.
Er starrte stattdessen auf die Hände, die er gehofft hatte, nie wiederzusehen. Hände, die er heute schon einmal hatte erdulden müssen.
Kurz darauf wurde es still draußen.
Sie warteten noch eine Weile, nachdem die Stimmen verklungen und die beiden Männer nicht mehr zu sehen waren. Janine weinte, und auf dem Meer warf ein Kutter seine ersten Netze aus.
Der Strand lag noch immer verlassen vor den Toren der Stadt und wartete auf den Ansturm der letzten Badegäste für diese Saison. Es würde ein schöner Tag werden.
»Sind sie weg?«, flüsterte sie.
»Ich glaube, ja.« Bazin versuchte, in der Dunkelheit der Kabine das Ziffernblatt seiner Armbanduhr zu erkennen. Zweiundzwanzig Minuten über der Zeit. Schwarz, Pair, erste Kolonne.
»Alles wird gut«, flüsterte er und küsste sie auf die Stirn.
In diesem Moment wurde die grüne Tür zu Rita Hayworths Kabine mit einem brutalen Ruck aufgerissen, kalte Luft strömte herein. Gegen das gleißende Licht des frühen Morgens konnte Bazin zuerst nichts erkennen. Er blinzelte, und als er nach draußen gezerrt wurde, sah er zuerst den Totschläger.
»Bruno!«, schrie Janine.
»Halt dein Maul!«
Als der erste Schlag Bazin direkt im Gesicht traf, zersplitterte seine Brille, und er sah verschwommen, wie die Holzplanken auf ihn zurasten. Überall Rot, dachte er. Aus seiner Nase tropfte dickes Blut und vermischte sich mit dem Blut der jungen Frau, die ihm jetzt vorkam wie eine nächtliche Erscheinung, die es nie gegeben hatte. Ein schwerer Stiefel traf ihn in die Seite, er stöhnte auf.
Janines flehende Stimme war verschwunden, vermutlich brachten sie sie zurück. Er dachte an den Nachtbus nach Blonville. Er setzte sich stets in die dritte Reihe, auf der Fahrerseite. Links. Rot. Manque, dritte Kolonne. Impair.
Als ihn jemand hochriss und in die Dunkelheit einer Kabine zerrte, sah er eine kleine Holzkugel, die über die Kanten und Vorsprünge des Kessels sprang, sich drehte und wendete, als würde sie sich umblicken, wohin sie fallen sollte. Es war immer der schönste Moment seiner Arbeit gewesen. Dieser kurze Moment, bevor die Kugel fiel. Dieser Satz, den nur er sagen durfte, der ihm Macht verlieh. Ihm, der nie Macht hatte haben wollen, sondern nur ein ruhiges Leben in Deauville.
Rien ne va plus.
Draußen lachte hämisch eine Möwe.
Kapitel 1
Paris
Im Frühling
Fast fünfzig Jahre später
Nicolas Guerlain saß an einem kleinen Holztisch am Fenster eines Cafés in der Avenue Montaigne und ärgerte sich, dass sein Handy klingelte. Er hatte den Passanten draußen auf dem breiten Bürgersteig hinterhergeblickt und sich vorgestellt, wie es wäre, ihr Leben zu leben. Eine Métro zu nehmen, die ihn dorthin fuhr, wo jemand auf ihn wartete. Ein Taxi zu rufen, das ihn fort von hier brachte, wo jemand wie er an einem kleinen Holztisch saß und trüben Gedanken nachhing. Er warf einen Blick auf die Uhr, es war 19.53 Uhr. Die Vorstellung würde in sieben Minuten beginnen.
Draußen löste sich allmählich der feste Knoten des Feierabendverkehrs, Paris schaltete einen Gang runter. Nicolas wusste, dass das ein Trugschluss war, aber der Gedanke an eine Atempause gefiel ihm. Er fischte zwei Münzen aus der Innentasche seines Anzugs und beobachtete ein junges Paar, das eng umschlungen am Fenster des Cafés vorbeilief. Der Frühling kam, schüchtern noch. Wie ein Schüler, der zum ersten Mal die neue Klasse betrat. Vorsichtig anklopfend.
»Ja?«
Nicolas hatte nicht aufs Display schauen müssen, um zu wissen, dass es Bertrand war. Er war der Einzige aus dem Team, der gerade Zeit hatte zu telefonieren. Gilles Jacombe, ihr Chef, war noch im Dienst, und Manou brachte um diese Zeit seine jüngere Tochter ins Bett. Sonst gab es niemanden, der ihn anrufen könnte. Also Bertrand.
»Salut, wo steckst du?«
Nicolas blickte hinüber zur anderen Straßenseite, wo die Schlange vor dem imposanten Théâtre des Champs-Élysées jetzt nur noch kurz war. Die Vorstellung war ausverkauft.
»Zuhause«, erwiderte er knapp. Nicolas konnte hören, wie eine Schranktür aufgeschoben wurde, er vernahm das Klappern von Kleiderbügeln.
Er winkte die Bedienung herbei und gab ihr die Münzen, seine Lippen formten ein lautloses »Merci«. Er griff nach seinem Mantel und bemerkte aus den Augenwinkeln, dass sie ihm interessiert hinterherblickte.
Das nächste Mal würde er woanders warten.
»Hast du schon gepackt? Vergiss nicht deine Badehose! Und Sonnencreme, es soll warm werden«, sagte Bertrand. Im Hintergrund war das leise Rauschen der Dusche zu hören. Vermutlich Sabrina. Nicolas glaubte jedenfalls, dass Sabrina gerade der angesagte Name war.
»Bringst du die Frau in der Dusche mit?«, fragte er und hielt einer älteren Dame die Tür auf. Draußen war es mild, er hätte seinen Mantel zuhause lassen können.
»Bist du verrückt«, flüsterte Bertrand. »Wir fahren an die Côte d’Azur! Blaues Meer, Sonne, kleine Wassertropfen auf brauner Haut. Mein kleiner Nicolas, du solltest mal abschalten, wir fahren in Urlaub!«
»Aha.«
»Was ist eigentlich mit dir? Wen bringst du mit?«
»Wen sollte ich mitbringen?« Er drückte auf den Knopf an der Fußgängerampel und hielt seine Hand vor das Handy, damit die Straßengeräusche gedämpft wurden.
»Was ist mit der Kleinen, du weißt schon, die aus der Personalstelle?«
»Keine Ahnung, wen du meinst.«
»Ach komm, Nico, entspann dich mal! Sag, stehst du auf dem Balkon, oder was?«
Nicolas blickte auf das große Plakat, das an der weißen Außenwand des Theaters in der Avenue Montaigne befestigt war. Ein Mann rempelte ihn an, ohne sich zu entschuldigen. An einem Kiosk wurden die ersten Ausgaben der Abendzeitung sortiert, zwei Tauben stritten sich um die Krümel, die das Croissant eines kleinen Jungen auf dem abendlichen Trottoir hinterlassen hatte. Das Hupen der Autos wurde nicht leiser.
Er war müde.
»Hör zu, Bertrand, ich muss auflegen. Komm pünktlich morgen, wir fahren um halb sieben los.«
»Und so was nennt man Urlaub«, seufzte Bertrand. »Mitten in der Nacht aufstehen, und das nur, um mit einem schlecht gelaunten Menschen wie dir ans Meer zu fahren.«
»Wir fliegen, Bertrand«, sagte Nicolas. »Und der Minister hat gute Laune. Ganz bestimmt.«
Der Vorplatz des Theaters war mittlerweile menschenleer, die Vorstellung würde in zwei Minuten beginnen. Antonín Dvořáks 9. Sinfonie. Er blickte sich um und merkte, dass er der Letzte war, alle anderen Konzertgäste waren bereits drinnen. Eilig hastete er die Stufen hinauf, nickte den beiden Mitarbeitern am Eingang zu, gab seinen Mantel an der Garderobe ab und schaffte es gerade noch durch die große Flügeltür hinein, bevor sie geschlossen wurde.
Im Saal war das Licht bereits gedämpft, und er erntete böse Blicke, als er sich an Beinen und abgestellten Handtaschen vorbeidrängte. Der Platz zu seiner Rechten war unbesetzt, so wie immer. Applaus brandete auf, als der Dirigent die Bühne betrat.
›Aus der Neuen Welt‹. E-Moll. Nicolas wollte gerade sein Handy stummschalten, als er sah, dass er eine Nachricht erhalten hatte.
Viel Spaß im Konzert. Gruß von den Mädchen. Manou.
Er musste lächeln, zum ersten Mal an diesem Tag.
Als der erste Geiger sich aufrecht hinsetzte und den Dirigenten erwartungsvoll anschaute, lehnte sich Nicolas zurück und schloss die Augen. Langsam atmete er aus und dachte an den warmen Frühling an der Côte d’Azur. Kurz darauf kletterten zwei Akkorde langsam hinauf, bis unter die Decke des großen Saales, und blickten von dort spöttisch herab. Auf ihn und den leeren Platz an seiner Seite.
Nicolas dachte, dass es von dort oben wohl aussehen musste, als würde eine Taste auf einer Klaviatur fehlen.
Eine weiße Taste.
Kapitel 2
Normandie
Drei Tage später
Drei Stunden bevor Jean Carasso auf den nassen Planken der Hirondelle de la Mer ausrutschte und beinahe ins tiefe Wasser vor der Côte Fleurie stürzte, schaute er auf die alte Uhr an der Wand und bemerkte, dass er spät dran war. Ihm blieb nicht viel Zeit, wenn er unterwegs noch einen Espresso trinken wollte. Draußen war es noch stockdunkel, aber das leise Schnarchen des Ozeans auf der anderen Seite der Fensterscheibe beruhigte ihn.
Kein Grund zur Sorge, sagte sich der alte Mann. Es war nur einer von vielen Aufträgen. Er hatte in den vergangenen Jahrzehnten hunderte dieser Fahrten gemacht, und nie hatte ihn seine Liebe zum Meer verlassen. Carasso drückte die Stirn gegen das kalte Glas des Panoramafensters und spürte die Vorfreude in sich aufsteigen. Auch wenn er mit allzu hastigen Schritten auf die siebzig zuging, dort draußen war sein Revier.
Etwas umständlich zog er seine regenfeste Jacke an, steckte ein Stück Baguette und eine Flasche Wasser ein und überprüfte ein letztes Mal den Inhalt seiner Fototasche. Die Kamera, zwei Objektive, Ersatzbatterien, eine kleine eingerollte Reflektorleinwand, falls die Sonne im Laufe des Tages doch noch rauskommen würde. Dazu eine ältere Ersatzkamera und ein kleiner Blasebalg, um Schmutz von der Linse zu pusten. Alles war da.
»Nun denn, alter Freund«, murmelte er und schulterte die Tasche. Er wollte gerade das Licht in der Küche ausschalten, als ein heftiger Hustenanfall ihn hinterrücks anfiel und durchschüttelte. Erst als er einen kräftigen Schluck Wasser nahm und ein trockenes Stück Brot kaute, ging es ihm wieder besser.
»Verdammtes Alter«, murmelte er und schloss kurz darauf die Haustür der Villa Proust hinter sich ab. Den Schlüssel legte er wie immer unter den linken Blumentopf auf der Fensterbank zum Hof. Bei ihm gab es nichts zu holen, und die andere Wohnung im ersten Stock stand derzeit ohnehin leer. Er trat durch das eiserne Tor hinaus auf die Straße. Weiter unten nahm er die Umrisse des »Roches Noires« wahr, des ehemals besten Hotels an der Küste. Proust und Monet hatten hier gewohnt. Jetzt stand das Gebäude leer.
Carasso begann eine hübsche Melodie zu pfeifen, als er in Richtung der Rue d’Orléans aufbrach, wo im »Café de la Marée« vermutlich in diesem Augenblick das Licht über dem Tresen angeknipst wurde. Ein leichter Wind kam auf, und es schien, als würden sich die Strandhäuser nach ihm umdrehen. Die verzierten Dachgauben blickten ihm hinterher, als seine Schritte durch die Stille drangen.
Der Hafen von Trouville war noch nie das Zentrum der Fischerei an der Côte Fleurie gewesen. Und im Laufe der Jahre hatten Le Havre, aber auch Dieppe und Cabourg der Stadt immer mehr den Rang abgelaufen. Und so schaukelte an diesem frühen Morgen gerade einmal ein knappes Dutzend Boote auf dem schwarzen Wasser der Touques, die hier ins Meer mündete und die Trouville von Deauville trennte und die beiden Städte gleichzeitig miteinander verband. Die Flut drückte das Wasser des Ärmelkanals ins Hafenbecken, bald würden die ersten Boote auslaufen können.
Am Rande des Hafenbeckens beleuchteten einige matte Lichter die kleine Fischhalle, die die Stadt erst kürzlich hatte renovieren lassen. Ganz im Gegensatz zu seiner hübscheren, aber etwas in die Jahre gekommenen großen Schwester Deauville auf der anderen Flussseite, baute Trouville auf den Charme eines Fischerortes. In einigen Stunden würden die ersten Touristen an den Ständen entlanglaufen und Ausschau halten nach frischen Makrelen, Austern und Kabeljau. Kinder würden sich die Nase an den Aquarien platt drücken, in denen Langusten und Krabben ihren letzten verzweifelten Tanz aufführten. »Fangfrisch« war das Geheimnis des kleinen Erfolgs von Trouville. Noch aber gähnten sich die Schiffe an diesem Morgen gegenseitig an, streckten und reckten sich, so dass die Planken knarzten und die Seile an den Eisenringen in der Kaimauer scheuerten.
André Dumarc saß mit einem Becher Kaffee in der Hand auf ebendieser Kaimauer und blickte auf sein altes Schiff. Er fuhr seit seiner Kindheit zur See, er kannte jedes Geräusch, das die Hirondelle de la Mer von sich gab, wenn sie so wie er ihre steifen Knochen streckte und sich bereit machte für einen weiteren anstrengenden Tag dort draußen. Auf der anderen Seite der Touques-Mündung waren die Schatten zweier großer Kräne zu erkennen, die dunklen Stahl-Giraffen schlummerten am Rande einer Baugrube. Trouville setzte auf seinen Fisch, Deauville auf neue Penthousewohnungen mit Meerblick.
Es würde ein schöner Tag werden, trotz des aufkommenden Windes. Oder womöglich gerade deshalb.
Ein windstiller Tag war vor allem still. Und Stille gab es in Trouville ohnehin mehr, als gut sein konnte, seitdem die großen Zeiten des Fischfangs endgültig vorbei zu sein schienen.
Unten an Deck fluchte einer der Matrosen, die Dumarc heute mit rausnehmen würde.
»Was gibt es?«, rief Dumarc ihm zu, sah aber bereits, was passiert war. Eine der Ketten, mit denen das große Fangnetz hochgeholt wurde, war rostig, und ein Kettenglied hatte sich gelöst.
»Dein Schiff wird alt«, rief der Matrose.
Dumarc kannte ihn seit vielen Jahren und nahm ihm den hämischen Kommentar über seine Hirondelle nicht übel. Er hatte recht, sein Schiff war in einem desolaten Zustand, daran änderte auch der frische grüne Anstrich der Außenwand nichts.
»Du solltest es mal ins Dock nach Le Havre bringen, André«, rief ein anderer Fischer.
»Wenn ihr endlich mal ordentlich fischen würdet, anstatt euch Gedanken über mein Schiff zu machen, dann fahr ich nach Le Havre«, antwortete der Kapitän und stand langsam auf, wobei seine müden Knochen so knirschten wie der Kies unter seinen groben Stiefeln.
»Damit sicher nicht.« Die rostige Kette landete auf den Deckplanken.
»Nehmt das Tau, das geht auch. Und beeilt euch, sobald Jean da ist, legen wir ab.« André Dumarc blickte durch den Nebel hindurch nach Nordwesten, wo jenseits der Bucht Le Havre lag, der große Seehafen mit seinen Kränen, den Verladestationen und den Fährterminals.
Und dem Trockendock.
Zwanzigtausend Euro, so viel kostete die Instandsetzung der Hirondelle de la Mer, er hatte sich erkundigt. Er hatte gestern drüben angerufen und sein Schiff angemeldet. Die Besatzung wusste davon nichts, und er wollte, dass es vorerst auch dabei blieb.
Im Hafen hier glaubten alle zu wissen, dass er sich die Reparatur nicht leisten konnte.
Bislang jedenfalls.
Flussaufwärts, über den Hügeln des Hinterlandes, war das erste Licht des Tages zu erahnen.
Jean Carasso war mittlerweile in die Rue Croix abgebogen und sah die schwache Außenbeleuchtung des »Café de la Marée« vor sich. Die kleinen Gassen von Trouville waren noch unberührt. Die Stadtreinigung würde erst in einer Stunde die Bürgersteige mit Wasser abspritzen, jetzt aber hatten die Restaurants noch trockene Füße, die guten wie die schlechten. Zwei Minuten später stellte ihm die Besitzerin einen Espresso mit etwas Milch auf den Tresen, schaltete das Radio ein und legte ihm die Zeitung hin.
»Und, was liegt heute an?«, fragte sie, während sie die Tische abwischte. Sie kannten sich seit vielen Jahren.
»Mode«, antwortete Carasso. Ein Pariser Label hatte ihn engagiert, um auf dem Meer Aufnahmen für eine neue Kampagne zu machen.
»Und hast du ein heißes Model dabei?«
Der alte Mann lachte. »Nein, nur das Meer. Sie brauchen es als Hintergrund für ihre Plakate.«
»Das Meer ist immer ein guter Hintergrund«, sagte die Besitzerin und blickte ihn an. »Und wenn ich es mir recht überlege: Ein guter Grund ist das Meer auch.«
»Für was?«
»Keine Ahnung.« Sie lachte. »Für alles? Für das Leben. Die Liebe. Und vor allem für den Regen, der heute noch kommen soll.«
Er schaute aus dem Fenster hinaus auf die Straße und dachte an das, was heute vor ihm lag.
Das Meer.
Er hoffte, dass alles gut gehen würde. Und jetzt musste er sich beeilen.
»Ich muss los, das Meer wartet nicht.«
Die Besitzerin des Cafés schaute dem alten Mann nachdenklich hinterher, als er in der kleinen Gasse verschwand, die sich weiter unten zum Hafen hin öffnete.
Carasso eilte durch die Rue des Bains, und als er kurz darauf zwischen den Häusern hindurch zum Meer blickte, war die Dunkelheit einem Anflug von Grau gewichen. Er winkte André Dumarc von Weitem zu und merkte, dass er sich freute, trotz allem. Als er an die Kaimauer kam, sah er die Fischer der Hirondelle, wie sie die Seile aufrollten und Plastikschalen stapelten, in denen später Brassen, Makrelen und hoffentlich auch ein paar Langusten landen würden.
»Eh, Jéjé, ein bisschen früh für dein Alter, oder?«, rief ihm einer der beiden zu und wischte seine Hände an der gelben Ölkleidung ab. »Und angeblich soll es draußen Wellen geben, dann müssen wir deinen Rollstuhl wohl an der Reling festbinden!«
Der Ton unter den Fischern war rau, und Carasso dachte, dass er wohl genau deshalb so gerne hier runter kam.
»Ich habe euch Fischstäbchen eingepackt, was anderes fangt ihr ja doch nicht, ihr Freizeitangler«, brummte er.
»Macht mir den alten Herrn nicht verrückt, in ein paar Jahren fahren wir nur noch für Touristen raus. Und für Fotografen.« Der Kapitän der Hirondelle de la Mer umarmte ihn mit einem breiten Lächeln, das makellose Zähne offenbarte, umrahmt von einem Zehntagebart und vielen kleinen Falten. Er schob seine Strickmütze etwas tiefer in die Stirn und schaute in Richtung Hafenausfahrt.
»Es könnte ein bisschen wackelig werden heute, aber du kennst das ja.« Tatsächlich war Carasso schon so oft mit rausgefahren, dass er die Küste mittlerweile nicht weniger gut kannte als die Fischer selbst.
Die große Drehspule, an der später die Netze ins Meer gelassen würden, ließ nicht viel Platz an Deck. Die beiden Seeleute sprangen über Leinen und Streben, sie nutzten jeden Quadratzentimeter aus. Carasso stellte seine Ausrüstung in die Kabine und zog das gelbe Ölzeug über. Es roch nach Fisch, alles hier roch nach Fisch.
»Wir wollten eigentlich Richtung Seine-Mündung fischen, aber die Strömung dort ist heute zu stark. Die Küste runter ist es etwas einfacher.« Dumarc beugte sich über eine Seekarte, gab Koordinaten in sein Steuerpult ein und nahm ein Funkgerät von der Wand.
»Hier spricht die Hirondelle de la Mer. Wir brechen jetzt auf, Fahrzeit etwa drei Stunden, Richtung Houlgate.«
»Bonne route, bringt mir was mit«, krächzte es aus einem kleinen Lautsprecher, die Hafenmeisterei von Trouville war jetzt informiert. Der Kapitän ließ vorsichtig den Motor an, und kurz darauf schob sich der Bug des Kutters langsam aus dem Hafen.
Carasso sah die Leuchtschrift des Casinos von Trouville auf der rechten Seite, backbord konnte man die Marina von Deauville erahnen, mit ihren überteuerten Wohnungen und den Geschäften für die reichen Yachtbesitzer.
Die Touques trieb sie schnell in Richtung offenes Meer. Kurz hinter dem Casino kamen sie an dem kleinen Bac vorbei, der Fähre, die Trouville und Deauville seit Jahrzehnten miteinander verband, auch wenn sie heute fast niemand mehr nutzte.
Der Bac lag schnarchend an der Kaimauer und Hugo, der junge Kapitän, offenbar noch in seinem Bett, genau wie sein Hund Jalabert. Carasso hätte Hugo gerne aus der Ferne gegrüßt.
»Kaffee?« Dumarc reichte seinem alten Freund eine weiße Kanne und schloss die Tür des Steuerhauses. Draußen machten es sich die beiden Fischer hinter einem Haufen Kisten bequem.
»Hast du gewusst, dass das Meer ein guter Grund ist?« Carasso sah, dass sie gerade an den beiden Signalfeuern am Ende der Hafenausfahrt vorbeikamen. Die ersten Schaumkronen schlugen gegen die Außenwand, draußen wurde es langsam heller.
»Natürlich ist es ein guter Grund«, sagte Dumarc und blickte ihn ernst an. »Und was mich betrifft, auch der einzige.«
Carasso dachte, dass sein Freund traurig aussah.
Als kurz darauf der Bug der Hirondelle nach Süden drehte, setzte über dem offenen Meer ein leichter Regen ein.
Kapitel 3
Côte d’Azur
Zur gleichen Zeit
Nicolas brauchte einen Moment, um sich zu orientieren, aber das leichte Schwanken unter seinen Füßen gab ihm einen ersten Hinweis. Durch ein kleines Bullauge fiel mattes, weiches Licht in seine Kabine. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, setzte sich langsam auf und griff nach seiner Armbanduhr. Halb sechs. Sein Blick fiel auf die kleine Medikamentenpackung auf dem Nachttisch. Er dachte kurz über die sich ihm bietende Möglichkeit nach, beschloss dann aber, diesem frühen Tag eine Chance zu geben.
Irgendetwas beunruhigte ihn.
Es war nur ein Gefühl, vielleicht noch nicht einmal das, aber ganz offensichtlich störte ihn etwas. So wie ein leerer Platz an seiner Seite.
Reihe D. Plätze dreizehn und vierzehn. Théâtre des Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Paris.
Er zwang seine Gedanken zurück in die Kabine, hier auf dem Schiff. Es ließ ihm keine Ruhe, dieses Gefühl, und so schloss er wieder die Augen und versuchte sich zu erinnern. Was hatte ihn aufgeweckt? Leichte Kopfschmerzen stellten sich ihm in den Weg, zwangen ihn zu einem Umweg, das Denken wollte ihm noch nicht allzu gut gelingen. Er legte sich zurück aufs Bett, exakt in die Position, in der er aufgewacht war, und zog die Decke bis zum Hals hoch. Das Schiff bewegte sich leicht unter ihm, es war ein angenehmes Schaukeln. Er hörte ein leichtes Glucksen auf der anderen Seite der Wand, das Mittelmeer schlief noch.
Alles ist gut, dachte er und wusste doch, dass seine müde Seele ihn schamlos belog.
Eine Tür.
Er hatte das leichte Klacken einer Tür vernommen und war davon aufgewacht.
Seine Kabine befand sich im hinteren Teil der großen Yacht, genau wie die Kabinen der anderen Teammitglieder. Sein Kopf pochte weiter im Rhythmus der Wellen. Der Leiter des kleinen Sicherheitsteams, Gilles Jacombe, seine Frau und die beiden Jungs waren hinten links untergebracht. Gegenüber Manou mit Elise und den Mädchen. Bertrand und er hatten jeweils eine kleine Kabine in der Mitte. Er atmete langsam erst ein und dann wieder aus und dachte dabei an die Medikamente auf seinem Nachttisch.
Trotz allem, die beiden Urlaubstage hatten ihn entspannt. Das Lachen der Kinder, das blaue Meer. Seine Blicke, die irgendwann nicht mehr von links nach rechts geeilt waren, sondern am Glitzern der Sonne hängen blieben. Bertrand hatte den Mädchen auf den anderen Yachten hinterhergepfiffen, und die beiden Jungs hatten ihm nachgeeifert. Er selbst hatte seine freie Zeit damit verbracht, Musik zu hören. Sein kleiner CD-Player lag in der obersten Schublade, immer griffbereit. Brassens und Brel, ein Mann des Südens und einer aus dem Norden.
Diese Himmelsrichtungen konnte er auf seinem Kompass noch erkennen.
Das Geräusch war nicht von hinten gekommen, da war er sich plötzlich sicher. Und genau das beunruhigte ihn. Nicolas kniff die Augen zusammen, um sich zu konzentrieren. Die Verbindungstür im Gang schwang nach außen auf. Holz, Schwingen, kein Klacken. Eine weitere weiße Tür, die in einen Serviceraum führte. Abgeschlossen, er selbst hatte den Schlüssel.
Er setzte sich mit einem Ruck auf, zog eine Hose über und gähnte sein Spiegelbild an, was ihn erfolgreich daran hinderte, es zu lange zu betrachten. Er hatte das Gefühl, sich selbst aufzulösen, wenn er sich zu lange im Spiegel ansah. Nicolas griff nach seiner Waffe, die er im Holster über einen Stuhl gehängt hatte, beschloss dann aber, dass dies etwas übertrieben war. Leise öffnete er die Tür, sah im Gang die verschlossenen Kabinen des Teams und ging zwei Treppenstufen nach oben. Der große Aufenthaltsraum der Yacht war leer.
Einige Champagnergläser standen noch auf dem Tisch, auf den Sesseln hatten sich einsame Luftschlangen und vertrocknete Kuchenreste niedergelassen. In der abgestandenen Luft hing das Echo eines schlecht gesungenen Geburtstagsliedes. Nicolas musste lächeln, als er an Manou dachte, mit einem Napoleon-Hut auf dem Kopf und Taucherflossen an den Füßen. Es war ein schöner Abend gewesen, sogar er hatte sich amüsiert.
Hinter ihm öffnete sich leise eine Tür. Nicolas blickte zurück in den Gang und sah, wie Elise, Manous Frau, ihn müde anschaute.
»Alles gut, Elise, schlaf weiter«, flüsterte er und legte einen Finger auf den Mund. Sie blickte ihn für einige Sekunden an, nickte und schloss die Tür wieder.
Eine leere Packung Chips rutschte von einem der Stühle, und Nicolas bemerkte einen leichten Luftzug auf seinem Unterarm. Die Tür, die auf das seitliche Deck hinausführte, stand offen. Die Tür direkt gegenüber auch. Jemand musste aus den Privaträumen des Ministers gekommen sein.
Mit drei schnellen Schritten war Nicolas draußen. Diffuses Licht empfing ihn, in der Ferne konnte er die Küste sehen.
Das Schiff lag jetzt seit drei Tagen vor Cannes, François Faure und seine Frau waren gestern Mittag zu ihnen gestoßen. Nicolas war erst seit einigen Monaten in diesem Team, es war sein erster Sommerurlaub mit dem Minister. Bertrand hatte ihm erzählt, dass der engste Kreis jedes Jahr für ein paar Tage verreiste, gemeinsam mit den Familien. Es war ein ausdrücklicher Wunsch des Ministers.
Eigentlich eher ein Befehl, dachte Nicolas und ging mit schnellen, aber leisen Schritten die Reling entlang. Das Schiff maß fast fünfundzwanzig Meter, hatte verschiedene Sonnendecks und mehrere kleine Leitern, die hinab ins Wasser führten.
Oder hinauf aufs Schiff. Das hing vom Blickwinkel ab.
Und von der Absicht.
Das Meer war von einem grauen Schleier überzogen, und Nicolas musste die Augen zusammenkneifen, um Konturen auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Er hatte mittlerweile die Hälfte des Schiffes überprüft. Womöglich lag der Minister in seinem Bett und schlief. Vielleicht hatte seine Frau einfach vergessen, die Tür zu schließen, entgegen der ausdrücklichen Anweisung des Teams.
Vielleicht.
Nicolas hasste dieses Wort.
Da war ein Kopf.
Anfangs dachte er, es sei die Boje eines benachbarten Schiffes. Dann aber erkannte er auch den Oberkörper, er trieb regungslos an der Wasseroberfläche. Nicolas fluchte und begann zu zählen, während er über das Deck rannte. Eins.
Keine Bewegung im Wasser.
Zwei.
Er riss sich das T-Shirt vom Leib und spürte die kühle Luft auf seinem Rücken.
Drei.
Eine kleinere Welle schwappte über den Körper im Wasser. Nicolas war sich jetzt sicher, dass es ein Mann war.
Vier.
Als er an der großen Schiebetür vorbeikam, die ins Schiffsinnere führte, riss er den Vorhang beiseite und schrie so laut er konnte.
»Gilles! Gilles!«
Mit einem Satz stand er oben auf der Reling, holte tief Luft und sprang. Das Wasser war kälter, als er gedacht hatte.
Fünf.
Gilles Jacombe war seit zwanzig Jahren Personenschützer, die meisten davon im Dienst der französischen Regierung. Für sie beschützte er die Kabinettsmitglieder und ihre Staatsgäste. Seit sieben Jahren war er diesem Ministerium zugeteilt, vor fünf Jahren hatte er die Teamleitung des engsten Zirkels übernommen.
Situationen wie diese empfand er als Niederlage.
Sie hatten den Minister aus dem Wasser gezogen, ihm ein Handtuch gereicht und versucht, seine blasse Gesichtsfarbe zu ignorieren. Kurz darauf hatte sich das Team in Nicolas’ Kabine versammelt. Der Teamleiter war der Erste, der etwas sagen durfte, das gehörte zum abgesprochenen Ablauf nach einer Situation wie dieser.
Aber Gilles Jacombe schwieg.
Nicolas blickte auf seinen Nachttisch. Das Glas Wasser stand noch dort, wo er es abgestellt hatte. Die Packung mit den Tabletten hingegen lag dort nicht mehr. Er hatte schnell geduscht, während die anderen auf ihn warteten. Manou stand in der Tür, eine Tasse Kaffee in der Hand. Bertrand, das vierte Mitglied des kleinen Teams, räusperte sich verlegen. Wie ein unsichtbarer Gast hatte sich außerdem die Anspannung in die winzige Kabine geschmuggelt und kalt lächelnd zwischen ihnen Platz genommen.
»Als Erstes möchte ich festhalten, dass du alles richtig gemacht hast, Nicolas.« Jacombe blickte ihn an, er hatte einen festen, durchdringenden Blick.
»Wie geht es dir?«
»Gut, danke.«
»Ich mache dir keinen Vorwurf, niemand hier tut das.« Nicolas dachte, dass es nicht nötig war, ihm das zu sagen. Es sei denn, Gilles machte ihm eben doch einen Vorwurf. Wozu er jedes Recht hatte.
»Wie kommt er auch um diese Uhrzeit auf die Idee, schwimmen zu gehen?«, murmelte Bertrand und erntete dafür einen strengen Blick des Teamleiters.
»Es ist nicht deine Aufgabe, das zu beurteilen, hörst du?« Jacombe wandte sich jetzt an das gesamte Team.
»Wenn der Minister schwimmen will, dann macht er das. Er kennt unsere Sorgen, und dennoch muss er sich nicht rechtfertigen.«
Bertrand zeigte auf Nicolas.
»Du hättest wenigstens eine Unterwasserkamera mitnehmen können. Der Minister mit Schnorchel und Brille, du hättest reich werden können!«
Das Lachen seiner Kollegen löste bei Nicolas ein wenig die Anspannung. Er hatte noch immer Kopfschmerzen und ahnte, dass er die Tabletten später doch noch würde nehmen müssen. Die Tabletten, die irgendjemand vom Nachttisch genommen hatte.
»Schluss jetzt. In drei Stunden brechen wir auf, jeder von euch kennt den Auftrag. In einer Stunde machen wir eine Vorbesprechung, dann teile ich euch ein.« Gilles Jacombe öffnete die Tür zum Gang.
Im Aufenthaltsraum saßen die Kinder beim Frühstück, Manou gab seiner kleinen Tochter Lilli einen Kuss auf die Stirn.
»Bonjour, Papa! Was war denn los?«
»Alles gut, meine Kleine. Nico hat zu viel ›Findet Nemo‹ geguckt.«
Nicolas begrüßte die Frau des Ministers, die aus ihrer Kabine kam. Sie sah müde und mitgenommen aus.
»Mein lieber Nicolas, wie geht es Ihnen?«
»Merci, Madame. Wie geht es Ihrem Mann? Es tut mir leid, wenn …«
»Machen Sie sich keine Sorgen, der ist doch selbst schuld. Schnorcheln um die Uhrzeit, wer kommt denn auf so eine Idee?«
Draußen auf dem Sonnendeck hatte Lea, Manous ältere Tochter, es sich bereits bequem gemacht und ließ das Display ihres Handys nicht aus dem Auge. Ihre dunkle Sonnenbrille machte jedem deutlich, dass sie nicht angesprochen werden wollte. Die Jungs von Jacombe machten sich fertig für einen weiteren Tag im Meer.
Als Nicolas nach dem Frühstück zurück in seine Kabine kam, lag die kleine Packung mit den Tabletten wieder da.
Kapitel 4
Cannes
Drei Stunden später
François Faure liebte den großen Auftritt, und er war sich dessen völlig bewusst. Eine gewisse Eitelkeit gehörte einfach dazu, vor allem bei einem Mann in seiner Position, fand er.
Er hatte sich lange durch die Parteiinstanzen beißen müssen, um bei der letzten Regierungsumbildung als Minister gehandelt zu werden. Ein fleißiger Emporkömmling, dem man jedoch lange Jahre einen weiteren Aufstieg in der Politik verwehrt hatte. Zu jung. Faure musste höhnisch lachen, wenn er daran zurückdachte.
Über zehn Jahre hatte er den Großen zugearbeitet, Türen geöffnet und wieder geschlossen, hatte gesehen, welche Inkompetenz ihn umgab, und es still ertragen. Immer war er loyal gewesen, auch wenn er zum wiederholten Male zu verstehen bekam, dass seine Zeit noch nicht gekommen sei. Oder auch nie kommen würde.
Aber Stehvermögen war schon immer eine seiner Stärken gewesen. Schon zu seiner Zeit als Student in Paris hatte er gewusst, wo er hinwollte.
Und jetzt war er da. In der französischen Regierung. Das Ergebnis einer weitreichenden Neuordnung nach dem knappen Wahlausgang vor einem Jahr. Der Wähler hatte ihn nach oben gespült, die Angst der alten Herren vor dem Machtverlust war größer gewesen als ihr Misstrauen ihm gegenüber. Jetzt, mit Anfang fünfzig, war er da. Und er hatte nicht vor, wieder zu gehen, im Gegenteil.
Den lästigen Vorfall am frühen Morgen hatte er längst vergessen und Nicolas bei der Besprechung des Tages freundlich zugenickt. Er hatte kurz an einen Hai denken müssen, als der Mann neben ihm aus dem Wasser geschnellt war und ihn gepackt hatte. Idiot! Aber gut, vergessen. François Faure hatte Großes vor heute, und dafür brauchte er sein strahlendes Lächeln. Eigentlich, so dachte er, brauchte er ausschließlich dieses Lächeln, sonst nichts. Und darauf hatte er sich immer verlassen können.
Vom Festland aus mussten sie ein grandioses Bild bieten. Eines, das Abenteuer und Aufbruch versprach. Als er mit seinen Beratern in Paris diesen Tag plante, war es ihm vor allem um dieses erste Bild gegangen. Am Hafen von Cannes warteten heute hunderte von Fotografen, und er hatte seine Leute streuen lassen, dass er nicht wie alle anderen mit dem Wagen zum Festival anreisen würde. Sollten doch die anderen Minister, sofern sie überhaupt kamen, mit ihren schwarzen Limousinen vorfahren. Er hatte Besseres vor. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht, und er fragte sich, ob man den Ruhm riechen konnte, den Schauspieler und Regisseure in dieser Stadt verbreiteten.
Nicolas saß im Heck des kleinen Schnellbootes und schaute besorgt zum Hafen hinüber, der langsam näher kam. Für Personenschützer waren solche Veranstaltungen immer ein Grund zur Sorge, und ein Einsatz bei den Filmfestspielen von Cannes war erst recht eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Dass der Minister mit seinem Wunsch, das Schnellboot zu benutzen, noch mehr Unbekannte hinzugefügt hatte, hatte Gilles Jacombe und auch ihm selbst einige schlaflose Nächte bereitet. Das Team