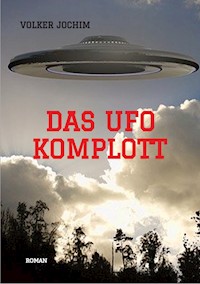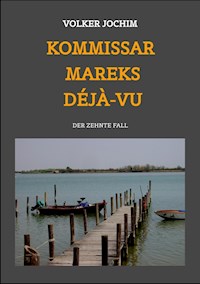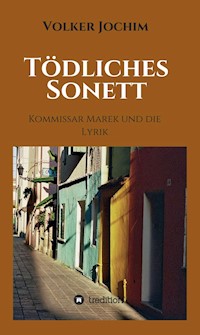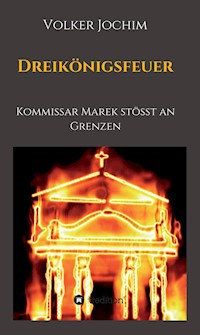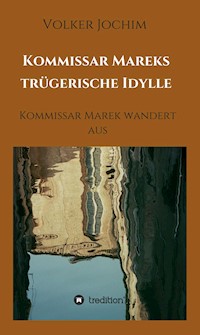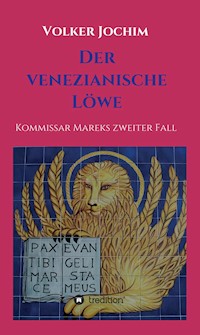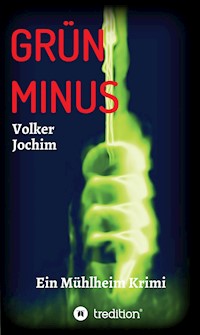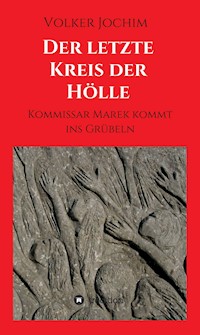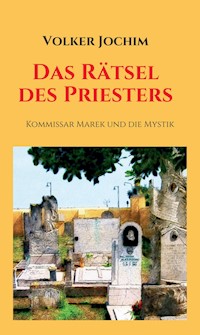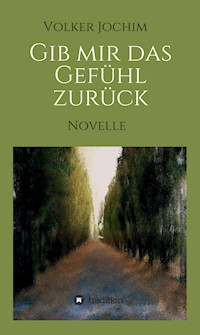
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann erfährt bei einem Besuch seiner Heimatstadt vom Tod seines Jugendfreundes, mit dem er auch in der 68er Bewegung aktiv war, bevor sich ihre Lebenswege trennten. Überrascht davon, wie sich sein Freund von einem überzeugten Kommunisten zu einem Unternehmer wandelte, arbeitet er, zusammen mit der Witwe seines Freundes, die Vergangenheit auf. Auf einfühlsame und doch unterhaltsame Weise, wird hier der 68er Generation ein Spiegel vorgehalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Volker Jochim
Gib mir das Gefühl zurück
Novelle
(Überarbeitete Neuauflage)
© 2015 Volker Jochim
Umschlag, Illustration: trediton
Volker Jochim (Foto)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Die erste Auflage erschien 2012 im Projekte-Verlag Cornelius (Halle/Saale)
ISBN
Paperback
978-3-7323-6164-9
Hardcover
978-3-7323-6165-6
e-Book
978-3-7323-6166-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mein besonderer Dank gilt dem Radiosender HR1 des Hessischen Rundfunks, für die Erlaubnis diesen Titel verwenden zu dürfen.
…… how many times can some people exist, before they’re allowed to be free……
(Bob Dylan)
1
….. der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen …..
***
Ich komme mir vor wie in einem der alten französischen Filme, in denen eine schwarz gekleidete Trauergemeinde, teilweise mit schwarzen Regenschirmen bewaffnet, auf einem Friedhof mit altem Baumbestand vor den Toren einer Kleinstadt, bei Nieselregen von einem der Ihren Abschied nimmt.
***
….. und so nehmen wir nun Abschied von unserem über alles geliebten Ehemann, Vater und lieben Freund Roland Jost …..
***
Es ist ein kalter, grauer Novembertag, es regnet in Strömen und ich habe keinen Schirm. Das Wasser läuft in den aufgestellten Kragen meines Trenchcoats und meine Schuhe geben seltsam schmatzende Geräusche von sich, wenn ich mich bewege, um die Kälte daran zu hindern von meinen Knochen endgültig Besitz zu ergreifen.
***
….. Asche zu Asche, Staub zu Staub …..
***
Ich hatte die Todesanzeige zufällig in einer Tageszeitung meiner Heimatstadt gelesen, als mich die Sehnsucht nach der Stätte meiner Kindheit und Jugendzeit wieder einmal hierher trieb.
Das passiert immer öfter, je älter ich werde. Einige meiner Freunde unken schon, dass dies bei alten Menschen immer so sei, bevor sie das Zeitliche segnen.
Ich bin doch noch nicht alt, zumindest fühle ich mich nicht so. Ich bin erst Ende fünfzig und die Zeit mit meinem Freund Roland ist noch gar nicht so lange her. Ich habe doch auch noch so viel vor. Trotzdem treffen mich solche, eigentlich im Scherz gemachten Bemerkungen tief in meinem Inneren.
Obwohl, zugegebenermaßen, machen sich schon gelegentlich einmal Verschleißerscheinungen bemerkbar. Morgens beim Aufstehen brauche ich ein paar Minuten um meine schmerzenden Knochen zu sortieren, und wenn ich hocke, habe ich das Gefühl mich nicht mehr aufrichten zu können und muss mich abstützen. Aber nicht immer.
Bis vor ein paar Jahren war ich noch topfit, war sportlich aktiv, ohne Beschwerden. Dann habe ich einfach aufgehört. Aus Zeitmangel habe ich mir eingeredet. Aber wahrscheinlich dachte ich mir damals, dass man in meinem Alter etwas Seriöses, Sinnvolleres tun sollte.
Vor einem halben Jahr hatte ich den Entschluss gefasst, wieder etwas für meine Gesundheit zu tun. Ich kaufte mir ein Paar neue Laufschuhe, und als die ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs mich weckten, ging ich auf die Piste. Doch statt der angepeilten fünf Kilometer wurde es nicht einmal einer. Ich bekam keine Luft mehr, vor meinen Augen sah ich bunte Kreise, wie in einem Kaleidoskop. Ich gab auf. Als mir auf meinem schmerzlichen Rückweg andere Läufer begegneten tat ich so als würde ich Dehnübungen machen.
Auf eines musste ich wohl verzichten: Das Laufen oder die Gauloises. Die Franzosen haben gewonnen.
***
Roland war auch erst Ende fünfzig. Genauer gesagt war er drei Tage älter als ich. Wir sind zusammen aufgewachsen, wohnten Haus an Haus. Wir spielten zusammen auf der Straße Fußball.
Damals gab es noch keinen Straßenverkehr, der die Kinder vertrieb. Drei, viermal am Tag fuhr ein Auto durch unsere Straße und ebenso wenige Autos parkten dort und zeichneten ihre Besitzer als etwas wohlhabender als den Rest der Nachbarschaft aus. An einen dieser Privilegierten kann ich mich noch gut erinnern. Er hieß Weigand und fuhr einen Opel Kapitän, ein riesiges Gefährt mit einem verchromten Kühlergrill, der uns wie das aufgerissene Maul eines Haifischs vorkam und der auf einem eigens für ihn aufgezeichneten Parkplatz stehen durfte.
Herr Weigand selbst war ebenfalls eine imposante Erscheinung. Ein großer, grauhaariger Mann mit ewig sonnengebräuntem Teint, der tagein, tagaus in einem Tweed-Sakko mit Lederknöpfen und einem Gürtel auf seinem Balkon im Erdgeschoss unseres Nachbarhauses saß und rauchte. Aus dem offenen Kragen seines weißen Hemdes lugte immer ein bunt gemustertes Seidentuch und in der Brusttasche seines Sakkos steckte ein dazu passendes Einstecktuch.
Er saß da und beobachtete uns beim Fußballspielen zwischen den Mülltonnen, die wir als Tore auf die Straße gestellt hatten, und wachte argwöhnisch darüber, dass wir nicht in die Nähe seines Wirtschaftswunder-Gefährts kamen.
***
Bis zum Ende der Volksschule drückten wir beide gemeinsam die Schulbank. Danach trennten sich unsere Wege das erste Mal. Ich musste aufs Gymnasium und Roland ging auf eine Realschule.
Das Gymnasium auf das ich ging, war ein alter, dunkler Kasten und erinnerte sehr stark an die Schule in der Verfilmung der Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann. So alt und verstaubt wie dieses Gebäude, war auch der Lehrkörper. Alles verströmte den Mief längst vergangener Zeiten und manchmal, manchmal hatte ich das Gefühl, das alte Lied vom schönen Westerwald in den Gängen widerhallen zu hören.
Da meine Mutter alleinerziehend und auch nicht Architektin oder Ärztin war, wurde ich von Anfang an wie ein Schüler zweiter Klasse behandelt, was darin gipfelte, dass ich Jahre lang für die Missetaten meiner lieben Mitschüler verantwortlich gemacht wurde und ich letztendlich von der Schule flog. Meine Mutter war untröstlich und ich erleichtert.
Später traf ich Roland auf der Fachoberschule wieder.
***
Als ich die Todesanzeige las, dachte ich zuerst an eine Namensgleichheit. Das konnte unmöglich mein Freund aus glücklichen Kindertagen sein. Aber es war sein Geburtsdatum, das dort stand, der fünfte August.
Die Anzeige war von seiner Frau aufgegeben worden. Mein Jugendfreund hatte also Familie. Die meisten meiner Freunde aus Jugendtagen hatten Familie. Ich war auch einmal verheiratet. Hat aber nicht gehalten.
***
Ich war wohl zu jung, gerade einmal zwanzig Jahre, um mir über die Folgen dieser Entscheidung bewusst zu werden. Am Anfang ist man noch euphorisch, findet alles toll, ist dauernd mit Freunden unterwegs und lässt sich beneiden. Später, viel zu spät bemerkt man erst, dass man zu verschieden ist und sich eigentlich nichts mehr zu sagen hat.
Roland hatte mich damals gewarnt.
„Du verrätst deine Ideale“, hatte er gesagt, „das ist der Einstieg ins bürgerliche Leben“.
***
Ich beabsichtigte, einen Kondolenzbesuch abzustatten. Ich dachte dies sei ich ihm zumindest schuldig. Aber dazu musste ich erst einmal die Adresse herausfinden.
Auf der Suche nach einem Telefonbuch klapperte ich erfolglos mehrere Telefonzellen ab.
„In welcher Zeit lebst du denn?“ hörte ich im Geiste meine Lebensgefährtin sagen. „Wir leben im 21. Jahrhundert. Da gibt es so etwas nicht mehr. Du hast doch ein Handy. Ruf die Auskunft an.“
***
Ich lebe jetzt schon ein paar Jahre mit meiner Lebensgefährtin zusammen und das passt sehr gut. Sie versteht mich, bringt mich aber immer wieder vorsichtig ins Heute zurück, wenn ich wieder einmal in meiner Welt lebe …
“Woodstock ist vorbei“, sagt sie dann immer und ich denke, „gib mir das Gefühl zurück.“
***
Mein Handy. Ich habe tatsächlich so ein Stück Hightech, benutze es aber eher selten im Gegensatz zu den Kindern meiner Freunde, bei denen diese Dinger zum Alltag gehören, ja teilweise am Ohr festgewachsen scheinen. Bis auf Kaffee kochen können diese Geräte ja mittlerweile alles. Was hat die Menschheit bloß früher ohne diese segensreiche Erfindung gemacht? Geschrieben? Ich befürchte, dass unser Nachwuchs das schon nicht mehr kann. Man sollte bei der Pisa-Studie einmal die Handy-Telefonie testen. Da wären wir bestimmt Weltmeister.
Ich kramte also mein Handy aus der Tasche meines Cord-Sakkos und wählte eine Nummer, die ich einmal in einer Fernsehwerbung gesehen hatte und bei der man bis zur Reservierung einer Opernkarte alles bekommen konnte. Tatsächlich bekam ich auch die Adresse meines verstorbenen Jugendfreundes. Eine Adresse hier in der Stadt, die mir aber völlig fremd war.
So ging ich zum nächsten U-Bahnhof in der Hoffnung, dort einen Stadtplan zu finden. In allen Bahnhöfen gibt es doch Stadtpläne, sagte ich mir, also wird es auch hier einen geben. Als ich endlich die Leuchtvitrine gefunden hatte, stellte ich mich geduldig hinter einer Gruppe junger Asiatinnen an, die den Stadtplan belagerten und laut schnatternd und lachend mit ihren schmalen Fingern auf der Karte hin und her fuhren. Nach einer Weile fragte ich höflich und auf Englisch, in der Hoffnung, dass sie mich verstehen würden, ob ich auch einmal einen Blick auf die Karte werfen dürfte. Zuerst sahen sie mich erstaunt mit ihren schönen Mandelaugen an, dann verbeugten sie sich mehrmals kichernd, um schließlich laut lachend in Richtung Rolltreppe davon zu laufen.
„Glückliche Jugend“, dachte ich um mich zugleich darauf zu besinnen, warum ich eigentlich hier stand.
***
Die Gegend, in der mein Freund zu Hause war, lag in einem dieser Randgebiete vor der Stadt, die erst später eingemeindet wurden. Zumeist waren es Neubaugebiete in denen sich Dutzende von völlig identischen Reihenhäusern, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, an einer Ringstraße entlang zogen.
Eine heile Welt Idylle, in die müde Familienväter, nach einem stressigen Büro Tag in der Stadt, am Abend eintauchen, um im Kreise ihrer Lieben den Tag vor dem neuen Flachbildfernseher mit einer spannenden Rateserie ausklingen zu lassen.
Ich stellte mir vor, wie sie mit ihren Kombis vorfuhren, auf der Suche nach der richtigen Hausnummer ohne die sie ihr Haus schwerlich identifizieren konnten. Auf den Garagenzufahrten liegen kleine, bunte Kinderfahrräder und in den zehn Quadratmeter großen Vorgärten liegt buntes Spielzeug.
Dort sollte mein Freund gewohnt haben? Mein Freund aus den Tagen des Klassenkampfes?
***
Langsam ging ich zu meinem Auto, dass ich etwas außerhalb der Innenstadt in einer ruhigen Seitenstraße geparkt hatte, und versuchte meine Gedanken zu ordnen.
„Gehört der Schrotthaufen Ihnen?“ hörte ich eine Stimme sagen, als ich die Fahrertür meines betagten, knallroten Citroen 2CV aufschloss.
Die Stimme gehörte einem jungen Mann, etwa dreißig Jahre alt, mit Solarium brauner Gesichtsfarbe, der in einem braunen Nadelstreifenanzug und spitzen, braunen Schuhen steckte. Um seine Frisur brauchte er sich keine Gedanken zu machen. Die hielt auch einen Tornado aus, soviel Haar-Gel war darin verarbeitet.
Er lehnte lässig an einer vor meinem Auto geparkten dunkelblauen Nobelkarosse süddeutscher Fabrikation. Eines dieser Modelle mit eingebauter Vorfahrt.
„Passen Sie bloß auf, dass Sie mir mit der Rostlaube meinen Wagen nicht verkratzen“, sagte er weiter, „so etwas sollte man auf der Straße verbieten.“
Ich hatte keine Lust zu streiten und so erwiderte ich gönnerhaft: “Junger Freund, das ist kein Schrotthaufen sondern ein Stück Kulturgut! Da du aber offensichtlich nicht weißt, was das ist, und ich meinen großzügigen Tag habe, verzeihe ich dir den dummen Spruch. Und was das Verbieten angeht, so sollte man eher solche Typen wie dich mit ihren Protzkarren verbieten.“
Ich lächelte ihm noch freundlich zu, als ich in meine Ente stieg, und ließ ihn, um Fassung ringend, zurück.
***
Als ich den Stadtteil erreichte, in dem mein Freund gewohnt haben soll, bot sich mir auch bald das Bild aus meiner Vorstellung. Auch wenn ich im Bekanntenkreis ob dieser Vorstellung immer wieder gescholten werde, so bleibe ich dabei, dass dies eine Kulisse ist, hinter der man sich trefflich verstecken und die gesellschaftlichen Probleme, die uns alle betreffen, außen vorlassen kann, statt sich damit auseinander zu setzen. Ich jedenfalls könnte mich nicht in solch einem Mikrokosmos verschanzen und die Augen vor der Realität verschließen, solange sie mich nicht einholt.
***
Anfänglich fuhr ich durch enge Straßen, die rechts und links von Hofreiten gesäumt waren, gelegentlich unterbrochen von kleinen Kneipen, Läden oder einer Kirche. Am Ende des alten Ortskerns fuhr ich an einer kleinen Tankstelle und einem unbebauten Grünstreifen vorbei. Und da waren sie, die schmalen bunten Reihenhäuschen. Eines wie das Andere. Mit den kleinen Fahrrädern vor der Garage und dem bunten Spielzeug im Vorgarten. Die Reihe zu meiner Linken war in einem dunkleren Gelbton gestrichen. Die Reihe auf der rechten Seite war hellblau.