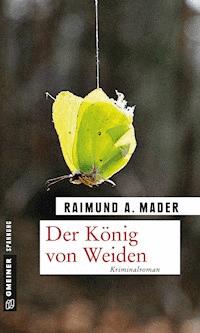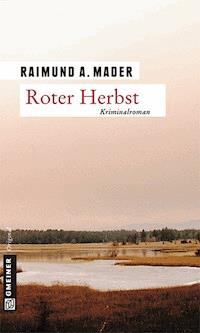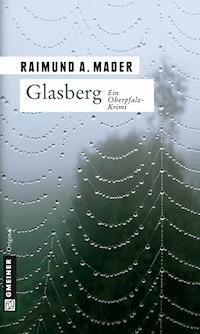
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bichlmaier
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Doppelmord erschüttert die Oberpfalz. In Weiden werden der bekannte Politiker Leonhard Güllner und seine schwangere Tochter Agnes kaltblütig getötet. Kriminalkommissar Adolf Bichlmaier aus Regensburg übernimmt die Ermittlungen in dem brisanten Fall. Zusammen mit seinen Mitarbeitern beginnt er nach Motiven für die Tat zu suchen. Doch es dauert lange, bis Bichlmaier endlich erkennt, dass der Schlüssel für den Mord an Güllner in dessen Vergangenheit liegt: Die Spur führt ihn zurück in die Tage des "Prager Frühlings" nach Bratislava in der Slowakei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raimund A. Mader
Glasberg
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von:©Gabi Schoenemann / PIXELIO
ISBN 978-3-8392-3036-7
Widmung
Meiner Andrea und unseren beiden Mäusen,
Hannah und Daniela, für die geschenkte Zeit …
ERSTES BUCH
Those who have crossed
With direct eyes, to death’s other Kingdom
Remember us – if at all – not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men
T.S. Eliot
1
Mit müden Schritten näherte sich der Mann dem schäbigen Gebäude in der Innenstadt der kleinen Oberpfälzer Stadt, die mit ihren knapp fünfzigtausend Einwohnern provinzielle Behäbigkeit und graue Langeweile ausstrahlte.
Ein nieselnder Aprilregen verstärkte das Gefühl von Trostlosigkeit, das trotz aller Vorboten des Frühlings über der Stadt zu liegen schien. Schon seit Tagen waren Kolonnen des örtlichen Bauhofs und der städtischen Gärtnereien unterwegs gewesen, um die Spuren des langen Winters zu beseitigen. Doch auch dort, wo Bäume von dürrem Geäst befreit worden waren, wo Büsche zu treiben begannen, wo das Gelb der Forsythien erste Farbtupfer zu setzen begann, auch dort ließen der stete Regen und die kalten Stöße des böhmischen Windes die Menschen erschaudern und in sich hineinkriechen.
Von den kahlen Bäumen der Allee tropfte das Wasser, und Leonhard Güllner hatte Mühe, den Pfützen, die sich auf den vom Winter ramponierten Gehwegen sammelten, auszuweichen.
Wie viele Male war er diesen Weg schon gegangen, vom Busbahnhof am Unteren Markt durch die Fußgängerzone, am Alten Rathaus vorbei hin zur Allee, die sich parallel zur Fußgängerzone erstreckte. In den ersten Jahren hatte es noch keine Fußgängerzone gegeben. Die hatte man erst in den späten siebziger Jahren eingerichtet, als sich zeigte, dass sich dadurch der Umsatz der städtischen Geschäftswelt in ungeahntem Maße hatte steigern lassen. Auch der Busbahnhof war neu. Ein rühriger Bürgermeister und ein ihm treu ergebener Stadtrat hatten dafür gesorgt, dass die Infrastruktur der Stadt ihrer wachsenden Bedeutung als Einkaufsmetropole für ein weites Umland entsprechend verbessert und ausgebaut worden war. Leonhard Güllner lachte freudlos in sich hinein, als er an Wellmann, den Bürgermeister, seinen jetzigen Parteifreund, dachte. Der war zu einer Zeit, als er, Güllner, noch unschlüssig war, welchen Weg er einmal einschlagen würde, bereits als Hoffnungsträger seiner Partei für das Amt des Bürgermeisters gehandelt worden. Und schon damals, als vergleichsweise junger, politisch unerfahrener Mann, hatte er es verstanden, die menschlichen Schwächen seiner innerparteilichen Gegner für seine Zwecke zu nutzen. Einen Moment lang dachte Güllner an den alten Hofmann, der sich als Chef der Stadtratsfraktion seiner Partei Hoffnungen auf den Bürgermeistersessel gemacht hatte. Nur wenige Wochen vor der Nominierung − und niemand hatte daran gezweifelt, dass es Hofmann sein würde, der zum Bürgermeisterkandidaten gekürt werden würde − waren Bilder in der örtlichen Presse erschienen, die Hofmanns besonderes Interesse an gut gebauten Knaben deutlich machten. Es wurde niemals geklärt, auf welche Weise das belastende Material dem Verlag zugespielt worden war. Tatsache aber war, dass der Schuss, mit dem Hofmann seinem Leben ein Ende setzte, gleichzeitig der Startschuss zu Wellmanns politischer Karriere gewesen war.
In diesem Augenblick trat plötzlich und unvermittelt ein alter Mann aus einem Torbogen, Güllner in den Weg, sodass dieser sich genötigt sah, für einen kurzen Moment im Schritt innezuhalten, vom Gehsteig herunterzutreten und einen Bogen um das Hindernis zu machen. Der Mann trug einen in undefinierbarem Beige gehaltenen Anzug, der seine Herkunft aus trostloser osteuropäischer Produktion nicht verhehlen konnte. Es schien Güllner, als wolle der Mann ihn ansprechen, sodass er sich ihm, obwohl er dabei weiterging, zuwandte.
»Prozim«, sagte der Mann, und seine toten Augen richteten sich auf Güllner, der ihn verwundert anstarrte.
»Prozim«, murmelte er noch einmal, und er wollte hastig weitersprechen, als plötzlich zwei junge Männer hinter Güllner auftauchten, auf den Mann zutraten und, ihn in ihre Mitte nehmend, lachend und lärmend auf ihn einredeten, wobei sie ihn von Güllner wegzogen. Der Sprache nach schienen es Tschechen zu sein. Der Vorgang dauerte nur wenige Sekunden und doch führte er zu einer augenfälligen Veränderung bei Güllner. Es war, als habe der alte Mann ihm, als sich ihre Blicke kreuzten, etwas mitgeteilt, das ihm tödliche Angst einflößte. Er ging noch einige wenige Schritte, klammerte sich dann an eine der unter den Alleebäumen in regelmäßigen Abständen aufgestellten Bänke und setzte sich schwer.
Güllner achtete nicht auf die Menschen, die an ihm vorbeihasteten, die ihre Blicke kurz auf seine zusammengesunkene Gestalt richteten, verwundert, was er, der im städtischen Leben eine prominente Rolle spielte, hier im nur allmählich nachlassenden Regen tat. Die Menschen hatten auch für einen wie ihn nur einen kurzen Blick ohne eigentliches Interesse. Eine Ahnung von dem Kranken, dem Verlorenen, das ihn umgab, ließ sie wohl weitergehen. Güllner richtete seinen Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite, ohne etwas wahrzunehmen. Wahnsinnige Angst hatte ihn ergriffen. Er wusste, dass er in seinem tiefsten Inneren ein Feigling war, hatte es schon immer gewusst. Feigheit war die Triebfeder all seiner beruflichen, seiner politischen Erfolge gewesen, hatte ihn angestachelt, Trophäen zu erwerben, die die Angst, dass jemand die abgrundtiefe Hohlheit seines Wesens erkennen würde, verbergen halfen. Starke Menschen, das hatte er immer wieder gesehen, brauchten keine Erfolge, die ihnen eine trügerische Sicherheit vorgaukelten. Dieses Wissen allein hatte jedoch nicht genügt, die Leere seines Ichs, die tiefe Angst vor dem Leben, zu überwinden. So war es auch nicht die Angst vor dem Tod, dem Ende eines sinnlosen Lebens, die ihn erschaudern ließ, als vielmehr die Vorstellung der Schmerzen, die mit seinem Tod verbunden sein würden. Er kannte die Männer, die da gekommen waren, die schon auf ihn warteten. Er hatte eine Ahnung von ihrer Lust am Quälen, ihrem Sich-Weiden an den Momenten, in denen sich ihr Opfer alles Menschlichen entledigte und nur noch schreiendes, flehendes Fleisch war. Es war diese Angst, die ihn verfolgte, seit er sich entschlossen hatte, seinem Leben eine andere Richtung zu geben, die ihm den Schlaf geraubt hatte, die ihm sämtliche Kraft aus den Knochen gezogen hatte.
Wieder blickte er hinüber auf die andere Straßenseite, auf das graue Gebäude mit den grellen Neonzeichen. Dort, oberhalb des Capitols, einem der drei Kinos der Stadt, befand sich sein Bürgerbüro, in dem er seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten Bittsteller, Schmeichler, politische Freunde und Feinde empfing. Dort oben hatte er an seiner politischen Karriere gebastelt, hatte er zusammen mit seinem Mentor, dem ehemaligen Abgeordneten Zeller, der grauen Eminenz der Partei, den Grundstein für seinen Aufstieg zum einflussreichen Bundestagsabgeordneten gelegt.
Eigentlich angefangen hatte für Güllner allerdings alles, als er sich als junger Rechtsreferendar im Anwaltsbüro von Zeller, Grochowina und Partner seine ersten Sporen verdienen durfte und dabei den Annäherungen der attraktiven Frau seines Chefs ohne großen Widerstand erlegen war. Maritta war damals, vor etwa fünfundzwanzig Jahren, für den jungen und, was Frauen anbelangte, eher unbedarften Leonhard zu einer Quelle ständiger, erhitzter Erregung geworden. Nicht nur in den Augenblicken, in denen sie durch die Kanzleiräume von Zeller und dem längst verstorbenen Grochowina schlenderte, viel mehr noch in den meist eintönigen und einsamen Nachtstunden in seiner billigen Unterkunft nahe dem Augustinus-Gymnasium erzeugte der Gedanke an ihren sinnlichen Körper eine Lust in ihm, die sich oftmals in seinen Fantasien ins Unermessliche steigerte und dann schmerzhaft und demütigend entlud. Als sie dann eines Abends wie selbstverständlich vor seiner Tür stand und sich ihm, der seiner Verwirrung kaum Herr wurde, anbot, da hatte es für ihn keinen Anlass gegeben − etwa aus einem Gedanken der Loyalität heraus − auf das zu verzichten, was sein Geist bereits im Übermaß genossen hatte. Güllner erinnerte sich an die Wochen und Monate nach ihrem ersten Abend, an Augenblicke der Lust, in denen das, was sein erhitztes Gehirn erdachte, und das, was ihm an sinnlicher Realität gegeben wurde, eins wurden. Maritta selbst schien ohne jegliche Hemmungen zu sein und dankbar für seine außergewöhnlichsten Wünsche und Perversionen. Nie mehr in seinem Leben hatte er dieses Gefühl des absoluten, des grenzenlosen Treibens in auch nur annähernder Weise wieder gefunden. Spiele zwischen unsäglicher Qual und skurrilem Ausleben einer Macht, die im anderen nur mehr das verletzbare, zu peinigende Objekt sah, waren der Rahmen einer Beziehung, die schon bald in eine verzweifelte Verachtung sowohl der eigenen als auch der anderen Existenz mündete.
War es am Anfang nach den Stunden hemmungsloser Ekstase noch die Angst vor der Erschütterung seiner bürgerlichen Fassade, die Güllner zu schaffen machte, wenn er dem Mann gegenübertreten musste, dem er genommen hatte, was diesem doch nie zu eigen gewesen war, so musste er bald erkennen, dass es weitaus schlimmer war, dass er seine Seele an eine Frau verkauft hatte, die durch und durch böse war. Als sie ihm eines Tages sagte, dass sie Dokumente angefertigt hatte, die ihn in Posen tiefster Erniedrigung zeigten, Dokumente, die ihn in jeglicher Weise vernichten konnten, da hatte er, ohne sich sonderlich dagegen aufzulehnen, akzeptiert, dass sein Schicksal von nun an in ihrer Hand lag. Dabei hatte sie es in all den Jahren danach niemals nötig gehabt, auszusprechen, was beide wussten. Ihre Macht über ihn war so vollkommen gewesen, dass sie ohne Worte auskam.
Dennoch war es Maritta gewesen, die dafür gesorgt hatte, dass ihr Mann, ein politisches Schwergewicht, der den Stimmkreis in der nördlichen Oberpfalz seit vielen Jahren im Bundestag vertreten hatte, dass er sich des jungen Güllner annahm und ihm den Weg in die Politik ebnete.
Güllner hatte sich oft gefragt, ob Zeller von seinem Verhältnis mit Maritta gewusst hatte. Maritta selbst hatte mit ihm nie über ihre Beziehung zu ihrem um viele Jahre älteren Mann gesprochen. Als er Zeller einmal gefragt hatte, warum er sich so für ihn einsetze, hatte dieser ihn nur angesehen und gesagt:
»Maritta hält große Stücke auf dich, Leo. Sie meint, du seiest der Richtige, einmal mein Erbe anzutreten.« Es klang dabei ein Ton von Melancholie in seiner Stimme mit, und Güllner hatte wohl begriffen, dass der Ältere die Situation durchschaut hatte. Und dann hatte der gelacht, und es war ein freudloses Lachen gewesen. Güllner hatte sich mit dieser Antwort zufriedengegeben und nie mehr versucht, tiefer in Zeller zu dringen. Auch Maritta hatte ihm, als er sie einmal danach fragte, deutlich zu verstehen gegeben, dass ihn ihre Beziehung zu ihrem Mann nichts anginge. So hatte er die Situation akzeptiert, hatte auch akzeptiert, dass sein Lebensweg von jener Zeit an von diesen zwei Menschen bestimmt wurde.
Zellers Einfluss war es zu verdanken, dass Güllner zu Beginn der achtziger Jahre als damals jüngster Abgeordneter in den Bundestag gewählt wurde. Zeller selbst zog sich, für alle überraschend, in dem Augenblick aus der aktiven Politik zurück, als Güllners Triumph feststand, und er vermied es bis zu seinem Tod, jemals wieder mit seinem ehemaligen Schützling in Kontakt zu treten. Dies hatte natürlich für viel Gerede gesorgt, das sich jedoch bald legte, da sich Zeller fast gänzlich aus dem öffentlichen Leben zurückzog und Güllner durch seine häufigen Aufenthalte in Bonn wenig Anlass für Gerüchte bot.
Dazu kam, dass Zeller schon kurze Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Politik an einer rätselhaften Schwächung des Immunsystems erkrankte und, noch ehe Güllner seine erste Periode im Bundestag ganz absolviert hatte, auch daran verstarb. Güllner hatte Maritta nie geheiratet, sie hatte das nicht gewollt.
Dennoch war sie es gewesen, die in den ganzen Jahren die treibende Kraft hinter Güllner blieb.
Die Frau, die sich in diesem Augenblick neben Güllner auf die regennasse Bank setzte, war ganz plötzlich da gewesen. Güllner, versunken in seine Gedanken, hatte nicht bemerkt, woher sie gekommen war. Wahrscheinlich hätte er von ihr kaum Notiz genommen, wenn sie ihn nicht angesprochen hätte.
»Guten Tag, Leo«, sagte sie, während sie ihn aus traurigen Augen ansah, Augen, die einmal, vor langer Zeit, leuchtend und voll von Leben gewesen sein mussten. Güllner hob den Blick. Ihre Züge waren fein und ebenmäßig und von großer Anmut. Umso schockierender war es, als sie den Kopf wandte und sich Güllner der Blick auf eine schrecklich verformte und vernarbte Gesichtshälfte bot, die die Frau auf grausame Weise entstellte. Ihre Stimme war weich und dunkel und voll Wärme, gleichzeitig schwang in ihr jedoch eine große Traurigkeit, dass Güllner davon noch stärker bewegt war als von ihrem zerstörten Gesicht.
»Kennst du mich nicht mehr?«
Und dann, als er zögerte, sagte sie ganz leise, und er hörte den fremden Klang in dieser Stimme:
»Trommler, Trommler, hör mich an, hast du mich denn ganz vergessen, hab ich denn am Glasberg nicht bei dir gesessen?«
Da fiel es Güllner wie Schuppen von den Augen, und er war auf einmal wieder der Junge, der Achtzehnjährige, der er vor vielen Jahren gewesen war. Und es war für ihn ganz selbstverständlich, dass sie da war.
»Bist du gekommen, Petra, bist du endlich gekommen?«
Und dann, als sie nicht antwortete, sagte er:
»Nun, dein Trommler hat auf dich gewartet. All die Jahre habe ich auf dich gewartet. Selbst als ich glaubte, dass du tot seiest, selbst da habe ich auf dich gewartet.«
Da lächelte die Frau, und sie schaute ihn nicht an, als sie ihn fragte:
»Und, Leo, bist du bereit, mit mir zu gehen? Bist du bereit, auf den Glasberg zu steigen? Bedenke, dieses Mal werde ich nicht mir dir sein.«
Der Blick, mit dem sie den Mann neben sich dann ansah, war streng und von archaischer Härte dort, wo das Wundmal ihre Züge versteinert hatte, doch mild und gütig, wo sich ihr Herz spiegelte.
»Ich habe Angst, Petra, so schreckliche Angst. Warum kommst du nicht mit mir? Kannst du mir denn nicht vergeben?«
Der Mann schaute die Frau neben sich an, und plötzlich waren sie beide wieder jung, und die Spuren des Lebens waren aus ihren Gesichtern verschwunden. Petra schüttelte leise den Kopf.
»Nein, Leo, ich kann dir nicht vergeben. Vergeben, das kann nur einer wie Gott. Aber leider gibt es keinen Gott mehr. Der ist vor langer Zeit gegangen und hat uns alleingelassen. Vielleicht hast du ihn damals vertrieben. Vielleicht aber hat es ihn überhaupt nicht gegeben, und wir haben ihn uns nur erträumt, und dann haben wir unsere Träume verloren.«
Sie sagte dies, und der plötzlich vorhandene schwere Akzent in ihrer Stimme wirkte wie ein Filter, der alles Pathetische aus ihren Worten wegnahm und nur einen Bodensatz von Traurigkeit übrig ließ.
»Dann gibt es also keine Hoffnung für mich?«, fragte Güllner, doch die Frau schwieg.
Der Regen hatte inzwischen nachgelassen, und an manchen Stellen des Himmels zeigte sich für kurze Momente eine Spur von Blau, die im nächsten Moment von den vorüberjagenden Wolken wieder aufgesogen wurde. Wie die Feuerzungen eines tausendköpfigen Drachens, der in unstillbarer Gier alles Leben in seiner Nähe verschlingt, so fegten die Wolken über die graue, trostlose Stadt.
Ein kleines Mädchen näherte sich der Bank, auf der Güllner und die Frau saßen. Es hatte sich für einen Moment von der Hand seiner Mutter losgerissen und sprang nun jauchzend durch die größte Pfütze, die sich vor der Bank gebildet hatte. Wasser spritzte nach allen Seiten, durchnässte das Schuhwerk des Kindes. Die schrillen Schreie und die nervöse Hilflosigkeit seiner Mutter schien es nicht wahrzunehmen. Es war eingetaucht in eine Welt, in der kein Platz war für andere, in der es niemanden brauchte, nur sich und seine Fantasien. Da fiel sein Blick auf die beiden Menschen auf der Bank, und das Mädchen verharrte für einen kleinen Moment in seinen Bewegungen. Es lächelte und ein Ausdruck des Verstehens trat in seine Augen, sodass sein Gesicht plötzlich ganz alt wurde. Doch mit einer kleinen Geste wischte es seine Verlegenheit hinweg und rannte hin zu seiner Mutter.
»Siehst du, Leo, das ist unser Problem. Wir können nicht mehr wie die Kinder sein, wenn wir einmal unsere Unschuld verloren haben. Das ist das Verzwickte an unserer Situation. Etwas steckt in uns von Anfang an, und dieses Etwas wird immer größer und größer, und auf einmal ist es dann so groß, dass es uns völlig beherrscht.«
»Gibt es denn keinen Weg zurück?«
»Den gibt es nur in den seltensten Fällen. Ja, manchmal werden die Menschen im hohen Alter wieder wie die Kinder. Sie vergessen dann, dass sie einmal erwachsene Menschen gewesen sind, und ihre Schuld wird ihnen erlassen. Da sie aber in einem Zustand des Vergessens sind, nützt ihnen dies nichts.«
Güllners Blick folgte dem kleinen Mädchen, das nun neben seiner Mutter ging und ab und zu voll Lebensfreude zu hüpfen begann, von seiner Mutter aber sogleich wieder zurechtgewiesen wurde.
»Warum wollt ihr mich dann töten?«, fragte Güllner.
»Weil die Bilanzen des Lebens stimmen müssen.«
»Dann bin ich also nur eine Nummer in einer sinnlosen Addition, bei der es nie zu einem Ergebnis kommen kann?«
Die Frau sah den Mann neben sich an und legte eine Hand auf die seine. Sie nickte.
»Und was ist dann mit den anderen? Sind sie auch Teil eurer Buchhaltung? Werdet ihr sie auch töten? Oder habt ihr sie schon getötet?«
»Ach, Leo«, sagte die Frau darauf und sah Güllner missbilligend an.
»Was du nur für dumme Fragen stellst. Was die anderen getan haben, muss dir doch einerlei sein. Es ging immer nur um das, was du getan hast. Hast du denn das noch immer nicht verstanden?«
»Doch, Petra, ich habe schon verstanden. Ich habe all die Jahre gewusst, dass ich irgendwann würde bezahlen müssen für das, was ich dir angetan habe. Ich weiß, dass ich dein Leben in dieser einen Nacht zerstört habe, aber glaube mir, auch mein Leben war von jenem Zeitpunkt an ohne Sinn und ohne Freude. Bei allem, was ich seit jener Zeit getan habe, immer habe ich dein Bild, dein Lachen, deinen Schmerz vor meinen Augen gehabt.«
»Meinen Schmerz, Leo? Nein, meinen Schmerz kann man nicht mit den Augen sehen. Meinen Schmerz, den muss man fühlen, bis man eins wird mit ihm.«
Die Frau hatte Güllner bei diesen Worten den entstellten Teil ihres Gesichtes zugewandt, ihn so in den Spiegel menschlicher Abgründigkeit blicken lassend. Schaudernd löste dieser seinen Blick, betroffen von der Bösartigkeit, die sich ihm zeigte und die doch die eigene nur war.
Auf der Bank, die sich in einem Abstand von etwa fünfzig Metern hinter der befand, auf der Güllner und die Frau saßen, hatten die zwei jungen Männer Platz genommen, die vor kurzer Zeit Güllners Weg gekreuzt hatten. Unbeweglich und aufrecht saßen sie da, nun nicht mehr lachend und ohne sich zu unterhalten, wie zwei der Zeit entrückte Wächter, die die Unerbittlichkeit eines für den Menschen nicht fassbaren Schicksals verkörperten. Es schien, als seien ihre Blicke ohne Ziel, unfähig, auf Mensch und Gegenstand zu ruhen, ins Nichts gerichtet. Wie die beiden blinden Diener jener alten Dame, die einst gekommen war, der Welt ihre Rechnung zu präsentieren, saßen sie da, drohend, schweigend, gefühllos.
Dennoch wusste Güllner, dass diese beiden nur seinetwegen da waren, auf ihn warteten, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten.
»Wirst du deinen Schmerz je vergessen können? Nun, da die Rechnung bald beglichen sein wird? Ach, Petra, wirst du noch einmal glücklich sein, ein Leben führen wie die anderen Menschen auch?«
Die Frau neben Güllner schüttelte den Kopf.
»Nein, Leo, Menschen, die zerbrochen wurden, können niemals vergessen, was man ihnen angetan hat. Da führt kein Weg zurück. Solche Menschen können nie mehr Glück empfinden, nie mehr Liebe empfangen oder geben. Solche Menschen sind nicht einmal mehr in der Lage zu hassen. Das Einzige, was diesen Menschen bleibt, ist die Hoffnung, Ruhe zu erlangen, eine Ruhe, wie sie sie ganz nur im Tod finden.«
Dann, nach langem Schweigen, fragte sie ihn:
»Bist du je glücklich gewesen, danach? Du sagtest, du habest immer mein Bild vor Augen gehabt. Hat es nicht dennoch Augenblicke gegeben, in denen du eine Spur von Glück empfunden hast?«
Güllner lehnte sich zurück. Er faltete die Hände hinter seinem Kopf und blickte hinauf auf die dahintreibenden Wolken, die die aberwitzigsten Figuren und Bilder formten, um diese, kaum dass sie entstanden waren, gleich wieder zu zerstören. Seine Gedanken bewegten sich zurück in die Zeit nach jenem unsäglichen Vorfall, der das Leben so vieler Menschen verändert hatte. Für ihn waren es Jahre des Lernens, des Studierens, des Versuchs zu vergessen gewesen. Damals, als die Welt im Umbruch war, als viele die so schnell welkenden Blüten der Hoffnung im Haar trugen, hatte er sich seiner Ausbildung gewidmet, hatte er Zuflucht in der trockenen Materie des Jurastudiums gesucht. Nein, dies war keine Zeit gewesen, in der er Freude oder gar Glück empfunden hatte. Auch danach nicht, als sich berufliche Erfolge einstellten, oder in den Momenten, in denen er seinen sexuellen Hunger stillte, noch weniger, als er in die entwürdigende Abhängigkeit von Maritta und ihrem Mann geriet. Je mehr er in dieser Zeit in den Augen der Welt vorangekommen war, desto stärker war das Gefühl ewiger Verlorenheit in ihm hochgekommen. Da hatte er sich dann oft an die unbeschwerte Zeit seiner Kindheit erinnert, an die Frische der beginnenden Tage, als er mit einem Gefühl grenzenloser Energie zu erwachen pflegte, voll Freude auf das, was der Tag ihm bringen würde. Und es war ihm manchmal, als könne er die Gerüche dieser frühen Morgenstunden noch einmal einatmen. Doch nie mehr, nie mehr hatte er diese Freude empfunden, nie mehr die Leichtigkeit der damaligen Unschuld verspürt. Und doch, es hatte Augenblicke gegeben, in denen er eine kleine Ahnung bekam von dem, was Glück bedeuten könnte.
»Ja, Petra, solche Momente hat es gegeben. Momente, in denen ich glaubte, einen Zipfel des Glücks in Händen zu halten. Ich hatte mein Leben verpfuscht, noch ehe es so richtig begonnen hatte, und doch ist aus der Erstarrtheit meiner Existenz neues, unschuldiges Leben entstanden. Als ich zum ersten Mal mein neugeborenes Kind, meine kleine Agnes, in den Armen hielt, da war mir, als habe sich ein Wunder ereignet, ein Wunder so groß, dass daneben die Schwere meiner Schuld ein wenig verblasste.«
»Ach Leo«, sagte daraufhin die Frau, und ihre Stimme war hart, und ihr fremder Akzent war plötzlich wieder deutlich zu hören. »Auch die Schergen Hitlers waren Väter, waren Mütter. Ist denn ihre millionenfache Schuld geringer, nur weil sie neues Leben in diese graue Welt setzten?«
Güllner war betroffen von der Bitterkeit, mit der die Frau die Worte hervorstieß, und Schweigen trat zwischen die beiden Menschen. Dann, nach langer Zeit, als der Wind den Klang der Verzweiflung hinweggefegt hatte, sagte die Frau mit leiser Stimme:
»Du musst jetzt gehen, Leo. Es ist Zeit.«
Da erhob sich Güllner, und er blickte hinunter auf die kleine Gestalt mit dem entstellten Gesicht, und er wollte ihr sagen, wie sehr er sie liebte und wie leid es ihm tue, und er wollte sie in seine Arme nehmen, sie umklammern und sich an ihr festhalten, doch ihre Augen waren in die Ferne gerichtet und verwehrten ihm jegliche Hoffnung. Als er sich umwandte, da sah er, wie sich die beiden jungen Männer langsam in Bewegung setzten. Sie traten an ihn heran, nickten ihm zu und nahmen ihn in ihre Mitte.
Und als sie sich von der Bank entfernten, die drei Männer, da war der Blick der Frau noch immer in die Ferne gerichtet. Doch auf ihren Lippen hatten sich Worte gebildet, die nur sie hören konnte.
»Da gehst du nun hin, du dummer Mensch. Du weißt, dass du sterben musst, und doch gehst du nun deinen Weg. Warum bist du nur damals nicht auch ein kleines bisschen mutiger gewesen? Warum, Leo, warum?«
Die drei Männer gingen die wenigen Schritte durch die Allee und überquerten die Straße, die um diese Tageszeit nur wenig befahren war. Als sie sich dem Kino näherten, konnten sie durch die geöffneten Fenster des Foyers das An- und Abschwellen einer bombastischen Musik hören, die einen der gezeigten Filme untermalte. Vor dem kleinen Nebeneingang, von dem aus eine Treppe zu der Etage führte, auf der sich Güllners Büro befand, blieb der Abgeordnete stehen, wandte sich um zu den beiden Männern, die nun hinter ihm waren und ihn schweigend und ohne Regung betrachteten, und sein Blick sagte ihnen, dass er die letzten Schritte ohne sie gehen wollte. Dann öffnete er die Tür, und die Musik, die ihm entgegenschwappte, wurde lauter und schriller, und die beiden Männer wussten, dass ihr Auftrag erledigt war, dass der Rest dessen, was den Mann nun erwartete, ihrer Mithilfe nicht mehr bedurfte.
Nur kurz verharrte Güllner am Fuß der Treppe, die er so viele Hundert Male hinauf- und hinabgegangen war. Seine Hand strich über das abgegriffene Holz des Geländers. Und plötzlich wurde die Angst in ihm übermächtig, und er verlor jegliche Kontrolle über seinen Körper, spürte nicht mehr, wie der heiße Urin an seinen Beinen hinunterlief, sich der ekelerregende Gestank seiner Gedärme in seine Hosen ergoss und ein krampfartiges Zucken seinen Körper überfiel. Es war eine so unbeschreibliche Angst, die von ihm Besitz ergriffen hatte, dass sie alles andere in ihm auslöschte, ihn wie eine Welle erfasste und ihn dorthin spülte, wo der letzte Akt seines verpfuschten Lebens gespielt werden würde. Und während unten die Musik anschwoll, öffnete er die Tür, und als er eintrat, da erblickte er den geschundenen Körper seines Kindes, und er tauchte ein in den Schmerz, von dem die Frau gesprochen hatte, wurde Teil davon, und er sah sein Kind, sein Leben, sah die klaffende Wunde, den gebrochenen Blick, sah, was sie mit seinem Mädchen gemacht hatten, und er wusste, dass nicht sie es gewesen waren, dass er all dies getan hatte, und als der Schmerz zu groß wurde, als er ihn nicht mehr ertragen konnte, da hörte er auf zu denken und zu sein. In diesem Augenblick traf ihn die barmherzige Kugel aus der großkalibrigen Pistole und riss ein hässliches Loch in seine Schädeldecke.
Ein alter Mann in einem schäbigen Anzug, gehalten in undefinierbarem Beige, schraubte wenig später den Schalldämpfer von der Waffe, verstaute ihn und die Pistole in einer billigen Plastiktüte und verließ den Raum. Von unten drang noch immer Musik nach oben.
2
Adolf Bichlmaier, Hauptkommissar im Regensburger Morddezernat, hatte den Motor seines Wagens abgestellt, war jedoch noch sitzen geblieben, um dem Regen, der auf das im Lauf der Jahre mürb gewordene Stoffdach seines alten Saab prasselte, zu lauschen. Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass durch die porösen Stellen im hinteren Teil Wasser ins Wageninnere sickerte, das sich, unsichtbaren Kanälen folgend, unter den Fußmatten sammelte. Wenn der Regen in dieser Stärke die ganze Nacht über anhalten würde, dann konnte er davon ausgehen, dass am nächsten Morgen das Wasser knöcheltief im Fußraum stehen würde. Er verfluchte sich selbst, dass er noch nichts dagegen unternommen hatte, dann verfluchte er das Wetter und schließlich die Tatsache, dass er über keine Garage verfügte. Irgendwie war das ja Mariannes Schuld, denn seit seine Frau das neue Auto fuhr, war es keine Frage, wer über den Garagenplatz, den sie im nahen Parkhaus für sündteures Geld angemietet hatten, verfügen durfte. Wenn man es genau betrachtete, so gab es eigentlich auch keinen Grund, warum sie sich einen zweiten Wagen leisten sollten, gerade jetzt, wo die Benzinpreise in abenteuerliche Höhen geklettert waren, aber Marianne hatte darauf bestanden.
»Ich brauche ein Auto!«, hatte sie erklärt, und ihr Ton war so gewesen wie damals, als er ihr vorgeschlagen hatte, die viel zu kleine Wohnung im Zentrum von Regensburg aufzugeben und in das geräumige Haus seiner Eltern am Stadtrand zu ziehen.
»Nur über meine Leiche!«, hatte sie gesagt und ihn dabei mit einem Blick angesehen, der ihm signalisierte, dass jeglicher Widerstand zwecklos war. Natürlich hatte sie damals recht gehabt. Spätestens nach zwei Wochen wäre ihre damals noch junge Ehe den Bach hinuntergegangen. Da war er sich mittlerweile sicher. Was wäre gewesen, wenn er damals nicht nachgegeben hätte?
Missmutig blickte er hoch zu den erleuchteten Fenstern im dritten Stock.
Die Schlieren des Regenwassers ließen die Silhouette des imposanten Gebäudes verschwimmen, und er hatte plötzlich das Gefühl, als sei der alte Bau dabei, völlig aus dem Lot zu geraten, als würde er nun jeden Augenblick auf ihn niederstürzen und ihn unter sich begraben.
Dabei hatte es heute Morgen angefangen wie immer. Ein Wort zu viel, ein verletzender Nebensatz, eine Auseinandersetzung, die eigentlich keiner wollte. Was war es überhaupt gewesen, worüber sie sich gestritten hatten? Bichlmaier hatte es vergessen. Sicher wieder der Vorwurf, dass er zu viel arbeitete, dass er seinen Beruf mehr liebte als sie. Sie hätten Kinder haben sollen, dann wäre sie vielleicht zufriedener gewesen, dachte er. Es hatte halt nicht geklappt. An ihm hatte es nicht gelegen. An ihr auch nicht …
Er wusste, sie würde jetzt in der Küche sitzen und weinen, und dann würde er versuchen, sie zu trösten, würde er versuchen, ihr zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutete, und er wusste, dass ihm dazu wieder einmal die Worte fehlen würden. Da würde er sie dann in die Arme nehmen und sie so lange an sich drücken, bis sie aufgehört hatte zu weinen. Bis sie zu müde war, weiterzuheulen. Aussitzen, dachte er. Man muss die Dinge nur aussitzen.
Dann stieg er aus, und die wenigen Augenblicke, die er brauchte, um unter das schützende Vordach zu kommen, genügten, ihn total zu durchnässen. Der Fahrstuhl war wieder mal außer Betrieb, und so schlurfte er die drei Stockwerke hoch. Ehe er aufsperrte, blieb er einen Moment stehen, versuchte, etwas zu Atem zu kommen, und wischte sich das Wasser aus dem Gesicht. Nächste Woche würde er anfangen, etwas für seine Gesundheit zu tun. Vielleicht joggen. Oder Rad fahren. In sämtlichen Zimmern brannte das Licht. Auf dem Tisch in der Küche lag ein Zettel: Bin bei Mama. »Verdammt«, sagte er. Im selben Augenblick läutete das Telefon.
Als Meier Zwo ankam, hatte Bichlmaier bereits geduscht und trockene Klamotten angezogen. Marianne hatte sich nicht mehr gerührt, und als er versucht hatte, bei seiner Schwiegermutter anzurufen, war die Leitung besetzt gewesen. Er hatte Kopfschmerzen.
Meier Zwo war schon seit über zehn Jahren bei der Mordkommission in Regensburg und arbeitete seit fast ebenso vielen Jahren in Bichlmaiers Abteilung. Der schätzte ihn, vor allem, weil er es verstand, zur rechten Zeit den Mund zu halten, andererseits aber oftmals die Dinge auf den Punkt brachte, gerade wenn sie mit ihren Ermittlungen in einer Sackgasse steckten. Dennoch war er bei den meisten der anderen Kollegen wenig beliebt, wohl auch deswegen, weil er ein rechter Zyniker war und in seiner knappen und barschen Art oftmals sehr verletzend sein konnte.
Das kurze Autobahnstück zwischen Regensburg und dem Einsatzort in Weiden war bei einbrechender Dämmerung nur wenig befahren, doch Meier Zwo musste höllisch aufpassen, dass er den schweren Dienstwagen bei dem hohen Tempo, das er fuhr, auf der regennassen Fahrbahn in der Spur halten konnte.
»Warum sind wir so spät erst informiert worden?«, fragte Bichlmaier. Meier Zwo zuckte mit den Achseln.
»Die üblichen Kommunikationsprobleme. Die Kollegen in Weiden wollten zuerst selbst übernehmen. Aber dann ist ihnen die Sache zu heiß geworden, und sie mussten den zuständigen Staatsanwalt informieren. Der war aber dann gerade bei einer Besprechung und … na ja, du weißt schon.«
Bichlmaier grunzte angewidert.
»Scheiß Bullen«, sagte er. Meier Zwo grinste und schaltete endlich in den fünften Gang hoch. Eigentlich waren sie ein gutes Team, er und sein Chef.
Sie parkten in der Tiefgarage in der Nähe des Kinocenters und gingen die wenigen Meter zu Fuß, folgten damit, ohne dies zu wissen, den letzten Schritten, die Leonhard Güllner vor wenigen Stunden gegangen war. Der Regen hatte mittlerweile etwas nachgelassen, aber noch immer tropfte das Wasser von den kahlen Bäumen, die die Straße säumten. Dies schien die Menge von Schaulustigen und Gaffern, die sich gegenüber von Güllners Bürgerbüro aufgebaut hatte, aber kaum wahrzunehmen. Da war eine eigentümliche Stimmung unter den Menschen, die fast ohne Bewegung in der Kälte des frühen Abends ausharrten. Selbst das vor Ort erschienene Kamerateam eines örtlichen Fernsehsenders war Teil des kollektiven Entsetzens geworden, das Adolf Bichlmaier fast körperlich spüren konnte, als er und Meier Zwo sich ihren Weg zu der Absperrung bahnten, die von zwei jungen Polizeibeamten gesichert wurde. Aber erst als Bichlmaier in die Gesichter der beiden blickte, ahnte er, dass ihm nun etwas bevorstand, was ihm in seinem langen Polizistenleben noch nicht begegnet war.
Sie waren dann die Treppe hochgegangen. Meier Zwo war dicht hinter ihm gewesen. Im Rückblick sollte sich Bichlmaier vor allem daran erinnern, dass ihm Meiers gepresster, unangenehm säuerlicher Atem extreme Übelkeit erzeugt hatte, ihn aggressiv gemacht hatte, sodass er am liebsten geschrien hätte, ihn am liebsten weggestoßen hätte. Er hatte den Eindruck gehabt, als sei das Treppenhaus erfüllt von diesem Geruch, von diesem Rhythmus aus Angst und Hilflosigkeit.
Aus dem Raum vor ihnen war das grelle Licht der Scheinwerfer gedrungen, die aufgestellt worden waren, das Unbegreifliche bis ins letzte kleine Detail auszuleuchten. Und als Bichlmaier in den Raum trat, da nahm er ein Bild in sich auf, das er für den Rest seines Lebens in sich tragen würde. Es war nicht der tote Mann, der da in seltsam kniender Stellung, vornüber gekippt, am Boden lag, der den Anblick so unerträglich machte. Es war vielmehr das Mädchen. Ihre Arme waren festgebunden an den Holmen des mächtigen Bücherregals, das die gesamte rückwärtige Wand des Raumes bedeckte. Ihre Beine waren gespreizt und ebenfalls an den Holmen fixiert. Ihr Unterkörper war entblößt. Der oder die Täter hatten dazu ganz offensichtlich Wert darauf gelegt, dass der gebrochene Blick des Mädchens, in dem die Qualen des Todeskampfes wie in einer Momentaufnahme festgehalten waren, den Eintretenden direkt traf. So hatten sie ihren geschundenen Kopf mit Isolierband umwickelt und ihn dann so am Regal befestigt, dass er nicht auf die Brust sacken konnte. Ihre Bluse war weit geöffnet, aufgerissen, gab so den Blick frei auf eine klaffende Wunde, die von schwarzem Blut gerändert war. Bichlmaier war nur wenige Schritte in den Raum hineingetreten, dann bewegungslos stehen geblieben. Selbst nach den langen Jahren bei der Mordkommission und den vielen Variationen menschlicher Grausamkeit, die er dabei erfahren hatte, bereitete ihm der erste Anblick der oftmals übel zugerichteten Opfer immer noch größtes Unbehagen. Das Schlimmste waren für ihn immer die Kinder gewesen, die Halbwüchsigen, die eigentlich noch ein ganzes Leben vor sich gehabt hätten. Er hatte auf den Körper des Mädchens gestarrt, auf die schreckliche Wunde, und dann hatte er in einem Augenblick aberwitzigen Hoffens geglaubt, den Herzschlag des Mädchens unter der Wunde wahrzunehmen, und er hatte aufschreien wollen, jedoch im selben Moment gesehen, dass es lediglich ein kleines schwarzes Insekt gewesen war, das aus dem Einschussloch hervorgekrochen war. Da hatte sein Magen zu rebellieren begonnen, und er hatte sich umgedreht, war hinausgestolpert, und dann hatte er sich in einer Ecke des Treppenhauses übergeben.
»Das Mädchen war seine Tochter. Siebzehn Jahre alt. Er muss sie noch so gesehen haben, wie Sie sie gerade gesehen haben. Erst dann ist er erschossen worden.«
Bichlmaier drehte sich um. Der kleine, graue Mann, der hinter ihm stand, wirkte fast verlegen, als er sich vorstellte.
»Mahr. Ich habe mit Ihrem Kollegen in Regensburg telefoniert. Wir waren als Erste am Tatort.« Er reichte Bichlmaier die Hand und legte mit einer nachsichtigen Geste die zweite darüber.
»Verdammt, was ist hier nur passiert?«, erkundigte sich Bichlmaier , den es immer noch würgte, und er sprach dabei mehr zu sich selbst als zu seinem Kollegen. Der kleine Mann seufzte.
»Natürlich wissen wir noch sehr wenig. Sicher ist nur, dass es sich bei den beiden Opfern um Leonhard Güllner, den Politiker, und um seine Tochter Agnes handelt.«
Bichlmaier kannte Güllner, wusste zumindest, wer er war. Schließlich war der ein hochrangiger Politiker gewesen, weit über die Grenzen des Oberpfälzer Raums hinaus bekannt. Ständig präsent in sämtlichen Medien. Für seinen Geschmack viel zu präsent. Bichlmaier, der Politiker nicht leiden konnte, deren oftmals penetrante Selbstgefälligkeit ihn abstieß, dachte an den Toten in dem grell erleuchteten Raum. Die Vorstellung, was der Mann vor seinem Tod durchlebt haben musste, drückte ihm das Herz ab. Das war wie ein körperlicher Schmerz. Der da vor seinem toten Kind gekniet hatte, war kein Politiker mehr gewesen, nur ein armes, hilfloses Schwein. Ein totes armes Schwein, dachte Bichlmaier. Was musste es für ihn bedeutet haben, sein Kind in solch einem Zustand vorzufinden? Er dachte an Marianne, die so gerne Kinder gehabt hätte.
»Wir haben nur den Tatort abgesichert, und dann haben wir euch gerufen«, wiederholte Mahr, als wollte er sich dafür entschuldigen, dass er den Fall noch nicht gelöst hatte.
»Für uns ist das Ganze natürlich eine Nummer zu groß. Das war uns sofort klar.« Er lächelte traurig und sah dabei aus wie ein altes, graues Zirkuspferd.
»Wurden die Angehörigen schon verständigt?«, fragte Bichlmaier.
Mahr zuckte mit der Schulter.
»Wir haben versucht, Frau Güllner zu erreichen. Bislang ohne Erfolg.«
»Na gut, versucht es weiter.«
»Die Kollegen von der Spurensicherung kommen jeden Moment«, sagte Meier Zwo.
»Motsch habe ich zu Hause erreicht; müsste auch gleich da sein.«
Motsch war der Chefpathologe, ein höchst arroganter Mensch, der aber in schwierigen Fällen oder bei Fällen, bei denen es um prominente Opfer ging, immer hinzugezogen wurde.
Bichlmaier nickte etwas säuerlich.
»Könnt ihr mal das Licht in dem Zimmer wegnehmen«, sagte er dann. »Ich möchte den Raum so sehen, wie er gewesen ist, als die Leichen entdeckt wurden.«
Seit er als junger Mann von der Polizeischule zur Mordkommission gekommen war und vor allem, seit er selbst als Leiter in der Verantwortung stand, hatte er es sich zum Prinzip gemacht, wo immer dies möglich war, in einem ganz frühen Stadium der Ermittlungen die Orte, an denen ein Verbrechen stattgefunden hatte, mit all seinen Sinnen zu erfassen.
»Jeder Tatort hat seine eigene Ausstrahlung, seine Gerüche, seine Geräusche, seine ganz spezifische Art der Komposition, mit der die Dinge auf unser Auge treffen«, hatte der alte Stangl immer gesagt.
»Da müssen sie erst mal mit dem Bauch ran, meine Herrn, nicht nur mit dem Kopf.«
Damals auf der Polizeischule in München Sendling. Die jungen Beamten, die Heißsporne, die darüber nur gelächelt hatten. An die Technik und an den Verstand hatten sie geglaubt, an die den Dingen innewohnende Logik. Stangl, der in seiner speckigen Lederbundhose und den klobigen Haferlschuhen ein Original gewesen war, hatte bei seinen Schülern nur verlegenes Grinsen geerntet. Und doch hatte er recht gehabt, wie Bichlmaier schon bald erkannt hatte. Natürlich wäre es blanker Unsinn gewesen zu glauben, dass das Eintauchen in die Aura eines Tatorts allein schon zur Lösung des Falles führen würde. Da hätte man gleich mit Hellsehern und Propheten statt mit Polizisten arbeiten können. Doch blieb trotz aller Professionalität und Rationalität der Polizeiarbeit immer ein kleines Quäntchen an Unwägbarkeiten, das das intuitive Entscheiden während der Ermittlungsarbeit unabdingbar machte. Und oft schon hatte gerade das Unbewusste, gespeist aus solchen nicht näher bestimmbaren Quellen, zum Erfolg geführt.
Bichlmaier wusste, dass er nun bereit sein würde, den Tatort näher in Augenschein zu nehmen.
»Ein Bulle, der kotzen muss, wenn er eine Leiche sieht. Ob das gut geht?«, sagte er in Richtung Mahr und versuchte, eine leichte Verlegenheit zu unterdrücken. Der lächelte jedoch nur sein Zirkuspferdlächeln und meinte lapidar: »Mein Schwager ist beim Finanzamt. Was meinen Sie, wie oft der kotzen muss?«
Die Kollegen hatten mittlerweile die starken Halogenlampen abgeschaltet, sodass der Raum mit den beiden Toten durch das weiche Licht der Deckenlampe eine Wärme gewann, die das Entsetzliche der Tat noch stärker hervortreten ließ. Es war Bichlmaier, als er nun ein zweites Mal durch die Tür trat, als würde er aus der Dunkelheit eines Theaterraums auf die spärlich illuminierte Szene einer griechischen Tragödie oder eines Jesuitendramas blicken. Der Raum war aufgeräumt, kein umgestürzter Stuhl, keine auf dem Boden verstreuten Akten, die darauf hätten schließen lassen, dass ein Kampf stattgefunden hatte. Alles strahlte Ordnung aus, und selbst das an das Bücherregal gekreuzigte Mädchen schien irgendwie mit dem Raum zu verschmelzen, schien Teil einer Dekoration zu sein, die nur durch die Leiche des Mannes in ihrer schrecklichen Harmonie gestört wurde. Bichlmaier trat näher, um den klotzigen Schreibtisch herum, immer darauf bedacht, nichts zu berühren oder zu verändern. Und wieder entstand, als er vor den Toten stand, ein Bild vor seinen Augen, vor dem die realen Gegebenheiten zurücktraten. Der Anblick der beiden erinnerte ihn an eine alte barocke Darstellung der Gottesmutter, die zu Füßen ihres gekreuzigten Sohnes in tiefstem Schmerz verharrt. Nur dass hier die Vorzeichen vertauscht waren. Der Vater, der den Tod der Tochter betrauerte. Irgendetwas schien ihm an diesem Bild wichtig zu sein, ohne dass er es jedoch fassen konnte. Der Moment ging vorüber, der Eindruck verflüchtigte sich.
Im Eingangsbereich, am Fuß der Treppe, waren Stimmen zu hören, Männer, die fluchend den Regen aus den Kleidern schüttelten, polternde Schritte auf dem Weg nach oben, Metallkoffer, die gegen das Geländer schlugen. Über allem die hohe, schneidende Stimme von Motsch.
»Hätte jemand die Güte, mir zu sagen, wo die Leichen liegen?«
Und ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, stapfte er die letzten Stufen herauf und trat auf das Zimmer zu. Als er Bichlmaier wahrnahm, der gerade den Raum verlassen wollte, stutzte er kurz, und dann, als er das tote Mädchen erblickte, spitzte er den Mund und stieß einen affektierten kleinen Pfiff aus.
»Ach du heilige Scheiße!«, sagte er.
»Macht das Licht wieder an«, rief Bichlmaier nach draußen und wandte sich an Motsch.
»Schau dir doch mal die beiden an, bevor die Techniker loslegen. Ich bräuchte deine ungefähre Einschätzung, wann der Tod eingetreten ist.«
»Mal sehen, was sich machen lässt«, nickte der, und als er sich an Bichlmaier vorbeizwängte, schlug er ihm süffisant grinsend mit der flachen Hand auf den Bauch.
»Du wirst fett, mein Alter. Wie geht’s denn Marianne?«
»Blödes Arschloch«, dachte Bichlmaier und zog den Bauch automatisch etwas ein.
»Gut«, sagte er.
Als er auf den Korridor hinaustrat, nahm er plötzlich einen unscheinbaren Mann wahr, der offensichtlich schon die ganze Zeit dort gewartet hatte, den er aber bislang überhaupt nicht registriert hatte. Er war ihm auf Anhieb in einer Weise unsympathisch, wie er dies selten erlebt hatte. Gegen diesen Typen war selbst Motsch noch so etwas wie ein Sympathieträger.
»Das ist Herr Lamprecht. Er hat die beiden Toten entdeckt und uns sofort benachrichtigt«, sagte Mahr ohne sonderliche Begeisterung.
Lamprecht wirkte nur auf den ersten Blick unscheinbar. Als sich Bichlmaier ihm nun zuwandte, da erkannte er eine seltsame Ausgeformtheit der Gesichtszüge des Mannes, die auf verwirrende Weise in lauter Einzelteile zu zerfallen schienen. Es war ihm, als würde sein Blick angezogen von diesem Gesicht, ohne dass es ihm die Möglichkeit zu verweilender Ruhe bot. Und so blieb, als er den Blick wendete, nicht der Abdruck eines Ganzen haften, sondern lediglich die Ahnung von einer ungewöhnlich fein geformten Nase, von Augen, die sich in jeweils Hunderte von blassen Punkten der Iris aufgelöst hatten, von seltsam mädchenhaft geschwungenen Lippen und von einem Oberlippenbart, der präzise rasiert aussah, als sei er von der Hand eines japanischen Tuschezeichners gemalt worden.
Das Fehlen einer harmonischen Gesamtheit wirkte verwirrend auf Bichlmaier und löste bei ihm ein Gefühl von Unruhe aus, das ihn mit instinktiver Abscheu und Abwehr reagieren ließ. Etwas haftete diesem Gesicht an, das ihn wie ein kaum wahrnehmbarer, ekelerregender Geruch abstieß, ohne dass er genau hätte sagen können, was seine Abneigung erzeugt hatte.
»Herr Lamprecht arbeitet beim Oberpfälzer Kurier und wollte ein Interview mit Güllner machen«, sagte Mahr, der Bichlmaiers Abneigung gegenüber dem Mann zu teilen schien.
»Erzählen Sie«, wandte sich Bichlmaier an den Journalisten.
»Wie sind Sie denn überhaupt hier heraufgekommen? Ist der Eingang unten normalerweise nicht abgeschlossen?«
Er habe einen Termin mit Güllner gehabt, sagte Lamprecht. Wegen des Interviews. Dies sei der Grund gewesen, warum er habe vorsprechen wollen. Als er unten an der Eingangstür geläutet habe, sei ihm nicht geöffnet worden, woraufhin er festgestellt habe, dass der untere Zugang gar nicht verschlossen gewesen sei. Er sei deshalb nach oben gegangen, und auch dort habe er die Tür, die zu Güllners Büro führte, nur angelehnt vorgefunden. Als er daraufhin eintrat, habe er die Leichen von Güllner und dem Mädchen gefunden.
»Keine der beiden Türen war also verschlossen?«
»Das habe ich doch schon gesagt. Sowohl die Eingangstür als auch die Tür zum Büro waren offen, zumindest nicht verriegelt.«
»Und Sie haben niemanden gesehen? Im Treppenhaus … oder auf der Straße?«
»Nein.«
»Etwas gehört?«
»Nein. Nur die Musik aus dem Kino.«
»Haben Sie gleich bemerkt, dass etwas nicht Ordnung war?«
»Ja. … Nein. Nicht gleich. Aber es hat so komisch gerochen.«
»Wie gerochen?«
Der Mann überlegte.
»Nach Urin und … als hätte jemand in die Hose geschissen … Und nach Angst.«
Bichlmaier überlegte, wie Angst roch. Und er versuchte sich zu erinnern, ob er schon jemals Angst gerochen hatte. Er war sich nicht sicher. Vielleicht als er mit Meier Zwo die Treppe hochgestiegen war?
»Sind Sie dann gleich ins Zimmer gegangen?«
»Ja.«
»Was haben Sie getan, als Sie sahen, was da passiert ist?«
Lamprecht zögerte einige Sekunden, schien nachzudenken.
»Ich habe Licht gemacht, um besser sehen zu können. Dann habe ich mir die Leiche des Mannes angeschaut. Wollte wissen, ob er vielleicht doch noch lebt. Aber da war nichts zu machen. Der war mausetot. Jemand hat ihm von hinten die Birne weggeblasen. Sah echt krass aus.«
Bichlmaier zuckte unwillkürlich zusammen. Der läppische Modejargon schien ihm hier denkbar unpassend, verstärkte seine Abneigung gegenüber dem Mann vor ihm.
»Wussten Sie gleich, dass es Güllner war?«
»Nein, aber ich konnte es mir denken.«
»Haben Sie sich auch das Mädchen näher angesehen?«
Lamprecht überlegte.
»Na klar. Sie war das Erste, das ich gesehen habe, als ich die Tür öffnete. Wirklich gespenstisch. Ich hatte den Eindruck, die schaut mir direkt ins Gesicht.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Das wissen Sie doch. Ich habe die Bullen gerufen.«
Bichlmaier machte eine Pause. Als würde er nachdenken. Dann fragte er:
»Sie arbeiten für die Presse, Herr Lamprecht. Haben Sie denn auch Fotos gemacht?«
Einen Moment lang glaubte er, der Reporter würde ihm nicht antworten, doch dann gab er widerstrebend zu:
»Natürlich. Das ist doch nicht verboten, oder?«
»Und wo sind die Fotos jetzt?«
»In der Redaktion … Kein Problem mit dem Handy«, fügte er hinzu, als er Bichlmaiers fragenden Blick sah.
»Verdammt«, dachte Bichlmaier. Das hatte noch gefehlt. Die Gazette würden morgen ohnehin voll sein mit den abstrusesten Theorien über den Mord und die eventuellen Motive, die hinter diesem Verbrechen stecken mochten. Da konnte er es sich nur zu gut ausrechnen, was auf ihn und die Mordkommission zukommen würde. Wenn dann auch noch Bilder von der Tat in der Presse erschienen, die die ganze Brutalität des Geschehens sichtbar werden ließen, dann würde erst recht ein Aufschrei durch die Republik gehen und der Druck auf die Ermittlungsbeamten noch größer werden. Da mussten dann Ergebnisse her, koste es, was es wolle.
Bichlmaier wandte sich ab, ließ den Mann bei Mahr stehen. Der würde sich schon die Adresse und Telefonnummer des Zeugen geben lassen. Kannte ihn wahrscheinlich ohnehin. Weiden war keine Millionenstadt und derOberpfälzer Kurierwahrscheinlich die einzigeörtliche Tageszeitung. Die Zahl der für sie arbeitenden Reporter begrenzt.
In dem Augenblick kam Motsch aus dem Zimmer, in dem die Spurensicherung noch immer ihrer Arbeit nachging, packte im Gang seine Instrumente zusammen und knöpfte seine Bereitschaftstasche zu. Dann ging er zur Treppe.
»Viel kann ich so noch nicht sagen«, meinte er im Vorbeigehen zu Bichlmaier.
»Auf jeden Fall ist das Mädchen schon sehr viel länger tot als der Mann. Und der kann maximal zwei Stunden tot sein.«
»Ist das Mädchen vergewaltigt worden?«
»Das wird die Obduktion zeigen. Auf den ersten Blick aber würde ich sagen, nein. Zumindest sind keine äußerlichen Verletzungen im Vaginalbereich zu erkennen.«