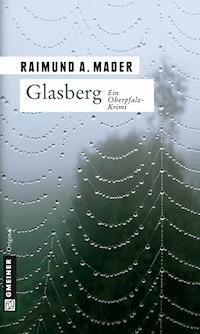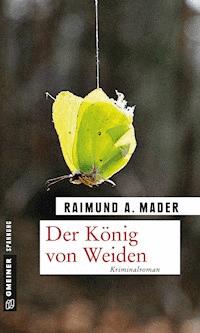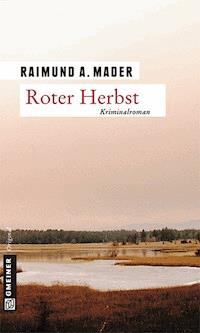Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Aussig – das heutige Ústí nad Labem - eine Industriestadt im ehemaligen Sudetenland. Aussig – ein Ort der Schande. Jahre sind vergangen seit dem blutigen Massaker, dem so viele zum Opfer gefallen sind. Männer Frauen, Kinder … Ein Mann steht am Rande der Brücke, die sich über den grauen Fluss wölbt. Er blickt hinunter und aus dem Grau des Wassers steigt das Rot von Blut und Schmerz und Tod. Sein Schwur: Vergeltung für das, was damals geschah … Und … ein Polizist aus Regensburg, der das Monster jagt. Kajetan Engel, nach dem grausamen Tod seines Sohnes selbst von Dämonen getrieben, begibt sich auf die Suche nach dem Schlächter, versucht zu verhindern, was sich dessen krankes Hirn ersonnen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raimund A. Mader
ENGEL und der Fluch des Golem
Krimi
XOXO Verlag
Über den Autor
Raimund A. Mader, geboren 1952 in Bad Tölz, lebt seit vielen Jahren in Eschenbach, in der nördlichen Oberpfalz. Er studierte Anglistik und Germanistik in München und in Seattle, Washington. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Bis August 2017 arbeitet er als Gymnasiallehrer in Weiden, genießt mittlerweile aber die »Freuden« der Pension. Er hat fünf Kriminalromane und mehrere Kurzgeschichten bei unterschiedlichen Verlagen (Gmeiner, ars vivendi, kbv) veröffentlicht und möchte mit dem aktuellen Roman neue Wege beschreiten. Bis Dezember 2021 leitete er die Geschäftsstelle des SYNDIKATS e.V.
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-220-4
E-Book-ISBN: 978-3-96752-718-6
Copyright (2023) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung der Bilder:
Stockfoto-Nummer: 1845095470
von www.shutterstock.com
Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Alte Heerstraße 29
27330 Asendorf
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
PROLOG
Du weißt noch, wie deine Hand beim ersten Mal gezittert hat. Das wird dir nicht noch einmal passieren. Ganz ruhig wirst du sein. Das Messer. Der scharfe, kurze Schnitt … Du hast keine Ahnung, woher du mit einem Mal diese Sicherheit nimmst. Sie ist einfach da.
Dennoch wünschst du dir, du wärest weit weg.
Aber du bist jetzt hier.
Du hast die Grenze überquert, eine Grenze überschritten. Wie immer: ein eigenartiges Gefühl. Jetzt fährst du auf buckligen, schlecht geteerten Pisten in Richtung Nordosten. 25 Kilometer, dann erreichst du die Stadt: 50° 39 nördliche Breite, 14° 2 östliche Länge. Ústí nad Labem, das einstige Aussig. Ein Ort der Schande.
Der Weg zur Elbe führt dich durch öde Vorstädte, die Altstadt. Dann stehst du vor der Brücke, die sich über den grauen Fluss wölbt. Du steigst aus, gehst die wenigen Schritte, blickst hinunter und aus dem Grau des Wassers steigt das Rot von Blut und Schmerz und Tod zu dir empor. Erahnst du, was damals geschah? Die fahlen Erinnerungen in deinem Kopf sind durch tausend Geschichten und Erzählungen gegangen, sind neuen Bildern gewichen, die, gestählt im Feuer des Hasses, dir zum Kompass deines Lebens geworden sind. Du rufst nach deinem Onkel, den Gelynchten, den Opfern des Mobs … Weißt du denn nicht, dass die Zahl derer, die dem Wahnsinn der Zeit zum Opfer gefallen sind, unermesslich größer ist als die der Gepeinigten, die in den Fluten dieses Flusses an jenem einen Tag versunken sind?
Du wendest, fährst durch die Stadt. Über eine andere Brücke gelangst du ans jenseitige Ufer. Ein weiteres Mal überschreitest du eine Grenze, überschreitest das Wasser des Grauens, das die Welt der Lebenden und das Totenreich voneinander trennt. Wo bist du Charon? Ich entbiete dir deine Münze.
Nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt, das kleine Dorf mit seinen Gutshöfen und Feldern und Alleen. Hier beginnt deine Suche.
Du bist gerüstet. Abseits des Dorfes und doch in Sichtweite hast du dir im nahen Wald einen Unterschlupf gesucht. Von hier aus beobachtest du. Und wenn es Nacht wird, trittst du hervor, machst dich auf die Suche nach dem Mann, den du töten wirst.
Dein Körper schmerzt von der unbequemen Position, die du in deinem Unterschlupf gezwungen warst, einzunehmen, aber das zählt nicht. Du bist zufrieden.
Denn natürlich findest du ihn.
In der Dämmerung des Morgens schleichst du auf den Hof, den du aus den Erzählungen und nunmehr aus deinen eigenen Beobachtungen kennst. Die Türen sind – wie du es erwartet hast - unverschlossen, was es dir leicht macht, dich deinem Opfer zu nähern.
Und dann … mit schrecklich ruhiger Hand führst du den tödlichen Schnitt durch die Kehle des Schlafenden. Das Messer so scharf … Blut ergießt sich im Rhythmus des brechenden Herzens. Nur ein Röcheln ist zu vernehmen. Letzte Zuckungen. Es ist vollbracht.
In diesem Moment nimmst du eine Bewegung wahr, spürst den Lufthauch, der damit einhergeht und wendest dich mit einer schnellen Drehung. Hinter dir im Halbschatten des beginnenden Tages steht ein Mädchen, eine junge Frau. Du siehst, wie sich ihre Augen weit öffnen, erahnst den Schrei, der über ihre Lippen drängt und greifst mit beiden Händen nach ihrer Kehle, drückst sie zu Boden. Ihr wälzt euch in verzweifeltem Kampf, bis sie unter dir zu liegen kommt – besiegt. Ihr Nachthemd ist hochgerutscht und nun kauert sie da, ein erlegtes Stück Wild, und wartet auf den Stoß, der sie in ewige Nacht stürzen wird.
Den kleinen Jungen, der hinter einem Vorhang Zeuge des Schrecklichen wird, siehst du nicht, sein Wimmern hörst du nicht. Übertönt von wildem Keuchen.
Aber wisse, auch er wird niemals vergessen, was hier geschah …
I. BUCH
Sometimes my burden is more than I
can bear - it´s not dark yet but it´s
gettin´ there. (B. Dylan)
Der alte Mann im Bett neben mir – ein bleicher Mensch mit ausgeprägt mongolischen Zügen - ringt nach Luft. Sein magerer Brustkorb hebt und senkt sich. Verzweifelt versucht er, Schleim aus den maroden Lungenflügeln zu pressen. Dazu hustet er heiser und trocken. Ich beobachte ihn, weiß, dass ich ihm nicht trauen kann. Irgendwann wird er seine Bemühungen aufgeben und mit leisem, eintönigem Pfeifen in die Kissen zurücksinken. Dann wird er den Kopf wenden und mich mit seinem spöttischen Grinsen aufspießen. Triumph wird in seinen Augen glitzern, wässrig und hinter den schmalen Lidern kaum erkennbar. Mich aber kann er nicht täuschen, sehe ich doch hinter jede seiner Masken …
Erst als die Tür aufgeht und eine der Pflegerinnen kommt, um nach dem Rechten zu sehen und zu lüften, wende ich den Blick ab. Für einen Moment fühle ich mich sicher. Die Pflegerin in ihrem weißen Kittel, der weißen Hose, den ebenfalls weißen Socken und Sportschuhen verbreitet Stille um sich. Sie geht ihren Verrichtungen nach, ohne Hast und mit größter Sorgfalt, bis ich Teil der Stille werde … Wenn sie doch länger bleiben würde.
Als habe sie meine Gedanken erraten, setzt sie sich, nachdem sie die Flügel der vergitterten Fenster mit Schwung aufgerissen hat, an mein Bett. Ich weiß, dass sie Olga heißt und – wie sie mir verraten hat - seit der Wende in Deutschland lebt. Zugegeben, sie ist eine aus der Flut derer, die nach dem Fall der Mauer unser Land überschwemmt haben. Aber gelegentlich sind nun mal auch solche dabei, wie sie … Olga ist um einiges jünger als ich. Allerdings vermute ich, dass sie das fünfte Lebensjahrzehnt bereits erreicht hat, wenngleich sie wegen ihrer gebückten Haltung älter wirkt, als sie in Wirklichkeit wohl ist. Diese Haltung ist ihrer auffallenden Körpergröße geschuldet, die sie zeitlebens genötigt hat, sich kleiner zu machen als sie ist. Das ist oft bei Menschen der Fall, deren Bestreben es ist, unter keinen Umständen aus der Masse herauszuragen.
»Wie geht es Ihnen denn heute?«, fragt sie nach einer Weile, die wir schweigend verbracht haben - ich in meinem Bett, sie auf der Bettkante. Ich nicke nur, froh, dass sie in ihrer sanften, mitfühlenden Art nicht auf nähere Ausführungen meinerseits besteht. Was sollte ich auch sagen? Das Schweigen dauert an, aber es ist ein angenehmes Schweigen, das nur von dem Pfeifen aus dem Nachbarbett übertönt wird.
»Sie haben Besuch«, sagt Olga nach einer Weile bedächtig. Sie lächelt nachsichtig und schüttelt den Kopf als sie sieht, wie ich erst mit Furcht und dann mit Abscheu und stummer Verzweiflung auf die Nachricht reagiere.
»Ihre Familie … Ist doch Weihnachten.«
Ich wende mich ab, drehe mich zur Seite, sodass ich die weiße, leere Wand vor Augen habe. Olga macht mit ihren Lippen ein schmatzendes Geräusch, das sie immer macht, wenn sie ihrer Missbilligung Ausdruck verleihen will. Ich starre auf die weiße Fläche, spüre, wie sie sich schwerfällig erhebt.
Dann stürmen meine Besucher herein. Sie legen Geschenke auf das unschuldige, ebenfalls weiße, mit Wachstuch bezogene Tischchen neben meinem Bett.
»Frohe Weihnachten«, rufen sie und die Kleinen kichern.
Jemand – wahrscheinlich meine Frau - setzt sich auf die Bettkante, auf der Olga eine Kuhle hinterlassen hat und streicht die Bettdecke glatt. Ich höre, wie sich die anderen im Zimmer verteilen. Jemand besorgt Stühle, die hin- und hergeschoben werden. Es ist dabei unerträglich laut und ich spüre augenblicklich ein Pochen in meinem Kopf, das sich über meinen gesamten Körper ausbreitet. Ein nicht zu kontrollierendes Zucken, das jedoch in meinem Inneren verschlossen bleibt. Äußerlich bin ich ein totes Stück Fleisch.
Dabei wäre es falsch zu glauben, dass ich meine Familie hasse. Das Gegenteil ist der Fall. Morella, meine Frau, die beiden Mädchen, die Enkel … ich liebe sie, soweit mir das nur möglich ist. Ein Gefühl einer eigentümlichen Zuneigung verbindet mich mit meiner Frau. Als ich sie vor vielen Jahren – lange nach den unsäglichen Ereignissen, die mich noch immer quälen – zufällig kennenlernte, erschien sie mir wie ein Anker in stürmischer See, in der ich unterzugehen drohte. Und auch wenn wir zu keiner Zeit von Leidenschaft sprachen, so führten wir doch bis zu meinem Zusammenbruch eine harmonische Ehe, aus der zwei Mädchen und eine Reihe von Enkeln hervorgingen.
Jetzt spüre ich ihre kalte Hand, die mir den Schweiß von der Stirne wischt, spüre, wie sie mir mit ihren blutleeren Fingern durchs Haar fährt. Ich wage nicht, mich zu regen oder gar ein Zeichen des Unwillens zu zeigen, würde sie dies doch sofort als Bereitschaft deuten, mich ihr zuzuwenden. Aber gerade dies ist unmöglich. Was ich … nein, was wir vorhaben, duldet keine Sentimentalität.
Dabei ist sie es gewesen, die mich mit der schrecklichen Wahrheit konfrontiert hat, der ins Auge zu blicken ich all die Jahre nicht bereit gewesen bin. Ihre Versuche aber, mich damit zu beruhigen, dass das Schreckliche, dem ich mich in einem früheren Leben ausgesetzt sah, nur in meiner Einbildung herrscht, haben endgültig den Entschluss in mir reifen lassen, mich der oberflächlichen Welt, in der sie in dumpfer Ahnungslosigkeit lebt, auf geraume Zeit zu entziehen.
So bin ich hier gelandet. In einer Klapsmühle. Nicht, weil ich dazu genötigt oder gar eingeliefert worden bin, vielmehr aus freien Stücken, was es mir – dessen bin ich mir sicher - jederzeit erlauben würde, diesen Ort der Verzweiflung auch wieder zu verlassen. Auf keinen Fall bin ich wahnsinnig, und wenn mich Dinge, wie die Anwesenheit meiner Familie, mitunter zur Raserei treiben, dann entspringt das nur einer quälenden Ruhelosigkeit, die seit jeher Teil meines Wesens ist.
Zum Glück dauert der Überfall meiner Familie nicht allzu lange, und doch flehe ich zum Himmel, die Minuten, in denen ich wie erstarrt daliege, mögen schneller vergehen. Aber erst als das Zucken in meinem Inneren kaum noch zu kontrollieren ist, erhebt sich Morella und dann – nachdem sie mir einen Kuss aufs Haar gedrückt hat – ist der Spuk wieder vorüber. So tobend, wie sie gekommen sind, verlassen die drei Frauen und ihre Kinderschar das Zimmer.
Als Ruhe eingekehrt ist, wage ich es, mich zu drehen und meinen Blick von der weißen Wand zu lösen. Sofort nehme ich das höhnische Gelächter – eine Art Kichern – aus dem Bett meines Zimmernachbarn wahr. Als ich zu ihm hinüberschiele, erkenne ich, dass er mich unverwandt anstarrt und dabei diese seltsamen Töne von sich gibt. Das Blut, so scheint es mir, gerinnt in diesem Augenblick in meinen Adern. Ich frage mich, warum er nichts sagt, weiß ich doch, dass er durchaus in der Lage ist, zu sprechen. Manchmal, wenn Olga an seinem Bett sitzt, höre ich, wie er hastig und aufgeregt vor sich hinmurmelt, während Olga dazu nickt. Da richte ich mich dann in meinem Bett auf und versuche zu erhaschen, was es ist, wovon er spricht. Und auch wenn ich nichts oder nur wenig verstehe – so verschwörerisch leise ist sein Ton -, bin ich überzeugt, dass es dabei allein um mich geht und er sich mit Olga über mich unterhält. Ich frage mich dann, ob er weiß, wie mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen ist. Niemand sonst ahnt etwas davon, und selbst Morella hat nur eine vage Vorstellung. Natürlich habe ich ihr gegenüber einige Andeutungen fallen lassen, doch begreift auch sie nicht im Entferntesten, was es ist, das mich quält. Warum also sollte er, ein Fremder, davon wissen?
Wenn Olga, nachdem sie sich vom Bett meines Feindes – ja, ich nenne ihn meinen Feind, ganz bewusst nenne ich ihn so - erhoben hat, sich zu mir setzt und mit Belanglosigkeiten versucht, meinen Argwohn zu zerstreuen, wird mir zunehmend bewusst, in welcher Gefahr ich mich befinde.
Der Gedanke, dass etwas geschehen muss, hat sich gerade in den letzten Tagen und Nächten in meinem Gehirn festgesetzt. Vor allem in den Nächten, wenn die Geräusche auf den Fluren verstummen und die Schwestern und Pfleger nur noch Schatten sind, die kaum hörbar durch die Gänge huschen, treibt mich das schrille Pfeifen aus dem Nachbarbett von Stunde zu Stunde tiefer in den Wahnsinn. Zu gern würde ich über diese Formulierung lachen, muss aber doch gestehen, dass mich in solchen Phasen nur ein schmaler Grat von jener düsteren Welt trennt.
Es ist kein Hass auf den alten Mann, der mich treibt. Er hat mir nichts Böses angetan, mich nie beleidigt. Und doch bin ich in den Nächten, die ich wach verbringe, zu der Überzeugung gelangt, dass seine Existenz etwas zutiefst Zerstörerisches auf mein Leben hat. Ich muss – dessen bin ich mir bewusst geworden – die Grenzen überwinden, die einen durch und durch humanistisch gebildeten Menschen wie mich bislang davor bewahrt haben, in tiefste, abscheulichste Animalität zu versinken. Seit jenen Tagen, als ich während meiner Reise in den Osten dem Bösen begegnet bin, weiß ich, dass es mein Schicksal ist, mich dem Kampf gegen dieses Böse zu stellen – auch wenn es bedeutet, selbst Teil davon zu werden.
Einer der Vorzüge, den das Leben in einer Klapse bietet, ist die Tatsache, dass die Zeit hier keine Rolle spielt. Minuten haben oftmals die Länge unzähliger Stunden und dann wieder verfliegen Stunden, ja Tage und Wochen, im Rausch einer Sekunde. Was sich ändert, ist die Intensität des Lichts, das den Morgen kündigt und sich zu Beginn der Nacht in schwarze Dunkelheit auflöst. Dazwischen Mahlzeiten, die ich eher unwillig zu mir nehme, Visiten von Ärzten und Pflegern, die ich ohne Emotion über mich ergehen lasse. Was bleibt, ist das stete Geräusch aus dem Nachbarbett.
Nachts um zehn Uhr werden die Lichter gelöscht – lediglich eine Notbeleuchtung bleibt - und die Insassen werden von der Schwärze der Nacht umfangen, allein gelassen mit ihren Dämonen, die alsbald mit ihnen zu tanzen beginnen. Auch ich kenne diese Dämonen, begleiten sie mich doch seit vielen Jahren. Wilde Fratzen und böse Stimmen, die mich bedrängen. Erinnerungen … Manchmal aber erkenne ich in weiter Ferne sanfte Augen, die mich voll Schmerz umfassen. Eintauchen möchte ich ihre dunkle Abgründigkeit – doch dann, gerade dann - reißen mich die schrecklichen Geräusche des Alten neben mir aus meinen Wachträumen.
Es ist nicht auszuhalten.
Ich setze mich auf. Nicht zum ersten Mal in den vielen vergangenen Nächten. Wie oft schon bin ich bereit gewesen, dem Horror ein Ende zu setzen? Vergebens! Dieses Mal bin ich es. Geduldig warte ich, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken, atme mit geschlossenem Mund. Ich weiß, dass ich träume und doch finde ich mich in der klaren Realität des Zimmers. Ich spüre die Kälte, die in mich hineinkriecht. Ich lausche, lausche dem singenden Atem des Alten. Ob er schläft? Oder liegt er da und horcht, geradeso wie ich selbst es tue? Ahnt er vielleicht, was ich vorhabe? Leise, schrecklich leise, streife ich die nachtfeuchten Laken von meinem Schoß, von den Beinen, drehe mich aus dem Bett, bis ich die Füße am kalten Boden absetzen kann. Mit einem Mal ist mir, als sei der Atem des Mannes im Nachbarbett verstummt, doch ist dies wohl nur eine Sinnestäuschung, denn kaum habe ich die ersten tapsenden Schritte getan, setzt das Geräusch mit unveränderter Stärke wieder ein. Ich beschließe dennoch zu warten. Verharre mit angehaltenem Atem, bis ich das Blut in meinen Schläfen rauschen höre. Unendlich langsam lasse ich die Luft aus meinen Lungen entweichen. Erst dann bewege ich mich weiter, um mein Bett herum, dorthin, wo das Bett des Alten schemenhaft zu erahnen ist. Je weiter ich mich vorantaste, umso schneller werden die Atemzüge meines Feindes. Ich frage mich, ob er eine Ahnung von meinem Tun und Trachten hat. Schneller und schneller, lauter und lauter kommen die Stöße aus der Tiefe seiner Lunge, sodass mich die Angst packt, auf dem Gang und in den benachbarten Zimmern könnte man sein überlautes Pfeifen vernehmen. Ich muss handeln. Schließlich stehe ich direkt neben ihm. Ich blicke auf ihn herab, höre ein leises Stöhnen und bin mir sicher, dass er mich wahrgenommen hat. Ob er weiß, dass ich ihn töten werde? »Wer ist da?«, krächzt er plötzlich und ich sehe, dass er sich aufrichten will. Mit einem gellenden Schrei stürze ich mich auf ihn, umfasse seinen dürren, knochigen Hals und drücke und drücke … Wie fürchterlich er zappelt und mit Armen und Beinen um sich schlägt. Ich weiß nicht, wie lange ich über ihn gebeugt stehe und erst als ich merke, wie sein Körper schlaff und ohne Widerstand ist, löse ich meine Hände von ihm. Endlich ist es still im Zimmer. Der alte Mann ist tot. Ich setze mich an sein Bett und warte, dass meine Hände aufhören zu zittern. Erst nach einer Weile erhebe ich mich und schalte das Nachtlicht neben seinem Bett an. Dann ordne ich das Bettzeug, das er in seinem Todeskampf von sich geworfen hat und decke ihn ganz sacht zu. Nur sein Kopf ist noch zu sehen. Das grobe, mongolische Gesicht mit den breiten Wangenknochen. Ja, er ist bestimmt tot – tot!
Noch einen letzten Blick werfe ich auf ihn – und da, ich stoße einen Schrei des Entsetzens aus – öffnet er die Augen, die er in schrecklichem Triumph auf mich richtet und wie zwei glühende Kohlen brennen sich diese in mein Herz …
»Golem, verfluchter Golem, werde ich dir denn niemals entkommen?«, schreie ich, ehe mich barmherzige Dunkelheit umfängt.
2
Irgendwann im Jahr 1959
Vor ein paar Tagen hat mich Papa zur Seite genommen und von dem kleinen Dorf erzählt, in dem er aufgewachsen ist. Ich kenne die Geschichte in- und auswendig und weiß, dass ich ihn nicht unterbrechen darf. Ich muss ruhig sitzen, sonst wird Papa böse. Er mag es nicht, wenn ich herumzapple. Beim letzten Mal bin ich aber aufgestanden, weil ich auf´s Klo musste. Ganz dringend. Da ist Papa fürchterlich rot im Gesicht geworden und er hat mich mit dem Stock geschlagen, der in seinem Büro steht. Jetzt weiß ich, dass es besser ist, wenn ich in die Hose pinkle.
Manchmal erzählt er auch von Onkel Georg. Onkel Georg war sein kleiner Bruder. Den haben sie umgebracht. Papa hat dabei zugesehen. Sie haben ihm die Hände gefesselt und dann haben sie ihn von einer Brücke aus in den Fluss geworfen. Vorher haben sie ihm die Ohren abgeschnitten. Wenn er von Onkel Georg erzählt, dann weint Papa und Mama muss ihm dann Schnaps bringen. Das ist auch schlimm, denn wenn er zu viel Schnaps trinkt, dann wird er wütend und schlägt Mama. Einmal habe ich mich vor Mama gestellt, weil ich nicht wollte, dass er sie schlägt, da hat er uns beide verprügelt.
Papa hat ein altes Foto, auf dem sieht man Onkel Georg. Der ist da noch ein kleiner Bub und sieht ganz komisch aus. Er trägt kurze Hosen, die ihm bis zu den Knien gehen und ein weißes Hemd mit einem riesigen Kragen. Dazu ist er barfuß. Er steht vor einem großen Auto, das schrecklich alt aussieht. Papa hat gesagt, es würde ihm gehören. Aber die Schweine haben es ihm und Großvater weggenommen.
»Wie alt war Onkel Georg …?«, frage ich. »… als ihn die Schweine getötet haben?«
Natürlich weiß ich, dass er zwölf Jahre alt gewesen ist, aber Papa mag es, wenn ich danach frage. Dann kann er erzählen. Auch dass ich sie Schweine nenne, gefällt ihm. Genau weiß ich nicht, wen er damit meint, aber ich werde es herausfinden. Auf jeden Fall müssen es sehr böse Menschen sein …
Papa sagt, dass alles mit einem riesigen Knall begonnen hat. Der war so laut, dass die Menschen ganz fürchterlich geschrien haben und dann haben alle gesagt, dass die Deutschen daran schuld sind. Und dann sind die Menschen böse geworden und haben die Deutschen, die doch gar nichts dafür konnten, mit Stöcken und Dachlatten und mit ihren Fäusten geschlagen. Papa hat einen Mann gesehen, der hatte eine lange Stange, an deren Ende ein Nagel war. Damit hat er viele Deutsche getötet. Einfach so. Und dazu hat er gelacht. Überall waren tote Menschen, und eine Frau hat den Kopf gehoben, aber sie war schon fast tot. Da hat ein Mann mit einem Gewehr auf sie geschossen, aber sie hat immer noch den Kopf gehoben und Papa angeschaut. Dann hat der Mann noch einmal geschossen und dann war die Frau tot. Papa sagt, dass er im Geist noch immer ihre Augen sieht, die ganz traurig gewesen sind.
Wenn Papa davon erzählt, hält er sich die Ohren zu und schreit ganz fürchterlich. Und dann ruft er nach Onkel Georg. Aber der kann ihn ja nicht mehr hören, weil sie ihm die Ohren abgeschnitten haben.
Da muss ich auch weinen und Mama weint auch, sodass ihr Gesicht ganz rot ist. Und ich verspreche Papa, dass ich die Schweine finden werde, die das getan haben und dass dann alles wieder gut werden wird.
Das sind böse Menschen, die andere töten. Aber manchmal möchte auch ich töten …
Am bösesten von allen ist aber der Golem. Das ist kein Mensch, das ist ein Gespenst, das in der Dunkelheit durch die Straßen der Stadt zieht und nachschaut, ob die Menschen, die unterwegs sind, tote Kinder mit sich tragen, die sie beim Juden in die dunklen Gassen werfen. Kinder, denen man die Ohren abgeschnitten hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das mit den toten Kindern macht mir aber Angst. Vielleicht war Onkel Georg eines der toten Kinder. Papa sagt immer, dass der Golem ein gutes Wesen ist, aber ich habe trotzdem Angst vor ihm …
3
Dort oben, zwischen den Häuserzeilen, setzt die Dämmerung ein. Der Nacht bleibt nur noch wenig Zeit, um zu verschwinden. Alles ist still, nur vereinzelt sind Motorengeräusche zu hören. Bald schon werden die Leute zur Arbeit fahren. Zur Autobahn Richtung Hof und Regensburg. Auch ins Industriezentrum im Westen der Stadt, das schnell erreicht ist. Viele, die dort arbeiten. Ein Auto bleibt stehen, die Tür öffnet sich und der Fahrer steigt aus. Er will Zigaretten kaufen. An einem freistehenden Gebäude hängt ein Automat – nicht mehr viele, die es davon gibt. Schneeflocken tanzen vom Himmel, setzen sich und lösen sich auf. Es ist zu warm. Trotz der Kälte. Der Schnee bleibt nicht liegen.
Er dachte an Andi. Das war nichts Ungewöhnliches, denn er dachte oft an ihn. Aber das war auch wegen des Schnees. Allerdings hatte er in letzter Zeit des Öfteren Probleme, sich an Andis Gesicht zu erinnern, an sein schiefes Grinsen, die zornigen Augen, die so richtig funkeln konnten, wenn man ihn ärgerte. An die Sommersprossen auf seiner Nase, die auch im Winter nicht weggingen. Die Einzelteile waren da, aber immer, wenn er glaubte, nach dem Bild seines Jungen greifen zu können, schob sich Fleischers Gesicht davor. Der sah ihn dabei mit einem eigenartigen Blick an.
Fleischer war damals dabei gewesen. Ein Einsatz, zu dem sie niemand gerufen hatte. Sie waren lediglich in der Nähe gewesen, als der Funkspruch kam. Auf der Fahrt zurück zum Präsidium … Da hatten sie sich kurz angesehen und waren hingefahren. Die Stimme aus der Leitzentrale hatte von einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Straße gesprochen. Nach ersten Informationen mit Personenschaden. Nichts Genaues … Rettung ist unterwegs.
In einem Meer von Rot liegt ein Körper auf dem Gehweg. Ein Bein ist seltsam angewinkelt, als gehöre es nicht zu dem Körper. Dahinter ein Eisenzaun, der das Areal einer Eisenwarenfirma begrenzt. Es ist ein sehr stabiler Zaun und man kann auf den ersten Blick kaum erkennen, wo der Wagen mit großer Wucht hineingekracht ist. Jemand – wohl die Ersthelfer, die nun ratlos herumstehen - haben den Wagen einige Meter weggezogen, um an das Opfer heranzukommen. Doch jegliche Hilfe kam zu spät.
Später erfuhr er dann, dass Andi noch versucht hatte, sich am Zaum hochzuziehen. Aber er hatte keine Chance gehabt. Der Wagen war einfach zu schnell gewesen. Ein blindes Geschoß auf tückischem Schnee - das hatte seinen Jungen zu Tode gequetscht. Nur sein Gesicht war unversehrt geblieben. Als sie, Fleischer und er, damals angekommen waren, hatte er den hellen Anorak wahrgenommen, der ihm seltsam bekannt vorgekommen war. Aber selbst, als er vor dem geschundenen Körper kniete, hatte er noch nicht verstanden, dass es Andi war, sein Sohn, der vor ihm lag. Erst als Fleischer ihn an der Schulter berührte, um ihn hochzuziehen, hatte er geschrien.
Irgendwann hatte ihn Fleischer nach Hause gebracht. Vor dem Haus ein Streifenwagen, der nach seinem Empfinden nicht dorthin gehörte. Er hatte nach oben geblickt. Die Wohnung im dritten Stock. Er wollte zu Fuß gehen, nicht wie sonst den Lift nehmen. So dauerte es länger. Dann stand er vor Elke. Sie blickte ihn aus leeren Augen an, war ganz ruhig. Eine ältere Frau saß neben ihr. Wahrscheinlich eine ärztliche Betreuerin, jemand vom Notdienst … Sie hatte einen Arm um Elkes Schulter gelegt. Er nahm an, dass man Elke ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte. »Hast du …« Er machte einen Schritt auf sie zu, wollte sie an sich drücken, aber sie schaute weg.
Engel blickte nach oben.
Die Fenster im dritten Stock waren erleuchtet. In wenigen Minuten würde Elke die Lichter wieder löschen und kurz darauf durch die Tür treten, um zur Arbeit zu gehen. Sein Blick würde ihr folgen, bis er sie im Schneetreiben nicht mehr sehen konnte. Erst dann würde er aussteigen und nach oben gehen.
Seit geraumer Zeit nahm er immer nur die Treppe. Als er jetzt oben ankam, war er völlig außer Puste. Einen Augenblick blieb Engel stehen, um wieder zu Atem zu kommen. Erst dann sperrte er auf. In der Wohnung war es eisigkalt. Elke hatte es versäumt, die Heizung hochzudrehen und hatte darüber hinaus das Küchenfenster weit offenstehen lassen. Auf dem Fensterbrett sammelte sich die Feuchtigkeit der Flocken, die hereinwirbelten und schmolzen. Leise tropfte das Wasser auf den Fußboden. Kajetan fluchte und schloss das Fenster. Dann wischte er mit einem Geschirrtuch die Nässe weg.
Auf dem Küchentisch stand das Foto von Andi, das bei seiner Erstkommunion gemacht worden war. Er streckte die Hand danach aus, berührte es aber nicht.
Andi lachte. »Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten, Papa? Maradona oder Messi?«
»Maradona«, sagte Engel. »Ist doch klar.«
Dabei dachte er, dass der doch schon längst tot war.
»Oben im Himmel«, fügte er hinzu.
Andi lachte wieder.
»Niemand spielt hier Fußball«, sagte er.
»Weiß ich doch«, nickte Engel.
»Woher willst du das denn wissen?«
»Das weiß doch jeder.«
Engel nahm das Foto mit der schwarzen Schleife und stellt es auf den Küchenschrank zurück. Er fühlte sich in diesem Moment gänzlich allein und dachte, dass sein Leben immer schon von Einsamkeit geprägt war. Das lag in seinem Wesen begründet. Er war nun mal kein geselliger Mensch. Aber nach Andis Tod war alles noch schlimmer geworden. Da half es auch nicht, dass Elke und er trotz der gähnenden Leere, die sich zwischen ihnen aufgetan hatte, zusammengeblieben waren. Sie lebten nun nebeneinander und jeder versuchte auf seine Weise mit dem Verlust fertig zu werden. Ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Kindes war bei ihm jedoch der Zusammenbruch gekommen. Er hatte es nicht mehr ausgehalten. Dabei war er immer davon ausgegangen, dass er der stärkere von ihnen beiden war. Aber es war Elke gewesen, die alles veranlasst hatte, ihm einen Platz in der Klinik verschafft hatte.
Das Telefon im Wohnzimmer blinkte. Engel ging hinüber, um zu sehen, wer zu solch früher Stunde angerufen hatte. Vielleicht jemand, der ihn brauchte. Jemand, der seine Dienste in Anspruch nehmen wollte. Sein neuer Job … Menschen finden, die aus dem Leben gefallen waren. Menschen, die verschwunden waren.
Nach dem Klinikaufenthalt hatte er nach Ansicht der Ärzte den Verlust seines Sohnes verarbeitet und seinen Dienst bei der Mordkommission wieder aufgenommen. Aber man hatte ihm zur Vorsicht auch Tabletten verschrieben. Die musste er nehmen. Und schnell stellte sich heraus, dass er der täglichen Routine doch nicht mehr so recht gewachsen war. Trotz der Tabletten. Sein Chef hatte ihn irgendwann zu sich gerufen und ihn gefragt, ob er so weitermachen wolle.
»Nein«, hatte er erwidert und aus dem riesigen Fenster geblickt, das auf den Villapark ging. Dort spielten Kinder in einem Sandkasten und ihre Mütter saßen auf den Bänken in der Nähe und lachten und redeten.
»Aber, was soll ich machen? Ich bin Polizist … was anderes kann ich nicht.«
Der Chef hatte an ihm vorbei flehend auf das Kruzifix über der Tür seines Büros gesehen.
»Ich hätte da was, Engel … Was Anständiges. Keine Arbeit im Archiv oder ähnliches …«
Was das wäre, hatte er gefragt und der Chef hatte eifrig genickt, weil er sich über Engels Interesse freute.
»Ein Schreiben vom Landeskriminalamt … Die suchen Kollegen für Sonderermittlungen … Mit einem Mordsetat ausgestattet …«
Engel hatte sich erhoben, war ans Fenster getreten. Er betrachtete die Kinder, die sich mit Sand bewarfen und ihre Mütter, die kreischend dazwischengingen. Es war ein Kreischen, das nicht bis zu ihm nach oben drang, sondern auf dem Weg dahin verlorenging. All diese Kinder auf diesen gottverdammten Spielplätzen, hatte er gedacht.
»Was für Sonderermittlungen?«
»Da ist jemandem ganz oben aufgefallen, dass in Bayern zu viele Menschen verschwinden und nicht mehr zurückkommen … die irgendwann einfach weg sind.«
»Einfach weg«, wiederholte er. »Auch Kinder?«
»Na ja, eher Jugendliche … aber auch Erwachsene. Die Aufklärungsrate ist einfach nur grottenschlecht …«
»Und meine Aufgabe?«
Sein Chef hatte ihm einen Stoß Akten hingelegt und erleichtert gelacht.
»Voila Engel, kannst dir was aussuchen … Aber halt mich auf dem Laufenden.«
Und so war er, Kajetan Engel, Sonderermittler geworden, jemand, der nach Zeitgenossen suchte, die sich in Luft aufgelöst hatten. Cold Cases …
4
Seit meiner Flucht aus der Psychiatrie ist weniger als ein Tag vergangen und doch scheint es mir, als lägen Jahre zwischen gestern und heute. Die trübe Dezembersonne ist bereits hinter den Wipfeln der Bäume verschwunden, aber es macht mir nichts aus. Schließlich kenne ich den Weg entlang der ehemaligen Grenze, den ich in langen Jahren seit meiner Kindheit hunderte Male gegangen bin. Einen Fuß nach den anderen setzen, an nichts denken. Es ist so einfach.
Vor dem letzten Anstieg bleibe ich stehen, um Luft zu holen. Mein Atem kommt stoßweise und ich spüre meine schmerzenden Lungen. Der schwere Rucksack, gefüllt mit dem Notwendigsten, drückt. Ich beuge mich nach vorne, presse meine Hände in die Seiten, verharre, bis das Toben in meiner Brust nachlässt. Wenn ich nur besser in Form wäre, so wie früher. Wie lange das schon her ist. Ich wische das schweißnasse Haar aus der Stirn. Obwohl es klirrend kalt ist, schwitzte ich am ganzen Körper. Trotz der Eiseskälte, die auch von innen kommt. Ich massiere meine Hände. Knochig und bleich sind sie und wie immer schmerzen sie. Ich muss plötzlich lachen – weiß nicht warum - laut und heiser, was in der Stille des Waldes unwirklich und gespenstisch klingt. Energisch richte ich mich auf und sauge die würzige Luft tief in meine Lungen. Bis es schmerzt.
Ich will schon weitergehen, als ich ein Geräusch höre, das aus den Tiefen zu meiner Linken zu kommen scheint. Ich richte den Blick auf die grün-weiße Wand, die sich in schwarze Finsternis dehnt. Ist da jemand, der mich heimlich beobachtet? Unsinn. Wer sollte schon ein Interesse daran haben, mich zu beobachten. Niemand, der etwas ahnt von dem, was ich mir vorgenommen habe. Auch das Miststück nicht, das es gewagt hat, mich zu erpressen … Wahrscheinlich ist es nur ein Tier, das sich in der Dämmerung auf Nahrungssuche gemacht hat. Ein Reh oder ein Wildschwein, von denen es in den Wäldern unzählige gibt. Ich schüttle mich wie ein Hund, muss mich von den verstörenden Gedanken frei machen.
In dem Augenblick ein weiteres Knacken, das Brechen von Zweigen. Lauter als zuvor und – so scheint es mir - näher als beim ersten Mal. Muss ich mir doch Sorgen machen? Die kleine Forsthütte, die ich soeben verlassen habe, kommt mir in den Sinn – und das Geheimnis, das sie birgt. Unmöglich, dass man mir auf die Spur gekommen ist. Papas Hütte … Papa hat sie in den 50ern von den Bayerischen Staatsforsten erworben. Tief im Wald liegt sie und über die Jahre sind die Bäume, die sie umschließen, weiter in die Höhe geschossen, ist das dazwischen wuchernde Dickicht nahezu undurchdringlich geworden, sodass sie den Blicken der Menschen fast gänzlich entzogen ist.
Mein Atem hat sich beruhigt und ich lausche, ohne mich zu bewegen, aber nichts ist in diesem Augenblick zu hören. Nur die Bäume wiegen sich leise hin und her. Es ist mir mit einem Mal, als lebe der Wald, als sprächen die Bäume miteinander, als flüsterten sie sich geheime Botschaften zu. Ob sie mein Geheimnis kennen?
Hier muss wohl alles verhext sein. Wer die geheime Sprache der Natur lesen kann, der sieht dies am verdrehten Wuchs der Bäume und Sträucher. Ist auch dies ein Ort der Dämonen?
Meine Blicke gleiten nach oben, aber von dort kommt keine Antwort. Gerade sehe ich noch, wie eine Krähe von einem der Zweige hochsteigt und mit starkem Flügelschlag im Dunkel verschwindet. Schnee, der sich dabei löst, flirrt auf den Waldweg herab und legt sich feucht auf mein Gesicht. Ich nehme die Hände aus den Taschen meines Lodenmantels und wische mit meinen steifen Fingern die Nässe weg. Fluche. Noch einmal atme ich tief ein und aus. Schließlich setzte ich mich wieder in Bewegung.
Wenige hundert Meter bis zu der kleinen Lichtung, wo der alte Kastenwagen verborgen unter einem kahlen Baum steht …
Plötzlich löst sich aus dem grauen Zwielicht hinter einem der Bäume ein Schatten. Entsetzt blicke ich in die glühenden Augen eines Wesens, halb Mensch, halb Wolf. Ich beginne zu laufen.
5
In den frühen Siebzigern
Morgen ist mein großer Tag.
Papa wird für mich bürgen und neben ihm Herr Nowak, der extra zur Feier anreisen wird. Für jedes neue zukünftige Mitglied im Jugendverband müssen zwei andere aus dem Bund eine solche Bürgschaft übernehmen. Dass Herr Nowak sein Kommen zugesagt hat, ist eine große Ehre für mich. Er ist aus Fürth und leitet den dortigen Ortskreis. Er und Papa sind gute Freunde und sie besuchen sich sehr oft und sprechen dann über das Unrecht, das den Vertriebenen zugefügt wurde. Sie wollen erreichen, dass den Flüchtlingen und den Vertriebenen das Eigentum zurückgegeben wird, das ihnen gestohlen wurde. Herr Nowak sagt auch, dass das Sudetenland heim ins Reich geholt werden soll. Papa meint das ebenfalls und dann sprechen sie über das Böse, das ihnen und den anderen zugefügt wurde. Papa erzählt von Onkel Georg und Herr Nowak hört ihm zu. Auch über das alte Auto, das meinem Großvater und meinem Papa gehört hat, sprechen sie … Manchmal weint Papa und dann trinken sie Schnaps.
Herr Nowak ist ein sehr bekannter Mann und er schreibt Artikel für verschiedene Zeitungen. Darin versucht er die Wahrheit zu erzählen, die viele Menschen in der BRD bereits vergessen haben, wie er sagt. Auch, dass vieles, was über die Vergangenheit der Deutschen erzählt wird, gar nicht so schlimm gewesen ist und dass vieles nur Propaganda ist. Er nennt das mit den Juden eine gewaltige Geschichtslüge …
Papa ist stolz, dass ich ein richtiges Mitglied werde.
»Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue«, hat er zu mir gesagt, ehe wir zu Bett gingen. So ganz habe ich das nicht verstanden.
In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Irgendwann muss ich aber doch eingenickt sein, denn als ich aufgewacht bin, war es bereits hell. Kurz darauf ist Papa zu mir gekommen und hat gesagt, dass Mama tot ist. Ich war erstaunt, dass er überhaupt nicht geweint hat. Meine Mama, die war immer traurig und hat viel geweint, vor allem, wenn sie von der Heimat und der Flucht erzählt hat - und jetzt war sie tot.
Sie war ein kleines Mädchen von zehn Jahren gewesen, als sie zusammen mit ihren Geschwistern flüchten musste. Die Russen waren auf dem Vormarsch gewesen und jeder im Dorf wusste, was das bedeutete.
Ein eigentliches Ziel hier im Westen hatten sie nicht gehabt.
»Weg, nur weg«, hatten die Eltern gesagt. »Ganz schnell weg. In den Westen, dort ist eure neue Heimat.«
Da waren sie losgezogen. Die Eltern waren geblieben.
»Die Russen vergreifen sich nicht an Müttern …«
Ein letzter Blick zurück. Sie wissen, dass es ein Abschied für immer ist. Dann endlich, die ersten Amerikaner, die ihnen entgegenkommen … »Die haben so gut gerochen, weil die Aftershave benutzt haben …« Irgendwann erreichen sie ein Auffanglager.
»Wir waren alle nur froh, dass wir endlich wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Nicht mehr unter freiem Himmel schlafen … unter einer löchrigen Pferdedecke.«
Mama hat nie viel von ihrer Flucht erzählt, aber irgendwann habe ich durch Zufall gesehen, dass sie in ihrem Nachtkästchen ein Foto, ein kleines braunes Foto, aufbewahrte, das ihre Mutter zeigte. Einmal bin ich ins Schlafzimmer meiner Eltern geschlichen, als diese schliefen und da habe ich gesehen, dass sie dieses Foto noch in der Hand hielt … ganz fest.
Ja, Mama war immer traurig und lange Zeit ahnte ich nicht warum, aber damals ist es mir klar geworden. Schließlich hat sie sich erhängt, wollte einfach nicht mehr leben.
Jetzt weiß ich, dass die Schweine sie auf dem Gewissen haben.
An diesem Tag habe ich einen heiligen Eid geschworen.
6
Engels Büro lag im Keller. Ein kleiner Raum, drei auf drei Meter. Das spärliche Licht kam durch einen Lichtschacht, der auf die Straße führte, die das Präsidium vom Park trennte. Zwei Stockwerke unter dem weitaus größeren Büro des Chefs gelegen. Die Menschen, die vorbeihasteten, hatten keine Ahnung, dass dort unten jemand saß, der ihre Beine nur bis hinauf zur Kniebeuge sehen konnte und sich dabei ausmalte, wie die Menschen darüber aussahen. Jemand, der manchmal Geschichten erfand, die zu den Beinen passten. Nur kleine Kinder bückten sich gelegentlich und lächelten ihm verwundert zu und manchmal brachten sie ihre Mütter dazu, sich zu bücken und ebenfalls hinunterzusehen. Die aber erschraken meist und lächelten ganz verlegen, wenn sie Engels ansichtig wurden und richteten sich schnell wieder auf. Da brauchte er sich dann keine Geschichten auszudenken.
Engel mochte sein Büro. Dort fühlte er sich geborgen wie ein Fötus im Mutterleib. Auch sein neuer Job gefiel ihm. Anfangs war er erstaunt gewesen, wie viele Menschen im Lauf eines Jahres abhandenkamen. Darunter waren Familienväter, die von einem Tag auf den anderen verschwanden, Frauen, Mütter, die aus der Eintönigkeit ihres Lebens herausgerissen wurden - ob freiwillig oder unter Zwang blieb oftmals ein Rätsel. Seine Fahndungserfolge waren allerdings überschaubar, und manchmal, wenn er bei seinen Recherchen einem oder einer der Verschwundenen zu nahekam, spürte er eine sonderbare Ablehnung, die ihm entgegenschlug. Da wurde ihm dann klar, dass er kein Recht hatte, solche Seelen in seine Welt zurückzuholen und er zog sich zurück, machte höchstens einen Vermerk in den Akten. Gelegentlich waren die Gesuchten tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen oder durch einen Unfall ums Leben gekommen, die Frage ihres Verbleibs konnte geklärt werden, sodass zumindest die Suche nach ihnen eingestellt und ihre Akten vorerst geschlossen werden konnten. An eine Lösung dieser Fälle glaubte im Dezernat ohnehin niemand mehr. So war es ihm nur in ganz seltenen Fällen vergönnt, einen dieser Abhandengekommenen aus dem Totenreich wieder zurück ins Leben zu führen.
Jetzt hatte diese Frau mit dem italienischen Akzent angerufen. In ihrer Stimme glaubte er das Meer zu hören und das Rauschen von Pinien. Aber das Meer war nicht das Meer des Sommers. Es war aufgewühlt und die Pinien waren vom Wind gepeitscht. Zumindest bildete er sich das ein.
»Olga hat mir gesagt, dass ich Sie anrufen soll … Olga Przcybilka.«
Es klang lustig, wie sie den Namen aussprach und Kajetan hätte beinahe laut aufgelacht. Dann musste er an Olga denken und an die Zeit in der Klinik.
»Woher kennen Sie denn Frau Przcybilka?«
»Von Wöllersbach«, sagte sie. »Mein Mann war dort als Patient und Frau Przcybilka … Olga war seine Pflegerin.«
»Verstehe.«
»Kann ich Sie treffen?«, fragte sie dann.
»Natürlich. Kommen Sie zum Präsidium. Wissen Sie …«
»Ich weiß, wo das ist. Ich fahre gleich los.«
»Bis dann«, sagte er noch, aber sie hatte schon aufgelegt.
»Was ist denn?«, fragte Fleischer, der von oben gekommen war und plötzlich im Türrahmen stand. Engel nickte ihm zu und legte den Hörer auf. Er war müde, zu müde, um ein belangloses Gespräch zu führen. Er hatte die ganze Nacht nicht richtig schlafen können. Immer wieder war er aus einem diffusen Halbschlaf hochgeschreckt und sofort hellwach gewesen. Dann hatten die Gedanken angefangen zu kreisen. Schließlich war er aufgestanden, um frühzeitig nach Regensburg ins Büro zu fahren. Elke hatte so getan, als schliefe sie, aber die Art und Weise, wie sie atmete, hatte ihm verraten, dass sie hörte, wie er die Wohnung verließ.
Er vermutete, dass Fleischer an einem neuen Fall arbeitete und nun seine Meinung dazu hören wollte. Wie immer ging es wahrscheinlich um irgendeine Kleinigkeit, die ihm Kopfzerbrechen bereitete. Ehe die Sache mit Andi passiert war, waren sie dicke Freunde gewesen. Partner, die sich gegenseitig zuarbeiteten. Das war danach anders geworden und auch zwischen sie beide hatte sich ein Schatten geschlichen, der nicht mehr weichen wollte.
»Was Neues?«, fragte Engel.
»Irgendein Spinner«, antwortete Fleischer. »Ein anonymer Anrufer, der einen Mord meldet, aber keine Spur einer Leiche als die Kollegen ankommen …«
»Und der Anruf?«
»Kam von einem Prepaid-Handy …« Er zuckte mit den Schultern.
»Sieht nach einem Dumme-Jungen-Streich aus«, sagte Engel. Fleischer antwortete nicht, schaute nur angefressen an ihm vorbei.
»Es wird immer schlimmer«, meinte er schließlich. »Kein Respekt mehr in dieser Welt. Keine Prinzipien. Nur Wut und Hass. War früher anders …«
Engel nickte, musste aber insgeheim lächeln. In der Klinik hatten sie ihm gesagt, dass er nach vorne schauen solle, nicht zurück. Aber es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit, dachte er … und auch keine Gegenwart.
»Na ja«, meinte Fleischer nach einer Weile düster. »Wir sollten mal auf ein Bier gehen. Zum Kneitinger, wie früher.«
»Ja«, sagte Engel. »So wie früher.«
Dann wussten sie nicht mehr weiter und für beide war es eine Erlösung, als sie hörten, wie jemand die Treppe herunterkam.
»Muss dann mal«, sagte Fleischer und Engel nickte ihm zu.
Das erste, das er wahrnahm, war das Tattoo über ihrer rechten Brust. Es stellte wohl einen Schmetterling dar, aber er war sich nicht ganz sicher, da ihre Bluse trotz des großzügigen Dekolletés, das meiste davon verdeckte. Er hatte Mühe, seinen Blick davon zu lösen und er sah, wie sie lächelte. Sie sieht gut aus, dachte er. Es irritierte ihn, dass sie ihm gefiel. Dabei schätzte er sie schon jenseits der Fünfzig. Eigentlich kein Alter … aber doch deutlich älter als Elke …
»Morella Weizmann«, sagte sie. »Wir haben telefoniert.«
Engel gab ihr die Hand, fragte sich aber sofort, ob das überhaupt angemessen war. In den vergangenen Monaten hatte man gelernt, auf solche Förmlichkeiten zu verzichten. Sie lächelte aber nur, als würde sie sich unantastbar fühlen.
»Mein Mann ist verschwunden«, sagte sie und setzte sich. Dann verfiel sie in Schweigen, wartete auf seine Reaktion. Aber Engel weigerte sich, die erwartete Betroffenheit zu zeigen. Das Schweigen dauerte.
»Tagtäglich verschwinden Menschen, ohne dass man sich gleich auf die Suche macht«, sagte er schließlich. »Wie lange ist ihr Mann denn schon weg?«
»Seit zwei Tagen.«
»Und dafür gibt es keine vernünftige Erklärung?«
Sie sah ihn verunsichert an, als sei ein solcher Gedanke völlig absurd.
»Wohin sollte er denn? Er lag doch in Wöllersbach, in der Psychiatrie. Da läuft man nicht einfach so weg.«
Engel erinnerte sich, dass sie Olga erwähnt hatte. Olga, die sie zu ihm geschickt hatte.
»Sie kennen also Olga Przcybilka?«
»Ja, sie ist die Pflegerin, die mein Mann am meisten mag. Zu ihr hat er Vertrauen.«
»Was hat Ihr Mann denn?«
Sie sagte nichts, überging seine Frage und holte stattdessen ihr Handy aus der Tasche.
»Das ist er«, sagte sie.
Die Aufnahme zeigte einen älteren Mann mit Halbglatze, der versonnen in die Kamera blickte. Er wirkte weitaus älter als seine Frau und Engel fragte sich, wie die beiden zueinander passten.
»Hat er psychische Probleme?«
Die Frau verzog leicht den Mund und Engel begriff seine eigene Frage nicht. Er erinnerte sich an seinen Aufenthalt in Wöllersbach und an die Menschen, die er dort kennengelernt hatte. Alle hatten sie mit sich gekämpft und waren in irgendeiner Form am Leben verzweifelt. Was sonst hätte sie bewegen können, sich hinter die düsteren Mauern der Bezirksklinik zurückzuziehen.
»Haben Sie schon eine offizielle Vermisstenanzeige aufgegeben?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein. Olga hat mir davon abgeraten und gemeint, dass ich mich an Sie wenden sollte … Und außerdem jetzt an den Feiertagen …«
»Sehen Sie«, sagte er, »ich gehe den Fällen von Menschen nach, die schon vor längerer Zeit abhandengekommen sind. Manche von ihnen sind schon seit vielen Jahren verschwunden und wir suchen nach ihnen, weil wir hinter ihrem Verschwinden ein Verbrechen vermuten. Aber nach jemandem zu suchen, der erst seit zwei Tagen vom Bildschirm verschwunden ist …«
Er zuckte mit den Achseln, aber sie schien seinen Einwand überhaupt nicht wahrgenommen zu haben.