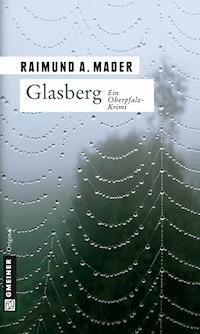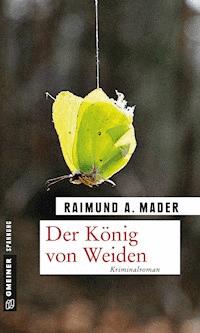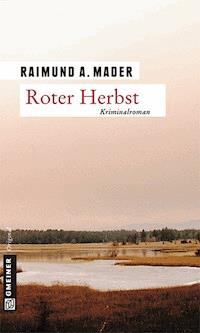Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Literaturwelt ist in Aufruhr. Gerüchte über das Auftauchen eines verschollenen Manuskripts von Franz Kafka machen die Runde. Es soll alles übertreffen, was vom Autor je an die Öffentlichkeit gelangt ist. Als ein Literaturprofessor auf der Suche nach der Erzählung verschwindet, beauftragt dessen junge Geliebte einen Detektiv. Während ihn seine Ermittlungen von Regensburg nach Wien führen, wird ihm schnell klar: Der unbedingte Wunsch, dieses Werkes habhaft zu werden, hat die dunkelsten Triebe des Menschen zum Vorschein treten lassen und eine Welle des Bösen ausgelöst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raimund A. Mader
Das Kafka-Manuskript
Kriminalroman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Der König von Weiden (2016), Roter Herbst (2013), Schindlerjüdin (2010), Glasberg (2008)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Michael Thaler/shutterstock
ISBN 978-3-8392-5760-9
Widmung
Für Andrea
Zitat
Sie sog’n, wann ma tot is,
fangt das Leb’n erst an,
aber wos is, wann nix is,
wann nix is, wos is dann?
Wolfgang Ambros
Erstes Buch
1 Die Verhaftung
Als Gregor aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich von schwärzester Dunkelheit umgeben. Nicht dass es ihn überrascht hätte, war dies doch seit jenem ersten Morgen so. Noch leicht benommen tasteten seine Finger sofort Brust und Bauch ab, als habe er Angst, etwas Seltsames sei während des Schlafes mit ihm und seinem Körper passiert. Er verspürte jedoch nichts Ungewöhnliches, keine panzerartige Versteifung seines Bauches etwa, die ihn in einen ungeheuren Käfer verwandelt hätte, oder etwas vergleichbar Beängstigendes. Selbst seine Beine lagen unverändert schwer auf der harten Matratze, ohne zu dünnen Insektengliedmaßen geschrumpft zu sein.
Er wusste nicht, woher diese Ängste kamen, die ihn in letzter Zeit so häufig heimsuchten, vermutete jedoch, dass sie mit seiner gegenwärtigen Situation zu tun hatten. So war es nur wahrscheinlich, dass der Verlust seiner Freiheit und das damit verbundene Gefühl von Hilflosigkeit Bilder in ihm wachriefen, deren Vorhandensein ihm längst entfallen war. Warum in aller Welt sollte er sonst – wenn auch nur im Traum – auf den Gedanken kommen, in einen Zustand tierhaften Dahinvegetierens zurückgeworfen zu werden?
Er richtete sich auf seiner Pritsche auf, lauschte in die Schwärze hinein, kniff die Augen zu, bis ein Blitzen hinter geschlossenen Lidern die Illusion weckte, von lichter Helligkeit umschlossen zu sein.
In dem Augenblick war ein schepperndes Geräusch zu hören, wurde irgendwo in seinem Rücken eine Tür geöffnet, sodass mit einem Mal graues Licht in den Raum drang. Er wusste, dass es Marek war, der ihm, wie jeden Morgen, das Frühstück brachte. Marek, der kein Wort sprach, der ihm auf seine Fragen keine Antworten gab, Marek, der ihn stets aus blassen slawisch-blauen Augen ansah, als wollte er ihn allein durch die Intensität seines Blicks zu einem Eingeständnis seiner Schuld zwingen.
Marek war es auch, der ihn, manchmal mitten in der Nacht, aus dem Schlaf riss, ihn zu einem der Verhöre am Ende des Ganges brachte und ihn nach den endlos langen Fragen, auf die er keine Antworten wusste, wieder zurück in seine Zelle führte. Irgendwann hatte er begonnen, jede Aussage zu verweigern. Sollten sie ihn doch verhören, er würde nicht mehr auf ihre Fragen antworten. Ohnehin würde nichts dabei herauskommen, zumindest nichts Wahres. Er wusste ja selbst nicht, was passiert war.
Dennoch änderte sich nichts an den Abläufen: Marek, der ihn abholte und nach hinten brachte, die Fragen, auf die er nicht zu antworten wusste, der Weg zurück in seine Zelle. Und Marek, der jegliches Gespräch verweigerte.
»Hier ist es unerträglich dunkel«, sagte Gregor.
Marek stellte das Tablett auf den klobigen Metalltisch neben der Pritsche, ohne die Andeutung einer Reaktion zu zeigen. Gregor beobachtete ihn, verfolgte jede seiner Bewegungen mit großer Anstrengung.
»Eigentlich will ich nur wissen, warum ihr mich hier immer noch festhaltet«, fuhr er fort.
In den letzten Tagen und Wochen hatte er Marek und den Männern, die ihn verhörten, diese Frage wieder und wieder gestellt, doch nie eine Antwort erhalten. Seine Stimme hatte im Lauf der Zeit einen flehenden Ton angenommen, wofür er sich gelegentlich schämte. Warum, so fragte er sich in solchen Momenten, warum sollte er sich wie ein Bittsteller verhalten, der jeglichen Anspruch auf Freiheit verwirkt hatte? War es denn nicht eher so, dass seine Inhaftierung ohne jede Berechtigung erfolgt war?
Das Licht, das durch die geöffnete Tür in die Zelle drang, gewann an Intensität, und die Kargheit des Raumes war nun deutlich zu erkennen. Auch Marek war nicht mehr nur ein Schatten, der schwerfällig und stoisch seine Arbeit verrichtete. Immer, wenn er Gregor besonders nahe kam, nahm dieser das struppige weiße Haar des Mannes wahr, die Pupillen in seinem müden Gesicht, die konzentriert seinen Verrichtungen folgten, den gebeugten Rücken, die abgetragene Uniform. Einen Moment lang glaubte er jetzt gar, dass sich im Gesicht des alten Mannes etwas regte. War da etwa ein Flackern in seinen Augen? Es schien ihm, als habe Marek seine Worte verstanden … Aber vergebens hoffte er und schnell wurde ihm klar, dass nur das hereinfallende Licht die Züge in Mareks Gesicht mit Leben gefüllt hatte.
Auch heute würde er keine Antwort erhalten.
Warum nur war er hier? Er hatte doch nichts Böses getan. Sie hatten ihm zuerst nicht einmal sagen wollen, wo er sich befand. Erst nach Tagen war ihm aufgrund so mancher Andeutung klar geworden, dass er in einem tschechischen Gefängnis gelandet war. Zumindest vermutete er dies. Seine Fragen nach dem Grund seiner Inhaftierung und den gesetzlichen Voraussetzungen dafür hatten sie ignoriert, ihn damit getröstet, dass er demnächst über sämtliche Hintergründe informiert werden würde. Nichts war jedoch bislang geschehen.
Immer wieder hatte er zu Protokoll gegeben, dass er sich an die Zeit vor seiner Inhaftierung nicht erinnern könne. Auch nicht an seine Festnahme. Die verhörenden Beamten – es waren nicht immer dieselben – notierten seine dahin gehenden Aussagen zwar, aber er hatte nicht den Eindruck, als würden sie ihm glauben. Als er ihnen auch auf die Frage nach seinem Namen eine Antwort schuldig blieb – schuldig bleiben musste –, hatten sie angefangen, ihn Gregor zu nennen. Anfangs empfanden sie dies wohl als erheiternd, denn bei jeder Nennung dieses Namens lachten sie herzhaft und ein Anflug von Menschlichkeit spiegelte sich – so erschien es zumindest Gregor – in ihren Zügen. Ihm selbst sagte der Name jedoch nichts.
Auf seine Bitte, ihm ein Gespräch mit dem Botschafter seines Heimatlandes zu ermöglichen, reagierten sie eher ironisch. Welchen Botschafter er denn sprechen wolle, hatten sie gefragt, den deutschen oder österreichischen oder gar den Schweizer Vertreter. Vielleicht sogar den Niederländer … Da hatte er nicht gewusst, was er antworten sollte.
Was wusste er überhaupt? Es war nicht viel. Als er irgendwann zu sich gekommen war, hatte er, ohne dass er einen Grund dafür nennen konnte, eine Erektion gehabt, und er hatte sich dabei ertappt, dass die Finger seiner rechten Hand sein Glied umschlossen hatten. Es war ein eigenartiges Gefühl gewesen, aber keines, das er als unangenehm empfunden hatte. Gleichzeitig waren Bilder in seinem Kopf gewesen, die wohl etwas mit seiner den flüchtigen Träumen geschuldeten Erregtheit zu tun hatten. Kaum fassbare Bilder, die sich sofort wieder in Nichts aufgelöst hatten. Einen winzigen Moment lang waren sie, zwischen unbeschreiblicher Glückseligkeit und blankem Entsetzen treibend, da gewesen. Erst Sekunden später hatte sein Denken eingesetzt, und es war nicht die Frage, wer er war, die ihn in Panik versetzte, sondern seine Verlorenheit in der Dunkelheit, die ihn umhüllte. Er hatte das Gefühl gehabt zu schweben, nicht mehr in der Lage zu sein, zwischen oben oder unten unterscheiden zu können.
Als er sich von seiner ersten Verwirrtheit befreit hatte, beschloss er, sich mit dem Dunkel, das ihn umfing, vertraut zu machen. Er richtete sich auf, wobei ihn ein Gefühl von Schwindel überkam Erst aber, als er – vorsichtig tastend – einen Fuß auf festen Grund gesetzt hatte, empfand er ein Gefühl von Sicherheit und der Schwindel ließ nach, verschwand schließlich gänzlich. Dennoch dauerte es eine Ewigkeit, bis er mit beiden Beinen auf einem Boden stand, der sich – er hatte sich gebückt und die Fläche vor ihm ertastet – als kalter Betonboden erwies.
Mit nach vorn gestreckten Armen war er dann Schritt für Schritt erst in die eine, dann in die andere Richtung gestolpert, ständig gewärtig in ein dunkles Nichts hinabzustürzen. Er war jedoch nur gegen blanke Wände getaumelt – fand in einer Ecke ein Waschbecken, eine stinkende Kloschüssel, eine hölzerne Tür – feuchte Wände, die ihn von jeder Seite umschlossen. Zumindest eine Vorstellung von den Ausmaßen des Raumes erhielt er dabei:
Ein Kerkerloch von circa drei Metern Länge und drei Metern Breite.
Wie nur war er hierhergekommen? Jegliche Erinnerung fehlte.
Dann ging Marek, nachdem er seine Arbeiten verrichtet hatte, ließ ihn allein zurück. Zumindest hatte dieser, ehe er die Tür schloss, eine vergitterte Luke geöffnet, durch die fahles Licht hereinfiel, sodass er, Gregor, sein Frühstück nicht in absoluter Dunkelheit einnehmen musste.
Von irgendwoher konnte er Geräusche unbekannter Herkunft vernehmen: Das ferne Gepolter von Straßenbahnen, ihr gelegentliches helles Klingeln, das Scheppern der Müllabfuhr, das Gestotter eines Presslufthammers. Stimmen, die der Wind herübertrug.
Ein Gefühl totaler Vereinsamung bemächtigte sich seiner. Was ihn aber am meisten quälte, war die Tatsache, dass er keine Vorstellung von seinem Gesicht, von seinen Gesichtszügen hatte. Ihm war, als habe er die Grenze zwischen sich und seiner Umwelt verloren. Wer war er nur? Hunderte Male hatten seine Finger tastend versucht, ein Bild herbeizurufen, an das er sich hätte erinnern können. Vergeblich. Kurzes, volles Haar, eine hohe Stirn, die Nase kräftig, schmale Lippen – mehr war es nicht, was sie ihm sagen konnten. In seiner Zelle gab es keinen Spiegel, keine reflektierende Scherbe, nichts, das ihm eine Ahnung davon hätte geben können, wie er aussah. Und selbst als er sich vor die Kloschüssel in seiner Zelle hingekniet hatte, um sich im trüben Wasser, das darinstand, zu erkennen, hatte sich ihm nur übel riechende Dunkelheit gezeigt.
Marek kam hin und wieder, rasierte ihn. Aber auch er brachte nie einen Spiegel, der ihm ein Bild von sich hätte verschaffen können. Nicht einmal auf seine Bitten hin. Schließlich hatte er auf dem Weg zu seinen Vernehmungen immer wieder vergeblich nach etwas Ausschau gehalten, was ihm hätte Aufschluss geben können. Etwas, in dem sich sein Bild fing. Doch da war nichts gewesen, sodass er in seiner Verzweiflung während der endlosen langen Befragungen manches Mal ganz nahe an die Beamten gerückt war, in der absurden Hoffnung sich in ihren Augen zu spiegeln.
Letztlich aber war ihm nur die Erkenntnis geblieben, dass er weder wusste, wer er war, noch dass er eine Vorstellung davon hatte, wie er aussah.
»Was wird mir denn vorgeworfen?«, fragte Gregor.
Der Offizier, der hinter einem mächtigen Schreibtisch Platz genommen hatte, lächelte den Gefangenen – und als solcher empfand sich Gregor, unbeschadet der Tatsache, dass ihm sein Status bislang noch nicht offiziell verkündet worden war – mit großer Herzlichkeit an.
»Der Grundsatz, nach dem hier entschieden wird, ist: Die Schuld ist immer zweifellos. Andernfalls wären Sie nicht hier. Außerdem, es wurde gegen Sie Anzeige erstattet.«
Er sprach makelloses Deutsch, dem dennoch ein fremder Klang innewohnte, was Gregor in seiner Empörung jedoch nicht wahrnahm.
»Aber das ist doch absurd. Ich bin noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Da bin ich mir sehr sicher.«
Der Offizier lächelte abermals, doch glaubte Gregor, nunmehr etwas Spöttisches in diesem Lächeln zu erkennen. Er führte dies sofort darauf zurück, dass sein Gegenüber – ein Verhörspezialist, wie er vermutete – die kleine Einschränkung in seiner Antwort registriert hatte.
»Mit letzter Sicherheit kann ich das natürlich nicht behaupten«, fuhr er deshalb bemühter fort, als ihm dies eigentlich recht war. »Hören Sie, ich habe ja schon mehrfach zu Protokoll gegeben, dass ich mich nicht an das erinnern kann, was zu meiner Verhaftung geführt hat. Wie soll ich da Auskunft geben können über mein bisheriges Leben? Ich kann mich an nichts erinnern?«
»Nun, sehen Sie!«
Es klang weder triumphierend, noch war eine Spur von Mitleid in der Antwort des Offiziers zu hören. Höchstens Langeweile. Gerade aber die Tatsache, dass der Mann so ohne Zweifel zu sein schien, ärgerte Gregor über die Maßen.
Er betrachtete ihn daraufhin genauer. Ein kräftiger Kerl, mittleren Alters, der aber, bedingt durch das dünne Haar, das seinen kantigen Schädel zierte, älter aussah. Vielleicht war es aber auch die Selbstsicherheit, die er ausströmte, die ihn gereifter wirken ließ, als ihm aufgrund seiner Jahre eigentlich zustand. Dazu kam, dass die militärische Strenge, die unverkennbar war, ihm eine gewisse Würde verlieh. Gregor konnte sich erinnern, dass er während der bisherigen Verhöre als Einziger der Offiziere immer dabei gewesen war. Dennoch hatte er nie in die Befragungen selbst eingegriffen.
»Wie, wenn ich gar nicht der bin, für den Sie mich halten?«
»Wer sollten Sie denn sonst sein, Gregor?«
»Ich weiß doch nicht einmal, ob ich wirklich Gregor heiße.«
»Wie heißen Sie denn dann?«
»Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich bin jedenfalls nicht der Mann, von dem Sie behaupten, dass er Gregor heißt.«
Der Offizier deutete wieder ein überlegenes Lächeln an und zuckte mit den Schultern. »Das ist für diese Abteilung ohne Bedeutung. Finden Sie heraus, wer Sie sind, und dann sollten Sie sich Ihrer Schuld auch stellen. Wir sammeln nur die Beweise, die in der Verhandlung gegen Sie verwendet werden.«
Gregor blickte mit gerunzelter Stirn auf den Schreibtisch, der zwischen ihm und dem Offizier stand. Eine leere Fläche, lediglich ein dünner Aktenordner, der darauf lag. In großer, etwas unsicherer Schrift war der Name »Gregor« vermerkt. Er wollte schon danach greifen, doch hielt ihn eine unbestimmte Furcht davor zurück.
»Wenn ich nun gar nicht wissen will, wessen ich mich schuldig gemacht habe? Was dann?«
»Nun …«
Gregor wollte dem Offizier in einer trotzigen Geste sein Gesicht entziehen und blickte ziellos herum. Doch der ergriff mit einem Mal seine Hände, sodass sich Gregor gezwungen sah, ihm in die Augen zu blicken.
»Tun Sie das nicht. Verstehen Sie? Wenn Sie uns Ihre Mitarbeit verweigern, dann könnten wir gezwungen sein, Ihnen bei der Suche zu helfen.«
»Wie meinen Sie das?«
Der Offizier ließ Gregors Hände los und erhob sich. Breitbeinig, die Hände in den Hüften, stand er still und blickte auf den Gefangenen hinab. Dann nickte er ihm aufmunternd zu. »Wir könnten Sie foltern. Es wäre also wirklich besser, wenn Sie sich Ihrer Verantwortung stellen.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass hier in Ihrem Land die Folter noch immer Teil der offiziellen Gerichtsbarkeit ist? Das kann doch nicht sein!« Gregor wollte voll Empörung aufspringen, doch ein Blick aus den strengen Augen des Offiziers ließ ihn in seinen Stuhl zurücksinken.
»Wir haben eine lange Tradition peinlicher Befragungen und sind stolz auf die Erfolge, die wir auf diese Weise erzielen. Und vergessen Sie nicht, damit bewegen wir uns durchaus im Rahmen des europäischen Humanismus, wenngleich …«
Er führte den Satz nicht zu Ende. Es schien vielmehr, als würde ein weiterer Gedanke an die Oberfläche drängen.
»Was halten Sie davon, wenn ich Sie mit unserem feinsten, bewährtesten Foltergerät vertraut machen würde? Es ist in der Tat ein Wunderwerk der Technik und den modernen Gerätschaften, wie sie bei den Amerikanern oder Russen, selbst bei den Chinesen, Verwendung finden, in jeder Weise überlegen.«
Gregor zuckte mit den Schultern. Von Wollen konnte natürlich nicht die Rede sein, doch war es angesichts der Situation, in der er sich befand, wohl angebracht, der Aufforderung seines Gegenübers Folge zu leisten.
»Ich bin selbstverständlich ein Gegner der Folter, wie Sie sicher verstehen werden, nicht nur aus persönlicher Betroffenheit heraus. Aber ebenso wenig kann ich mich Ihrem Wunsch entziehen. Meine Lage ist mir ja durchaus bewusst.«
Der Offizier nickte. »Kommen Sie also«, sagte er, wobei ihm die Genugtuung über Gregors Bereitschaft anzusehen war.
»Es ist ein eigentümlicher Apparat«, erklärte er wenig später.
Gregor, der ihm ohne Widerstand in einen der tiefer liegenden Räume gefolgt war, richtete seinen Blick auf einen monströsen und doch fragil wirkenden Apparat, der in der Mitte des Zimmers stand. Der Offizier ließ einen bewundernden Blick auf die ihm wohlbekannte Apparatur fallen, um dann mit Eifer einige ihm wichtig erscheinende Ausführungen folgen zu lassen.
»Ursprünglich wurde dieses Gerät verwendet, um Verurteilte in angemessener Weise zu exekutieren. Erst seit einiger Zeit führen wir damit auch Folterungen durch, um die Angeklagten dazu zu bringen, sich ihrer Schuld zu stellen. Wie gesagt, mit großem Erfolg.«
»Haben Sie dieses Monstrum erfunden?«, unterbrach ihn Gregor, der seine Abscheu nicht verbergen konnte.
»Nein, nein.« Der Offizier hob die Hände, als wollte er den Eindruck, er könnte sich mit fremden Federn schmücken, weit von sich weisen. »Das, was Sie hier sehen, ist nicht das Original. Das ist verschollen. Aber es ist uns gelungen, mittels der Schriften eines unserer wichtigsten Autoren eine exakte Replik herzustellen … ein Meisterwerk.«
Gregor hatte nur wenig Sinn für den Apparat, ließ sich aber dennoch – wenn auch widerstrebend – die Funktionsweise erklären.
»Dieser Apparat besteht, wie Sie sehen können, aus drei Teilen: Der untere wird das ›Bett‹ genannt, der obere heißt der ›Zeichner‹ und der mittlere, schwebende Teil wird als ›Egge‹ bezeichnet … Im Übrigen sind dies die Originalbezeichnungen, wie sie überliefert wurden.«
Gregor trat nun doch näher heran, ließ sogar seine Finger über das glatte Holz und das schimmernde Metall des Folterinstruments gleiten.
»Ich will Sie nicht mit Einzelheiten langweilen, auch wenn das System höchste Bewunderung verdient«, fuhr der Offizier nach einer Weile fort. »Jedenfalls wird der Delinquent auf dem Bett festgeschnallt, sodass nicht die geringste Bewegung möglich ist. Dies ist wichtig, da wir äußerst exakt arbeiten und jede auch nur geringe Positionsänderung die Genauigkeit der Ausführung infrage stellen würde.«
Gregor nickte, als verstünde er die Zusammenhänge des komplexen Mechanismus. »Was passiert, wenn das Opfer auf dem Bett liegt?«
Der Offizier unterbrach ihn sofort. »Ich bitte Sie inständig, im Zusammenhang mit den Folterungen nicht von ›Opfern‹ zu sprechen. Letztlich helfen wir den Delinquenten, die Wahrheit zu erkennen … Aber sehen Sie …« Er deutete nun auf die Egge, die gleichsam über dem Bett zu schweben schien. Zweierlei Nadeln in vielfacher, unterschiedlicher Anordnung ragten daraus hervor. »Die Egge wird anschließend auf den Körper des darunterliegenden Menschen gesenkt und setzt sich in Bewegung, sticht ihre Spitzen in den Rücken. Ein äußerst schmerzhafter Prozess. Die lange Nadel schreibt, während die kurze Wasser ausspritzt, um das Blut von der Haut des Darunterliegenden abzuwaschen. So wird die Schrift immer klar erhalten. Der gesamte Vorgang dauert in der Regel etwa zwölf Stunden. Länger hat noch keiner die Prozedur ertragen …« Der Offizier setzte eine Weile in seinen Erklärungen aus, um Gregor genügend Zeit zur ungestörten Betrachtung zu geben.
»Nun liegt also der Mann«, sagte Gregor. »Was aber wird in seine Haut geritzt?«
»Das, worin seine Schuld besteht. Ein Schriftzug, der die jeweilige Schuld in präziser Form zusammenfasst.« Der Offizier bemerkte Gregors Verwirrung und lachte. Er deutete auf den Zeichner, der über der Egge angebracht war. »Dort im Zeichner ist das Räderwerk, welches die Bewegung der Egge bestimmt, und dieses Räderwerk wird nach uralten, uns überlieferten Zeichnungen gesteuert.«
»Woher kommen diese Zeichnungen?«
Gregors Gegenüber zuckte mit den Schultern, als sei die Frage ohne Bedeutung, doch ihm, Gregor, schien es, als habe er den Schwachpunkt der Maschinerie instinktiv erkannt. Wenn es zutraf, dass die Herkunft des Regelsystems nicht klar zu bestimmen war, lud dies doch zu fehlerhaften Auslegungen gerade im Hinblick auf Fragen der Schuld ein.
Er äußerte diesen Einwand, doch machte er nur wenig Eindruck auf den Offizier.
»Es gibt in der Tat Bestrebungen, die Zeichnungen zu ändern, sie dem Zeitgeist anzupassen …«
Er lachte und zeigte damit, wie wenig er von solchen Tendenzen hielt.
»Aber wir gehen doch davon aus, dass Gesetzmäßigkeiten ihre Berechtigung auch aus der Tatsache ziehen, dass sie auf eine tiefer liegende, der Zeit entzogene Wahrheit zurückzuführen sind.«
Dieser Position konnte Gregor in seiner gegenwärtigen Lage natürlich nur wenig entgegensetzen, und so entschied er sich, die Ausführungen seines Gegenübers nicht weiter zu kommentieren. Ohnehin schien der Offizier mit einem Mal das Interesse an weiteren Erklärungen verloren zu haben. Wohl ging er davon aus, dass seine Präsentation ihr Ziel erreicht hatte und Gregor sich der Unausweichlichkeit seines weiteren Schicksals bewusst geworden war.
Er drückte auf einen verborgenen Knopf neben der Tür und nach wenigen Minuten erschien Marek, um Gregor in seine Zelle zurückzuführen.
»Was passiert nun mit mir?« Gregor schrie die Worte so laut, dass sich ihm der Offizier ganz erstaunt zuwandte.
»Mich fragst du?«, sagte er – vor lauter Erstaunen war er ins persönlichere Du gewechselt. Er fasste sich aber sofort. »Nun, wenn Sie wollen, können Sie gehen. Die Türen stehen Ihnen offen«, fügte er dann noch hinzu. »Aber eines sollten Sie beachten: Es ist Ihnen nicht gestattet, die Stadt zu verlassen … unter keinen Umständen.« Dann drehte er sich endgültig weg, so als wollte er mit seinem Lachen allein sein.
2 Der Auftrag
Sie heißt Alexandra und erinnert mich ein bisschen an die Sängerin mit der rauchigen Stimme, deren Liedern ich vor mindestens hundert Jahren voll Sehnsucht gelauscht habe.
»Alexandra?«, frage ich. »Wie die Sängerin?«
Sie lacht, sagt, sie kenne keine Sängerin mit diesem Namen. Aber egal. Wahrscheinlich hält sie mich für einen alten Sack, der kurz davor steht, ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ich gebe mich cool, spiele mit meinem Kugelschreiber. Wie sie auf mich gekommen sei, will ich wissen. Ich blicke dabei an ihr vorbei auf das Bob-Dylan-Poster, welches mich seit meiner Studentenzeit begleitet und nun hinten an der Wand meines Büros hängt. Ob sie wenigstens ihn kennt? Ich wage nicht zu fragen.
»Auf Empfehlung«, meint sie. Es klingt ein bisschen kokett. Ich beschließe, dies für den Moment zu akzeptieren. Die Freundin der Lebensgefährtin eines Freundes würde mich kennen. Sie nennt einen Namen, der mir nichts sagt. Ich nicke dennoch.
»Was also …?«
Sie kramt in ihrer Tasche, die teurer wirkt als ihre gesamte restliche Garderobe. Dann zieht sie ein Foto heraus, legt es vor mich hin.
»Mein Prof«, erklärt sie, als sei damit alles gesagt.
Ich rücke das Foto näher heran und blicke in das Gesicht eines Mannes, den man wohl als gut aussehend bezeichnen kann. Die Haare dicht und dunkel über ebenso dunklen, buschigen Brauen, der Mund voll und doch männlich, ein markantes Kinn, Augen, die, weit von der Nasenwurzel entfernt, an der Kamera vorbeiblicken. Ich schätze ihn auf etwas über 40, wobei ich mir eingestehen muss, dass ich Männer hinsichtlich ihres Alters meistens falsch einschätze. Ein französisches Gesicht mit einem Hang zur Schwermut. Er erinnert mich an den jungen Gilbert Bécaud, und wie es scheint, hat er meiner Besucherin den Kopf verdreht.
Professor Antonin Hruby ist spurlos verschwunden. Ist nachts aus dem Hotel geschlichen und nicht zurückgekommen. Er habe nur noch einen Drink zu sich nehmen wollen, während sie genug von den Anstrengungen des Tages gehabt habe und schon zu Bett gegangen war.
»Er hat sich in Luft aufgelöst. Einfach so.«
»Das kann nicht sein! Niemand löst sich in Luft auf.«
»Dann ist er davongeflattert wie ein Vogel.«
»Auch nicht sehr wahrscheinlich.«
Sie schaut mich böse an. Als würde ich sie nicht ernst nehmen.
»In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Professor?«
»Wir vögeln.«
Ich lasse dies sacken, richte meinen Blick auf Bob, der hinter seiner dunklen Sonnenbrille zu grinsen scheint. Die Saat ist aufgegangen, denke ich. Keine Frage. Da kommt der Nobelpreis nicht ganz unverdient.
»Interessant«, erwidere ich.
Sie zuckt mit den Schultern. »Er ist natürlich schon ein bisschen aus der Übung, aber wir lieben uns, und ich möchte, dass Sie ihn finden.«
Das Telefon schrillt. Ich kenne die Nummer auf dem Display: Charlotte, die Seelenverwandte, mit der ich seit geraumer Zeit Wohnung, Bett und Fernsehprogramm teile.
»Meine Freundin«, sage ich entschuldigend. Alexandra, die wohl so alt ist wie Charlotte, nickt gönnerhaft. »Nur zu.«
Ich komme mir plötzlich albern vor, wenig seriös. Denke daran, wie kritisch sich die junge Frau über ihren Professor und seine erotische Tauglichkeit geäußert hat. In seinem und meinem Alter sollte man eigentlich eine feste Beziehung und keine Freundin haben. Ist das nicht so? Die Frage, was Charlotte von meinen männlichen Qualitäten hält, scheint mir mit einem Mal wichtig. Irgendwann werde ich sie danach fragen. Ich hebe ab.
»Stör ich?«, vernehme ich. Es scheint ihr aber nicht in den Sinn zu kommen, dass diese Möglichkeit tatsächlich bestehen könnte, denn sie sprudelt sofort weiter. »Ich möchte endlich mit dir verreisen«, sagt sie.
Ich kenne ihre spontane Art, bin somit von ihrem Ansinnen nicht überrascht. Dennoch halte ich es für angebracht, sie in ihrer Euphorie etwas zu zügeln. Sie liegt mir schon seit Tagen mit dem Wunsch, die Stadt für ein paar Tage zu verlassen, in den Ohren. Selbst mein Hinweis, dass ich zu arbeiten habe, wie andere Menschen auch, hat sie nicht sonderlich beeindruckt.
»Du weißt, dass mir die Leute hier auf den Geist gehen.«
»Wohin willst du denn überhaupt?«, frage ich. Eine Frage, die selbst für mein Gefühl sehr passiv klingt.
»Ich weiß nicht«, sagt sie, »nur weg von hier.«
Ich lache verhalten. Ihr Wunsch kommt mir bekannt vor. Einen Moment lang lasse ich meinen Blick schweifen. Von Bob zu der jungen Frau, der der Professor abhandengekommen ist, und wieder zurück zu Bob.
»Na ja«, meine ich schließlich. »Vielleicht tut sich da tatsächlich etwas. Aber ich weiß noch nichts Genaues … Ich komm bald. Also bis nachher.«
Sie hat bereits aufgelegt. Ich spreche mit dem Leerzeichen. Telefonate mit Charlotte laufen nie normal ab.
Alexandra lächelt. »Ihre Freundin möchte verreisen?«
Ich seufze, zucke mit den Schultern. »Regensburg gefällt ihr nicht, zu viel Provinz, und überhaupt …«
»Dann machen Sie ihr doch die Freude. Wien ist sehr schön.«
»Wieso gerade Wien?«, frage ich verwirrt, ehe es mir dämmert. »Ihr Professor …«
Sie nickt. »Wir sind im Hotel Schani abgestiegen. Nicht weit von der Donau entfernt, ganz im Zentrum. Gutes Hotel … Bis er dann verschwunden ist.«
»Was wollte Ihr Professor denn in Wien?«
Alexandra blickt versonnen auf den Kugelschreiber in meiner Hand. Sicher sieht sie ein phallisches Symbol darin, geht es mir durch den Kopf. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich senke jedenfalls die Spitze.
»Wir wollten uns amüsieren. Wir beide wollten das. Es waren gerade Semesterferien und … außerdem wollte er jemanden treffen, der in Wien oder ganz in der Nähe wohnt.«
»Wissen Sie, wer das war?«
»Nein. Er hat es nur kurz erwähnt. Ich wollte ursprünglich, dass er mit mir nach Venedig fliegt, aber er meinte, Wien sei für ihn besser, da er da die Gelegenheit nutzen könne, jemanden zu sprechen, der ihm etwas mitteilen wolle. Etwas ganz Besonderes. Vielleicht hing das mit seinen Forschungen zusammen. Toni war ja immer auf der Suche nach irgendwelchen ungeheuer wichtigen Dingen.«
Sie verdreht ihre dunklen, intensiven Augen ein bisschen, was ihr recht gut steht. Zumindest nach meinem Gefühl. Ihre Stupsnase mit dem kleinen Aufwärtsdrall wird dadurch betont.
»Hat er erwähnt, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat?«
»Nein. Ich war damals sauer, dass er nicht nach Venedig wollte. Wien scheint mir ja eher etwas für alte Leute. Da hab ich ihn nicht weiter danach gefragt …«
»Hm.« Ich brumme etwas, ohne in irgendeiner Weise auf ihre Aussage hinsichtlich Wiens einzugehen. Ich persönlich liebe Wien mit seinem dekadenten Flair, ohne mich dabei alt zu fühlen. Mag schon sein, dass es hierbei unterschiedliche Meinungen gibt. Nun ja! Was wohl Bob dazu sagen würde? Ich blicke nach hinten, aber er hält sich bedeckt.
»Werden Sie den Fall also übernehmen?«
Es klingt ein wenig fordernd, was aber – wie ich vermute – nur ihrer Besorgtheit geschuldet ist. Noch ist es kein Fall, denke ich. Viele Männer verschwinden einfach, ohne Spuren zu hinterlassen. Manchmal von einem Tag auf den anderen. Frauen tun das eher selten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Letztlich geht es aber immer nur um die Frage, ob das Verschwinden einer Person freiwillig oder unfreiwillig erfolgt. Allerdings gibt es dabei eine Reihe von Zwischentönen.
»Haben Sie denn schon mit der Polizei gesprochen?«
Sie macht eine wegwerfende Handbewegung, die den gesamten Beamtenapparat zu umfassen scheint.
»Natürlich. Es gibt eine offizielle Vermisstenanzeige. Seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Mehr aber wollten sie mir nicht sagen …«
Ich nicke. Natürlich würde man ihr keine näheren Auskünfte geben. Dennoch wundere ich mich, dass man sie noch nicht vernommen hat. »Hat man Sie über Ihre Reise mit dem Professor nicht ausführlicher befragt?«
»Nur ganz kurz. Der Polizist, der mir die Fragen gestellt hat, hat mich wohl für ein kleines, dummes Flittchen gehalten und kaum hingehört.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, nicke also lediglich mitfühlend. Daraufhin nimmt sie das Foto, das immer noch vor mir liegt, und steckt es in ihre teure Tasche.
»Nun?«
»Ich melde mich«, sage ich. »Sie können das Foto gern hierlassen.«
Sie holt es wieder hervor, legt es vor mich hin. Dann geht sie und hinterlässt eine Lücke auf dem alten Korbsessel. Als sie an Bob vorbeikommt, lächelt sie ihm leicht zu. Ich kann es genau sehen. Der verzieht jedoch keine Miene.
Kaum hat sie mein Büro verlassen, rufe ich Trotzki an. Trotzki, das ist mein alter Freund und früherer Chef, der im Gegensatz zu mir mit einer Extraportion Sitzfleisch und Beharrlichkeit ausgestattet ist. Trotzki ist natürlich nicht sein bürgerlicher Name, aber so heißt er für mich seit gemeinsamen Studententagen. Inzwischen hat Trotzki die Karriereleiter bei der Regensburger Polizei erklommen und gilt als aussichtsreichster Anwärter auf den Posten des Polizeichefs, sollte der jetzige jemals in Ruhestand treten.
Ich frage ihn nach Antonin Hruby und ob sie etwas über ihn haben.
»Komm doch auf einen Sprung rüber«, keucht er. Er ist Raucher und klingt wie Hildegard Knef zu ihrer besten Zeit. Sein Büro liegt lediglich zwei Minuten entfernt am Minoritenweg.
»Ist gut«, sage ich. Schon legt er auf. Fast so schnell wie Charlotte. Zumindest lässt er mich ausreden, denke ich. Noch Sekunden danach habe ich das Krachen seiner maroden Lungenflügel in meinen Ohren.
»Schön, dass du da bist«, begrüßt er mich wenig später. Er hat eine Zigarette im Mund und der Rauch von Hunderten bereits gerauchter liegt in der Luft seines Büros. »Schließlich habe ich das Mädchen ja zu dir geschickt. Interessanter Fall …«
»So läuft der Hase also.« Ich bin nicht sonderlich überrascht. Gelegentlich schanzt er mir einen Auftrag zu, wenn er und seine Truppe auf offiziellem Weg nicht weiterkommen.
»Offizieller Auftrag?«, frage ich.
»Nein«, sagt er, »aber das Honorar ist in Ordnung.«
»Gut«, sage ich. »Was ist denn mit diesem Hruby?«
»Komische Sache das Ganze.« Er reicht mir ein Schriftstück, eine Art Dossier zum Fall Hruby. Darin eine Reihe von Fakten, alle säuberlich vermerkt. Professor Hruby lebt in Regensburg. 42 Jahre alt. Studium an der Karls-Universität von Prag. Promotion über Franz Kafka. Seit zwei Jahren ordentlicher Professor an der Uni Regensburg. Verheiratet mit einer gleichaltrigen Psychologin mit eigener Praxis. Frauenschwarm und äußerst beliebt bei seinen Studentinnen. Von einer Reihe außerehelicher Beziehungen kann mit einiger Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Vor circa zwei Wochen spurlos aus einem Wiener Hotel verschwunden.
Ich blicke Trotzki an. Der bleckt die Zähne. Eine Reihe nikotingelber Perlen leuchtet mir entgegen.
»Hier.« Er deutet auf eine mehrfach gefaltete Seite, die vor ihm liegt und ganz offensichtlich aus einer Zeitschrift herausgetrennt worden ist. »Könnte eine Spur sein …«
»Was ist das?«, frage ich nach einem kurzen Blick.
»Lies halt!« Er lacht. Es klingt, als würden mehrere Häuser gleichzeitig zusammenstürzen. »Hat mir Hrubys Frau gegeben. Die hat den Artikel in einer Jackentasche des Professors gefunden.«
Der Text ist in einer mir völlig fremden Sprache verfasst – wohl in einem Wissenschaftsmagazin erschienen. In der Mitte des Textes ein verblichenes Schwarz-Weiß-Foto, das einen Mann mittleren Alters zeigt. Ein mächtiger Schnauzbart gibt ihm das Aussehen eines Walrosses.
»Du bist ein Komiker, Trotzki«, sage ich und stecke den Artikel ein.
Charlotte ist sofort bereit, mit mir nach Wien zu fahren. Sie sagt, sie mag die Österreicher, vor allem die Wiener, mit ihrem Schmäh und ihren Fernsehsendungen, die – wie sie meint – einfach kultig sind. Ich stimme ihr zu. Dann fragt sie mich, warum ich mit einem Mal bereit bin, mit ihr zu verreisen. Ich erzähle ihr von Professor Antonin Hruby und seinem plötzlichen Verschwinden.
»Er hat keine Spuren hinterlassen, ist wie vom Erdboden verschluckt …«
Charlotte ist enttäuscht. Kann ohnehin nicht verstehen, warum ich die Suche nach Menschen, die wie Antonin Hruby plötzlich von der Bildfläche verschwinden, zu meinem Beruf gemacht habe. Sie empfindet es als verstörend, sich mit der dunklen Seite des Lebens zu beschäftigen, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
»Wie eine Kanalratte, die in der menschlichen Scheiße ihr Leben fristet und bald so stinkt wie ihre Umgebung.«
Ich halte ihre Ausdrucksweise für weit überzogen, beinahe für peinlich, muss aber zugeben, dass sie ein bisschen recht hat: Der Beruf färbt zu einem gewissen Grad ab. Macht einen manchmal richtig traurig. Aber meine Bestimmung im Leben ist es nun mal, nach Menschen zu suchen, die verloren gegangen sind.
»Ich habe nichts anderes gelernt«, sage ich. »Ein verkrachter Polizist mit einer viel zu jungen Freundin. Was soll ich machen?«
Sie lacht und wenig später versuche ich turnerisch-erotisch mein Bestes zu geben. Dabei liegt mir die Akrobatik, zu der mich Charlotte meistens nötigt, nicht unbedingt. Ich denke an Alexandra, die junge Frau, nach deren viel zu altem Liebhaber ich nun bald meine Fühler ausstrecken werde.
3 Das Hotel Schani
Wir nehmen den Zug. Charlotte ist begeisterte Zugreisende. Sie hasst Fliegen, mehr aber noch das Autofahren.
»Was ist so toll am Zugfahren?«, frage ich sie.
Sie lacht. »Einfach alles. Vor allem bist du frei. Du kannst tun, was du willst.«
Ich blicke sie ganz skeptisch an. »Eingesperrt bist du. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Aber nein. Ganz und gar nicht. Du schläfst, wenn du müde bist. Du gehst spazieren, wenn du dir die Beine vertreten willst. Wenn es einen Speisewagen gibt, kannst du essen und trinken, mit interessanten Männern flirten. Du öffnest die Abteiltür, wenn du Besuch empfangen willst …«
Da erzähle ich ihr eine Geschichte, die ich einmal gelesen habe. Ein Zug, der durch einen Tunnel rast, der eigentlich sehr kurz ist, an jenem Tag aber nicht mehr zu enden scheint. Ein mitreisender Student, der in den gewohnten Zug eingestiegen ist, wird, da er sich die Länge des Tunnels nicht erklären kann, von Unruhe befallen. Nachdem er sich zur Lokomotive nach vorn gekämpft hat, findet er zu seinem Entsetzen den Führerraum leer vor. Der Zugführer ist abgesprungen. Nichts ist, wie es sein sollte. Die Lokomotive gehorcht nicht mehr, die Notbremse funktioniert nicht und der Zug rast immer schneller und schneller in einen dunklen Abgrund. Am Ende sieht der Student dem kommenden Tod mutig ins Auge. Es gibt ja, wie er erkennen muss, ohnehin nichts, was er tun könnte.
»Was ist mit seinen Mitreisenden?«
»Die bemerken nicht, was mit ihnen geschieht. Rasen mit auf den Abgrund zu.«
Charlotte findet meine Geschichte schrecklich, ist sich sicher, dass so etwas in der Realität nie passieren kann. Ich stimme ihr zu. Dann blicke ich aus dem Fenster. Kein Tunnel weit und breit.
Das Hotel Schani,im Viertel Belvedere, ganz zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegen, ist noch recht neu und versucht, Wiener Gemütlichkeit und Moderne in Einklang zu bringen. In der Lobby sind Tische mit Computern, die auf rastlose Geschäftsleute warten. WLAN ist selbstverständlich kostenfrei und auch auf den Zimmern verfügbar. Für mich ist es das erste Hotel, in dem mein Smartphone gleichzeitig auch als Zimmerschlüssel fungiert. Ein Tatbestand, der bei Charlotte nicht den Hauch von Verwunderung auslöst, mich aber doch etwas irritiert. Gerade in Wien hätte ich schon eher Zimmerschlüssel in Größe und Form barocker Totschläger erwartet. Ich lasse mir aber nichts anmerken, gebe mich weiterhin weltoffen.
Charlotte ist müde von der Zugfahrt, beschließt früh zu Bett zu gehen, was mir ganz recht ist. Ich sehe eine Parallele zu Alexandra und ihrem Professor und horche in mich hinein. Vielleicht lässt sich ja eine Duplizität der Ereignisse herstellen, wenn ich, wie der Abgängige, das Hotel noch einmal verlasse, um mir einen hinter die Binde zu gießen. Ein verlockender Gedanke. Gleichzeitig ist es lächerlich, ein plumper Beschwörungsversuch.
Ich begebe mich hinunter in die Lobby. Sie nennen es »Schanis Wohnzimmer«, einen Ort der Inspiration. An der Bar sitzen einige wenige Geschäftsleute, die traurig in ihre Gläser stieren, wenn ihre Blicke nicht gerade der jungen Angestellten hinter dem Tresen folgen. Keiner, der mit einem der anderen Gäste ein Wort wechseln würde. Ich verstehe sofort, warum Antonin Hruby das Hotel verlassen hat. Inspiration ist hier nicht zu erwarten. Wiener Flair noch weniger.
Die Bedienung ist recht jung, vielleicht eine Studentin, die sich nebenbei ein Taschengeld verdient. Ich zeige ihr das Foto, das mir Alexandra gegeben hat, frage, ob sie sich an Professor Hruby erinnern könne.
»Ja«, sagt sie. »Die Kieberer haben auch schon nach ihm gefragt. Des is aber schon a Zeit lang her.«
Ihr Wienerisch ist angenehm und melodiös. Ich habe keine Probleme damit.
»Ja, und?«
»Na ja. Der Mann war hier an der Bar. Aber nicht lang. Dann is er weiter. Wahrscheinlich hat’s ihm nicht gfalln bei uns …«
»Wo ist er denn hin?«
»Er hat gfragt, ob’s in der Nähe was gibt, wo’s gmütlicher is.«
»Und?«
»Na, ich hab ihm das Orion am Bahnhof empfohlen … Ob er da hin is, weiß ich aber nicht.«
»Das Orion …«
»Jaja, wenn S’ was erleben wolln …«
Ich lache und gebe ihr zu viel Trinkgeld. Dann mache ich mich auf den Weg. Ehe ich die Lobby verlasse, drehe ich mich noch einmal um. Sie blickt mir hinterher. Den Ausdruck in ihrem Gesicht kann man getrost als nachdenklich bezeichnen.
Auf dem Weg zum Orion habe ich mit einem Mal das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich drehe mich um, aber da ist niemand, der sich auffällig verhalten würde. Ich verlangsame meine Schritte, bleibe gelegentlich stehen, vertiefe mich in die Auslagen der Geschäfte, die noch immer hell erleuchtet sind. Nichts. Ein dünner Strom von Passanten, der an mir vorüberfließt, Männer und Frauen, die meinen Weg kreuzen. Ein dunkel gekleideter Mann kommt mir entgegen, mustert mich im Vorübergehen. Ich blicke hinter ihm her, doch er schreitet voran, ohne sich umzudrehen. Nach einiger Zeit verliere ich ihn aus den Augen.
Das Orionliegt in einer Seitenstraße, nur wenige Schritte vom Bahnhofsplatz entfernt, und ist Teil einer multikulturellen Oase inmitten der Stadt. Es sind vorwiegend Männer jedweder Altersgruppe, die hier herumstreichen, die meisten, wie es scheint, auf der Suche nach irgendetwas. Eine typische Bahnhofsgegend, wie man sie in vielen europäischen Hauptstädten findet.