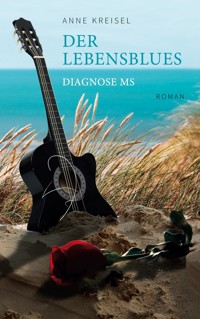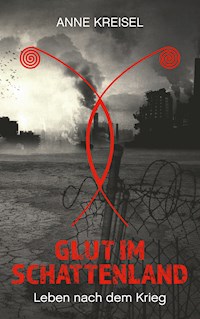
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Team aus amerikanischen und englischen Wissenschaftlern wird ein Jahr nach Kriegsende damit beauftragt, im Raume Nürnberg die KZ-Verbrechen der Nazis zu dokumentieren. Sie erleben hierbei nicht nur schwer traumatisierte Opfer, sondern auch eine Bevölkerung, die sich mit der Vergangenheitsbewältigung schwertut und jeden Tag um die Absicherung ihres Alltags ringen muss. Aus dem anfänglichen Misstrauen den Wissenschaftlern gegenüber entwickelt sich im Laufe der Zeit eine deutliche Ablehnung, die schließlich für diese zur realen Bedrohung wird. So können sie ihre Arbeit nicht mehr wie geplant durchführen, weil ihnen hierfür die notwendige Unterstützung versagt wird. Als schließlich die junge Wissenschaftlerin Elisabeth Dawson lebensbedrohlich erkrankt, kann der Kriminologe John O'Connor sie nur noch durch eine Nottrauung mit ihm retten, bevor sie dann fluchtartig Deutschland verlassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ankunft in Nürnberg
Der Familiennachzug
Der Ausflug nach Erlangen
Die Ausreise der Kinder
Die Feiertage
Das neue Jahr
Die Abreise
Der Umzug
Das Attentat
Die Fahrt nach England
Die Trauung
Der Neuanfang in Oxford
Der Besuch in Irland
Die Erbschaft
Der Kongress
I. Ankunft in Nürnberg
Nachdem Prof. Stanley nun schon das dritte Mal innerhalb der letzten halben Stunde auf seine Taschenuhr gesehen hatte, erhob er sich vom Besprechungstisch und teilte den anderen mit: »Ich muss los. Der Flieger von meiner Nichte wird bald landen.« – »Ich würde Sie gerne begleiten; dann kann ich unsere neue Mitarbeiterin gleich kennenlernen«, schlug Mr O’Connor ihm vor und stand ebenfalls auf.
Sie kamen gerade am Militärflughafen an, als das Flugzeug auf der Landebahn ausrollte. Es war ein mittelgroßes Lastenflugzeug, das nur mit ausdrücklicher Genehmigung Passagiere mitnahm. Elisabeth Dawson strahlte, als sie ihren Onkel erblickte, und wirkte auch noch optimistisch, obwohl Mr O’Connor sie äußerst kritisch musterte und eher reserviert wirkte, als er ihr als Arbeitsgruppenleiter vorgestellt wurde.
Während sie ihre beiden Koffer und die Reisetasche sowie den großen Seesack im Kofferraum des Wagens verstauten, bemerkte O’Connor nüchtern: »Ich hoffe, Sie erwarten nicht zu viel von Ihrem Deutschlandaufenthalt.« Sie verstand seine Bemerkung nicht ganz und fragte deshalb nach: »Was meinen Sie damit?« – »Ich denke, dass eine große Garderobe für diesen dreckigen Job etwas unpassend ist.« Verärgert über die Art seiner ersten Einschätzung, erklärte sie: »Ich habe auch geländefeste Kleidung dabei. Aber da ich wohl das nächste Jahr nicht nach Hause komme und meine Mutter mir sagte, dass es hier nichts zu kaufen gibt, ist schon so einiges zusammengekommen.«
Auf der Fahrt zu ihrer Unterkunft sah Elisabeth interessiert aus dem Wagenfenster, während ihr Onkel berichtete, dass sie sich hier alle inzwischen recht gut eingelebt hätten und schon Spezialisten im Improvisieren geworden seien. Als sie durch Straßenzüge fuhren, deren Häuser stark zerbombt waren, fragte Elisabeth: »Wie geht es den Kindern? Kommen sie mit der neuen Situation klar?« – »Na ja, Tom hat einige Schwierigkeiten. In seiner Klasse sind zwei Jungen aus Amerika und die findet er vollkommen arrogant. Mit dieser stark zerstörten Stadt hier können sie aber inzwischen ganz gut umgehen, weil sie genau wissen, dass ihr eigentliches Zuhause in Oxford ist.«
Leicht amüsiert wollte Elisabeth wissen: »Und wie sieht es mit unseren amerikanischen Mitbewohnern aus? Findet Tom die auch arrogant?« O’Connor, der auf dem Beifahrersitz saß, wusste diese Spitze zu deuten und antwortete: »Ich bin Ire mit amerikanischem Pass.« – »Oh, wie sind Sie denn dazu gekommen?«, fragte Elisabeth erstaunt. »Durch Heirat«, war seine knappe Antwort. »Ist Ihre Frau auch mitgekommen?«, zeigte sich Elisabeth interessiert. Sein Gesicht, das er ihr zugewandt hatte, wirkte verschlossen, als er antwortete: »Nein, für so etwas hätte ich sie niemals begeistern können und jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Unser Scheidungsverfahren läuft.«
Elisabeth war bestürzt über seine Antwort und murmelte etwas unbeholfen: »Das tut mir leid.« Jetzt wirkte sein Blick fast herausfordernd, als er sie fragte: »Und was ist Ihr Grund, dieses Jahr in Deutschland unterzutauchen?« – »Mein Onkel hatte mich gefragt, ob ich ihn bei seiner Arbeit unterstützen wolle, und da habe ich zugesagt«, antwortete sie betont ahnungslos. Er schwieg einen Moment, bevor er feststellte: »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine so junge hübsche Frau wie Sie freiwillig diesen Job hier machen will.« Nun reagierte sie angriffslustig: »Warum nicht? Außerdem frage ich mich, was das Aussehen mit der Arbeit zu tun haben sollte, wenn man nicht gerade Schauspielerin werden will.«
Sie waren inzwischen vor dem Gartengrundstück angekommen, auf dem das mehrgeschossige Haus stand, in dem sie untergebracht waren. Nachdem Prof. Stanley den Wagen angehalten hatte, stieg er aus, um das große schmiedeeiserne Gartentor zu öffnen. Sofort wurde er von einem kläffenden Schäferhund begrüßt, der aber ansonsten friedlich zu sein schien; zumindest schloss Elisabeth dies aus dem Verhalten ihres Onkels. Dann fuhren sie weiter zum Haus, während der Hund neben dem Fahrzeug herlief.
Beeindruckt von dem kräftigen Tier, stieg Elisabeth etwas zögernd aus dem Auto aus. Der Hund mit dem Namen Haras beschnupperte sie sofort sehr intensiv, ließ sie dann aber mit den anderen ins Haus gehen, nachdem sie ihr Gepäck aus dem Fahrzeug ausgeladen hatten. Den ersten Stock des Hauses hatte Prof. Stanley mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern bezogen. Hier sollte nun auch seine Nichte in einem kleinen Zimmer untergebracht werden. Die Familie Stanley war erleichtert, dass Elisabeth heil angekommen war, und zeigte ihr nach der Begrüßung die möblierte Wohnung, die sehr geräumig und geschmackvoll eingerichtet war. Im ausgebauten Dachgeschoss waren die amerikanischen Mitarbeiter untergebracht. Man hatte sich jedoch darauf geeinigt, dass die Mahlzeiten gemeinsam im ersten Stock eingenommen wurden, zumal sich Mrs Stanley bereit erklärt hatte, für die Verpflegung aller Mitarbeiter zu sorgen.
Während des Abendessens lernte Elisabeth die übrigen Mitarbeiter, Mike Baker aus New York und Miss Trailer, die Sekretärin von Mr O’Connor, kennen. Miss Trailer musterte Elisabeth kritisch und hielt sich auch während der anschließenden Gespräche sehr zurück, während Mr Bakers recht lebhafte Art gleich eine angenehme Vertrautheit vermittelte. Er war Psychologe und jüdischer Abstammung. Als ihn Elisabeth fragte, ob er nicht Probleme mit diesem Job habe, räumte er ein: »Die Arbeit macht mich schon ziemlich fertig, aber das spornt mich nur an, besonders gut zu sein.«
Am nächsten Morgen verließen sie wie üblich um acht Uhr gemeinsam das Haus. Sie fuhren zu dem Kasernengelände, in dem die amerikanischen Besatzungskräfte untergebracht waren. Ihre sechs Büroräume lagen in einem abgelegenen Seitenflügel in der unteren Etage und wirkten ausgesprochen ungemütlich. Es gab hier tatsächlich nur das Notwendigste; für jeden Mitarbeiter einen Schreibtisch mit Stuhl, ein paar Aktenschränke, ein schwarzes Telefon und zwei alte Schreibmaschinen.
Die ersten beiden Stunden nahm man sich die Zeit, Elisabeth die geplante Arbeitsweise zu erklären und ihr auch die Funde und Fotos vorzulegen, die inzwischen gemacht worden waren. Während Prof. Stanley und Mr O’Connor sehr sachlich berichteten, war es Mr Baker anzumerken, dass dies für ihn weit mehr war als nur ein Job. Elisabeth hatte ihnen sehr aufmerksam zugehört und die eine oder andere Frage gestellt, wenn sie noch mehr Informationen zu bestimmten Themen haben wollte. Im Übrigen zeigte sie sich wenig emotional berührt. Erst als sie zwischendurch die Toilette aufsuchen und hierfür einen langen Kasernengang passieren musste, der jeden ihrer Schritte mit einem kalten Klang nachhallen ließ, machte sich in ihr ein wachsendes Unbehagen bemerkbar. Die ganze Situation hier kam ihr so gespenstisch und unwirklich vor.
Am Nachmittag fuhren sie zu dem Lager in Hersbruck, welches von amerikanischen Besatzungskräften bewacht wurde. Dieser verlassene Ort war eines der Beweismittel für die Grausamkeiten der letzten Jahre, die sie nun, ein Jahr nach Kriegsende, festhalten und dokumentieren sollten. Sie gingen gerade durch den seit Tagen anhaltenden Regen zu einer langgestreckten Baracke, als Baker mit einer gewissen Verbitterung in seiner Stimme bemerkte: »Sogar der Himmel weint angesichts dieser Verbrechen.«
Während Prof. Stanley und O’Connor fotografierten, untersuchte Elisabeth die Barackenunterkunft auf Hinweise, die ihre ehemaligen Bewohner, eingeritzt in Holz oder Stein, hinterlassen hatten. In einer Ecke bemerkte sie eine Unebenheit im Fußboden. Mit Zustimmung der anderen stemmte sie mit der spitzen Seite einer kurzen Eisenstange einen Ziegelstein hoch, unter dem sich Briefe, eine goldene Kette mit Medaillon, eine Uhr und ein Ehering sowie Aufzeichnungen verbargen.
Beim Sichten des Fundes sagte O’Connor anerkennend: »Ich wusste ja gar nicht, dass Sie so gut zupacken können.« Dieses Lob verfehlte jedoch seine Wirkung. Gereizt fragte Elisabeth: »Warum wohl nicht? Weil ich recht hübsch aussehe?« Mike Baker mischte sich ein, indem er belustigend erklärte: »John hat eben etwas antiquierte Vorstellungen vom weiblichen Geschlecht. Er denkt noch immer, dass die hübschen Frauen heiraten und nur die hässlichen arbeiten müssen.«
Bevor sie wieder zurück zur Kaserne fuhren, wollte Elisabeth noch auf einen der Wachtürme steigen. Während ihr Onkel und Baker sie begleiteten, setzte sich O’Connor schon ins Fahrzeug. Als sie wieder zu ihm zurückkamen, fragte sie ihn provozierend: »Na, haben Sie Höhenangst?« – »Nein, aber ein kaputtes Bein«, war seine knappe Antwort. Sie schwieg betroffen und erinnerte sich daran, dass er vorhin in der Baracke, als sie den Stein ausgehoben und dann die gefundenen Gegenstände untersucht hatten, beim Niederknien etwas ungewöhnlich sein linkes Bein angewinkelt hielt.
Miss Trailer hatte sie in der Kaserne schon ungeduldig erwartet, weil es später als anfangs beabsichtigt geworden war und sie schon der Hunger plagte. Gemeinsam fuhren sie zurück zu ihrer Unterkunft, wo Mrs Stanley schon das gemeinsame Abendessen zubereitet hatte. Ihre Tochter Vivienne versuchte ihre aufkommenden Hungergefühle derweil mit Klavierspielen zu unterdrücken, brach es aber sofort ab, als sie hörte, wie Haras die Ankunft des Wagens ankündigte.
In den nächsten drei Wochen fuhren sie jeden Tag ins Lager. Sie nannten diesen Projektabschnitt Bestandsaufnahme; alles wurde fotografiert, skizziert und die Eindrücke in Berichten festgehalten, welche von Miss Trailer später auf der Schreibmaschine abgetippt wurden. In der Arbeitsgruppe wurde recht wenig über die eigenen Gefühle gesprochen. Erst wenn die amerikanischen Kollegen abends nach oben in ihre eigene Wohnung gegangen waren, unterhielt sich Prof. Stanley mit seiner Ehefrau und seiner Nichte über ihre Empfindungen zu den unfassbaren Funden.
Obwohl Prof. Stanley der dienstälteste Wissenschaftler dieser Arbeitsgruppe war, wurde O’Connor zum Gruppenleiter bestimmt, weil ein Großteil der Projektkosten von den Amerikanern finanziert wurde und man deshalb Wert darauf legte, dass sich dies auch in der Leitungsstruktur widerspiegelte. Über den beruflichen Werdegang von John O’Connor wusste Prof. Stanley nur so viel, dass dieser vor zwei Jahren ein Fachbuch herausgegeben hatte, welches sich mit der Betreuung von Verbrechensopfern befasste. O’Connor hatte darin über seine Forschungsergebnisse berichtet und hierdurch in der Fachwelt allgemein Anerkennung gefunden. Prof. Stanley vermutete, dass diese Arbeit wohl auch ausschlaggebend dafür war, dass O’Connor trotz seines noch recht jungen Alters von gerade 33 Jahren diese Projektaufgabe übertragen wurde. Er selbst schien mit dieser Regelung keine Probleme zu haben, weil er den Eindruck hatte, dass O’Connor sehr souverän das Team leitete und auch immer wieder zum Ausdruck brachte, dass er Wert darauf legen würde, dass jeder sein Wissen einbringt.
Es war nun schon Anfang Oktober und das Wetter wurde deutlich ungemütlicher. Weil das Lager durch den anhaltenden Regen nur noch schlecht begehbar war, machte O’Connor den Vorschlag, in einem Waisenhaus einen überlebenden 15 Jahre alten Jungen aufzusuchen. Während der gemeinsamen Abendmahlzeiten hatte er immer wieder beobachtet, wie liebevoll und unkompliziert Elisabeth mit den Kindern ihres Onkels umgegangen war, und fragte sie deshalb, ob sie die Befragung des Jungen übernehmen wolle.
Gemeinsam fuhr er mit ihr in das Nürnberger Waisenhaus, in dem der Junge untergebracht war. Sie hatten auf der Hinfahrt noch besprochen, wie weit Elisabeth bei ihrer Befragung gehen solle, damit der Junge hierdurch nicht zu stark belastet werden würde. Nachdem sie ihr Eintreffen im Eingangsbereich des Hauses gemeldet hatten, wurden sie zuerst zu der Heimleiterin geführt. O’Connor hatte schon mehrfach mit ihr telefoniert, so dass sie über ihr Vorhaben Bescheid wusste und auch den Jungen von ihrem Kommen in Kenntnis setzen konnte. Man einigte sich darauf, dass Elisabeth in einem kleinen Besucherzimmer allein mit dem Jungen, der Ludwig hieß, reden solle.
Elisabeth war nervös, als sie kurz darauf in dem schmalen, tristen Zimmer auf ihn wartete. Um sich zu sammeln, trat sie an das Fenster und sah auf den Hof, wo einige Kinder Fangen spielten. An der Mauer erblickte sie ein kleines Mädchen, das vielleicht fünf Jahre alt war. Es saß dort zusammengekauert und sein Blick schien ins Leere zu gehen; nur der Oberkörper wippte unaufhörlich und stieß dabei immer wieder mit dem Rücken an die Steine der Mauer.
Die Zimmertür wurde geöffnet und Elisabeth drehte sich um. Ein schlanker Junge mit blassem Gesicht und dunklen Schatten unter den Augen wurde von der Heimleiterin in den Raum geschoben. Elisabeth spürte, wie ihr plötzlich nicht mehr wohl bei ihrem Vorhaben war. Um sich von ihrer inneren Zerrissenheit nichts anmerken zu lassen, ging sie auf den Jungen zu und reichte ihm die Hand. Sein Händedruck war kaum spürbar und es war wohl eher sein Gefühl für Höflichkeit, was ihn dazu gebracht hatte, die ihm entgegengestreckte Hand anzunehmen.
Nachdem die Heimleiterin wieder gegangen war, forderte Elisabeth ihn auf, sich mit ihr an den Tisch zu setzen, der unter dem Fenster stand. Wortlos setzte er sich und blickte auf seine Hände, die verkrampft auf seinen Oberschenkeln lagen und offenbar Mühe hatten, eine ruhige Position einzunehmen. Obwohl sich Elisabeth ein Konzept für dieses Gespräch überlegt hatte, war auch sie für einen kurzen Moment sprachlos. Ihr kam ihre Befragung ein wenig unmenschlich vor angesichts dessen, was dieser Junge erlebt haben musste. Um den Faden wiederzufinden, stellte sie sich kurz vor und erklärte ihm den Grund ihres Besuches. Anschließend vergewisserte sie sich, ob er ihr auch wirklich berichten wolle, was mit ihm und seiner Familie geschehen war.
Ludwig hatte ihr mit ernstem Gesicht zugehört und brauchte etwas Zeit, um ihre Frage beantworten zu können. Dann sagte er fast tonlos: »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann«, worauf Elisabeth behutsam von ihm wissen wollte: »Möchtest du mir denn helfen?« Nach einem kurzen Schweigen nickte er und blickte wieder auf seine schmalen Finger, die sich in unruhigen Bewegungen aneinanderklammerten.
Sie vereinbarten, dass Elisabeth von nun an jede Woche für eine Stunde zu ihm kommen werde und er ihr dann erzählen könne, was ihm wichtig erschien. Sie wollte es bewusst ihm überlassen, was er an Erinnerungen preisgeben wollte, und hielt sich deshalb auch mit Nachfragen sehr zurück. Nach dieser ersten Stunde hatte sie den Eindruck, dass er Vertrauen zu ihr gefasst hatte und wohl auch für sich einen Sinn in dieser Unterhaltung erkennen konnte.
Nachdem sich Elisabeth von dem Jungen verabschiedet hatte, trat sie in den Flur, wo O’Connor auf sie wartete. Gemeinsam mit der Heimleiterin saß er auf einer der kargen Holzbänke und unterhielt sich mit dieser. Elisabeth ging auf sie zu und fragte die Heimleiterin nach dem kleinen Mädchen im Hof, das dort noch immer an der Mauer kauerte, obwohl die niedrigen Außentemperaturen es frieren lassen mussten. Sie erfuhr, dass dieses Mädchen mit dem Namen Sofie auch aus dem Lager stammte und damals mit ansehen musste, wie ihr kleiner, zwei Jahre alter Bruder beim Transport von den Menschenmassen erdrückt worden war. Die Eltern von Sofie hätten das Lager nicht überlebt.
Elisabeth spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam. Bestürzt erkundigte sie sich: »Was passiert nun mit dem Kind? Hat sie noch andere Verwandte?« Ihre Fragen wurden von der Heimleiterin mit einer fast unwirklichen Routine beantwortet: »Verwandte haben alle diese Kinder nicht mehr. Unsere Heime sind voll, auch von richtigen Waisen; ich meine von deutschen Kindern. Essen und ein Bett sind jetzt das Wichtigste, was die brauchen.« – »Na, dann ist es ja gut«, hörte sich Elisabeth etwas hilflos sagen, obwohl sie selbst nicht daran glaubte, und ergänzte noch: »Vielleicht kann ja Sofie auch noch etwas wärmer angezogen werden, wenn sie schon die meiste Zeit da draußen im Hof verbringt.«
Im Fahrzeug fragte O’Connor in ihre Sprachlosigkeit hinein: »Ist es wirklich das, was Sie sich hier in Deutschland antun wollen?« – »Was soll ich denn hier sonst Sinnvolles machen?« – »Elisabeth, was treibt Sie in dieses verbrannte Land?« Sie holte tief Luft und bat ihn dann, in der nächsten Straße anzuhalten. Dann sagte sie: »Sie haben Recht, es muss einen schon etwas dazu treiben, diesen Job zu tun. Es ist tatsächlich mehr als Kriminalistik. Das ist kollektiver Wahnsinn auf höchstem Niveau und der ist noch längst nicht vorbei, weil er in einigen Köpfen weiterleben wird, schon als Rechtfertigung für das eigene Handeln.«
Er schwieg und sah sie einfach nur an, als Aufforderung zum Weitersprechen. Ihre Stimme wurde leiser und sie sah durch die Windschutzscheibe ins Leere, als sie fortfuhr: »Mein Onkel hat mich im richtigen Moment gefragt. Mein ehemaliger Verlobter war als Krüppel aus Frankreich zurückgekehrt; wir hatten uns aber schon eine Zeit lang vorher getrennt. Nicht wegen seiner Behinderung, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab, sondern weil ihm der Krieg wichtiger wurde als das gemeinsame Leben. Die Behinderung hat unsere Trennung nur noch hinausgezögert und meine Schuldgefühle ihm gegenüber verstärkt.« Diesmal war er es, den dieses Gespräch betroffen gemacht hatte. Nach einem Moment des Schweigens schlug er vor, zum nahe gelegenen Waldstück zu fahren, um dort spazieren zu gehen und miteinander zu reden. Sie zögerte erst einen Moment, weil sie befürchtete, dass sich ihr Onkel Sorgen machen könnte, wenn sie zu lange fortbleiben würden, aber stimmte schließlich zu, nachdem sie ihn zuvor von einer Gaststätte aus angerufen hatten.
Sie nahmen sich für dieses Gespräch über eine Stunde Zeit, um sich gegenseitig ihre Beweggründe für diesen Einsatz zu erklären, und bemerkten, dass ihnen hierbei manche Zusammenhänge erst selbst richtig bewusst wurden. John O’Connor erzählte ihr, dass er als Kind hinten im Fahrzeug seiner Eltern gesessen hatte, als es von einer Handgranate der Religionsfanatiker getroffen wurde. Seine Mutter starb bei diesem Anschlag und sein Vater, der am Steuer saß, verlor beide Beine. Er selbst hatte schwere Verletzungen davongetragen, aufgrund dessen sein linkes Knie nur noch eingeschränkt beweglich war. Sein Vater, der den Verlust seiner Ehefrau und seine eigene Behinderung nie wirklich verarbeitet hatte, erkrankte fünf Jahre danach unheilbar an Krebs. Nach dessen Tod hatte er dann alles in Irland hinter sich gelassen und war nach Amerika gegangen.
Durch die Heirat der Schwester eines befreundeten Kollegen schien es auch für ihn so auszusehen, als könnte Amerika seine neue Heimat werden. Nach drei Jahren Ehe wurde ihm allerdings bewusst, dass seine Ehefrau niemals bereit sein würde, eine Beziehung so zu führen, wie er es sich vorstellen könnte. Am Anfang gab es noch einen gemeinsamen Kinderwunsch, dann aber stellte sich heraus, dass nach zwei Fehlgeburten seine Ehefrau ganz andere Pläne hatte. Sie wollte wieder unabhängig sein und ihr Leben selbst gestalten. Trotz dieser Erkenntnis habe er nach Lösungen gesucht, doch noch ein akzeptables gemeinsames Leben hinzubekommen. Das sei aber letztendlich daran gescheitert, dass seine Ehefrau eine neue Beziehung begonnen habe. Die Ehescheidung sei nun nur noch eine Formalität, um die sich derzeit die Anwälte bemühen würden.
O’Connor fühlte sich seitdem staatenlos. In Irland hatte er seine Eltern verloren und in Amerika war es ihm nicht gelungen, eine Familie zu gründen. Das Angebot zu diesem Job passte deshalb nicht nur zu seinen beruflichen Interessen als Kriminologe, sondern auch in seine derzeitige Lebenssituation.
Elisabeth erzählte ihm daraufhin, dass sie ihren ehemaligen Verlobten Phil immer nach dem Abschluss ihres Studiums heiraten wollte, dann aber der Krieg diese Pläne zerstört habe. Phil habe sich nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich einer Organisation angeschlossen, die den Widerstand in Frank reich unterstützte. Sein Einsatz hierfür sei immer riskanter und engagierter geworden und ihre Beziehung habe schließlich keinen Raum mehr gehabt, zumal ihr Phils geheime Einsätze auch keine Chance gegeben hätten, überhaupt noch Zugang zu ihm und seiner Tätigkeit zu finden. In den letzten zwei Jahren habe es immer wieder Grundsatzdebatten darüber gegeben, inwieweit man bereit sein muss, zur Rettung anderer sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, und welche Mittel hierfür akzeptabel seien. In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass Phil in seiner Arbeit immer radikaler wurde. Vor einem Jahr hatte sie ihm die Entscheidung zwischen der Beziehung zu ihr und seiner Widerstandsarbeit abverlangt, wo er sich dann gegen die Beziehung entschieden hatte. Zwei Monate später sei er dann schwer verletzt nach England zurückgebracht worden und habe dort ein halbes Jahr im Krankenhaus gelegen. Auf Bitten seiner Mutter habe sie sich um ihn gekümmert, obwohl sie genau wusste, dass ihre Liebe längst vorbei war. Auch wenn sie ihm während dieser Zeit nie die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft gemacht habe, klammerte er sich in seiner Hilflosigkeit an sie und verschlimmerte hierdurch ihre Schuldgefühle. Erst die tagelangen Gespräche mit ihrem Vater, der als Pfarrer tätig sei, brachten sie schließlich dazu, wieder ein eigenes Leben zu leben.
O’Connor, der ihr aufmerksam zugehört hatte, fragte nach: »Hat Phil Ihre Entscheidung akzeptiert?« – »Dass wir kein Paar mehr sind, musste er schon deshalb akzeptieren, weil er es damals war, der unsere Beziehung beendet hatte, und dann ist nach der Trennung auch noch etwas mit einer Widerstandskämpferin gelaufen, bevor er verletzt wurde. Weniger akzeptieren kann er aber, dass ich nun meinen eigenen Weg gehen will. Ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn wir diesen Job gemeinsam gemacht hätten. Er glaubte, so die Nazis für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen zu können.« – »Und was wollen Sie nun erreichen?«, hakte er nach. »Ich möchte, dass die Opfer ihre Würde zurückbekommen. Nicht mehr nur in Form von anonymen Opferzahlen, die im Zusammenhang von Folter, Vertreibungen und Massenvernichtungen genannt werden, sondern dass auch ihre Einzelschicksale bekannt werden.«
In der Kaserne hatten die anderen das längere Warten auf die Rückkehr von O’Connor und Elisabeth recht unterschiedlich genutzt. Prof. Stanley gelang es, von dem Betreiber des Kasernenkasinos einen alten Billardtisch zu erstehen, und Mike Baker konnte abklären, wann seine Ehefrau mit seiner kleinen Tochter Sally in Deutschland eintreffen würde. Insgesamt war die Stimmung so optimistisch und gelöst, dass Elisabeth einen Moment brauchte, um sich nach dem sehr ernsten Gespräch mit O’Connor wieder auf diese schönen Dinge des Lebens einstellen zu können.
II. Der Familiennachzug
Beim gemeinsamen Abendessen wurde besprochen, wo Mrs Baker mit dem kleinen Mädchen untergebracht werden könne. O’Connor, der als Einziger im Dachgeschoss zwei Zimmer mit Verbindungstür bewohnte, machte den Vorschlag, in das bisherige Einzelzimmer von Mike Baker umzuziehen, damit dieser mit seiner Familie seine jetzigen Räume beziehen könne. Probleme gab es nur mit der Unterbringung der Arbeitsmaterialien, die er teilweise in seinen Zimmern aufbewahrte. Prof. Stanley bot ihm deshalb an, sein Arbeitszimmer im ersten Stock gemeinsam mit ihm zu nutzen. O’Connor nahm dieses Angebot sofort an, zumal er schon einige Abende zusammen mit Prof. Stanley in dessen Arbeitszimmer verbracht hatte, an denen sie entweder zusammen Schach gespielt oder sich bei einem Glas schottischen Whisky angeregt unterhalten hatten. Überhaupt verstanden sich die drei männlichen Wissenschaftler ausgesprochen gut und überlegten nun gemeinsam, wo die erworbene Billardplatte untergebracht werden könne.
Gut gelaunt schlug Baker die Ecke neben dem Kamin im Salon vor, worauf Mrs Stanley sofort protestierte, weil sie um die Nachtruhe ihrer Kinder fürchtete. So einigte man sich schließlich auf das Arbeitszimmer, wobei die Männer schmunzelnd verkündeten, dass sie dort ihren Herrensalon einrichten wollten. Elisabeth, die das Arbeitsklima insgesamt als angenehm empfand, fühlte sich in solchen Momenten von dem Männerbündnis ausgeschlossen. Etwas beleidigt schlug sie deshalb vor: »Vielleicht sollten wir doch einen anderen Platz für den Billardtisch finden, weil ich auch gerne einmal mitspielen würde.« O’Connor blickte sie amüsiert an, bevor er stichelte: »Oh, ich vergaß, dass Sie mir gerade beibringen wollen, was Frauen noch so alles können neben den eher klassischen Dingen.« Baker, der wegen der bevorstehenden Ankunft seiner Familie in auffällig euphorischer Stimmung war, machte gönnerhaft den Vorschlag: »Wir können ja auch unseren Männerbund an einem Abend in der Woche für das weibliche Geschlecht öffnen.«
Mrs Baker und ihre kleine Tochter kamen am Ende der Woche in Nürnberg an. Sie waren müde von der langen Reise und deshalb froh, dass sie sich gleich in ihre beiden Räume zurückziehen konnten. Miss Trailer reagierte sehr ambivalent auf die Neuankömmlinge. So gab sie beim gemeinsamen Abendessen zu bedenken, dass sie Schwierigkeiten mit ihrem amerikanischen Vorgesetzten Mr Harris bekommen könnten, wenn bekannt werden würde, dass nun auch die Familienangehörigen angereist seien, was Prof. Stanley überhaupt nicht verstand, weil dies für ihn doch gerade die Bedingung für die Annahme dieses Jobs gewesen war. Als weitere Bedenken äußerte Miss Trailer, dass Haras der Kleinen etwas antun könnte. O’Connor schien seine Mitarbeiterin sehr gut zu kennen und sagte deshalb mit einer überzeugenden Gelassenheit: »Miss Trailer, wenn wir alle auf die Kleine gut aufpassen, wird Haras ihr schon nichts tun.«
Die kleine einjährige Sally lebte sich sehr gut ein und wurde von fast allen ziemlich verwöhnt. Sogar Tom und Vivienne fanden Gefallen an dem kleinen Mädchen und beschäftigten sich häufig mit ihr. Wenig Begeisterung herrschte dagegen bei der Familie Schumacher, den Vermietern der beiden Wohnungen, die im Untergeschoss des Hauses lebten. Frau Schumacher hatte bislang im Dachgeschoss die Zimmer gereinigt und sich so noch etwas Geld dazuverdient. Dies wollte nun aber Mrs Baker übernehmen, was den anderen auch nur recht war, zumal schon mehrfach der Verdacht bestand, dass Frau Schumacher in deren Sachen herumgestöbert hätte. Diese versuchte ihrem Unmut dadurch Ausdruck zu verschaffen, dass sie plötzlich jedes längere Schreien der kleinen Sally als Lärmbelästigung beanstandete und auch das Klavierspiel von Vivienne und Elisabeth plötzlich als störend empfand. In der Hoffnung, dass sich diese Verstimmung mit der Zeit wieder legen würde, versuchte man weitere Konflikte zu vermeiden und verhielt sich ausgesprochen ruhig, zumal an den Wochentagen die Hälfte der Mieter ihrer Projektbearbeitung in der Kaserne nachging und auch erst gegen Abend wieder vor Ort war.
Während die übrigen Mitarbeiter der Arbeitsgruppe ihre Daten aus der Bestandsaufnahme der letzten Wochen ordneten und falls möglich auch schon auswerteten, konzentrierte sich Elisabeth auf Opferbefragungen und erhielt hierfür auch viel Unterstützung von ihren Kollegen Baker und O’Connor. Ihre wöchentlichen Besuche im Kinderheim nutzte Elisabeth aber auch, um Ludwig immer eine Extraportion Essen zukommen zu lassen. O’Connor nannte dies amüsiert »Bestechungsproviant«, hatte aber ansonsten hiergegen keine Einwände. Er war derzeit damit beschäftigt, zu erfassen, wie viele Kinder in den umliegenden Heimen aus den Konzentrationslagern stammten. Nachdem ihm Elisabeth erzählt hatte, dass ihre Eltern in den letzten Jahren einige der nach England verbrachten jüdischen Kinder erfolgreich in zuverlässige Familien vermitteln konnten und sehr viele dieser Familien auch bereit waren, diese Kinder bei sich zu behalten, seit bekannt wurde, dass es für viele von ihnen kein Zurück mehr gab, erkundigte er sich bei den Behörden, ob noch weitere Waisen außer Landes gebracht werden könnten.
In der Arbeitsgruppe hatte man an mehreren Abenden darüber diskutiert, welche Zukunft diese Kinder in einem Land haben würden, in dem sie erst als angesehene Bürger mit ihren Familien leben durften und dann plötzlich als Abschaum der Gesellschaft behandelt wurden, der ausgerottet werden sollte. Konnten diese Kinder und auch all die anderen ehemaligen KZ-Häftlinge mit ihren Erlebnissen überhaupt noch Vertrauen zu den Menschen fassen, die sie gestern noch vergasen wollten?
Ludwig schien sich über die Besuche von Elisabeth inzwischen zu freuen, und zwar nicht nur weil er von ihr Essen bekam, sondern weil es jemanden gab, der die Verbrechen an seiner Familie ernst nahm, anstatt so zu tun, als habe er einen Schicksalsschlag erlitten oder als sei er nur ein Fall von vielen anderen. Er erzählte sehr viel von der Zeit, als seine Welt noch in Ordnung schien, und Elisabeth konnte aus seinen Worten erahnen, wie wichtig ihm seine Familie war. Für das, was dann mit ihm geschah, fand er oft gar keine Worte. Er wirkte angespannt, wenn er von seinen Erlebnissen im Lager erzählte, aber für die Gefühle von Trauer und Wut schien er im Moment gar keine Kraft mehr zu haben. Nach diesen Treffen war Elisabeth immer sehr schweigsam und in sich gekehrt, so dass O’Connor den Vorschlag machte, dass sie mit Baker über ihre eigenen Empfindungen hierzu einmal sprechen solle. Sie tat es auch ein einziges Mal, merkte dann aber schnell, dass ihr eine völlige Versachlichung dieses Themas nicht weiterhalf, weil ihr ihre eigene Betroffenheit weitaus normaler vorkam. Elisabeth war nun schon sechs Wochen in diesem Land und konnte, sosehr sie sich auch darum bemühte, zu verstehen, was hier alles geschehen war, immer weniger begreifen, wie all diese Grausamkeiten in diesem Ausmaß überhaupt möglich waren. Ihr Vater hatte sie den christlichen Glauben gelehrt, der feste Regeln des Zusammenlebens vorgab. Warum hatten diese Regeln nicht gereicht, um dies alles zu verhindern?
Es war schon Ende Oktober, als O’Connor einen Anruf von seinem Anwalt bekam. Das Gespräch dauerte nur ein paar Minuten. Danach kam er zu den anderen in den Besprechungsraum und sagte erleichtert: »Die Scheidung ist durch.« Baker erkundigte sich gleich: »Und? Musst du ihr jetzt noch Unterhalt zahlen?« – »Nein, darum hat sie sich aber selbst gebracht. Sie hätte eben nicht so früh etwas Neues beginnen dürfen.« Miss Trailer reagierte auf diese Nachricht übertrieben erfreut und sagte auf ihre manchmal auffällig gluckenhafte Art: »Na, dann können Sie ja wieder ruhig schlafen. Diese Frau hat auch kein anderes Urteil verdient.«
Als sie an diesem Nachmittag zurück zur Unterkunft kamen, begrüßte sie Haras nicht wie gewohnt. Sie hörten zwar sein Kläffen, aber er war im Haus und sein Bellen ging fast unter in dem lautstarken Geschrei eines Mannes und dem Weinen einer Frau. Sie alle wussten, dass Herr Schumacher häufig aggressiv war. Manchmal schlug er mit seiner Krücke nach Haras und schrie auch schon bei geringen Anlässen seine Ehefrau und seinen 14 Jahre alten Sohn Franz an. Frau Schumacher entschuldigte dies manchmal damit, dass er früher ganz anders gewesen sei und ihn der Krieg so gemacht habe.
Beunruhigt über die Situation, stiegen sie aus dem Fahrzeug aus und wollten gerade zum Haus gehen, als sich das Schreien von Herrn Schumacher noch verstärkte und krachende Geräusche zu hören waren. Frau Schumacher schrie panisch, worauf Prof. Stanley energisch im Treppenhaus an die Wohnungstür der Schumachers klopfte. Es wurde ihm erst nach dreimaligem Klopfen geöffnet. Herr Schumacher stand mit rotfleckigem Gesicht auf seine Krücken gestützt im Türrahmen und fragte barsch: »Was gibt’s?«, worauf sich Prof. Stanley in einem ruhigen Ton erkundigte: »Kann ich etwas für Sie tun? Für mich hörte es sich eben so an, als gäbe es Probleme.«
Herr Schumacher stierte ihn einen Moment ungläubig an, bevor er höhnte: »Ein Problem? Ich habe eine blöde Frau. Ist das ein Problem?« Prof. Stanley bemerkte sofort, dass Herr Schumacher nicht mehr ganz nüchtern war, und schlug deshalb vor: »Egal, wie Ihre Ehefrau ist, vielleicht kann man ja morgen in Ruhe über alles reden und findet dann auch eine Lösung für Ihren Streit.« Herr Schumacher beurteilte die Situation aber ganz anders: »Das Einzige, was hier was bringt, ist eine Tracht Prügel, und die hat sie gerade gehabt.« Die anderen hielten sich im Treppenhaus etwas im Hintergrund, weil sie die Situation nicht noch weiter verschärfen wollten. Nach einem kurzen Moment des Schweigens sagte Prof. Stanley: »Mit Schlägen löst man nicht wirklich Probleme. Reden Sie einfach morgen noch einmal mit Ihrer Frau.« Der Alkohol schien Herrn Schumacher noch wackeliger auf den Beinen zu halten, als es sonst schon seine Behinderung tat. Er schwankte leicht und stieß gegen den Türrahmen. Um nicht zu fallen, klammerte er sich an dem Holz fest. Dann sagte er mit schwerer Zunge: »Komm geh, hau ab! Ich brauche deine blöden Ratschläge nicht.«
Prof. Stanley drehte sich zu den anderen um und deutete mit einer Kopfbewegung an, dass sie alle nach oben gehen sollten. Als sie im ersten Stock ankamen, merkten sie an den Gesichtern der Frauen und Kinder, dass die Brutalität von Herrn Schumacher ihnen Angst gemacht hatte. An diesem Abend diskutierte man noch lange darüber, ob und was man gegen die Gewalttätigkeiten dieses Mannes tun könnte, kam dann aber nur zu dem Schluss, der Stelle für Wohnraumvermittlung mitteilen zu wollen, dass durch seine aggressive Art dessen Mieter verängstigt und auch beleidigt werden würden. Da die Familie Schumacher wegen der allgemein herrschenden Wohnungsknappheit die beiden oberen Etagen ihres Wohnhauses vermieten mussten, erhoffte man sich hierdurch, dass Herr Schumacher so einsehen würde, dass seine Art nicht einfach stillschweigend von ihnen erduldet wird.
Am nächsten Tag, es war der erste Donnerstag im November, hörten Mike Baker und O’Connor auf dem Dachboden plötzlich ein lautes Poltern. Sie wollten diesem Geräusch nachgehen und stellten hierbei fest, dass die Bodentür nur angelehnt war. Im Inneren des Dachbodens hörten sie, wie zwei Personen sich etwas zuflüsterten. Vorsichtig schoben sie die Tür auf und sahen, wie Franz und ein anderer Junge in seinem Alter sich an der Wäsche zu schaffen machten, die dort zum Trocknen auf der Leine hing. Da O’Connor wusste, dass dieser Trockenplatz der ersten Etage des Hauses zugewiesen war, fragte er: »Was macht ihr denn da?« Franz und der andere Junge zuckten erschrocken zusammen und drehten sich zu ihm um. Schnell versuchte Franz etwas hinter seinem Rücken zu verstecken und stotterte: »Wir wollten nur mal nach den Tauben sehen.« – »Nach was für Tauben?« Franz stotterte weiter: »Die hier immer brüten.« O’Connor trat auf ihn zu und sagte: »Franz, wir haben jetzt November, da brüten keine Tauben. Komm, zeig mir mal, was du hinter deinem Rücken versteckst.« Mit hochrotem Kopf übergab ihm Franz einen BH mit Spitzenbesatz und zwei dazu passende Unterhosen.
O’Connor musste sich sein Schmunzeln verkneifen, als er feststellte: »Das sieht mir aber gar nicht nach Taubeneiern aus, was du da in der Hand hältst.« Er nahm Franz die Wäschestücke ab, dem die Tränen in die Augen schossen. Verzweifelt bettelte dieser: »Bitte sagen Sie nichts meinen Eltern, sonst kriege ich wieder den Riemen.« – »Okay, ich sage ihnen nichts. Aber du versprichst mir, dass du so etwas nicht wieder machst und auch ganz doll aufpasst, dass meinen Leuten hier nichts passiert. Okay?« Franz versprach es ihm und huschte mit dem anderen Jungen an ihm vorbei.
O’Connor steckte die Unterwäsche in seine Jackentasche und ging dann in den ersten Stock. Dort fragte er nach Elisabeth, die gerade im Bad war. Diese war erstaunt, dass er sie allein sprechen wollte, und bat ihn in ihr Zimmer. Dort reichte er ihr die Wäschestücke, die sie nicht sofort in seiner Hand als ihre eigenen erkannte. Nachdem ihr aber bewusst wurde, was er ihr gerade überreicht hatte, wollte sie empört von ihm wissen: »Was machen Sie denn mit meiner Unterwäsche?« – »Franz und sein Freund hatten sie sich von der Leine geholt. Sie sollten diese kleinen Kostbarkeiten vielleicht zukünftig lieber in der Wohnung trocknen. In diesem Land hat man derartige Dinge sicher schon lange nicht mehr gesehen.«
Elisabeth legte die Wäscheteile auf ihre Kommode und bat ihn, in dem einzigen Sessel, der sich in ihrem Zimmer befand, Platz zu nehmen. Sie selbst setzte sich auf die Kante ihres Bettes, bevor sie ihm anvertraute: »Ich bekomme immer häufiger Probleme mit unserer Situation. Gestern waren wir noch die Feinde dieser Menschen und heute leben wir unter ihnen, und zwar nicht schlecht. Wir haben die besseren Wohnungen, das bessere Essen, während diese Menschen im Alltag um alles kämpfen müssen.« O’Connor sah sie besorgt an, als er feststellte: »Ich habe langsam Angst um Sie. Dieser Job allein ist schon schlimm genug, aber es gibt hierzu keinen wirklichen Ausgleich. Es war wahrscheinlich auch zu früh, nach der Sache mit Phil in so ein Projekt einzusteigen.« – »Meinen Sie, ich würde das alles nicht gut hinbekommen und sollte lieber aussteigen?« – »Ich fände es sehr schade, wenn Sie aussteigen würden, aber ich könnte es auch verstehen, wenn Sie es täten.«
Elisabeth schwieg einen Moment, bevor sie ihn fragte: »Stecken Sie das alles so einfach weg? Träumen Sie nie davon, was Sie hier tagsüber sehen?« – »Am Anfang habe ich mir noch sehr viel mehr Gedanken gemacht. Ich wollte alles begreifen, was ich hier aufgespürt habe. Heute will ich nur noch mit meinen Mitarbeitern dieses Jahr heil überstehen. Dieses Ziel ist mir schon deutlich wichtiger geworden als ein gutes Projektergebnis.«
Seine Antwort erstaunte sie: »Glauben Sie, dass wir noch mehr Schwierigkeiten bekommen werden, als wir so schon haben?« – »Ich weiß es nicht. Ein Offizier hat mir kürzlich davon berichtet, was für Chancen seine Leute bei der weiblichen Bevölkerung haben, ja, dass sogar die Dunkelhäutigen keine Probleme hätten, eine deutsche Frau ins Bett zu bekommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Volk, was einmal Weltmacht sein wollte, nun bereit ist, sich seinen Besatzern selbstverständlich zu unterwerfen.«
An dem kommenden Wochenende waren die Stanleys mit ihren Kindern für zwei Tage mit dem Zug nach Erlangen gefahren, weil dort die Zerstörungen der Stadt durch die Bombardierungen im letzten Kriegsjahr nur relativ gering ausgefallen waren. Sie wollten Tom und Vivienne einmal zeigen, wie schön diese historischen Städte vor dem Krieg einmal ausgesehen haben, was man in Nürnberg in manchen Vierteln nur noch erahnen konnte. Anfangs wollten sie auch ihre Nichte mitnehmen, sahen dann aber ein, dass man ihr einen größeren Gefallen damit tat, sie einfach einmal diese Tage allein zu lassen. Insgesamt zeigte sich im Laufe der Zeit, dass das enge Zusammenleben auch sehr viel Stress erzeugte und kaum noch Privatheit zuließ.
Elisabeth hatte sich schon auf ein gemütliches Wochenende mit einem guten Buch eingestellt, als O’Connor am Samstagmittag mit der weinenden Sally auf dem Arm an ihrer Wohnungstür klingelte. Entschuldigend sagte er: »Sorry, dass ich störe, aber Mike ist mit seiner Frau für zwei Stunden in die Stadt gegangen und ich kriege die Kleine nicht zum Schlafen. Könnten Sie es einmal versuchen?« Elisabeth nahm Sally auf den Arm und zu dritt gingen sie nach oben. Dort gab sie der Kleinen das Fläschchen und legte sich mit ihr auf die Matratze in der Ecke des Schlafzimmers, wo das Mädchen einen Spiel- und Schlafplatz erhalten hatte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis das bereits übermüdete Kind endlich eingeschlafen war.
O’Connor hatte sich im zweiten Zimmer der Bakers aufgehalten und wirkte richtig erleichtert, als sie ihm berichtete, dass Sally nun schlafen würde. Fast resigniert stellte er fest: »Die Kleine ist ja sonst sehr lieb, aber wenn die ihren Dickkopf bekommt, bin ich manchmal ganz schön ratlos.« Elisabeth musste schmunzeln und wollte gerade wieder nach unten gehen, als er sie fragte: »Haben Sie Lust, mit mir heute Abend ins Casino der Kaserne zu gehen? Es soll dort ein Film vorgeführt werden.« Sie zögerte einen Moment, sagte dann aber doch zu.
Um halb acht fuhren sie gemeinsam zur Kaserne. Das Casino war schon gut besucht und die Gäste in bester Feierlaune. Wie sie sofort feststellen konnten, gab es keinen Mangel an Frauen, sehr zur Freude der Soldaten. Elisabeth fühlte sich unwohl, weil sie gleich von vielen Männern interessiert gemustert wurde und nicht in die Kategorie »Soldatenliebchen« eingestuft werden wollte. O’Connor stellte seine Begleiterin Offizier Cooper vor, von dem sie zwar schon gehört, aber noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, ihn persönlich kennen zu lernen. Offizier Cooper war Ende 40 und wirkte wie ein Mann, für den seine Militärlaufbahn sein Lebensinhalt zu sein schien. Auch bereitete ihm das Kasernenleben keine größeren Probleme, weil ihm Kameradschaft wichtiger war als bürgerliche Privatheit.
Offizier Cooper zeigte sich erfreut, die Bekanntschaft von Elisabeth machen zu können, indem er zu O’Connor sagte: »Na, das ist ja schön, Sie einmal in unserer Mitte anzutreffen und dann auch noch in so einer hübschen Begleitung.« Mit einem breiten Lächeln wandte er sich an Elisabeth: »Mr O’Connor hatte ja schon einige Einladungen von mir erhalten, aber ihm geht das hier wohl zu munter zu.« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er mit Blick auf die weiblichen Gäste fort: »Ja, die deutschen Frauen sind wirklich willig. Die machen fast alles für ein paar Süßigkeiten oder ein paar Damenstrümpfe. Na ja, es gibt hier ja auch nur noch recht wenige Männer im besten Mannesalter und davon sind einige für sowas auch zu kaputt.«
Elisabeth verspürte ein deutliches Unbehagen und sah etwas unbeholfen zu O’Connor, der mit einer leichten Ironie in der Stimme entgegnete: »Es ist eigentlich so wie immer nach einem Krieg. Die Sieger teilen sich das Land auf und nehmen sich die Frauen der Besiegten.« Cooper amüsierte dies, er wollte aber dennoch richtigstellen, dass sich diese Frauen hier freiwillig anbieten würden.
O’Connor, der selbst das Gefühl hatte, dass derartige Gespräche nicht unbedingt seinem Niveau entsprachen, führte seine Begleiterin schon in den abgedunkelten Filmvorführraum, in dem die letzten Vorbereitungen getroffen wurden. Beide waren froh, als es endlich begann. Der Inhalt des Films traf genau den Geschmack der Soldaten und ihrer Begleiterinnen. Mutige Cowboys kämpften gegen die Indianer und gewannen für ihren Mut die Herzen der Saloondamen. Viele Kampfszenen wurden von den Zuschauern begeistert bejubelt und es gab reichlich Alkohol, der teilweise gleich aus Flaschen getrunken wurde.
Als der Film zu Ende war, bemerkte O’Connor sofort, dass es nicht im Sinne seiner Begleiterin war, noch weiter im Casino zu bleiben. Auf der Rückfahrt gab er zu: »Ich habe selbst nicht gewusst, wie so etwas abläuft. Ich hatte nur die Ankündigung der Filmvorführung gestern am Aushang gesehen und gedacht, dass wir einmal rauskommen sollten, damit wir in unserer Behausung keinen Lagerkoller bekommen.« – »Es war ja auch eine gute Idee, aber eben nur die falschen Zuschauer und der falsche Film.« Er zögerte einen Moment, bevor er vorschlug: »Hätten Sie denn nicht Lust, nächstes Wochenende auch nach Erlangen zu fahren?« – »Mit der ganzen Gruppe?«, wollte sie erstaunt wissen. »Nein, nur wir beide.«
Elisabeth schwieg einen Moment und sagte dann zweifelnd: »Ich glaube, dass die gute Stimmung dann in der Gruppe kippen wird.« – »Meinen Sie die Stimmung von Miss Trailer oder welche sonst?« – »Sie ist immerhin Ihre fürsorgliche Sekretärin.« Er seufzte: »Ja, manchmal leider etwas zu fürsorglich. Aber vielleicht wäre dies eine gute Gelegenheit, ihr zu zeigen, dass sie nicht die zweite Mrs O’Connor werden wird.« Elisabeth wollte sich noch nicht entscheiden und bat ihn deshalb: »Ich brauche einfach einmal ein bisschen Zeit für mich und sage Ihnen dann am Montag, ob ich nach Erlangen mitfahren möchte.« Obwohl er enttäuscht von ihrer Reaktion war, respektierte er ihren Wunsch nach Bedenkzeit.
Am Montag suchte Miss Trailer unter dem Vorwand, den letzten Bericht über den Besuch im Kinderheim noch einmal abstimmen zu wollen, das Gespräch mit Elisabeth. Sie war zu ihr ins Büro gekommen und kam nach dem dienstlichen Teil auf ihre Migräne vom Wochenende zu sprechen: »Es tut mir leid, wenn Ihnen der Western am Samstagabend nicht so gut gefallen hat, aber ich hatte wieder meine Migräne und konnte deshalb Mr O’Connor leider nicht begleiten, so dass er Sie fragen musste.« Elisabeth reagierte gereizt: »Ihre Migräne war sicherlich auch der Grund, warum Mr O’Connor mich bat, Sally ins Bett zu bringen?« Die Augen von Miss Trailer blickten angriffslustig, als sie erwiderte: »Kinder sind mir nicht völlig unbekannt, falls Sie dies meinen sollten. Schließlich hätte ich selbst einmal fast eines bekommen.«
Elisabeth war erstaunt: »Hatten Sie eine Fehlgeburt?« – »Nein, ich musste es wegmachen lassen«, antwortete Miss Trailer schroff. Elisabeth war zu höflich, um noch weiter nachzufragen, und sagte deshalb nur: »Das tut mir leid. Hoffentlich klappt es dann beim nächsten Mal.« Irritiert starrte Miss Trailer sie an und versuchte dann klarzustellen: »Es ist nicht so, wie Sie denken. Mein damaliger Freund hatte mich verlassen und allein wollte ich das Kind dann nicht.«
Abgeneigt, noch weiter über diese Angelegenheit zu sprechen, sagte Elisabeth: »Hier in Deutschland müssen derzeit auch viele Kinder ohne ihre Väter aufwachsen. Vielleicht hätten Sie es einfach mal versuchen sollen, anstatt ein Kind nur als nettes Beiwerk einer Beziehung zu betrachten.« Miss Trailer fühlte sich durch ihre Worte angegriffen und fragte aggressiv: »Und wenn ich es nicht geschafft hätte? Wäre es verantwortungsvoller gewesen, einem Kind ein derartiges Leben zuzumuten?« – »Dann hätten Sie immer noch Eltern für das Kind suchen können«, antwortete Elisabeth und verließ den Raum.
Sie spürte, dass O’Connor auf eine Reaktion von ihr wartete. Er hatte sie extra mit zum Kinderheim begleitet, um ihr die Gelegenheit zu geben, mit ihm unter vier Augen sprechen zu können. Als sie sich auch auf der Rückfahrt nicht zur Fahrt nach Erlangen äußerte, hielt er kurz vor der Kaserne den Wagen in einer Seitenstraße an und fragte sie: »Bin ich Ihrer Meinung nach am Wochenende etwas zu weit gegangen?« – »Nein, aber ich bin noch nicht so weit, und ich will auch nicht zur Zielscheibe Ihrer Sekretärin werden, nur weil sie offensichtlich einige unerfüllte Wünsche hat.«
Sie erzählte vom Gespräch mit Miss Trailer und fügte anschließend hinzu: »Ich habe Probleme damit, dass hier Privates mit Beruflichem so stark vermischt wird.« – »Haben Sie auch ein Problem damit, dass ich Ihr Vorgesetzter bin?« Nach einem kurzen Moment des Nachdenkens schüttelte sie den Kopf und sagte: »Ehrlich gesagt, habe ich Sie noch nie als Vorgesetzten empfunden. Für mich sind wir alle ein Team.« Ihre Worte schienen ihm zu gefallen: »Das hört sich gut an. Genau so wollte ich es auch haben.«
Die Woche über zeigte sich Miss Trailer Elisabeth gegenüber sehr reserviert, was auch damit zusammenhing, dass O’Connor mit ihr fast nur noch dienstliche Dinge besprach. An den Abenden war er häufig unten bei den Stanleys und hatte so auch die Gelegenheit, außerhalb der Arbeit Zeit mit Elisabeth zu verbringen. Als sie am Freitagabend gemeinsam mit Prof. Stanley Billard spielten, fragte sie ihn, als ihr Onkel gerade kurz den Raum verlassen hatte: »Hätten Sie Lust, nächstes Wochenende mit mir nach Erlangen zu fahren?« – Er sah sie erstaunt an und wollte dann von ihr wissen: »Passt jetzt alles zusammen?« Sie nickte. »Dann sollten wir es auch einfach tun«, schlug er vor.
III. Der Ausflug nach Erlangen
Elisabeth erzählte am Samstag ihrer Familie von der geplanten Fahrt nach Erlangen, worauf Prof. Stanley nur bemerkte: »Das habe ich mir fast schon gedacht, dass hier was läuft. Warum sollte er sich wohl sonst jeden Abend bei uns herumdrücken?« Weniger Zustimmung fand dagegen ihr Vorhaben bei Miss Trailer. Nachdem O’Connor ihr und den Bakers mitgeteilt hatte, dass er am nächsten Wochenende nach Erlangen fahren wolle, sagte diese gleich schwärmerisch: »Die Stadt soll ja wirklich sehr schön sein. Ich würde auch gerne einmal dorthin.« Um ihr auch wirklich gleich die letzte Illusion zu rauben, erwiderte O’Connor: »Wenn Miss Dawson und ich wieder zurück sind, können wir Ihnen vielleicht die richtig guten Plätze in der Stadt nennen, falls Sie auch einmal dort ein Wochenende verbringen möchten.«
Mike Baker musste schmunzeln, während Miss Trailer entsetzt dreinblickte. Wieder etwas gefasst, bemerkte sie: »Ich finde, es gehört sich einfach nicht, wenn ein Vorgesetzter mit seiner Mitarbeiterin ein Wochenende verbringt.« O’Connor reagierte auf diesen moralischen Fingerzeig gelassen: »Richtig. Ich finde auch, dass es unmoralisch sein würde, wenn ich mit meiner Sekretärin ein Wochenende zusammen verbringen würde.« – »Und? Was ist bei der Engländerin so anders?«, wollte sie mit mühsam beherrschter Stimme wissen. »Dass Miss Dawson in mir nicht ihren Vorgesetzten sieht«, sagte er gut gelaunt und ging in sein Zimmer.
Sie waren schon am Freitagvormittag mit dem Zug losgefahren, um drei Tage ungestört miteinander verbringen zu können. Auf der Fahrt sagte O’Connor: »Ich hatte erst überlegt, ob ich schon etwas für uns im Hotel reservieren lassen sollte, habe es dann aber doch nicht getan, weil ich nicht wusste, was Ihnen gefallen könnte.« – »Ich fände es gut, wenn wir uns einfach vor Ort ein Hotel aussuchen. Vielleicht in der Nähe der Innenstadt.« Er war hiermit einverstanden und erzählte ihr dann die übrige Zeit der Fahrt von seiner Jugend in Irland und davon, dass er gerne einmal wieder in seine Geburtsstadt fahren würde, wo noch sein Großvater und eine Tante von ihm lebten.
In Erlangen fanden sie recht schnell ein Hotel in einer ruhigen Seitenstraße. Bevor sie es betraten, wollte O’Connor von ihr wissen: »Und, was soll ich nun für uns anmieten?« – »Die preiswerteste Lösung. Dann haben wir wenigstens noch Geld, um essen zu gehen.« Er war sich nicht ganz sicher, ob er sie richtig verstanden hatte, und fragte deshalb: »Heißt das, ein Doppelzimmer?« Elisabeth schwieg mit einem leichten Lächeln.
Im Hotel fragte O’Connor, der recht gut Deutsch sprach, in Englisch den Portier am Empfangstresen, ob er und seine Lady ein Doppelzimmer bekommen könnten, weil er befürchtete, dass sie in diesem Hause als unverheiratetes Paar niemals ein Doppelzimmer bekommen würden. Seine Rechnung ging auf. Wegen seiner vorgespielten Sprachprobleme fragte keiner mehr nach, ob es sich bei seiner Lady auch um seine Ehefrau handeln würde.
Ihr Zimmer lag im ersten Stock des Hauses mit Blick auf ein Gartengrundstück. Es war nicht sehr groß, aber gemütlich eingerichtet und hatte ein kleines Bad. Elisabeth, die sehr darunter litt, dass sie in Nürnberg in ihrer Unterkunft nur sehr knapp Heizvorräte hatten, weshalb der Badeofen in der ersten Etage lediglich einmal pro Woche angeheizt werden konnte und dann, wegen der Vielzahl der Mitbewohner, auch nur jeder einmal im Monat baden durfte, fragte gleich begeistert: »Ist es okay, wenn ich erst einmal ausgiebig bade?« O’Connor sah sie etwas ungläubig an und erwiderte nur: »Ja, das ist schon in Ordnung.«
Während sie entspannt in der warmen Wanne lag, saß er in einem der beiden Sessel und ging seinen Gedanken nach. Der Beginn dieser Reise war nun doch etwas anders, als er es sich vorgestellt hatte, und er war gespannt, was nun noch auf ihn zukommen würde. In den letzten Wochen hatte er Elisabeth in vielen unterschiedlichen Situationen kennengelernt, aber eben nicht in dieser ganz besonderen Rolle.
Nach einer Dreiviertelstunde erschien seine Reisebegleiterin frisch gebadet und fertig angekleidet im Zimmer und machte den Vorschlag, ob sie sich jetzt die Stadt ansehen wollten. Ganz entsprechend seiner Strategie, sie einfach gewähren zu lassen, stimmte er zu. Bevor sie aufbrachen, gab er lediglich zu bedenken: »Meinen Sie nicht, wir sollten uns beim Vornamen nennen, wenn wir schon ein Hotelzimmer miteinander teilen?« – »Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee«, sagte sie wieder mit diesem merkwürdigen Lächeln.
In der Innenstadt war Elisabeth vor allem von den Kirchen angetan, die sie sich gerne ansehen wollte und sie war jedes Mal begeistert, wenn sich die schweren Holztüren öffnen ließen und man sie auch betreten konnte. Nachdem sie sich vier Kirchen angesehen hatten, fragte sie ihn: »Wärst du bereit, mit mir am Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen?« Für ihn war nicht ersichtlich, was sie eigentlich mit diesem offensichtlichen Hang zu Gotteshäusern bezweckte, und er fragte sie deshalb: »Warum ist es dir so wichtig, zum Gottesdienst zu gehen? Hast du ein schlechtes Gewissen, weil wir uns unchristlich benehmen könnten?« Sie sah ihn verständnislos an und wollte dann von ihm wissen: »Wieso unchristlich?« – »Na ja. Mit einer Frau außerhalb der Ehe in einem Doppelbett zu nächtigen, ist mit Sicherheit nicht im Sinne der Kirche.« Sie hatte wieder dieses merkwürdige Lächeln, als sie erwiderte: »Es kommt doch nur darauf an, was man daraus macht.«
O’Connor war sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob seine Reisebegleiterin für ihn noch berechenbar war. Er wollte keine komplizierte Beziehung mehr nach seiner gescheiterten Ehe, und dies hier schien ihm sehr kompliziert zu werden. Um das ganze Wochenende nicht in einem völligen Missverständnis enden zu lassen, lud er Elisabeth kurz entschlossen in ein kleines Lokal ein. Während sie auf Kaffee und Kuchen warteten, schlug er vor: »Wollen wir nicht einmal besprechen, was wir hier in Erlangen alles machen wollen?« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und sah ihn fast ein wenig herausfordernd an, als sie zurückfragte: »Was möchtest du denn machen?« Er überlegte kurz und äußerte dann recht selbstbewusst seine Wünsche: »Ich würde mit dir nachher gerne schön essen gehen, schließlich haben wir ja beim Hotelzimmer gespart, und danach noch in ein Nachtlokal. Wie du siehst, alles Dinge, die wir uns in Nürnberg nicht erlauben.«
Sie antwortete nicht sofort, weil gerade ihre Bestellung serviert wurde. Dann sagte sie: »Das hört sich gut an«, und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Würdest du am Sonntag mit mir noch in die Kirche gehen?« Sein Gesicht wirkte sehr ernst, als er ihr erzählte, dass er in den letzten Jahren nur Kirchen betreten habe, um ihm nahestehende Menschen zu Grabe zu tragen. Für ihn würden Gotteshäuser schon fast behördliche Funktionen erfüllen, für solche Dinge wie Taufe, Hochzeit und Beerdigung. Als ihn Elisabeth fragte, ob er denn damals nicht kirchlich geheiratet habe, antwortete er knapp: »Nein. Wir hatten nicht denselben Glauben und ich als Ire im Exil bin wohl inzwischen in Glaubensfragen etwas konfliktscheu geworden.«
Ihre Unterarme ruhten vor ihrem Gedeck auf dem Tisch, während sie etwas ratlos sein Gesicht betrachtete. »John, warum hast du deinen Glauben verloren? Machst du Gott dafür verantwortlich, was mit dir und deiner Familie geschehen ist?« Er dachte einen Moment nach und schüttelte dann den Kopf. »Nein, ich glaube nicht, dass Gott etwas gegen mich hat oder mich für etwas strafen wollte. Er war nur einfach nicht da, als ich ihn brauchte, und jetzt bin ich ziemlich selbständig geworden.« Als sie ihn nur schweigend betrachtete, fragte er: »Und warum möchtest du am Sonntag in die Kirche gehen?« – »Ich habe mir vorhin beim Gang durch diese schönen Gotteshäuser versucht vorzustellen, wie die Menschen hier nach diesem Krieg mit sich und ihrem Glauben ins Reine kommen können.« – »Heißt das, dass du hier in Erlangen deine Studien fortsetzen willst? Ich dachte, wir wollten hier einmal ganz privat sein.« Seiner Stimme war anzumerken, dass er gereizt war, worauf sie versuchte einzulenken: »Du hast Recht. Wir sind ganz privat hier. Würdest du einfach eine Pfarrerstochter am Sonntag in den Gottesdienst begleiten, die schon wochenlang keine Predigt mehr gehört hat?« Sein Blick wirkte etwas gequält, als er sein Okay zu ihrem Vorhaben gab.
Es war schon 17 Uhr, als sie das Café verließen, und es dämmerte bereits draußen. Auf dem Weg zum Hotel kamen sie an einer Schneiderei vorbei, die in ihrem schwach beleuchteten Schaufenster einige Damenkleider ausgestellt hatte. O’Connor war stehengeblieben und fragte sie: »Schau mal. Gefällt dir das Kleid dort?« Elisabeth betrachtete das elegante Kleid eher uninteressiert und sagte dann: »Ja, es ist sehr schön.« – »Komm, lass uns hineingehen. Wenn es dir passt, würde ich es dir gerne kaufen«, schlug er vor. Sie wehrte sofort ab: »Nein, das möchte ich nicht. Das Kleid ist zu teuer.« Er beugte sich zu ihr hinunter und flüsterte ihr ins Ohr: »Einen Teil des Preises vom Kleid haben wir schon durch unser Doppelzimmer eingespart. Probiere es doch einfach mal an.«
Sie tat es und musste feststellen, dass ihr das Kleid ausgesprochen gut stand, aber trotzdem sträubte sie sich innerlich, ein derartiges Geschenk von ihm anzunehmen. Etwas hilflos sah sie von der Schneiderin zu O’Connor, der so glücklich bei deren Worten wirkte, dass seine Gattin wirklich sehr elegant in dem Kleid aussehen würde. Sie widersprach daher nicht, als O’Connor entschied, das Kleid zu nehmen. Auf der Straße erklärte er Elisabeth, die schon im Vorfeld der Reise immer darauf bestanden hatte, ihren Anteil der Kosten für das Wochenende selber zu zahlen: »Ich mag es nun einmal, wenn du besonders hübsch aussiehst. Hier ist kein Hintergedanke dabei.«
Im Hotel entschied sich Elisabeth, das neue Kleid zum Ausgehen anzuziehen, schon um ihm damit eine Freude zu bereiten. Sorgfältig frisierte sie im Bad ihre Haare und erneuerte ihr Make-up. Als sie wieder zurückkam, zog er sie zu sich in den Arm und sagte anerkennend: »Du siehst wundervoll aus. Ganz so, wie ich es an dir mag.«