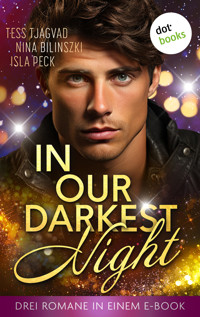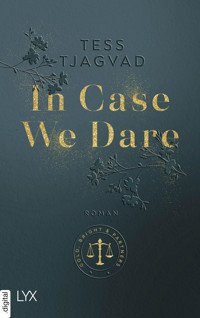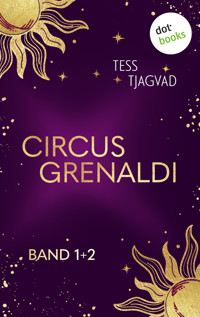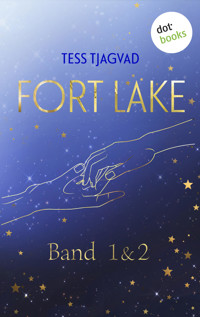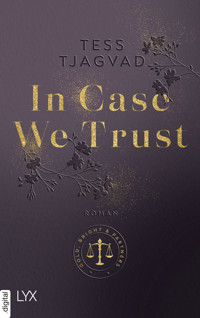Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Circus Grenaldi
- Sprache: Deutsch
Können sie einander bedingungslos vertrauen? Der Liebesroman »Go up in Flames« von Tess Tjagvad jetzt als eBook bei dotbooks. Margo hat es geschafft – die frischgebackene Journalistin konnte einen Praktikumsplatz bei einem bekannten Streaminganbieter ergattern! Einen ganzen Sommer lang wird sie den berühmten Circus Grenaldi begleiten, um Filmmaterial für eine neue Dokumentationsreihe zu sammeln. Margo ist fest entschlossen, sich voll und ganz auf das Projekt zu konzentrieren, wäre da nicht der charmante Direktionssohn und Feuerakrobat Elio, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Je besser sie ihn kennenlernt, desto klarer wird ihr, dass Elio hinter seiner sorglosen Fassade ein Geheimnis verbirgt. Während sie versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, kommen sich die beiden unweigerlich näher. Bis sie einen kleinen, aber folgenschweren Fehler begehen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prickelnde New-Adult-Roman »Go up in Flames« von Tess Tjagvad, zweiter Teil ihrer Dilogie, wird Fans von Ayla Dade und Lilly Lucas begeistern – und ist so aufregend wie ein Besuch im Cirque du Soleil oder Circus Roncalli. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Margo hat es geschafft – die frischgebackene Journalistin konnte einen Praktikumsplatz bei einem bekannten Streaminganbieter ergattern! Einen ganzen Sommer lang wird sie den berühmten Circus Grenaldi begleiten, um Filmmaterial für eine neue Dokumentationsreihe zu sammeln. Margo ist fest entschlossen, sich voll und ganz auf das Projekt zu konzentrieren, wäre da nicht der charmante Direktionssohn und Feuerakrobat Elio, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Je besser sie ihn kennenlernt, desto klarer wird ihr, dass Elio hinter seiner sorglosen Fassade ein Geheimnis verbirgt. Während sie versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, kommen sich die beiden unweigerlich näher. Bis sie einen kleinen, aber folgenschweren Fehler begehen …
»Go up in Flames« erscheint außerdem als Hörbuch und Printausgabe bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über die Autorin:
Tess Tjagvad, geb. 1995, ist gelernte Floristin, studiert aber derzeit Germanistik. Unter dem Pseudonym »barelines« avancierte sie auf Wattpad zur #1-Autorin mit über einer halben Million Reads. Tess läuft ständig mit Musik im Ohr herum. Wenn sie nicht gerade schreibt oder liest, vertreibt sie sich die Zeit beim Kraftsport oder bei Spaziergängen in der Natur.
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/tesstjagvad
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Romane der »Fort Lake«-Reihe: »Ich kann dich fühlen« und »Ich kann nicht vergessen« – die auch als Print- sowie Hörbuchausgabe bei SAGA Egmont erhältlich sind. In ihrer »Circus Grenaldi«-Reihe erscheinen bei dotbooks die Romane »Reach for the Stars« und »Go up in Flames«.
***
eBook-Ausgabe Mai 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Tess Tjagvad und SAGA Egmont
Copyright © der eBook-Ausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Paulina Ochnio unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-650-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Go up in Flames« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tess Tjagvad
Go up in Flames
Roman: Circus Grenaldi Band 2
dotbooks.
Für Opa.
Es gibt vielleicht keine Ewigkeit,
aber dafür gibt es Bücher.
Prolog | Margo
03. Juni, Toronto
Wo bin ich hier bloß reingeraten?
Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich auf das weiße Stück Papier starrte, das ich in meinen feuchten Händen hielt. Ein Haufen verschnörkelter Buchstaben, der nur eines bedeuten konnte: Du hast ein Problem.Ein gewaltiges.
»Also«, sagte meine Projektleiterin Ann und legte den roten Marker beiseite. »Es geht hierbei um eine kleine Dokumentationsreihe, die nächstes Jahr unter dem Titel extraordinary – die außergewöhnlichsten Jobs ausgestrahlt werden soll. Wir planen etwa acht Folgen von je neunzig Minuten.« Sie setzte sich zurück auf ihren Stuhl und sah meine Kollegschaft und mich der Reihe nach an. »Wir wollen euch hiermit ein wenig auf die Probe stellen. Deshalb werden wir euch allen die Möglichkeit bieten, ab nächstem Monat zwölf Wochen lang Menschen, die einen dieser hier aufgelisteten Berufe ausüben«, kurzer Fingerzeig auf das weiße Clipboard hinter ihrem Rücken, »in ihrem Arbeitsalltag zu begleiten. Euer Ziel soll es sein, uns Mitte Oktober eine überzeugende Dokumentation vorzulegen. Wie ihr die Sache angeht und welche Schwerpunkte ihr setzt, ist allein eure Entscheidung. Im Anschluss werden unsere Profis natürlich noch mal einen Blick darauf werfen, aber uns geht es in erster Linie darum, zu sehen, welche Fertigkeiten ihr schon vorzuweisen habt. Am Ende wollen wir den besten Beitrag mit einer Festanstellung bei Comet belohnen. Alles klar so weit?«
Nein. Absolut nichts war klar, denn auf meinem ausgelosten Zettel stand genau der Job, den ich von allen zur Auswahl stehenden am wenigsten gewollt hatte. NASA? Nada. Canadian Armed Forces? Negativ. Stattdessen: eine Crew aus Hochseefischerinnen und -fischern auf einem Schiff mitten in Alaska.
Es klang wie ein schlechter Scherz. Besonders, wenn man bedachte, dass das offene Meer und ich noch nie in einer guten Beziehung zueinander gestanden hatten.
Viel zu tief. Viel zu undurchsichtig. Viel zu beängstigend.
Und nun sollte ausgerechnet ich diese Menschen wochenlang dabei begleiten, wie sie sich Tag für Tag auf diesem Schiff mitten im Nirgendwo in Gefahr brachten?
Mir wurde flau im Magen, wenn ich auch nur daran dachte. Also sammelte ich all meinen Mut zusammen und hob die Hand. »Entschuldige, Ann? Eine Frage … Ist die Einteilung in Stein gemeißelt?«
»Wieso, gibt es ein Problem?«, fragte sie und rückte ihre Brille zurecht, die auf ihrem zierlichen Gesicht zu groß wirkte.
»Ehrlich gesagt schon. Ich kann nicht schwimmen.« Das war immerhin nur halb gelogen.
Ich hatte als Kind zwar schwimmen gelernt, aber es lag Jahre zurück, dass ich es auch getan hatte. Weil ich es schlichtweg vermied, wann immer es möglich war.
»Nun, das ist bei diesem Job vielleicht wirklich etwas ungünstig …« Anns Blick wanderte erneut über die Gesichter der anderen Praktikantinnen und Praktikanten, die mit uns am Tisch saßen. »Irgendjemand hier, der bereit wäre, mit Margo zu tauschen?«
Stille.
Ich konnte es ihnen nicht einmal verübeln. Wenn ich Hollywood oder Australien gezogen hätte, hätte ich auch nicht mit mir tauschen wollen.
»Gut, dann müssen wir uns wohl noch mal im Team besprechen und nach einer alternativen Lösung suchen.«
Ann wollte bereits aufstehen, um sich wieder dem Clipboard zuzuwenden, da kam mir plötzlich eine Idee.
»Sekunde. Was hältst du von einer Dokumentation über die Angestellten des Circus Grenaldi?«
1 | Elio
23. Juni, Montreal
Ab und zu stellte ich mir vor, ich würde mein Leben durch die Linse einer Kamera betrachten. Und dann fragte ich mich, in welchen Momenten ich wohl auf den Auslöser drücken würde.
Welche wären mir eine Erinnerung wert?
Ich wusste es nicht. Zumindest nicht sicher.
Womöglich die Momente kurz vor einer Show, wenn mein gesamter Körper vor Adrenalin kribbelte. Momente, die ich mit meiner Familie und meinen Freunden verbrachte; in denen wir gemeinsam lachten und komisches Zeug anstellten. Momente, in denen ich mich auf mein Motorrad setzte und ziellos durch die Gegend fuhr, ganz ohne Zeit und Pflicht im Nacken.
Was ich dagegen sicher wusste, war, welche Momente mir keine Erinnerungen wert wären. Solche, in denen ich gegen Blitzlicht anblinzelte oder zum hundertsten Mal dieselbe verfluchte Frage beantwortete. Momente, in denen ich heimkehrte und die spitzen Zähne der schwarzen Eisenzäune das Erste waren, was ich sah. Momente, in denen ich ein Lächeln aufsetzte, obwohl mir nicht danach war. Oder Momente wie dieser, in dem ich in einem fremden Bett aufwachte und eine seltsame Bedeutungsschwere in der Luft hing, die man mit dem Finger hätte anstoßen können.
Ich war weiß Gott niemand, der sich aus Wohnungen schlich und wortlos verschwand. Trotzdem war Bleiben keine Option, da das nur das Risiko erhöhte, dass es sich wiederholte. Und das wiederum erhöhte das Risiko, dass ich anfing, etwas zu vermissen, von dem ich nicht mal wusste, ob es wirklich existierte. Etwas, von dem ich möglicherweise nicht einmal wollte, dass es existierte, weil es die Dinge nur komplizierter machen würde.
Ich hielt mich lieber an flüchtige Augenblicke. Nicht an Menschen, denen ich auf Dauer ohnehin nichts zu bieten hatte.
Catia war als Frau für eine Nacht perfekt gewesen. Wir hatten uns in einer Bar nicht weit von ihrer Wohnung kennengelernt, und ich hatte sofort gespürt, dass wir auf einer Wellenlänge waren. Vielleicht lag es an ihren leeren Augen oder ihrem besorgniserregenden Zigarettenkonsum.
Sie hatte wie jemand ausgesehen, dem man nicht mehr wehtun konnte, weil jemand anderes einem vor sehr langer Zeit damit zuvorgekommen war.
Jetzt, wo der Alkohol aus meinem Blut gewichen war und die Sonne ihre goldenen Flecken auf Catias Gesicht warf, hätte mich nur zu sehr interessiert, wer sie früher mal gewesen sein mochte.
Und was, oder wer, sie dazu bewegt hatte, diese Version von sich aufzugeben. Was nur ein weiterer Grund für mich sein sollte, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden.
Ich stützte mich auf die Ellbogen, fuhr mir mit einer Hand durch mein gelocktes Haar und blickte mich in ihrer Einzimmerwohnung um, die kaum größer war als mein Wohnwagen. Ein beißender Geruch von kaltem Zigarettenrauch haftete an den Möbeln und Wänden. Staubkörner wirbelten durch die Luft, benutztes Geschirr stapelte sich in der Spüle, und ein Pfad aus Klamotten zog sich über den dunklen Parkettboden.
Beim Anblick der Unordnung erschauderte ich. Wenn das eigene Leben Chaos genug war, brauchte man im Alltag nicht noch mehr davon. Deshalb war ich stets darum bemüht, eine gewisse Grundordnung zu halten. Anders als meine kleine Schwester Yara, deren Wohnwageninneres sich an manchen Tagen kaum von diesem Bild unterschied.
»Hey. Du bist ja noch hier.«
Ich fuhr beim Klang ihrer Stimme zusammen. Catia hatte eines ihrer verquollenen grünen Augen geöffnet und blinzelte angestrengt gegen die Sonne an.
»Und du bist wach«, bemerkte ich überrascht.
»Mehr oder weniger.« Grummelnd wischte sie sich über das Gesicht und verschmierte dabei ein paar Reste ihrer Wimperntusche. »Wie spät ist es?«
»Kurz nach elf.«
»Und du bist trotzdem noch hier?«, wiederholte sie und setzte sich auf. Auch ohne dass sie etwas sagte, waren ihr die Kopfschmerzen anzusehen. Es war die Art, wie sie ihre Augen zusammenkniff.
»Soll ich gehen?«
»So meinte ich das nicht.« Ein heiseres Lachen kam ihr über die Lippen. »Du kannst gehen, wann du willst. Aber meine Schicht im Café beginnt um zwölf.«
Ich erinnerte mich, dass sie den Job gestern in einem Nebensatz erwähnt hatte. Genau wie ihr Kunststudium. Nun, da ich die vielen gerahmten Bilder an ihrer Wand sah, fand ich, dass es noch besser zu ihr passte als ohnehin schon. Nicht, weil sie schief hingen. Eher, weil ich Splitter von ihr in ihrer Kunst wiederfand. Oder andersrum.
Ich schmunzelte. »Kein Ding. Ich muss sowieso gleich los.«
Heute war Dienstag, was bedeutete, dass ich freihatte. Keine Zirkusshows. Kein Nachmittagsprogramm. Einer von zwei Tagen in der Woche, die ganz allein mir gehörten. Allerdings hatte ich meiner Familie trotzdem versprochen, heute beim späten Frühstück dabei zu sein.
Ich beobachtete, wie Catia nach der Schachtel auf ihrem Nachtschrank griff und sich eine Zigarette anzündete. So, wie sie dasaß, nackt und mit Kissenabdrücken auf ihren Wangen, während ihr das schwarze Haar in Wellen über die Brüste fiel, hätte man meinen können, sie wäre einem alten Schwarz-Weiß-Film entsprungen.
Keine Frage, Catia war schön. Ein bisschen zerbrochen, aber trotzdem – oder sogar gerade deshalb – schön.
Ich biss mir auf die Unterlippe und wandte den Blick ab.
»Sag mal«, begann sie und blies den Rauch gen Zimmerdecke aus, »wie war dein Name noch gleich? Leo?«
»Elio«, murmelte ich.
»Richtig, das war’s.« Catia kicherte vergnügt. »Elio Grenaldi. Fast vergessen, dass ich letzte Nacht mit einem Promi gevögelt hab. Muss ich jetzt Paparazzi fürchten?«
Mir entfuhr ein Schnauben. »Ich bin kein Promi.« Genau genommen war ich gar nichts. Ich hatte nur diesen halbwegs bekannten Namen, der ein Konstrukt aus Erzählungen und Erwartungen war, von denen ich bezweifelte, ihnen je gerecht werden zu können. An den meisten Tagen trug ich ihn wie ein schillerndes Showkostüm, ohne zu wissen, wer ich darunter eigentlich war.
»Also dein Instagram-Profil sagt was anderes«, behauptete Catia.
Mein Instagram-Profil sagt ziemlich viele Dinge, die nicht wahr sind, schoss es mir durch den Kopf.
Ich rutschte vom Bett und sammelte meine Klamotten vom Boden auf, bevor ich zurück in meine Boxershorts mitsamt Cargohose schlüpfte. »Wann hast du zwischen all dem Rummachen Zeit gefunden, dir mein Profil anzusehen?«
Sie grinste breit, was kleine Lachfältchen um ihre Augen aufblitzen ließ. »Als du in der Bar zur Toilette gegangen bist. Ich wusste, dass ich dein Gesicht schon mal irgendwo gesehen und deinen Namen gehört hab. Nur nicht mehr, wo.«
Ich hob eine Augenbraue. »Dann war das der Grund dafür, dass du mich mit zu dir nach Hause genommen hast? Weil du dachtest, ich wäre jemand?«
»Hm.« Sie schürzte die Lippen und legte den Kopf schief, während sie mich kurz von der Seite musterte. »Sagen wir, es war das i-Tüpfelchen.«
»Interessant. Und ich dachte, das wäre der Sex gewesen«, entgegnete ich sarkastisch.
So reagierte ich oft. Eigentlich andauernd, wann immer ich etwas überspielen wollte. In diesem Fall meinen Frust über ihre Bemerkung. Es war, als erlaubte ich mir nicht, ein anderes Bild als das des sorglosen Typs zu verkörpern, für den mich jeder halten sollte. Meistens war ich der ja auch. Nur eben nicht … immer.
Catia lächelte amüsiert und wackelte mit ihren rot lackierten Zehen. »Zu dem Zeitpunkt wusste ich doch noch nicht, wie der Sex wird. Ich konnte nur Vermutungen anstellen.«
»Verstehe.« Ich zog mir meinen Kapuzenpulli über den Kopf, der verdächtig nach Bier und Frittenfett roch, und griff nach meinem Schlüssel. »Dann hoffe ich, dass du nicht enttäuscht wurdest.«
»Kein bisschen.«
Ich überging ihre Antwort, die man auf zweierlei Arten verstehen konnte, und deutete mit meinem Daumen auf ihr Bad. »Kann ich noch mal pinkeln gehen, bevor ich abhaue?«
»Tu dir keinen Zwang an«, sagte sie. »Aber wunder dich nicht, der Wasserhahn ist im Eimer. Hatte nur noch nicht die Muße, einen Klempner zu rufen.«
Ich wunderte mich nicht. Und als ich mich zehn Minuten später von ihr verabschiedete, hatte ich es sowieso schon wieder vergessen. Genau wie den Namen ihrer Straße.
Ich fuhr zwei Stationen mit der Straßenbahn und umklammerte meinen Motorradhelm auf dem Schoß. In diesem Augenblick fühlte ich mich unvollständig, weil ein Teil meines Herzens an meiner Maschine hing, die fehlte. Dabei stand sie nur auf dem verlassenen Parkplatz der Bar, wo ich sie abgestellt hatte, bevor ich mit Catia nach Hause gegangen war.
Ich war mir sicher, dass niemand nachvollziehen konnte, warum ich sie bei einem Leben wie meinem, das sich hauptsächlich auf vier Rädern abspielte, überhaupt besaß.
Maman und Yara sahen in ihr mein Todesurteil, Papa sah darin einen harmlosen Zeitvertreib, und meine Freunde betrachteten sie als Spielzeug, das obendrein dazu diente, Frauen aufzureißen.
Ich wollte nicht bestreiten, dass ich bereits einige Bekanntschaften gemacht hatte, denen die Vorstellung von mir als Motorradjunkie gefallen zu haben schien. Zusammen mit meinen Tattoos verschaffte es mir wahrscheinlich eine Ausstrahlung, die das ein oder andere nette Abenteuer versprach.
Nur war es mir noch nie darum gegangen, irgendjemandem zu gefallen, denn wenn ich meine Maschine anschaute, sah ich darin nur eines: eine Ausflucht. Die Möglichkeit, schnell von A nach B zu gelangen, weg vom Zirkus und seinen Verpflichtungen, weg von … allem.
Und wenn es oft auch nur für ein paar Stunden war, genügte es, um meine Kraftreserven wieder so weit aufzufüllen, dass ich mich meinem Alltag stellen konnte, ohne befürchten zu müssen, dass mir jede Sekunde die Decke auf den Kopf fallen würde.
Ich erreichte den Parkplatz und kam neben meiner mattschwarzen Yamaha zum Stehen. Behutsam strich ich mit meinen Fingern über das von der Sonne erwärmte Metall. Einige Kratzer und Gebrauchsspuren fanden sich im Lack, aber nur die wenigsten davon waren auf den Alterszustand zurückführen.
Bisher hatte ich nicht den Drang verspürt, sie ausbessern zu lassen. Zum einen, da jede Delle ihre Geschichte erzählte. Zum anderen, da ohnehin andauernd neue dazukamen.
Ich schwang mich auf den Sitz, startete den Motor und erreichte nach gut zehn Minuten Fahrt durch die Stadt das weitläufige Parkgelände, auf dem wir seit Anfang Juni gastierten. Wie eine nachtblaue Gewitterwolke, die mit jedem Meter anschwoll, türmten sich die Dächer der Zirkuszelte vor mir auf. Die Sonne goss ihr Licht auf die gestreiften Zeltplanen und ließ die Glühbirnen an den Ständen im richtigen Winkel kristallartig aufblitzen.
Es war praktisch unmöglich, den Circus Grenaldi zu übersehen, und das nicht nur wegen der großen goldenen Leuchtreklame mit unserem Logo, das aus Sonne und Mond bestand. Der Anblick der Zelte und aufwändig verzierten Wagen hatte einfach etwas Magisches an sich.
Ich wollte so gern stolz auf dieses Zuhause sein, und an manchen Tagen war ich das auch. Aber an anderen Tagen, die mit zunehmendem Alter immer häufiger auftraten, bekam ich beim Anblick der schwarzen Eisenzäune schiere Atemnot.
Mir war bewusst, dass diese Zäune mir Sicherheit suggerieren sollten. Dass sie meine kleine heile Welt vor der großen weiten draußen schützen sollten. Nur fühlten sie sich nicht so an. Vielmehr fühlten sie sich wie ein Gefängnis an, das meine Träume klein und sie auf ewig hier drin gefangen hielt.
Wahrscheinlich hatte ich mir dieses Leben selbst vermiest. Weil ich ein Weltenbummler war und meine Gedanken stets von einem Ort zum nächsten wanderten, ohne je Wurzeln zu schlagen.
Dass ich bei einem Job wie meinem so etwas wie Fernweh verspürte, mochte für Außenstehende wenig Sinn ergeben. Immerhin waren meine Familie und ich andauernd auf Wanderschaft. Allerdings führte der Zirkus mich nie an neue Orte. Er führte nur immer wieder an dieselben zurück, und das Jahr für Jahr für Jahr. Schwer zu sagen, wie oft ich mir schon ausgemalt hatte, meine Koffer zu packen. Oder mich auf mein Motorrad zu setzen und auf unbestimmte Zeit nicht mehr zurückzukommen.
Trotzdem war ich noch hier. Weil der Zirkus mein Zuhause war. Meine Familie. Und wenn ich eines als Kind gelernt hatte, dann war es, dass man diese nicht im Stich ließ. Besonders dann nicht, wenn die eigene Schwester unter chronischer Abschiedsangst litt. Oder der eigene Vater sämtliches Vertrauen in einen setzte. Eher würde ich mir einen Finger abhacken, als sie beide zu enttäuschen.
Nachdem ich abgestiegen war und den Helm an meinen Lenker gehängt hatte, schob ich meine Maschine durch das Tor hindurch. Ich passierte das leere Häuschen unseres Nachtwächters Roy und näherte mich der Siedlung aus Anhängern und Wohnwagen, die alle in geordneten Reihen nebeneinanderstanden. Zwischen einigen waren Lichterketten und Lampions gespannt. Jetzt, wo der Sommer anklopfte, hatten manche ihre Markisen ausgefahren und Liegestühle vor der Haustür aufgestellt.
Mir gefiel die Aussicht, besonders bei Nacht. Das weiche Licht hatte etwas Friedvolles, fast schon Melancholisches an sich, das nur in lauen Sommernächten zu spüren war. Als würden Erinnerungen an unbeschwerte Tage in diesen Nächten lebendig werden. Erinnerungen an meine Kindheit, wie ich zusammen mit Yara Verkleiden im Kostümwagen gespielt hatte; wie wir mit einer Portion Zuckerwatte in der Manege gesessen und den Artistinnen und Artisten bei ihrer Arbeit zugesehen hatten oder an heißen Nachmittagen mit unseren Cousinen über den Rasensprenger gehüpft waren, um uns abzukühlen.
Tage, an denen meine Welt noch in Ordnung gewesen war, weil ich keinen Gedanken an die verschwendet hatte, die hinter den Zäunen lag.
Ich befand mich gerade auf Höhe der Duschwagen, als Milan mir entgegengerannt kam. Der Kleine trug ein diebisches Grinsen im Gesicht, das nur Ärger verheißen konnte – mal wieder.
Erst letzte Woche hatten er und sein bester Freund Emron meinem Kollegen Mael rohe Eier in die Schuhe gelegt. Das Mal davor hatten sie Trips VW-Bus mit Toilettenpapier umwickelt.
Die beiden besaßen mit ihren acht und neun Jahren definitiv zu viel Energie.
Ich stellte mein Motorrad ab und öffnete bereits den Mund, um ihn zu fragen, was er im Schilde führte, da hörte ich die wutverzerrte Stimme unseres Fahrrad-Akrobaten Trip.
»Ich schwöre dir, Milan, du kommst jetzt besser sofort zurück oder ich … verdammt, keine Ahnung! Aber irgendwas wird passieren, hörst du?«
Er stand mit grimmiger Miene im Türrahmen des Duschwagens und trug nichts am Körper. Alles, was sein bestes Stück vor fremden Blicken schützte, war seine rechte Hand.
Sobald er mich bemerkte, deutete er mit der anderen wild wedelnd auf Milan. »Gott sei Dank, Eli! Halt ihn fest!«
Reflexartig ließ ich meinen Arm nach vorn schnellen und bekam Milan gerade noch am Saum seines Shirts zu fassen, bevor er abbiegen konnte. Ich schnalzte tadelnd mit der Zunge.
»Hiergeblieben, kleiner Mann.«
Der Junge wand sich lachend in meinem Griff. »Lass mich los! Ich hab nichts gemacht!«
»Ach nein?« Mein Blick fiel auf das Kleiderbündel, das er sich wie einen Schatz an die Brust drückte und unter dem sich auch Trips Handtuch befand. »Mal im Ernst, wie oft hast du die Nummer jetzt schon abgezogen?«
Milans Kichern wurde lauter, als ich ihn mit dem Zeigefinger mehrmals in die Rippen pikte. »Was kann ich dafür? Es funktioniert jedes Mal.«
»Tja, heute nicht«, erwiderte ich, zog ihm die Klamotten aus dem Arm und wuschelte ihm durch das schwarze Haar. »Sorry, Kumpel.«
Seine Augen wurden größer und runder, als er schmollend die Unterlippe vorschob. »Aber …«
»Versuch’s erst gar nicht«, warnte ich. »Wo ist Emron? Kannst du dem nicht auf die Nerven gehen?«
Milan sah sich in der Siedlung um und kratzte sich den Hinterkopf. »Eben war er doch noch da. Emron?«, rief er. »E-e-e-e-mron! Wo bist du hin?«
Kurz darauf war er zwischen den Wagen verschwunden, um seinen verschollenen besten Freund zu suchen.
»Hier.« Ich reichte Trip, der von Kopf bis Fuß tropfte, zunächst sein Handtuch. »Vielleicht solltest du sie künftig ganz oben aufs Regal legen, damit er nicht drankommt.«
Er verdrehte die Augen. »Ich vergesse es andauernd.«
Während er sich das Handtuch umband, hielt ich den Blick höflich gesenkt, bevor ich ihm auch den Rest seiner Kleidung gab.
»Danke, Mann.« Trip fuhr sich durch das wasserstoffblonde Haar, das ihm platt an der Stirn klebte, und musterte mich. »Bist du eben erst nach Hause gekommen?«
»Ja, ich hab … woanders gepennt«, murmelte ich und rieb mir den Nacken – ein Zeichen dafür, dass ich das Thema nicht vertiefen wollte.
»Schon kapiert.« Trips Lippen verzogen sich zu einem wissenden Grinsen. »Hey, Mael, Oz und ich wollten gleich das Wetter ausnutzen und runter an den Strand. Vielleicht ’ne Runde schwimmen, falls es nicht zu kalt ist. Bist du dabei?«
»Erst mal ist spätes Frühstück angesagt«, antwortete ich mit einem Seufzen. »Papa will noch ein paar Dinge klären. Wahrscheinlich wegen dieser Dokumentationssache.«
Allmählich hatte ich das Gefühl, er redete von nichts anderem mehr, seit er von dem Angebot von Comet erfahren hatte.
Ein Angebot eines so bekannten Streaminganbieters ist ein Glücksfall. Vielleicht können wir auf diese Weise unsere Zielgruppe erweitern.
»Mies.« Trip klopfte mir mitfühlend auf die Schulter. »Pass auf, ich schick dir einfach ’nen Standort, falls du Bock hast, später nachzukommen. Gilt natürlich auch für die anderen beiden.«
Ich lächelte. »Danke.«
Nachdem ich das Motorrad vor meinem Wagen abgestellt hatte, trat ich ein, schlug die Tür hinter mir zu und atmete scharf aus. Vollkommene Stille umfing mich.
Ich ertrug sie genau zehn Sekunden lang, bis ich ins Wohnzimmer ging und meine Musikbox einschaltete.
Es gab nicht vieles, vor dem ich Angst hatte, aber Stille gehörte dazu. Wahrscheinlich war sie sogar das, was ich am meisten fürchtete. Denn wenn es neben meinem Zuhause noch einen anderen Ort gab, dem ich auf Dauer nicht entkommen konnte, dann war es mein Kopf. Und der schlief nie.
Oft versuchte ich, dem auf genau diese Weise entgegenzuwirken: mit Musik. Ich ließ sie ständig laufen – manchmal selbst nachts. Klammerten sich meine Gedanken an einen beliebigen Songtext, konnten sie ihre Flügel zwar ausbreiten, aber nicht loslassen. Taten sie es doch, kehrten sie früher oder später wieder zurück.
Wahrscheinlich hatte ich es dieser Vermeidungstaktik zu verdanken, inzwischen Hunderte von Songtexten in- und auswendig zu kennen. Dabei war es vollkommen egal, ob es französische oder englische waren. Ich hörte lieber die Gedanken anderer, als mich meinen eigenen stellen zu müssen.
Ich duschte, um den üblen Geruch von Zigarettenrauch genauso gründlich von meiner Haut zu schrubben wie Catias Berührungen, mochten sie sich noch so gut angefühlt haben. Anschließend zog ich mir frische Kleidung über und lief zum Wohnwagen meines Vaters schräg gegenüber.
Die Tür stand offen, und unsere Hündin, eine gescheckte Dogge namens Gigi, lag zusammengerollt in ihrem Korb, den jemand nach draußen gestellt haben musste. Auch der Esstisch war bereits zur Hälfte gedeckt worden. Der leichte Stoff der hellblauen Tischdecke wog sich im sanften Wind.
Ich hatte bereits einen Fuß auf die Treppe gestellt, als Nolan mit einem Stapel Teller auf der Hand balancierend aus dem Wagen kam. Kaum trafen sich unsere Blicke, lächelte er. Und kein Scherz, ich fühlte mich augenblicklich besser.
Nolan war der Sommer auf zwei Beinen. Wenn er lächelte, lächelte alles an ihm. Seine Augen, sein Gesicht, selbst seine Stimme.
Kein Wunder, dass Yara so vernarrt in ihn war.
Ich hatte versucht, ihn nicht zu mögen, aber es war unmöglich. Nolan hatte ein Herz aus Gold und das mehr als einmal bewiesen.
Er war in der vergangenen Saison als Yaras Showpartner eingesprungen, nachdem Oscar, ihr ursprünglicher Partner und einer unserer engsten Freunde, sich bei einem Sturz verletzt hatte. Sie waren Tag für Tag zusammen aufgetreten und hatten sich irgendwann ineinander verliebt.
Ursprünglich hatte Nolan nach der Saison ein Stipendium in Kalifornien antreten sollen, sich in letzter Sekunde jedoch dagegen entschieden, um im Zirkus bleiben zu können. Auch wenn ich die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte, war ich froh, dass er hier war. Nicht nur, weil ich wusste, wie glücklich er Yara machte, sondern auch, weil er in der vergangenen Zeit zu einem Freund geworden war, den ich nicht mehr missen wollte. Denn jetzt war sein Gesicht eines der wenigen, die mir in meiner schnelllebigen Welt ein kleines bisschen Beständigkeit gaben.
»Da bist du ja endlich. Dein Dad hat sich schon genötigt gefühlt, mir den Posten des Tischdeckers zu überlassen«, grüßte er mich – zu meiner Überraschung auf Französisch.
Ich wusste, dass er angefangen hatte, es mit Yaras Hilfe zu lernen. Dass es ihm in diesem Moment derart fließend und fehlerfrei über die Lippen kam, war allerdings ungewöhnlich.
»Wie lange hast du dafür gebraucht?«, fragte ich deshalb auf Englisch.
»Ewig.«
Ich musste lachen und klopfte ihm im Vorbeigehen auf den Rücken. »Wenigstens bist du ehrlich.«
Kaum hatte ich Papas Wagen betreten, schlug mir eine warme Dampfwolke entgegen. Es duftete nach einer Mischung aus Bacon und Ei, einer feinen Kräuternote und dem schwachen Eigengeruch der alten Holzmöbel.
Ich musste zugeben, dass mir sein Faible für das Kochen sehr gelegen kam – je seltener ich meine freie Zeit dafür opfern musste, desto besser. Außerdem kochte er immer frisch. Viel Gemüse, selten Fleisch. Letzteres war mir als Vegetarier nur recht.
»Morgen«, sagte ich, als ich einen flüchtigen Blick über Papas Schulter warf.
»Morgen, Chéri«, antwortete er. »Ausgeschlafen?«
»Wie man’s nimmt.«
Ich stibitzte mir eine von den Tomatenscheiben, die Yara gerade fein säuberlich auf einem Teller anrichtete. Als sie ein empörtes »Hey!« von sich gab, zog ich ihren Kopf an meine Brust und drückte ihr einen schnellen Kuss auf den Scheitel.
»Was ist mir dir, Papillon?« Ich steckte mir die Tomate in den Mund und betrachtete sie. »Du siehst aus, als hättest du letzte Nacht kaum ein Auge zugetan.«
Wie aufs Wort tastete Yara nach dem gelockerten Knoten, zu dem sie ihr schwarzbraunes Haar auf dem Kopf zusammengebunden hatte. Ihre Wangen waren leicht gerötet, die Augen klein und verschlafen. Aber sie leuchteten. Und mehr musste ich nicht wissen.
»Meine Nacht war wunderbar, vielen Dank.« Sie boxte mich in den Magen und befreite sich aus meinem Griff. Dabei vermied sie es, mich anzusehen.
Oh ja, und wie wunderbar, dachte ich.
»Und du? Wie war denn deine?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen, die zweifelsohne dafürsprachen, dass sie Bescheid wusste.
Mein Gesicht zu lesen und das zu hören, was ich nicht sagte, gelang ihr nicht immer, denn ich war auch außerhalb der Manege ein guter Schauspieler. Deshalb hatte sie keine Ahnung, was hinter dem Vorhang in meinem Kopf wirklich vor sich ging. Und ich würde immer dafür sorgen, dass das auch so blieb.
»Ebenfalls wunderbar.« Ich setzte ein Grinsen auf, nahm ihr den Teller sowie den Korb mit den warmen Croissants ab und brachte beides nach draußen, wo Nolan derweil vier Gläser mit Orangensaft füllte.
Als schließlich auch alle anderen Speisen auf dem Tisch Platz gefunden hatten, sanken wir auf die gepolsterten Stühle und begannen mit dem Essen.
Es war wärmer geworden in den letzten Tagen, der Rasen, der meine nackten Zehen kitzelte, nicht mehr so feucht. Ich liebte das Gefühl der langen Grashalme unter meinen Füßen. Es desillusionierte mich nicht so sehr, wie glatter Betonboden es tat.
»Also, worüber wolltest du reden?«, fragte ich Papa, bevor ich das Glas mit meinem Orangensaft beinahe in einem Zug leerte. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie ausgehungert und dehydriert ich nach meinem gestrigen Abend war.
»Oh.« Papa schluckte den Bissen seines Croissants herunter. »Ich habe gestern noch ein paar Informationen von Comet bezüglich Nolans Freundin bekommen.«
Ich runzelte die Stirn und blickte Nolan fragend an. »Deiner Freundin?«
Nolan nickte. »Ja, Margo. Sie macht ihr Praktikum dort.«
Margo. In Gedanken drehte ich ihren Namen auf meiner Zunge umher wie ein Bonbon. Ich hatte sie nur zweimal gesehen. Einmal in Yaras Wohnwagen und einmal auf Nolans Laptopbildschirm. Trotzdem hatte ich ihr Gesicht sofort vor Augen.
»Dann wird sie die Dokumentation drehen?«
Er nickte noch einmal, genau wie Papa. »Comet hat circa sechs bis acht Wochen dafür eingeplant. Sie wird also auch den Umzug nach Ottawa begleiten. Nächsten Montag wird sie in Montreal ankommen, Dienstag will sie sich hier einen ersten Überblick verschaffen. Da Nolan kein Grenaldi ist und die ganzen Zahlen und Fakten nicht kennt, würde ich mir wünschen, dass du in den nächsten Wochen ein Auge auf sie hast und ihr bei Fragen zur Verfügung stehst, Eli.«
Das Ei, auf dem ich herumkaute, bekam mit einem Mal einen üblen Beigeschmack. »Wenn es eine Freundin von Nole und Yara ist, wieso kümmert Yara sich dann nicht darum?«
»Weil du derjenige bist, der das Ganze hier eines Tages mal übernehmen soll, und genau so etwas dann auch in deinen Aufgabenbereich fallen wird«, entgegnete Papa. »Ich denke, je schneller du lernst, wie man den Zirkus von seiner besten Seite präsentiert, desto besser.«
Yaras Besteck klirrte, als sie die Gabel aus der Hand legte und sie zur Faust ballte. »Und ich kann das nicht?«
Papa sah sie an, legte den Kopf schief. Das tat er oft, und aus irgendeinem Grund gefiel mir das nicht. Es wirkte immer, als würde er sie aus einem anderen Blickwinkel betrachten wollen als mich. Dabei war Yara die weitaus Ambitioniertere von uns beiden. Ich an seiner Stelle hätte das gesamte Grenaldi-Imperium lieber in ihre Hände gelegt. Nur sah die Familientradition etwas anderes vor.
»Oh, Chérie, das habe ich nicht gesagt«, versuchte er, sie zu beschwichtigen, und tätschelte ihren Arm. »Aber erstens hast du nicht so viel Erfahrung mit der Presse und dem Fernsehen wie dein Bruder, und zweitens haben du und Nolan dank eurer neuen Nummer weitaus härter zu trainieren. Eli hat einfach mehr Zeit, um sich darum zu kümmern. Es ist doch kein Problem, oder?« Sein Blick wanderte zu mir zurück, und ich versuchte, ihm standzuhalten.
Sag, dass du keinen Bock darauf hast. Dass du Besseres zu tun hast und es dich ankotzt, andauernd irgendjemandem Fragen zu beantworten. Sag es!
Ich schluckte die aufkommenden Worte hinunter und rang mir ein Lächeln ab. »Nein, es ist kein Problem.« Wen willst du verarschen? »Hübschen Journalistinnen bietet man doch gern seine Hilfe an, oder?«
Kaum hatte ich es ausgesprochen, erntete ich drei verschiedene Reaktionen: Yara verschluckte sich an ihrem Orangensaft, Nolan hob eine Augenbraue – Alter? –, und Papa räusperte sich verärgert.
»Elio, das ist kein Freifahrtschein«, sagte er in ernstem Ton. »Du verhältst dich anständig, klar?«
Ich hob beschwichtigend die Hände. »War nur ein Witz. Natürlich werd ich mich anständig verhalten.«
Ich würde nie etwas mit einer Journalistin anfangen. Solche Leute hatten zu viel gegen einen in der Hand, wenn es schiefging. Und ich war nicht interessiert daran, irgendwelche Negativschlagzeilen zu sammeln. Eigentlich wollte ich überhaupt keine Schlagzeilen sammeln.
»Gut.« Papa atmete kaum hörbar auf. »Vielen Dank. Ich werde natürlich auch für Fragen und Interviews zur Verfügung stehen. Ich denke nur, dass es ihr lieber wäre, mit jemandem auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.«
»Kein Ding …«, murmelte ich. Gedankenverloren schob ich das Ei auf meinem Teller herum, während ich spürte, wie mein Lächeln unter dem Gewicht meiner Lüge zu bröckeln begann.
Warum tat ich das andauernd? Warum konnte ich nicht einmal aussprechen, was ich wirklich dachte?
Du weißt, warum.
»Wenn es dir zu stressig wird, dann gib mir Bescheid, okay?«, fragte Yara, die meinen Stimmungswandel offenbar bemerkt hatte.
Ich riss mich zügig wieder zusammen und zwinkerte ihr verstohlen zu. »Ich komm schon klar, Papillon. Ist schließlich nicht mein erstes Mal.«
Und es würde gewiss auch nicht mein letztes Mal sein. Papa hatte recht. Wenn ich später seinen Posten übernehmen sollte, würde ich ohnehin ständig mit der Presse oder dem Fernsehen konfrontiert werden. Vielleicht sollte ich endlich aufhören, sämtliche Energie darauf zu verschwenden, mich gegen dieses Leben zu sträuben, und es stattdessen einfach annehmen. Vielleicht würde das alles leichter machen.
»Margo ist der netteste und entspannteste Mensch, den ich kenne«, warf Nolan jetzt ein, womit er mich aus den Gedanken riss. »Eli wird sie sicher mögen.«
Yara gab ein Schnauben von sich. »Oh, da bin ich mir sicher.«
Meine spitze Zunge wollte schon etwas darauf erwidern, da bemerkte ich Marty, der hinter Nolan auftauchte.
Er legte ihm eine Hand auf die Schulter, was ihn vor Schreck zusammenzucken ließ. »Seht an, was haben wir denn hier? Frühstück ohne mich?«
Papa lehnte sich mit vollgeschlagenem Bauch auf seinem Stuhl zurück und lachte. »Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, uns Gesellschaft zu leisten, Martin.«
Unser Betriebsleiter winkte ab. »Ach, schon in Ordnung. Ich wollte euch eigentlich auch nur kurz das hier vorbeibringen. War heute Morgen nämlich schon in der Stadt.«
Er legte eine Zeitung in die Mitte des Tisches, damit wir alle einen Blick auf die Titelseite werfen konnten, auf der ein Artikel dem Zirkus gewidmet war: Le monde de rêve:Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Circus Grenaldi gastiert ab nächster Woche in Montreal.
Direkt darunter ein Show-Foto von Yara und Nolan.
Nach der vergangenen Saison, in der sie den Zuschauerliebling gewonnen hatten, waren sich beide schnell einig gewesen, auch künftig gemeinsam aufzutreten. Dieses Mal jedoch nicht am Luftring, sondern mit Strapaten. Eine Fertigkeit, die beide in den Frühjahrstrainings schon einiges an Nerven abverlangt hatte.
Ich fand es noch immer ironisch, dass die diesjährige Tour unter dem Motto Traumwelt lief, wo ich doch Dutzende davon in meinem Kopf trug. Wahrscheinlich hatte ich mich deshalb dazu entschieden, meine Nummer an einen Albtraum in Schwarz-Weiß anzulehnen. Ich meine, hey, sie hatten angefangen.
Ich ließ den Artikel nach kurzem Überfliegen links liegen und widmete mich wieder meinem Teller. Yara hingegen nahm die Zeitung an sich und reichte sie mit einem Schmunzeln an Nolan weiter.
Sieh mal, das sind wir, sagte ihr Blick. Und dieses Wir machte ihn so sichtlich stolz, dass er sich lächelnd zu ihr lehnte, um ihr einen Kuss auf die Schläfe zu drücken.
Ich wollte nicht hinsehen, aber wegsehen konnte ich auch nicht. Es war eine ihrer kleinen Gesten, in denen so viel Wärme und Zuneigung steckte, dass mein Hals eng wurde. Davon gab es viele. Wenn sie ihm spielerisch das Haar raufte. Wenn er mit Gigi rausging, obwohl es schweinekalt war und in Strömen regnete. Oder wenn sie sich unter den Tisch beugte, um einen Stift aufzuheben und er, ohne das Gespräch mit meinem Vater zu unterbrechen, die spitze Tischkante umfasste, damit sie sich beim Aufrichten nicht den Kopf stieß.
Ganz so, als bräuchten sie kein Ich liebe dich, weil auch ein simples Ich bin da genügte.
»Sie haben euch gut getroffen«, bemerkte Papa mit weicher Miene. Womöglich glomm sogar ein Funken Stolz in seinen Augen auf.
»Mein Reden«, sagte Marty. Sein Blick segelte zu dem Korb mit den Croissants und blieb einen Moment zu lange daran haften. Also nahm ich eines heraus und reichte es ihm.
»Nimm schon und setz dich, Marty.«
»Die Kinder haben recht. Komm, ich hole dir noch einen Stuhl.« Papa erhob sich und verschwand im Inneren des Wagens, weshalb Marty das Croissant widerwillig an sich nahm.
»Na schön. Danke, Junge.«
Wenig später saßen wir zu fünft am Tisch und unterhielten uns, während das Zirkusdorf nach und nach zum Leben erwachte. Stimmengewirr flirrte in der Luft, ein paar Türen öffneten und schlossen sich. Ab und zu ging jemand an uns vorbei und grüßte.
Als wir den Tisch nach dem Essen schließlich wieder abräumten, tippte ich Yara auf die Schulter.
»Trip ist mit Mael und Oz an den Strand gefahren. Er meinte, wenn wir Lust haben, können wir nachkommen. Seid ihr dabei?«
Sie und Nolan tauschten einen kurzen, vielsagenden Blick miteinander und lächelten. »Sicher.«
*
Wir hatten noch unsere Cousinen Fanni und Stella eingesammelt, bevor wir gemeinsam zum Strand aufgebrochen waren, der eigentlich nichts anderes war als ein schmaler Sandstreifen an einer Ausbuchtung des Flusses, welcher sich wie eine Hauptschlagader durch Montreal zog.
Es war nicht so überfüllt, wie ich es bei diesem Wetter angenommen hätte, dementsprechend benötigten wir nicht lange, um den Platz der anderen zu finden. Sie hatten neben einer großen Decke und einem Picknickkorb auch noch einen Kasten Bier mitgenommen, der im Schatten des Sonnenschirmes stand und vermutlich längst warm geworden war.
Trip und Mael warfen sich im hüfthohen Wasser einen Volleyball zu, wohingegen Oscar mit seinem Handtuch auf der Decke lag und in der Sonne döste.
Sobald er uns kommen hörte, setzte er sich auf. »Hey Leute. Habt ihr es also doch geschafft?«
Ein paar tropfende Haarsträhnen umrahmten sein Gesicht. Sie schimmerten genauso golden wie der feuchte Schleier auf seiner Haut. Offenbar war er zuvor selbst noch im Wasser gewesen.
»Sieht ganz danach aus, was?«, sagte Fanni und warf ihre Tasche in den Sand. Kurz darauf zog sie sich ihr Kleid über den Kopf, unter dem ein roter Bikini zum Vorschein kam, und rannte mit den Worten »Wer zuerst drin ist!« in Richtung Wasser.
Auch die anderen schlüpften aus ihren Klamotten und ließen sie achtlos im Sand liegen. Als Nolan bemerkte, dass Yara im Begriff war, sich mit ihrem Handtuch neben Oscar auf die Decke zu legen, schnalzte er missbilligend mit der Zunge. »Oh nein, vergiss es.«
»Was …« Yara stieß einen spitzen Schrei aus, als er sie packte und kurzerhand über seine Schulter warf. »Nole, wehe! Das Wasser ist eiskalt!«
»Das werden wir ja gleich sehen.«
»Ich warne dich!«, rief sie, als er unbeirrt mit ihr auf das Wasser zulief. »Nole!«
In der nächsten Sekunde war nur noch eine Mischung aus Yaras Gekreische und einem lauten Platschen zu hören. Sowie sie beide wieder an der Oberfläche auftauchten, schnappte Yara nach Luft und strich sich das Haar aus der Stirn. »Du bist unmöglich!«
Nolan lachte. »Solltest du das nicht langsam mal wissen?«
Ich grinste kopfschüttelnd in mich hinein, während ich Stella beobachtete, die deutlich zurückhaltender vorging und sich nur langsam vortastete. Erst die Füße, dann die Knöchel … Wenn sie in dem Tempo weitermachte, würde sie morgen noch am Ufer stehen.
Mit einem Ächzen ließ ich mich neben Oscar auf die Decke fallen. »Was sitzt du hier ganz allein?«
»Wollte mich kurz ein bisschen aufwärmen«, antwortete Oscar gedankenversunken. »Der Wind ist scheißkalt, wenn man im Wasser ist.«
Noch als er es aussprach, spürte ich die leichte Brise, die wie eine Feder über meine nackte Haut strich. »Verstehe.«
Mir fiel auf, dass sein Blick weiterhin auf Nolan und Yara verharrte, die lachend miteinander herumalberten. Er musste nichts sagen, damit ich wusste, was ihm in dieser Sekunde durch den Kopf ging. Oscar war nicht nur mein ältester Freund seit Kindheitstagen, sondern vor allem Yaras. Vermutlich war ich deshalb auch nur halb so überrascht gewesen, als herausgekommen war, dass er Gefühle für sie hatte. Gefühle, die derart stark gewesen waren, dass er sogar versucht hatte, Nolan loszuwerden.
Er hatte Yara das Herz gebrochen, und irgendwo nahm ich ihm das noch immer übel. Trotzdem hatten wir ihm inzwischen alle verziehen. Selbst Nolan – aber wen wunderte das?
Als ich ihn mal gefragt hatte, ob er es nicht seltsam fand, von nun an quasi direkt neben Oscar zu wohnen, hatte er mit den Schultern gezuckt und gesagt, dass er nicht länger an seiner Wut auf ihn festhalten wolle. Also würde ich das auch nicht tun. Gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass Oscar den beiden ihr Glück vermieste.
»Komm schon, Oz. Wenn du die ganze Zeit mit einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter hier rumsitzt, wird Yara es merken und sich schlecht fühlen«, sagte ich deshalb.
»Ich weiß.« Oscar seufzte tief und riss den Blick widerwillig von ihnen los. »Es ist nur … der Teil, der mit ihr befreundet ist, freut sich darüber, dass sie glücklich ist. Wirklich. Aber der Teil, der in sie verschossen ist, würde Nole am liebsten ertränken. Egal, wie nett er ist.«
Ich hob eine Augenbraue. »Bisschen drastisch, meinst du nicht?«
»Du weißt, wie ich das meine.« Oscar lachte leise, während er mit seinem Finger kleine Kreise in den Sand malte. »Aber ist schon okay. Ich habe ihr versprochen, dass ich damit klarkomme.«
»Bevor du wusstest, dass Nole zurückkommt.« Ich musterte ihn mitfühlend von der Seite.
Womöglich hatte ich ihm nicht nur vergeben, weil alle anderen es getan hatten, sondern auch, weil ich es als Bestrafung genug empfand, Yara und Nolan von nun an jeden Tag so sehen zu müssen.
»Bevor ich wusste, dass Nole zurückkommt, ja …«, wiederholte er mit einem Nicken. »Aber so ist es jetzt halt. Ich kann’s nicht ändern und will es auch gar nicht. Wie gesagt, ich freue mich für sie. Deshalb werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen, und weiterhin ein bisschen auf Abstand gehen.«
Ich stupste ihn mit meiner Schulter an. »Wenn ich irgendwie helfen kann oder du Ablenkung brauchst, dann sag einfach Bescheid, okay?«
Es war schließlich nicht so, als würde ich nicht selbst Tag für Tag danach suchen.
Oscar lächelte halbherzig. »Danke, Mann.«
»Wie läuft das Training?«, fragte ich, um auf ein anderes Thema zu lenken. »Immer noch schleppend?«
»Könnte besser, aber auch schlechter sein«, gab er gleichgültig zurück.
Ursprünglich hatte Oscar diese Saison wieder auftreten wollen wie vor seinem Unfall, doch war es ihm trotz wochenlangem Training noch nicht wieder gelungen, sein altes Level zu erreichen. Stattdessen war er jetzt Teil einer Gruppendarbietung, bei der er sich ein wenig im Hintergrund halten konnte.
»Es ist nicht optimal«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. »Trotzdem bin ich froh, wieder an den Shows teilnehmen zu dürfen. Das letzte Jahr hat mich echt fertiggemacht.«
Was du nicht sagst.
Ich beobachtete, wie Fanni sich von der Gruppe im Wasser entfernte und mit großen Schritten auf uns zugeschlendert kam. Oscar hob den Blick und streifte flüchtig über die Rundungen ihres Körpers, bevor er den Sand von seinem Handtuch klopfte und zur Seite rutschte, damit sie sich setzen konnte.
»Ich brauche nur meine Sonnencreme«, verkündete Fanni, kaum dass sie bei uns angekommen war. »Du weißt ja, wie schnell ich Sonnenbrand im Nacken kriege.«
»Soll ich dir den Rücken eincremen?«
»Nicht nötig, danke.« Fanni rubbelte sich mit ihrem Handtuch trocken, ehe sie mit der Creme in der Hand zurück zu den anderen ging. Sie rief Mael, der ihr am nächsten stand, aus dem Wasser und bat stattdessen ihn, ihr die Schultern und den Rücken einzureiben.
Ich blinzelte. »Was zum …«
»Alter, keine Ahnung«, brummte Oscar, der die Zähne so fest aufeinandergebissen hatte, dass seine Kiefermuskeln hervorstachen. »Seit der Sache mit Nole geht das so. Ich glaube, das ist ihre Art von Rache. Und es kotzt mich an, dass es funktioniert.«
Langsam wandte ich ihm den Kopf zu. »Dann stört es dich, sie mit ihm zu sehen?«
»Natürlich stört es mich, zu sehen, wie andere Kerle sie anfassen.« Oscar schnaubte. »Sie ist meine beste Freundin. Aber ich rede eher davon, dass sie mir neuerdings ständig die kalte Schulter zeigt.«
»Hm«, machte ich. Das war interessant.
Er schien meinen überraschten Tonfall zu bemerken. »Was ist?«
»Na ja«, sagte ich mit einem Schmunzeln auf den Lippen, »du weißt, dass man sich auch zu mehreren Personen gleichzeitig hingezogen fühlen kann, oder?«
Seine grauen Augen verengten sich. »Wieso sagst du das?«
»Nur so.«
»Leute, kommt ihr jetzt mal rein, oder was?«, brüllte Trip mit Trichterhänden aus dem Wasser.
»Na los.« Ich stieß Oscar an, schlüpfte aus meinem Shirt und stand auf. Ohne lange zu zögern, rannte ich auf den Fluss zu und stürzte mich mit einem Hechtsprung hinein.
»Verdammt, Eli!«, fluchte Stella, als sie meine Spritzer abbekam. Sie hatte es immerhin bis zur Hüfte hineingeschafft.
»Willst du ewig da rumstehen?«, fragte ich beim Auftauchen.
»Und wenn? Es ist viel zu kalt.«
»Findest du?« Ich näherte mich ihr, weshalb sie mit großen Augen ein paar Schritte rückwärts taumelte.
»Oh nein. Nein-nein-nein-nein.« Stella wollte sich gerade umdrehen, da bekam ich ihr Handgelenk zu fassen und zog sie mit einer geschmeidigen Bewegung zu mir.
»Du bist so ein Arsch!«, japste sie und schleuderte mir neben einer Handvoll weiterer Flüche einen fetten Schwall Wasser entgegen, der mich nur noch mehr zum Lachen brachte.
Keine Frage, das hier war einer: einer dieser Momente, in denen ich den Auslöser gedrückt hätte, um mich später daran zu erinnern.
2 | Margo
27. Juni, Toronto
Die Sonne knallte durch das offene Autofenster und brannte auf meiner Haut. Aufgrund der fehlenden Klimaanlage war mein Rücken bereits nass geschwitzt, als ich meinen hellblauen Käfer auf den Parkplatz lenkte, auf dem natürlich alle Plätze im Schatten der großen Eichen schon belegt waren.
Ich schaltete den Motor aus, kurbelte die Fenster bis zum Anschlag hinunter und betrachtete skeptisch die zwei Kräutertöpfe vom Markt, die im Fußraum des Beifahrersitzes standen: Estragon und Koriander. Der ganze Innenraum roch danach.
Hoffentlich würden sie mir die zwei Stunden Mittagshitze verzeihen.
Sobald ich die Tür abgeriegelt hatte, steuerte ich den Eingang der Seniorenwohnanlage an. Darum, dass jemand die Kräuter in meinem Wagen – wahlweise auch den Wagen selbst – stehlen könnte, machte ich mir keine Sorgen. Der rostige Käfer war so alt, dass er für jeden Langfinger mehr Ballast als Gewinn dargestellt hätte. Dabei hielt er sich für sein Alter ausgesprochen wacker.
Er schien aus demselben robusten Material wie sein ehemaliger Besitzer gefertigt worden zu sein.
Grampa hatte ihn mir vermacht, bevor er in die Seniorenresidenz gezogen war. Nach dem Tod meiner Gramma hatte ihn in ihrem großen Haus nichts mehr gehalten. Vermutlich weil an jedem Möbelstück Erinnerungen an sie hafteten. Wie eine unsichtbare Staubschicht, die einen in Herz und Augen zwickte, wenn man sie versehentlich aufwirbelte.
Deshalb kam ich auch sooft ich konnte her: Ich ertrug den Gedanken nicht, dass er hier eines Tages genauso in Einsamkeit ertrinken könnte, wie es mir vielleicht passiert wäre, wenn ich ihn und Gramma damals nicht gehabt hätte.
Ich betätigte die Klingel neben der Flügeltür, auf der der Nachname Jennings stand, und wartete.
Und wartete.
Und wartete.
Währenddessen ließ ich meinen Blick über die schlossähnliche Anlage und das Gebäude schweifen. Die graue Backsteinfassade trug tiefe Narben, die von Wind und Wetter zeugten. Ein paar gefüllte Rosen rankten sich an den weißen Sprossenfenstern entlang und erstickten Teile der verzierten Rahmen unter ihrer blassgelben Blütenpracht. Der gepflegte Rasen war von einem satten Grün und sorgsam gekürzt. Um die Stellen, an denen die Köpfe bunter Wildblumen aus dem Boden ragten, hatte man einen Bogen gemacht, als hätte man es nicht über sich gebracht, sie zu stutzen.
Dünne Gesprächsfetzen hingen in der flirrenden Luft, und es roch, als wäre erst vor wenigen Minuten gemäht worden. Ich entdeckte ein paar Senioren, die auf dem Weg in den angrenzenden Park waren. Manche mit Pflegepersonal, andere mit ihrer Familie.
Grampa bekam nur selten Besuch. Ein Großteil unserer Verwandtschaft lebte drüben in Vancouver und kam höchstens einmal im Jahr zu seinem Geburtstag vorbei. Und Mom und Dad waren seit jeher mit ihrem Job verheiratet.
Wann immer ich an sie dachte, dachte ich zuerst an gepackte Koffer im Flur. An Kaffeeflecken auf der Rückseite bunter Postkarten. An gehetzte Geburtstagsanrufe und bedeutungslose Mitbringsel.
Als ich noch klein gewesen war, hatte man mich einmal gefragt, warum ich Journalistin werden wolle. Meine Antwort war auf Knopfdruck gekommen: »Damit ich meinen Eltern nachreisen kann.«
Jahre waren vergangen, und ich hatte gelernt, dass es nichts brachte, Menschen hinterherzurennen, die sich alle Mühe gaben, vor einem davonzulaufen.
Mein Berufswunsch war geblieben, die Intention dahinter eine andere: Ich wollte schreiben. Über die Welt und alles, was sie bereithielt. Ich wollte sie mit eigenen Augen sehen. Nicht auf Postkarten oder Fotos.
Möglicherweise war ich schon mit Abenteuerdurst auf die Welt gekommen. Vielleicht hatten sie mir die Wanderlust auch in die Wiege gelegt. Das wäre neben der Leerstelle in meiner Kindheit immerhin noch etwas anderes, das sie mir hinterlassen hätten.
Manchmal wusste ich wirklich nicht, was oder wer aus mir geworden wäre, hätte ich meine Großeltern nicht gehabt. Sie waren immer mein Sicherheitsnetz gewesen, wenn meine Eltern mich fallen gelassen hatten.
Als endlich das Geräusch des Türöffners ertönte, fuhr ich mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock.
Grampa stand bereits im Türrahmen und lugte auf den Flur hinaus. Sobald er mich erkannte, erhellte ein Lächeln sein Gesicht. »Margo!«, sagte er erfreut. »Du hast dich gar nicht angekündigt.«
»Ich weiß.« Ich gab ihm einen schnellen Kuss auf die Wange. »Aber ich wollte noch mal vorbeischauen, bevor ich am Montag fliege. Kann ich reinkommen?«
Er trat ein Stück beiseite und deutete mit seinem Gehstock ins Innere der Wohnung, sodass ich eintreten konnte. Sie war nicht besonders groß, dafür schwamm sie dank der bodentiefen Fenster regelrecht in Licht.
Neben der Tür befand sich eine schmale Küchenzeile, auf der sich ein paar Töpfe türmten. Vom Wohnzimmer aus führte eine offen stehende Flügeltür in das angrenzende Schlaf- und Badezimmer. Ich wollte gerade einen Blick hineinwerfen, um nach dem Rechten zu sehen, als ich Mr Petersson bemerkte, Grampas Nachbar, der an dem kleinen Esstisch saß.
Offenbar waren sie dabei gewesen, eine Runde Karten zu spielen, bevor ich geklingelt hatte.
»Hey, Mr P.«, grüßte ich ihn lächelnd.
»Margo.« Er nickte mir knapp zu, ohne von seinen Karten aufzublicken.
Das war nichts Neues. Mr Petersson war ein Mensch der wortkargen Sorte, ähnlich wie mein Grampa.
Trotzdem mochte ich ihn. Und ich war mir sicher, dass er mich irgendwo unter seiner harten Schale ebenfalls mochte. Auch wenn er gern vorgab, ich würde ihm seinen letzten Nerv rauben. Nicht ganz unberechtigt, wie ich fand.
»Haben Sie eigentlich keine eigene Wohnung, oder warum hängen Sie andauernd hier drüben rum?«, fragte ich neckisch.
Mr Petersson hob eine Augenbraue und blickte zu Grampa, der sich mit einem Ächzen zurück auf seinen Stuhl fallen ließ.
»Deine Enkelin ist frech.«
Grampas Mundwinkel zuckte, als er seine Brille zurechtrückte und die Karten wieder aufnahm. »Wilde Herzen sollte man nicht zähmen, Earl. Weißt du doch.«
Ich drückte mit einem Grinsen seine Schulter. Dann griff ich in meinen Stoffbeutel und förderte einen ganzen Stapel Rätselhefte zutage.
»Hier.« Ich legte sie auf dem Tisch ab. »Teilt euch die für die nächsten drei Monate besser gut ein. Ich habe nicht vor, euch alle zwei Wochen neue zu schicken.«
Anschließend ging ich zu der Anrichte unter dem Fernseher, auf dem das vertraute Bild meiner Gramma stand. Direkt daneben eine Porzellanvase mit vertrockneter Calendula.
Ich warf die Blumen weg, wechselte das Wasser und tauschte sie mit frischem Vergissmeinnicht aus, das ich vom Markt mitgenommen hatte. Das letzte für dieses Jahr, wie man mir gesagt hatte.
Bei dem Anblick tastete meine Hand wie von selbst nach dem Kettenanhänger, der unter meinem Top verschwunden war. Es war eine kleine Glaskugel mit drei hellblauen Vergissmeinnicht-Blüten. Gramma hatte sie mir vor zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt. Ich fragte mich, ob sie zu dem Zeitpunkt schon etwas gewusst hatte. Und falls ja, ob die Kette eine stumme Bitte gewesen war.
Dabei war es für mich schon längst kein Vergissmeinnicht mehr. Es war Vergissdeinnicht. Denn das würde ich nicht.
Nie, Gramma.
Ich musste schlucken und den Blick abwenden, da begegnete ich Grampas, der seelenruhig auf mir lag.
»Schöne Blumen«, sagte er schlicht.
Er wusste, dass es ihre liebsten gewesen waren. Natürlich wusste er das. Grampa war schon immer jemand gewesen, der mit ganzem Herzen fühlte, aber nur mit halbem sprach. Und trotzdem hatte er meiner Gramma nie Anlass gegeben, an seiner Liebe zu zweifeln. Vielleicht war das auch der Grund dafür, weshalb ich mich insgeheim so sehr nach einer Beziehung sehnte, die ähnlich tiefgründig war und ewig hielt.
»Warum müssen wir uns die Hefte einteilen?«, riss Mr Petersson mich aus meinen Gedanken. »Hast du vor, wegzufahren?«
»Wieso? Höre ich da etwa einen Hauch von Hoffnung in Ihrer Stimme?«
Er schmunzelte. Nur leicht und doch mehr als gewöhnlich. »Möglich.«
Ich setzte mich zu ihnen an den Tisch und griff in der Keksdose nach einem Cookie, an dem ich mir fast die Zähne ausbiss, weil er steinhart war. »Sie nehmen mir die Sache mit dem Haarschnitt immer noch übel, was?«
Mr Petersson grunzte. »Hast du eine Ahnung, wie viele Bilder sie an diesem Abend geschossen haben?«
Ich verkniff es mir, die Augen zu verdrehen.
Vor ein paar Monaten hatte die Verlobungsfeier seines Enkels angestanden. Da er sich – wie üblich – zu spät um einen Friseurtermin bemüht und in einem fort am Zustand seiner Frisur herumgemäkelt hatte, hatte ich ihm kurzerhand angeboten, das zu übernehmen.
Viel Haar besitzt er ja nicht mehr, hatte ich gedacht.
Nun … am Ende hatte er nahezu keines mehr gehabt, weil ich beim Trimmen der Seiten den Aufsatz verwechselt hatte.
»Ach, kommen Sie, so schlimm war es nicht.«
Mr Petersson zog die Dose mit den Cookies kopfschüttelnd zu sich. »Gut, dass du keine Friseurin geworden bist. Auf Dauer wärste verhungert.«
Ich hob eine Braue. »Wer wird jetzt frech?«
Ein tiefes Lachen schüttelte seinen Körper. Es klang, als wäre es ihm irgendwann vor langer Zeit mal in seiner Kehle stecken geblieben, wo es angefangen hatte, zu rosten.
»Bekomme ich nun eine Antwort auf meine Frage oder nicht?«, hakte er nach, bevor er eine Karte legte.
»Sie hat doch die neue Arbeit«, kam Grampa mir zuvor. »Bei dem … Was sagtest du noch mal?«
»Bei Comet. Dem Streaminganbieter.«
Genau genommen einem der größten Streaminganbieter Kanadas. Doch obwohl sich Studierende und Berufseinsteigende regelrecht auf Praktikumsstellen wie diese stürzten, war Comet eigentlich nie meine erste Wahl gewesen, deshalb sah ich mich auch nicht mein Leben lang dort.
Am liebsten hätte ich für das bekannte Kulturmagazin CanCulture gearbeitet und Artikel über Kunst, Literatur, Essen und Reisen geschrieben, weil genau das Dinge waren, für die ich brannte. Nur hatten sie mich abgelehnt.
Nichtsdestotrotz wäre eine eigens gedrehte Dokumentation auf einer Streamingplattform wie Comet ein Traum. Schließlich war jede Referenz, die ich später in meinem Lebenslauf angeben konnte, in einem Job wie meinem Gold wert.
»Comic? Nie gehört«, gab Mr Petersson zurück. »Was ist das für eine Firma?«
»Nicht Comic, Comet«, korrigierte ich. »Das ist eine Medienplattform, die Filme und Serien online auf Abruf zur Verfügung stellt. Das heißt, man kann selbst entscheiden, was man sich ansieht und wann.«
Mr Petersson verzog das Gesicht, was ihn noch eine Spur kauziger aussehen ließ. »Ach, das ist mir alles zu modern. Ich bleibe lieber bei meinem guten alten Kabelfernsehen.«
Das wunderte mich nicht. Wenn er solche Dinge sagte, erinnerte er mich an meinen Mitbewohner Freddy, der genauso geübt darin war, fließend Pessimistisch zu sprechen.
»Und warum musst du dafür nach Montreal fliegen?«, erkundigte sich Grampa, der sich offenbar nicht mehr daran erinnern konnte, dass er mir dieselbe Frage erst vor wenigen Tagen am Telefon gestellt hatte.
»Ich habe mir überlegt, für meine Dokumentation zwei Zirkusse zu begleiten«, erzählte ich also erneut. »Einen mit Wildtieren im Programm und einen ohne. Ich will sie einander gegenüberstellen und den Zuschauenden zeigen, dass ein tierfreies Konzept viel sinnvoller und zeitgemäßer ist. Und der erste Zirkus gastiert seit ein paar Wochen in Montreal.«
»Und ich dachte, man geht hauptsächlich wegen der Tiere in einen Zirkus.« Mr Peterssons Stimme hatte einen leicht spöttischen Unterton angenommen.
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. »Aber so sollte es nicht sein. Löwen und Elefanten in winzige Käfige zu sperren und bei Wind und Wetter kilometerweit über den Highway zu transportieren ist Tierquälerei. Dass es noch keine einheitlichen Gesetze gibt, die das verbieten, finde ich grausam.«
Mr Petersson nahm einen Schluck von seinem Apfelsaft, ehe er sich räusperte und die nächste Karte legte.
»Als ich etwa in deinem Alter war, habe ich mal als Stallbursche in einem Zirkus gearbeitet. Die Tiernummern waren immer die beliebtesten, und laut dem Direktor auch der einzige Grund, weshalb sie noch nicht pleite waren. Das war vor gut fünfzig Jahren. Und damals hatte noch keiner von uns diese magischen Taschencomputer.«
»Sie meinen Smartphones?«
»Was auch immer.« Er winkte ab. »Die Frage ist doch: Wie will man ein Publikum, das nur noch an diesen kleinen Bildschirmen zu kleben scheint, von einem Programm begeistern, wenn man nicht einmal ausgefallene Tiere besitzt? Menschen kommen in den Zirkus, um etwas Außergewöhnliches zu sehen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben.«
Ich spürte, wie sich mein aufkommender Groll in meinen geballten Fäusten staute. »Man kann doch auch ohne Tiere außergewöhnlich sein. Der Circus Grenaldi arbeitet beispielsweise mit Hologrammen. Und sie haben unheimlich talentierte Artistinnen und Artisten aus aller Welt dort, die ich gern zu ihrer Arbeit befragen würde.«
»Grenaldi …«, überlegte Grampa laut. »Sagtest du nicht, dein Freund Nolan würde dort jetzt arbeiten?«
Kaum erwähnte er meinen besten Freund, entspannte ich mich wieder ein wenig.
Nolan hatte vergangenes Jahr sein Jurastudium abgebrochen, obwohl seine Eltern ihn immer in der familieneigenen Anwaltskanzlei hatten sehen wollen. Als ehemaliger Leistungsturner hatte er schon sein halbes Leben lang eine Leidenschaft für Akrobatik besessen und diese nun kurzerhand zu seinem Beruf gemacht. Ich freute mich für ihn, dass er endlich einen Ort gefunden hatte, an dem er glücklich war und die Menschen ihn zu schätzen wussten. Er selbst hatte nie gelernt, wie man gut zu sich war, und trotzdem gelang es ihm immer, einem das Gefühl zu geben, dass man wertvoll war.
»Ja, tut er«, antwortete ich nickend. »Und er ist wirklich unglaublich gut, Grampa! Wenn der Zirkus im Herbst herkommt, nehme ich dich zu einer Show mit. Sie am besten auch, Mr P. Sie könnten dringend mal wieder eine Portion Vitamin D gebrauchen, wenn Sie mich fragen.«
Er gab zum wiederholten Mal ein Schnauben von sich. »Solange du mir dafür nicht wieder die Haare schneidest.«
Ich streckte ihm die Zunge raus.
»Wenn du Nolan in den nächsten Wochen siehst, sag ihm, er soll mir gut auf dich achtgeben«, bat Grampa. »Mir gefällt das nicht, dass sie dich ganz allein durch die Gegend reisen lassen.«
Ich legte den Kopf schief. »So weit weg ist Montreal nicht, Grampa. Ich habe ja nicht vor, nach Timbuktu zu reisen.«
Er wirkte nicht überzeugt von meinen Worten, bis ihm plötzlich etwas anderes einzufallen schien. »Apropos Reisen. Hast du in letzter Zeit mit deinen Eltern telefoniert?«
Mir entwich ein tiefes Seufzen. Es war lange her, dass ich mit ihnen gesprochen hatte, und noch länger, dass ich sie zu Gesicht bekommen hatte.
Beide waren Journalisten mit Leib und Seele und engagierten sich obendrein ehrenamtlich, indem sie ausländische Organisationen und Projekte unterstützten. Derzeit waren sie irgendwo in Afrika unterwegs, drehten Material für Dokumentationen und halfen Kindern in Waisenhäusern dabei, Englisch zu lernen. Keine Frage, ich war stolz auf sie und ihre Arbeit. Nur war das eben auch schon alles, worauf ich stolz sein konnte.
Noch oft begleitete mich der leise Zweifel, dass ich ihre Liebe damals einfach nicht wert gewesen war. Vielleicht versuchte ich aber auch nur, mir das einzureden, um meine Wut auf sie zu rechtfertigen.
»Nein«, murmelte ich nach einer zu lang geratenen Pause. »Schon eine Weile nicht mehr.«
»Warum nicht?«
»Kein Bedarf.« Ich vermied es, in Grampas Richtung zu schauen, weil ich den Vorwurf in seinem Blick nicht sehen wollte.
Ich verstand nicht, wie er darauf beharren konnte, dass ich den Kontakt zu jemandem aufrechterhielt, dem ich, dem wir