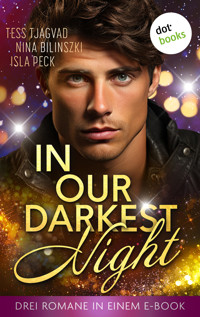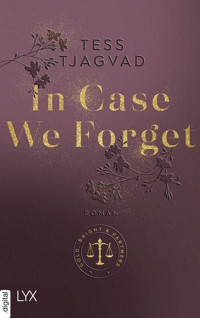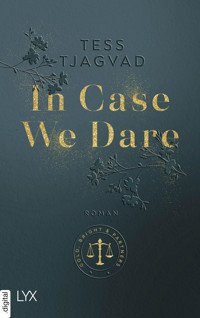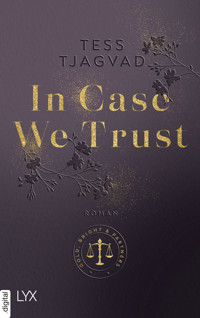
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gold, Bright & Partners
- Sprache: Deutsch
Sie sind Rivalen, doch können das Knistern zwischen ihnen nicht leugnen
Nach dem Jurastudium will sich Gracie endlich als Anwältin bei Gold, Bright & Partners, einer der erfolgreichsten Kanzleien Bostons, beweisen. Aber der Konkurrenzkampf unter den jungen Anwält:innen ist härter als gedacht. Ihr größter Rivale in der Gruppe von ehrgeizigen Anfänger:innen ist der attraktive Ira, der zu allem Überfluss auch noch auf denselben Fall angesetzt wird. Trotz ihres schlechten Starts kommen sich die beiden bei spätabendlichen Recherchearbeiten schon bald immer näher. Doch Gracie verbirgt ein Geheimnis, das ihre Karriere gefährden könnte - und Ira als ihr größter Konkurrent auf keinen Fall erfahren darf ...
»Tess erweckt mit Gracie und Ira zwei Figuren zum Leben, die echter und berührender nicht sein könnten. Ihre Geschichte ist leise und laut, zart und doch so eindrücklich, dass sie noch lange in Erinnerung bleibt.« LENA KIEFER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Leser:innenhinweis
Playlist
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Tess Tjagvad bei LYX
Impressum
TESS TJAGVAD
In Case We Trust
GOLD, BRIGHT & PARTNERS
Roman
Zu diesem Buch
Endlich auf eigenen Beinen stehen! Gracie Hoffman wünscht sich nichts mehr, als ohne die Hilfe ihrer wohlhabenden Eltern als Anwältin erfolgreich zu sein. Deshalb steigt sie nicht wie geplant nach dem Studium in die Familienkanzlei ein, sondern bei Gold, Bright & Partners, einer der renommiertesten Kanzleien Bostons. Doch gleich am ersten Arbeitstag muss sie feststellen, wie groß die Konkurrenz dort ist. Allen voran macht ihr der gut aussehende Ira Briggs, einer von sechs jungen Anwält:innen, die gemeinsam mit ihr anfangen, das Leben schwer. Als sie dann auch noch auf denselben Fall angesetzt werden, ist die Rivalität zwischen ihnen vorprogrammiert. Bis Gracie bei ihren gemeinsamen Recherchearbeiten erkennt, dass Iras ruhige, aufmerksame Art nicht nur ihre Selbstzweifel verstummen lässt, sondern sie auch mehr und mehr fasziniert. Schon bald kommen sich die beiden immer näher. Doch Gracie hat ein Geheimnis, das ihre Karriere gefährden könnte – und Ira als ihr größter Konkurrent auf keinen Fall erfahren darf …
Für Leif
Danke, dass du mein Chaos ordnest.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Tess und euer LYX-Verlag
Playlist
Layers – Joel Ansett
Fear Of Water – Noah Kahan
Quiet Talkers – Ken Yates
Bird of Prey – Emily James
Waltz Right In – Matt Maeson
Evergreen – Jake Wesley Rogers
River Flows In You – Yiruma
Please Don’t Go Home Yet – Stephen Sanchez
Quiet Moon, Wild Sea – Dustin Tebbutt
Grey Room – Damien Rice
Clouds – Tow’rs
Mess Is Mine – Vance Joy
Habit – Riley Pearce, MADDY MAY
How To Be Yours – Chris Renzema
Villain – Searows
No Complaints – Noah Kahan
You’ll Find It – Chris Lanzon
Missionary Feelings – Hazlett
Second Chances – Gregory Alan Isakov
prove a thing – lighthearted
Somewhere – Vincent Lima
1
Gracie
Es gab eine Sache, die sich in meinem Leben immer wieder bewiesen hatte: Es verschaffte einem eine Menge Privilegien, eine Cabot zu sein. War es nun, jederzeit bei den Reichen und Beliebten am Tisch sitzen zu dürfen, obwohl man insgeheim wusste, dass einen bis auf Geld nichts mit diesen Menschen verband; dass man sich nie um Freundschaften bemühen musste, weil die Leute einem ohnehin andauernd an den Fersen klebten; oder dass die Lehrkörper gern ein Auge zudrückten, falls man mal einen Fehler machte.
Eine Cabot durfte sich schließlich keine Fehler erlauben.
Das stand mit Sicherheit irgendwo in meiner Geburtsurkunde: dick und rot eingekreist, damit es auch kein Entkommen gab. Anders konnte ich mir nicht erklären, warum ich mein Leben lang so versessen darauf gewesen war, keine zu machen. Und wozu das Ganze? Um erfahren zu müssen, dass alles, was ich geglaubt hatte, mir in den vergangenen Jahren abseits dieser Privilegien hart erarbeitet zu haben, womöglich auf einer Lüge basierte.
Die Frage, die ich mir nun seit einigen Wochen stellte, war: Was war noch von mir übrig, jetzt wo ich dieses schillernde Kostüm abgelegt hatte? Wer war ich darunter?
Bisher hatte ich noch keine Antwort darauf gefunden. Nur eine darauf, wer ich nicht mehr sein wollte.
Und das war eine Cabot.
Um das zu erreichen, war ich in einer neuen Wohnung untergetaucht, die meine Stiefmutter sicher naserümpfend als Absteige bezeichnet hätte. Obendrein hatte ich einen Job als Anwältin bei Gold, Bright & Partners angenommen. Einer Kanzlei, die nicht nur zu den renommiertesten Bostons gehörte, sondern zugleich auch die größte Konkurrenz meines Vaters darstellte.
Wahrscheinlich machte mich der Gedanke an meinen ersten Arbeitstag deshalb umso nervöser. War ich überhaupt schon so weit, mich in der gestandenen Rechtswelt zurechtzufinden, wenn es mir an manchen Tagen nicht einmal in meiner eigenen gelang? Oder war der Preis, den alle Berufseinsteigenden zahlen mussten, ein Wurf ins kalte Wasser – getreu dem Motto: Nur die Besten überleben? Ich mochte seit Kurzem vielleicht ohne Schwimmflügel schwimmen, was sich befreiend anfühlte, gleichzeitig empfand ich die Vorstellung als unheimlich angsteinflößend, weil plötzlich nichts mehr da war, das mich über Wasser hielt, falls es zu tief und undurchsichtig wurde. Wie sollte ich mich vor all diesen Menschen behaupten? Was, wenn ich nicht gut genug war?
Du tust es schon wieder.
Ich versuchte, die aufkommenden Zweifel mit einem schwachen Kopfschütteln zu verscheuchen und mich auf das Jetzt zu fokussieren. Und das sah erst mal nichts anderes vor, als den Umzug von meiner besten Freundin und mir über die Bühne zu bringen.
Es war Anfang Oktober. Ein paar vereinzelte Bäume an den Gehwegen hielten noch eisern an ihrem letzten Grün fest, wohingegen der Rest ein flammendes Farbspiel aus gelben und roten Tupfern bildete. Die Luft, die sich durch die Strickmaschen meines Pullovers zwängte, war mild, nicht kalt. Daher störte es mich auch nicht, dass ich mit Socken auf einem feuchten Blätterteppich an der Straße stand und mich an meinen letzten Umzugskarton klammerte wie an einen Rettungsring. Aber irgendwie war er das ja auch – ein rettender Neubeginn.
»In Ordnung, das war der Letzte. Der Transporter ist leer.« Der Mann vom Umzugsunternehmen schloss die Türen mit einem so lauten Knall, dass ich zusammenzuckte. »Ich schicke eine Kopie der Rechnung an Ms Cassidy …?«
»Lind«, antwortete ich. »Cassidy Lind. Sie hat ihre Kontaktdaten hinterlegt.«
»Gut. Ich bräuchte hier nur noch eine Unterschrift, dann sind Sie uns auch schon los.«
Kaum hatte ich meinen Karton abgestellt, drückte er mir ein schwarzes Clipboard in die Hand und tippte mit dem Zeigefinger, der von Nikotin ganz gelb war, auf die Stelle, an der ich unterschreiben sollte. Normalerweise las ich mir solche Dinge gern in Ruhe durch, bevor ich meine Unterschrift setzte. Immerhin wusste ich dank meines Studiums, wie gern sich verfängliche Klauseln im Kleingedruckten versteckten. Da der Mann jedoch so ungeduldig mit seinen Füßen wippte, als wäre er gedanklich schon woanders, seufzte ich und griff nach dem Stift.
Im ersten Moment wollte ich mechanisch mit Cabot unterzeichnen, bis mir einfiel, dass ich offiziell keine mehr war, da ich den Mädchennamen meiner Mutter angenommen hatte. Also schrieb ich Gracie Hoffman und betrachtete mein Werk.
Die letzten Buchstaben waren schief. Ich beherrschte den Schwung noch nicht. Dabei hätten sie mir so viel leichter von der Hand gehen müssen, weil nichts an ihnen hing. Kein Gefühl, kein Privileg und erst recht keine Erwartungen.
»Kann ich hiervon auch noch eine Kopie bekommen?«, fragte ich.
Der Typ verkniff sich merklich ein Augenrollen, riss dann aber den Durchdruck ab und reichte ihn mir. »Selbstverständlich, Miss.«
»Danke.« Ich faltete das Papier ordentlich zusammen und legte es auf meinen Karton, ehe ich diesen wieder an mich nahm. »Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche.«
»Ebenso«, sagte er mit einem knappen Nicken. Kurz darauf war er hinter das Lenkrad gerutscht und mitsamt seinem Transporter und seiner Kollegin, die bereits auf ihn gewartet hatte, um die Ecke gebogen.
Ich ging nicht sofort rein, sondern blieb noch einen Augenblick stehen, um die rostrote Backsteinfassade des Wohnhauses zu betrachten, das ab heute mein neues Zuhause darstellte. Sie schien ein bisschen bröckelig an den Kanten. Einige Stellen hatten Moos angesetzt, an anderen wuchs Efeu, der sich wie rote Äderchen an dem braunen Rahmen der Erkerfenster entlangschlängelte. Das Holzgeländer an der Steintreppe, die zur doppelflügeligen Eingangstür hinaufführte, war morsch. Ich gab ihr noch einen feuchtkalten Winter, bis sich jemand ernsthaft daran verletzen würde. Vielleicht sollte ich das direkt der Hausverwaltung melden? Auch diesen Gedanken schob ich rasch beiseite. Vielleicht solltest du lieber erst mal ankommen.
Ich trat in den Hausflur, der mit kleinen schwarz-weißen Kacheln ausgelegt war. Die Sprünge darin bildeten ihre eigene Art von Muster. Es roch nach Staub, irgendwelchen Kräutern und Gewürzen, womöglich Curry. Entweder jemand kochte gerade, oder der Geruch hatte sich mit den Jahren hier verloren und in den Rissen der Wände festgesetzt. Es gab keinen Fahrstuhl, natürlich nicht, deshalb musste ich den Karton mühselig in den vierten Stock tragen. Dort angekommen, fiel mir direkt unsere Haustür ins Auge, die offen stand. Cassidys Vertrauen in die Menschheit war beachtlich, besonders bei einem Beruf wie unserem.
»Sie sind weg!«, verkündete ich, kaum dass die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war. Ich stellte die Kiste im Flur ab und schlüpfte aus meinen Wollsocken, in denen sich mehr Feuchtigkeit eingenistet hatte, als mir lieb war.
»Na endlich!«, kam es prompt zurück. »Mal ehrlich, das Ächzen von dem Kerl war kaum auszuhalten. Nach der fünften Zigarette war ich kurz davor, ihm die Nummer der Suchtberatung in die Hand zu drücken. Hast du ihnen Trinkgeld gegeben?«
Die Stimme meiner besten Freundin klang, als käme sie aus ihrem Zimmer. Da alle Räume jedoch nahezu leer waren und das Tapsen meiner nackten Füße wie ein Echo von den Wänden widerhallte, konnte sie von überallher stammen.
Ich blieb abrupt stehen. »Hätte ich das denn tun müssen?«
In dem ganzen Umzugsstress hatte ich tatsächlich gar nicht daran gedacht.
»Das fragst du, die am liebsten selbst ihrem alten Postboten Trinkgeld gegeben hätte?«
»Er hat auch einen guten Job gemacht und war immer freundlich!«, rechtfertigte ich mich.
Cassidys glockenhelles Lachen schallte durch die Wohnung, was unser neues Zuhause auf merkwürdige Weise wärmer wirken ließ. Als hauchte sie den Zimmern damit Leben ein. »Mach dir nichts draus. Streng genommen zahlen wir denen sowieso mehr als genug dafür, dass sie alle fünf Minuten eine Rauchpause eingelegt haben.«
»Was das Geld angeht … Ich schicke dir meinen Teil später, okay?« Ich warf einen Blick in Cassidys Zimmer und stellte verwundert fest, dass sie nicht dort war. »Wo bist du überhaupt?«
»Na, hier.«
Ich ging ins Wohnzimmer, wo sie rücklings auf dem Dielenfußboden lag, während die tief stehende Abendsonne ihr goldenes Licht in unzähligen Vierecken an die gemusterten Wände warf. Es überraschte mich, dass sie es überhaupt ins Innere unserer Wohnung schaffte, wo doch ein Großteil unseres Fensters von der knochigen Eiche an der Straße versperrt wurde, deren feine Äste bei jedem kleinen Windhauch an der Glasscheibe kratzten.
»Was genau wird das?«, fragte ich und lehnte mich gegen den Türrahmen. Der Anblick überraschte mich eigentlich nicht, dennoch musste ich schmunzeln.
Nichts stand an Ort und Stelle, Erdkrümel und zerstampfte Blätterreste zierten den Boden, überall stapelten sich Kisten. Cassidy lag unbekümmert im Chaoszentrum. Ich kam nicht umhin, darüber nachzudenken, wie passend dieses Bild für sie war: Die Welt hätte in dieser Sekunde untergehen können, und sie wäre trotzdem auf diesem schmutzigen Fußboden liegen geblieben, als könnte ihr das Ende rein gar nichts anhaben. Manchmal beneidete ich sie darum.
»Ich war mir irgendwie sicher, dass wir glückliche Besitzerinnen einer Fußbodenheizung sind«, murmelte sie und pustete sich ihren Fransenpony aus der Stirn. Ihr schwarzes Haar, das sie normalerweise kinnlang trug, war gewachsen, obgleich es ihr kaum bis zum Schlüsselbein reichte.
»Wir wohnen jetzt in Fenway, Cass. Sei froh, dass wir eine Kette an der Haustür besitzen«, erinnerte ich sie. Das Viertel gehörte zwar nicht zu den kriminellen Stadtteilen von Boston, aber eben auch nicht zu den Gegenden, in denen ich mich üblicherweise bewegt hatte.
Cassidy legte den Kopf in den Nacken, um mir ein amüsiertes Grinsen zu schenken. »Jetzt klingst du wie Eloise. Die Wohnung hier war deine Idee, schon vergessen?«
Selbstverständlich nicht. Allerdings hatte ich Cassidy nicht dazu gezwungen, mit mir einzuziehen. In erster Linie hatte ich mit diesem Umzug eines gewollt: weg von allem, das funkelte. Weg von den protzigen Penthouse-Wohnungen mit Blick aufs Wasser, weg von den Yachten im nahe gelegenen Hafen und weg von den teuren Designer-Lädchen. Hier in Fenway war das Einzige, das funkelte, die Stadtlichter bei Nacht.
»Du hast recht. Tut mir leid.« Ich stieß mich mit einem Seufzen vom Türrahmen ab und legte mich kurzerhand neben sie. Das Holz an meinem Rücken war kühl, die Härchen auf meinen Armen stellten sich sofort auf. »Vielleicht sollten wir uns einen Teppich zulegen.«
»Keine schlechte Idee«, stimmte sie zu.
Schweigen legte sich über uns, ein Zustand, den Cassidy meist nicht lange aushielt – genauso wenig wie ich. »Hast du deinem Dad und Eloise eigentlich erzählt, dass du hierhergezogen bist?«
Eloise war meine Stiefmutter. Ich hätte gern behauptet, dass es keine Rolle für mich spielte, dass sie nicht meine leibliche Mutter war, weil ich mich kaum an eine Zeit ohne sie erinnern konnte. Und doch gab es irgendetwas, das uns auf emotionaler Ebene voneinander trennte; eine Zwischenschicht, die hauchdünn, aber größtenteils undurchlässig war. Mit meinem Vater verhielt es sich ähnlich, wenn es seit meinem Abschluss von der Law School nicht sogar noch schlimmer geworden war.
»Und es ihnen extra noch mal unter die Nase gerieben? Klar.« Ich drehte meinen Kopf in ihre Richtung und wackelte vielsagend mit den Augenbrauen.
Die beiden waren entsetzt gewesen, als ich ihnen eröffnet hatte, dass ich aus meinem Apartment in Seaport ausziehen würde, um ab Oktober einen Job bei Gold, Bright & Partners anzutreten. Und nicht, wie sie es geplant hatten, in der Kanzlei meines Vaters.
»Wir werden das nicht unterstützen, Gracie«, hatten sie gesagt.
Genau das war mein Ziel gewesen. Nach allem, was passiert war, wollte ich schließlich weder länger ihre finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen, noch hätte ich ihr Einverständnis gebraucht. Das hier wollte ich allein schaffen, musste ich allein schaffen. Um meiner selbst willen. Denn auch wenn ich gern versuchte, es zu verdrängen, hatte ich längst gelernt, dass man vor allem an den Dingen wuchs, die einem am meisten Angst bereiteten.
Cassidy stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Draufgängerisch. Die neue Gracie gefällt mir.«
Die neue Gracie. Irgendetwas an dieser Bezeichnung tat weh. Nur ganz leicht, als würde jemand mit der Spitze einer feinen Nadel über meine Haut streichen. Vielleicht weil sie sich dafür, dass sie neu sein sollte, immer noch verdächtig wie die alte Gracie anfühlte. Ein bisschen zu verkopft, ein bisschen zu angespannt, ein bisschen zu viel von allem – nur nicht draufgängerisch. Diese Eigenschaft hatte ich bisher meinen Freundinnen überlassen. Freundinnen wie Cassidy, die von Mittelpunkten magisch angezogen wurden, die roten Lippenstift zum Einkaufen auflegten, sich nicht um fremde Meinungen scherten und nicht zögerten, für ihre Freundin in eine winzige Wohnung im bodenständigen Fenway zu ziehen, obwohl sie sich weitaus mehr leisten konnten. Freundinnen, die ein Stück weit so waren, wie ich nie sein würde, aber manchmal gern gewesen wäre.
»Apropos Eltern«, warf ich ein. »Du bist dir sicher, dass deine mich jetzt nicht abscheulich finden oder für einen schlechten Einfluss halten?«
Cassidy gab ein höhnisches Schnauben von sich. »Du und schlechter Einfluss? Bitte. Für meine Eltern warst du schon immer ein Engel und wirst es wahrscheinlich auch immer bleiben. Egal, was du tust.«
»Ein Engel also?« Ich hob die Augenbrauen. »Hast du ihnen denn auch die ganze Geschichte erzählt?«
»Komm schon, wir wissen beide, dass das nicht auf deinem Mist gewachsen ist. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Joseph so ein Ding abgezogen hat. Ich meine, klar, er sponsort die Uni und hat seine Kontakte, bla, bla, bla. Aber dass er sie auf diese Weise nutzt, hätte selbst ich ihm nicht zugetraut.« Sie schüttelte entrüstet den Kopf. »Trotzdem bedeutet das nicht, dass du dir deswegen nicht mehr selbst vertrauen kannst. Ich habe mit dir studiert, ich kenne dich.«
Ihre Worte schlossen sich wie eine Faust um mein Herz.
Auch ich hatte ihm das niemals zugetraut. Dabei wusste ich schon lange, wie mein Vater werden konnte, wenn seinem Ziel etwas im Weg stand. Dort, wo andere auf Granit stießen, fand Joseph Mittel und Methoden, um durchzubrechen – eine Eigenschaft, die ihm als Topanwalt Bostons von großem Nutzen war, und die er mir immer hatte mitgeben wollen. Nur waren unsere moralischen Kompassnadeln offenbar nicht gleich gepolt, denn meine zeigte definitiv in die andere Richtung. Trotzdem hatte ich geschwiegen. Und ich war mir nicht sicher, was das über mich als Menschen aussagte.
Bei der Erwähnung meines Vaters schob sich eine Erinnerung an ihn in den Vordergrund meiner Gedanken: Meine Güte, Gracie, stell dich nicht so an. Es war doch nur ein Ausnahmefall.
Wer konnte mir das garantieren? Wer konnte mir sagen, dass es nicht mehrere solcher Ausnahmefälle gegeben hatte?
Meine Eltern behaupteten viel, doch nur wenig davon entsprach der Wahrheit. Sie hatten diese Zweifel in meinen Kopf gepflanzt, wo sie über Wochen hinweg Wurzeln geschlagen hatten. Und nun waren die Ableger davon überall.
»Alles wegen dieses arroganten Mistkerls«, schimpfte Cassidy weiter. »Ich schwöre dir, wenn ich Marcus in die Finger kriegen sollte, dann –«
»Hey. Keine Kraftausdrücke und keine Ex-Freunde.« Ich verzog das Gesicht und massierte mir angestrengt die Schläfen. »Für heute habe ich schon genug Kopfschmerzen.«
Außerdem wollte ich nicht wieder darüber nachdenken, was Marcus mir angetan hatte. Inzwischen hatte auch ich begriffen, dass er es nicht wert war, länger Hauptdarsteller meiner Gedanken zu sein.
Cassidy verdrehte die Augen. »Ich mein ja nur. Wenn du ihn und Gwen an diesem Abend nicht miteinander erwischt hättest …«
»Was dann?«
Sie hob die Schultern und zupfte an einer Naht ihrer karierten Stoffhose. »Na ja, vielleicht wäre dann jetzt alles anders. Ihr wärt noch zusammen, du würdest brav in Josephs Kanzlei arbeiten, und ich würde planlos in der Weltgeschichte herumdümpeln.«
Ihre Aussage überraschte mich. »Ich dachte, Gold, Bright & Partners wäre auch deine erste Wahl gewesen?«
Davon war ich zumindest ausgegangen, weil für mich schnell festgestanden hatte, dass ich einen Job in dieser Kanzlei wollte, nachdem die meines Vaters keine Option mehr dargestellt hatte. Gold, Bright & Partners gehörte immerhin zu den erfolgreichsten Kanzleien Bostons, und Cassidy gab sich – außer für mich – nie mit etwas Zweitklassigem zufrieden.
Von der Begeisterung, die wir beide nach unserer Einstellung verspürt hatten, war auf ihrem Gesicht gerade jedoch nicht viel zu sehen.
»Ist sie auch«, versicherte sie nachdrücklich und stieß mit ihrem Knie gegen meines. »Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, vorher noch mal rauszukommen. Wir haben uns in den letzten Jahren den Ar… Hintern abgerackert. Eine längere Auszeit hätte uns bestimmt gutgetan.«
Ich wickelte mir eine rotblonde Haarsträhne um den Finger, während ich kurz über ihre Worte nachdachte. »Wir hatten doch den ganzen Sommer.«
»Sag ich ja.« Cassidy sah mich mit ihren katzenhaften grünen Augen an und grinste. »Eine längere Auszeit hätte uns bestimmt gutgetan.«
Ich widersprach ihr nicht, weil ich wusste, dass ihr Leben ähnlich eng getaktet verlaufen war wie meines. Nach der Highschool waren wir beide für unser Grundstudium nach Harvard gegangen und von dort direkt weiter an die interne Law School. Wir hatten uns auf der Toilette auf einer Erstsemester-Party kennengelernt. Mir war gerade der Träger meines Kleides gerissen, weshalb Cassidy so nett gewesen war, mir mit einer Sicherheitsnadel auszuhelfen.
Bei ihr hatte ich von der ersten Sekunde an das Gefühl gehabt, dass sie mich um meinetwillen mochte. Nicht weil sie beabsichtigte, über mich an einen Job in der Kanzlei meines Vaters heranzukommen. Also hatten wir fortan nahezu jeden Tag zusammen in der Jura-Bibliothek gesessen und Gesetzestexte gewälzt, bloß um am Ende des Tages mit dem Gedanken zu spielen, doch alles hinzuwerfen aus Angst, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein. Rückblickend war das Studium ein harter Weg gepflastert von Unsicherheit und Nervenzusammenbrüchen jeglicher Art gewesen, nichtsdestotrotz wäre ich ihn genau so wieder gegangen.
»Bist du nervös, Cass?«, fragte ich in die aufgekommene Stille hinein. Ich hatte den Blick auf die Decke geheftet, an der die Baumäste ein Schattenspiel veranstalteten. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass sie mich prüfend musterte.
»Das kann nur jemand fragen, der selbst nervös ist.«
Ertappt biss ich mir auf die Unterlippe. »Was, wenn irgendetwas passiert? Wenn wir am Montag zu spät kommen oder ich schon an dem ersten Fall scheitere?«
Oder schlimmer noch: Wenn sie herausfinden, was passiert ist?
»Was, wenn es gar nicht so schlimm wird, wie du es dir wieder ausmalst, Gray?«, schlug sie versöhnlich vor.
Mir entwich ein schweres Seufzen.
Wenn Zweifel eine Farbe hätten, wären sie grau. Nicht ganz schwarz, aber auch nicht weiß. Cassidy behauptete deshalb gern, ich wäre eine Graumalerin und nannte mich liebevoll Gray. Und so ungern ich es zugab: Sie hatte recht.
Ich war nicht schüchtern, und es verletzte mich auf eine merkwürdige Art, wenn andere mir diesen Stempel aufdrückten. Ich war nur nicht besonders gut darin, auf mich selbst zu vertrauen.
Manchmal war ich zu leise, obwohl ich laut sein wollte. Manchmal dachte ich zu lange über Sätze nach, bis ich über ihre Einzelteile stolperte. Manchmal saß ich ewig an einer Aufgabe, weil ich sie so exakt wie möglich lösen wollte. Und manchmal ließ ich mich von anderen verunsichern, weil ich mir zu viele Sorgen darüber machte, was sie wohl von mir denken könnten. In erster Linie war ich jedoch gut darin, mich selbst zu verunsichern.
Ich dachte so oft in Konjunktiven, so oft an dieses leidige Was-wenn, dass sich seine grauen Tentakelarme derart fest um meinen Kopf gewickelt hatten, dass es mir an manchen Tagen schwerfiel, mich davon loszureißen. Die meisten Menschen verstanden das nicht. Sie sagten, ich solle einfach damit aufhören – als hätte ich eine Wahl. Oft hätte ich sie deswegen gern angeschrien.
DU WILLST, DASS ICH AUFHÖRE? ICH WÜRDE JA GERN! Und wie gern hätte ich einen Riegel davorgeschoben. Doch für Impulsgedanken wie diese gab es keine Gedankenschlösser. Sie kamen zu schnell und zu plötzlich, als dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden konnten.
Meine Professorin für Verfassungsrecht hatte mir einst geraten: »Seien Sie überkritisch, seien Sie übergründlich, aber bitte vertrauen Sie sich selbst, Miss Cabot. Sie haben eine Menge Potenzial. Versuchen Sie, diese Was-wenn-Gedanken zu Ihrem Vorteil zu nutzen.«
Ich hatte mir ihren Rat zu Herzen genommen. Dass es mir hin und wieder gelang, diese Gedanken auf meine Arbeit zu übertragen und mit ihrer Hilfe Zusammenhänge zu erkennen, die anderen verborgen blieben, bedeutete allerdings nicht, dass ich wusste, wie ich sie in meinem Privatleben abstellte.
»Ich wette, die Leute werden dich lieben, Gray«, murmelte Cassidy jetzt. »Das tun sie immer.«
Ich war mir nicht sicher, ob ihre Stimme eine vorwurfsvolle Färbung angenommen hatte. Bevor ich einhaken konnte, stützte sie sich auf ihre Ellbogen und schaute sich in dem Durcheinander um, in dem wir badeten. »Ganz ehrlich? Ich bin so kurz davor, jemanden zu engagieren, der uns die Möbel aufbaut.« Sie hielt Zeigefinger und Daumen in die Luft, beide trennten wenige Millimeter. »Ich habe Hunger, ich bin müde, und ich stinke. Ich hasse Umzüge.«
Mit einem Grinsen auf den Lippen erhob ich mich vom Boden und klopfte mir den Staub von der Jeans. »Stell dich nicht so an. Sonst bist du doch die Letzte, die irgendjemanden um Hilfe bittet.«
»Verzweifelte Zeiten erfordern eben verzweifelte Maßnahmen.«
Ich stöhnte. »Ist gut, du Dramaqueen. Ich bestell uns was, okay? Ich muss in diesem Gerümpel nur mein Handy finden.«
Auf dem Weg in mein Zimmer gab der walnussbraune Dielenboden bei jedem meiner Schritte ein Ächzen von sich, als würde er mir eine uralte Geschichte erzählen wollen. Auch die gemusterte Blumentapete, die noch von der Vormieterin stammte, schien ein Überbleibsel aus vergangener Zeit zu sein. Ich hätte sie abziehen können, da sie sich an einigen Stellen bereits wellte und in den Ecken abgeblättert war, doch ich tat es nicht. Sie spiegelte auf seltsame Weise mein aufgerautes Innerstes wider.
Mein Zimmer besaß zum Glück gleich zwei Fenster, die großzügig Licht spendeten und zu einer schmalen Nebenstraße hinausgingen. Vor eines davon hatte ich meinen Schreibtisch stellen lassen, neben dem mein grüner Samt-Lesesessel stand. Alles andere, darunter das Bett, das derzeit eine Matratze auf dem Fußboden darstellte, würde ich in den kommenden Tagen noch aufbauen müssen.
Ich steuerte den Schreibtischstuhl an, über den ich vorhin meinen Mantel gelegt hatte. Dann ließ ich mich darauf sinken, streckte mit einem Seufzen die Füße von mir und zog das Handy heraus. »Worauf hast du Lust?«, rief ich in Cassidys Richtung. »Pizza? Pasta?«
»Sushi!«, kam es postwendend zurück.
Wieso nur hatte ich mit dieser Antwort gerechnet?
Ich wollte mich gerade der Auswahl im Internet widmen, da bemerkte ich die Bewegung eines Schemens am Rande meines Sichtfelds. Sowie ich den Kopf hob, flackerte mein Blick zu dem roten Backsteinhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Genau dort, vielleicht acht oder zehn Meter entfernt, stieg in dieser Sekunde ein hochgewachsener Typ aus seinem Fenster.
Mein erster Impuls war, aufzuspringen und »Vorsicht!« zu rufen, um wenigstens irgendetwas zu tun. Allerdings hatte er sich schon im nächsten Moment mit einer fließenden Bewegung an der Metallstange einer Feuerleiter hinaufgezogen. Fasziniert beobachtete ich ihn dabei, wie er sich auf eine der Stufen setzte und ein kleines Buch aus der Gesäßtasche seiner Jeans zog. Ein paar Strähnen seines aschblonden Haares fielen ihm in die Stirn, als er es aufschlug. Er fuhr sich mit gespreizten Fingern hindurch, ohne seinen Blick von den Buchseiten zu lösen.
Wie konnte er in der aufkommenden Dämmerung und bei dieser Geräuschkulisse ungestört lesen? Auch ohne mein Fenster zu öffnen, war ich mir der Lärmdecke bewusst, die über den Straßen Fenways lag. Wenn es nicht der Verkehr war, waren es die Baustellen oder die Lautsprecher aus dem nahe gelegenen Stadion, die am laufenden Band Töne ausspuckten. Dem Typen hingegen schien das alles nichts auszumachen. Es war, als hätte man ihn aus einer Momentaufnahme geschnitten und in diese schnelllebige Kulisse gesetzt. Er war sein eigener Fixpunkt, um den die Welt sich drehte.
»Und, hast du was gefunden?« Beim Klang von Cassidys Stimme fuhr ich erschrocken zusammen. »Was?«
»Na, etwas zu essen. Weißt du noch?«
»Oh.« Richtig. »Noch nicht.«
»Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?«
Ich hörte, wie sich ihre Schritte näherten. Kurz darauf fühlte ich ihre warmen Hände auf meinen Schultern, weshalb ich meinen Blick eilig von dem Fremden losriss. »Ich suche noch.«
»Und du glaubst, unser Nachbar kann dir dabei helfen?« Ein wissendes Lächeln zupfte an ihren Mundwinkeln. Und es wurde noch breiter, als sie bemerkte, dass mir Blut in die Wangen schoss. »Ich wusste es! Du Stalkerin.«
»Ich stalke niemanden!« Der Griff um mein Handy verstärkte sich, dennoch bemühte ich mich, unbeirrt weiterzuscrollen. »Irgendjemand muss ja ein Auge darauf haben, dass er nicht runterfällt und sich das Genick bricht.«
»Und da opferst du dich natürlich ganz selbstlos auf. Ist klar.« Cassidy lehnte sich mit verschränkten Armen gegen meinen Schreibtisch. »Wahrscheinlich hängen in den anderen Stockwerken gerade noch mindestens zwei weitere Frauen und Männer an ihren Fenstern. Stürmt ihr dann alle gemeinsam nach draußen, wenn es ernst wird?«
»Du bist gemein.«
Sie gluckste vergnügt. »Eigentlich warte ich nur darauf, dass du endlich diese Bestellung abschickst. Gerade du müsstest doch wissen, wie schmal der Grat zwischen hungry und angry ist, Miss Ich-brauche-Zucker-sonst-verliere-ich-die-Nerven.«
»Ist gut, ich mach ja schon«, grummelte ich genervt. Ein paar Klicks später erhielt ich eine Bestätigungsmail von einem Restaurant in unserer Nähe und zeigte sie ihr. »Da, bitte schön. Fünfzehn Minuten. Hältst du das noch aus?«
Ihre Augen blitzten. »Ich garantiere für nichts.«
Nachdem Cassidy und ich Sushi gegessen und uns währenddessen auf ihrem Tablet eine Folge Extraordinary Attorney Woo angeschaut hatten, sortierten wir noch ein paar Kartons. Dann schoben wir die Couch dorthin, wo wir sie haben wollten, und räumten das Geschirr in die Küchenschränke. Dabei tanzten und sangen wir so laut zu Pierre von Ryn Weaver mit, dass die Nachbarn aus dem Stockwerk unter uns mit irgendetwas, vermutlich einem Besenstiel, gegen die Decke klopften.
»Sieh mal, wir haben uns an unserem ersten Tag schon beliebt gemacht!«, rief Cassidy über die Musik hinweg mit einem breiten Grinsen. »Das ging schneller als erwartet!«
Als ich kurz vor Mitternacht in mein Zimmer ging, brannten mir die Augen. Dabei bezweifelte ich in Anbetracht meines näher rückenden ersten Arbeitstages, in den kommenden zwei Nächten überhaupt Schlaf zu finden.
Ich nahm ein paar meiner in Leder gebundenen Gesetzbücher aus einem Karton und stellte sie fein säuberlich nebeneinander auf meine Schreibtischablage. Sie waren alt und die Einbände zerfranst. Ich hatte mich geweigert, mir neue zu kaufen, weil ich den Geruch von alten Büchern liebte. Im Anschluss zog ich einen weiteren Karton hervor, in dem ich meinen Pyjama fand.
Mehr um sicherzugehen, dass mich niemand beim Umziehen beobachtete, als aus Neugier, glitt mein Blick zur gegenüberliegenden Straßenseite. Es war dunkel, aber in der Wohnung des jungen Mannes brannte noch Licht. Ich entdeckte ihn schnell, was bei den großen Rundbogenfenstern auch kein Wunder war. Er stand oberkörperfrei mit dem Rücken zu mir in seinem Schlafzimmer. Zumindest ging ich davon aus, dass es das war, weil ich ein Bett erkennen konnte. Die Bettwäsche war dunkelblau und lag wie ein zusammengeknülltes Taschentuch auf seiner Matratze.
Ich fragte mich, ob er allein wohnte, und gleich darauf, warum mich das interessierte.
Einen Moment lang blieb ich stehen, beobachtete mit einem warmen Prickeln im Nacken, wie er sich probeweise ein paar schlichte Hemden vor die Brust hielt. Manche warf er hinter sich aufs Bett, andere hing er sorgsam zurück in seinen Schrank. In ein weißes Hemd schlüpfte er schließlich hinein. Zunächst mit dem rechten Arm, dann mit dem linken – jeder Handgriff, mit dem er den Kragen richtete, war geschmeidig und ohne Hast. Als hätte die Zeit keinen Einfluss auf ihn, weil er einfach durch sie hindurchschwamm.
Es war seltsam, aber je länger ich hier stand und ihm zusah, desto mehr schien seine Gelassenheit auf mich überzuschwappen. Lauter kleine Wellen, deren Schaumbläschen an meinen Zehen zerplatzten. Bis mir mit einem Mal doch alles eine Spur zu schnell ging: Er drehte sich um und näherte sich dem Fenster, offenbar weil er etwas suchte. Was auch immer es war, mich fand er zuerst. Wahrscheinlich hätte ich irgendetwas tun müssen, allerdings vergaß ich unter seinem Blick prompt, wie man atmete.
Der Typ starrte mich an, und ich starrte zurück. So lange, bis er die Augenbrauen hob, mir damit das internationale Zeichen für »Ist was?« gab und ruckartig seine Vorhänge schloss.
Hitze stieg mir in die Wangen, breitete sich von dort wie ein Lauffeuer aus, sodass sich alles in mir auf unangenehmste Weise zusammenzog. Ein Gefühl, wie man es nur bekam, wenn man soeben dabei erwischt wurde, eine unsichtbare Grenze überschritten zu haben. Warum in aller Welt habe ich das getan?
Die Frage wummerte wie ein Echo in meinem Kopf, selbst als ich schon lange im Bett lag. Dabei kannte ich die Antwort insgeheim.
Er hatte irgendetwas an sich, das meinen Blick auf die andere Straßenseite gezogen hatte. Etwas Ruhendes, Stetiges. Vielleicht war es die Art und Weise, wie er sich bewegte, die es mir angetan hatte. So fließend und selbstsicher, als wäre er sein eigener Ruhepol. Und dadurch irgendwie auch meiner.
2
Gracie
Nicht alle Worte gingen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Manche setzten sich tief im Gedächtnisgewebe fest, wo sie eine längere Zeit überdauerten. Vielleicht nur ein paar Stunden oder Tage, vielleicht aber auch Wochen oder ganze Jahre.
Eine Sache, die mein Vater mich früh gelehrt hatte, war Pünktlichkeit. Und seine Worte waren aus irgendeinem Grund so fest in meiner Erinnerung verankert, dass sie sich bis heute nicht gelöst hatten: »Cabots lassen niemanden warten, Gracie. Lässt du eine Person warten, vermittelst du ihr das Gefühl, nicht wichtig genug zu sein und deine Arbeit nicht ernst zu nehmen.«
Tatsächlich hatte ich in meinem Leben schon oft festgestellt, dass man sich mit Pünktlichkeit eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen konnte. War man in Restaurants die Erste, konnte man sich oftmals selbst einen Platz aussuchen. In meinem Fall war das immer ein Tisch an der Wand, weil ich schon als Kind lieber in Ufernähe geschwommen war als im offenen Wasser.
Traf man für ein Meeting zu früh ein, konnte man gedanklich noch einmal in Ruhe das Skript durchgehen, um sich im Gespräch daran entlangzuhangeln und Satzstolperer zu vermeiden.
War man pünktlich, musste man sich außerdem nie Entschuldigungen oder Notlügen für die Verspätung zurechtlegen, die einem das gesamte Treffen über wie unangenehmer Belag auf der Zunge kleben blieben.
Aus all diesen Gründen plante ich meine Termine stets mit größter Sorgfalt und kontrollierte sie mindestens dreimal auf Richtigkeit, bevor ich sie in meinen Kalender eintrug. Dasselbe galt für meinen Wecker vor dem Schlafengehen.
Wie es mir trotz allem gelungen war, an meinem ersten Arbeitstag zu verschlafen, konnte ich mir auch nach dem fünften Blick auf mein Handy beim besten Willen nicht erklären. Hatte es nicht geklingelt? Oder hatte ich es gekonnt überhört? Im Grunde spielte es keine Rolle, denn in dem Moment, in dem ich es realisiert hatte, war ich bereits hellwach gewesen und aus dem Bett gesprungen.
Ich rannte barfuß in den Flur, wo ich mit geballter Faust gegen Cassidys Zimmertür schlug. Erst noch sanft, dann eine Spur fordernder. Sie hatte sich darauf verlassen, dass ich sie wecken würde, da ich von Natur aus eine Frühaufsteherin war.
Ein Fehler. Ein großer Fehler.
Womöglich hatte ich bei meinem Auszug aus meiner alten Wohnung doch mehr zurückgelassen als nur meinen Nachnamen.
»Cass, steh auf! Wir haben verschlafen!« Ich steckte meinen Kopf durch den Türspalt. Das graue Morgenlicht hing wie ein Schleier in ihrem Zimmer, ließ die nackten Wände noch trostloser aussehen.
»Was ist los?« Sie rieb sich die Augen und blinzelte mich verschlafen an. Ihr Pony stand wirr in alle Richtungen ab.
»Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, kommen wir zu spät«, sagte ich und tippte auf eine imaginäre Uhr an meinem Handgelenk.
»Wie, zu spät?« Sie griff nach ihrem Handy und linste flüchtig auf den Bildschirm. In der nächsten Sekunde saß sie kerzengerade auf ihrer Matratze. »Verflucht, ich dachte, du weckst mich?«
Wir stürzten ins Badezimmer, in dem sich dank des offen stehenden Fensters sämtliche kühle Morgenluft gesammelt hatte. Ich stellte mich bibbernd vor den Spiegel und putzte mir die Zähne, während Cassidy unter einem Schwall unterdrückter Flüche in die winzige Duschkabine stieg.
So ging es die nächsten Minuten hin und her, wie eine Art Tanz, bei dem wir uns mit der Schrittfolge abwechselten: Ich duschte, während sie sich die Haare föhnte. Ich föhnte mir die Haare, während sie sich Make-up auftrug. Ich trug mir Make-up auf, während sie sich die Zähne putzte. Dabei musste ich andauernd mit dem Handtuchzipfel über die beschlagene Spiegelscheibe wischen, um mich darin überhaupt sehen zu können.
Mein Vater hatte früher oft gesagt, ich sei das Ebenbild meiner Mutter, und soweit ich das anhand von alten Fotos beurteilen konnte, stimmte es. Wir hatten das dunkle rotblonde Haar gemeinsam, das mir wie glänzende Seide über die Schultern fiel. Ebenso die tiefbraunen Augen, die blasse Rosenhaut und die Abertausend winzigen Sommersprossen auf Nase und Wangen.
Heute schien es, als würden sich die kleinen Flecken besonders stark auf meiner Haut abzeichnen. Es war die Nervosität, die sich nicht nur in meinem Bauch, sondern auch in meinen Gesichtszügen eingenistet hatte.
Wahrscheinlich bekam ich nach dem Anziehen deshalb auch kaum einen Bissen von dem Marmeladentoast hinunter, den Cassidy mir über den Tresen zugeschoben hatte.
»Bist du sicher, dass du das tragen willst?«, fragte sie und blickte zweifelnd an mir hinunter, weshalb ich dasselbe tat.
Im Gegensatz zu Cassidy, die einen schwarzen Designer-Einteiler trug, hatte ich mich für eine senfgelbe Rüschenbluse und einen Blazer entschieden, der genau wie der knielange Bleistiftrock marineblau war, dazu eine graue Wollstrumpfhose mit weißen Punkten, weinrote Lackschuhe und den alten roten Haarreif meiner Mutter, der eines meiner wenigen Erinnerungsstücke an sie war.
Ich mochte vielleicht oft grau denken, aber ich liebte es, Farben zu tragen. Dieses Outfit war eine Kombination aus meinen Lieblingsteilen. Ich hatte gehofft, wenn ich mir selbst schon kein Gefühl von Sicherheit geben konnte, dann zumindest meine Kleidung. Nur machte Cassidys Kommentar sämtliche Hoffnung binnen eines Wimpernschlags zunichte.
»Was ist falsch daran?«
»Gar nichts!«, entgegnete sie schnell und eine Oktave zu hoch. »Es ist dein erster Eindruck. Trag das, was du möchtest und worin du dich gut fühlst.«
Obwohl ich Cassidy seit mehreren Jahren kannte, kam es mir manchmal so vor, als sprächen wir unterschiedliche Sprachen. Im Gegensatz zu mir wälzte sie ihre Sätze nicht mehrmals im Kopf herum, sondern sprach sie einfach aus.
Mir war bewusst, dass das meiste davon nicht böse gemeint war, und doch fiel es mir oft schwer, ihre Worte zu filtern und zu entscheiden, welche ich näher an mich heranließ und welche nicht. Auch diese waren wieder so spitz wie feinste Glassplitter. Ich konnte zulassen, dass sie mir unter die Haut gingen. Oder ich konnte sie an mir abprallen lassen.
Meine Hand ballte sich zur Faust. Es ist egal, was sie sagt. Solang du dich wohlfühlst, ist wirklich alles okay. Ich lockerte sie wieder.
»Also gut.« Sie wischte sich die Brotkrümel aus ihrem Mundwinkel und kontrollierte in der Spiegelung ihres Handys, ob ihr Lippenstift noch saß. »Wie ich dich kenne, hast du längst einen Plan, wie wir zur Kanzlei kommen?«
Natürlich hatte ich den. Ein detaillierter Fahrplan war eines der ersten Dinge, um die ich mich gestern nach dem Aufstehen gekümmert hatte.
Ich klappte meinen Taschenkalender auf und überflog meine Notizen. »Eigentlich dachte ich, wir würden mit der Bahn fahren.«
Bis zur nächsten Station in der Park Street war es allerdings ein Fußweg von etwa zehn Minuten. Zusammen mit einer zwanzigminütigen Bahnfahrt in Richtung Downtown und weiteren fünf Minuten Fußweg stand außer Frage, dass wir zu spät kommen würden.
»Wenn wir jetzt zur Bahn laufen, werden wir niemals rechtzeitig da sein«, sprach Cassidy meinen Gedanken laut aus. Sie steckte ihr Handy weg und schaute nachdenklich aus dem Küchenfenster. Plötzlich erhellte sich ihre Miene. »Sieh an. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht.«
»Wovon sprichst du?« Ich stellte meinen Teller in die Spüle und folgte ihrem Blick nach unten auf die Hauptstraße, wo in diesem Augenblick ein Taxi am Kantstein hielt. Der Fahrer überlegte kurz, in die kleine Seitenstraße einzubiegen, zu der mein Zimmerfenster hinausging, entschied sich in letzter Sekunde jedoch dagegen.
»Meinst du nicht, er wartet auf jemanden?«, fragte ich stirnrunzelnd.
Cassidy drehte ihren Kopf zu mir und grinste. »Ja, auf uns. Na komm, beeil dich!«
Sie nahm ihre Tasche und zog mich am Handgelenk hinter sich aus der Küche. Ich schaffte es gerade noch, im Flur nach meinen eigenen Sachen und einem Mantel zu greifen, bevor sie mich durchs Treppenhaus schleifte. Kaum hatten wir einen Schritt nach draußen gesetzt, legten sich die feuchtkühlen Finger des Oktobermorgens um meinen nackten Hals. Der Himmel war verwaschen und grau. Die dunklen Turmwolken sahen aus, als trügen sie Regen mit sich, der jede Minute zu schwer wurde.
Cassidy zögerte nicht, lief zum Taxi und klopfte mit einem breiten Lächeln an die Scheibe. Nachdem sie ein paar Worte mit dem Fahrer gewechselt hatte, winkte sie mich aufgeregt zu sich. »Na los, er nimmt uns mit!«
Wenn das kein glücklicher Zufall war. Ich hatte gerade die Hintertür geöffnet, um auf die Sitzbank zu rutschen, da tippte mir jemand auf die Schulter.
»Entschuldige, aber ich glaube, das ist meins.«
Es war eine warme Männerstimme. Ruhig und dunkel, ein bisschen wie in schwarzen Samt gehüllt. Ich drehte mich langsam zu ihr um und erstarrte, als ich begriff, zu wem sie gehörte. Am liebsten hätte ich laut aufgelacht, weil es so absurd war. Nur brachte ich in der ersten Schrecksekunde keinen Ton heraus.
Anders als er.
»Du.« Der finstere Ausdruck, der wie ein Schatten über sein markantes Gesicht huschte, verriet mir sofort, dass er mich ebenfalls erkannte. Seine blassgrünen Augen verengten sich leicht. »Erst bespannst du mich, und jetzt nimmst du mir auch noch mein Taxi weg?«
Bespannen? War das sein Ernst? Ich schnappte nach Luft. »Entschuldige mal, ich habe dich nicht bespannt!«
Er wirkte alles andere als überzeugt von meiner Antwort. »Du weißt, dass das streng genommen schon unter Voyeurismus fällt und strafbar ist?«
Mein Blick tastete sich flüchtig an seiner hochgewachsenen Statur entlang. Er trug einen dunkelgrauen Mantel über seinen breiten Schultern, darunter ein weißes Hemd mit gestreifter Krawatte, Anzughose und schwarzen Halbschuhen, die an der Spitze abgenutzt waren.
»Was bist du, Anwalt? Polizeibeamter?«, fragte ich glucksend.
Mein Gegenüber verzog keine Miene. »So etwas dürfte den meisten klar sein, schätze ich. Zumindest bin ich davon ausgegangen.«
»So? Dann weißt du ja vielleicht auch, dass ich für eine erfolgreiche Anklage deinerseits Fotos oder Videos von dir gemacht haben müsste, die das Ganze beweisen. Habe ich aber nicht. Ich habe nur in einem unpassenden Moment rübergeschaut, das ist alles.«
Der Typ verschränkte die Arme vor der Brust und legte den Kopf schief, wobei ihm eine aschblonde Strähne in die Stirn fiel. Er hatte versucht, sein Haar mit Wachs in Form zu bringen, allerdings war der leichte Wind nicht gerade gnädig. Es war schwer zu sagen, ob er neugierig oder überrascht aussah.
»Das behauptest du.«
»Weil es stimmt! Aber du hast recht. Es tut mir leid, dass ich deine Privatsphäre missachtet habe. Wirklich«, versicherte ich mit Nachdruck. »Das ist nicht meine Art, und es wird nicht wieder vorkommen. Versprochen.«
Er öffnete den Mund, um zu antworten, da rief Cassidy vom Beifahrersitz aus: »Gray, was dauert denn da so lang? Wir haben es eilig, schon vergessen?«
Ich steckte meinen Kopf ins Taxi. »Gib mir nur eine Sekunde«, bat ich. Dann widmete ich mich wieder unserem Nachbarn, der mich nun von Kopf bis Fuß musterte.
»Sind du und deine Freundin neu in der Gegend? Ich habe euch hier noch nie gesehen.«
»Wir sind vorgestern eingezogen«, murmelte ich und stellte den Kragen meines Mantels auf.
»Vorgestern?« Er gab ein Geräusch von sich, das halb Schnauben, halb Lachen war. »Na, das nenne ich mal einen einprägsamen ersten Eindruck.«
Ein Gefühl von Scham brannte sich in meinen Magen. Einerseits wäre ich gern im Erdboden versunken, andererseits wollte ich mit dem Fuß gegen den Autoreifen treten. All das wäre nie passiert, wenn ich nur rechtzeitig aufgestanden wäre. Stattdessen diskutierte ich mit einem Fremden auf offener Straße und würde an meinem ersten Arbeitstag zu spät kommen. So einen Start in der Kanzlei konnte ich mir nicht erlauben. Ich mochte das schillernde Cabot-Kostüm abgestreift haben, aber das bedeutete nicht, dass es deshalb okay war, Fehler zu machen. Erst recht nicht solche. Ich wollte niemanden warten lassen, und ich wollte niemandem das Gefühl vermitteln, nicht wichtig genug zu sein.
Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Wut wallte in mir auf. »Hör zu. Wir brauchen dieses Taxi wirklich, wirklich dringend. Ich kann es mir nicht leisten, ausgerechnet heute zu spät zu kommen, okay? Ich muss …« Einen guten Job machen. »Ich darf nicht …« Scheitern.
Meine Stimme überschlug sich, genau wie mein Herz.
»Denkst du, ich könnte es mir leisten, zu spät zu kommen?«, fragte er und deutete mit einer vagen Handbewegung auf das Auto. »Das ist mein Taxi. Steigt aus und bestellt euch ein eigenes, wenn ihr eins braucht.«
Obwohl er eine Diskussion mit mir führte, sprach er ruhig und beherrscht, doch aus irgendeinem Grund trug es nicht dazu bei, mich milde zu stimmen. Im Gegenteil.
»Gar nichts werden wir tun! Wir zahlen ihm nämlich das Doppelte für die Fahrt«, verkündete Cassidy, die ihr Fenster inzwischen runtergefahren hatte. »Also steig jetzt verdammt noch mal ein, Gracie!«
Als ich mit der linken Hand gehorsam nach dem Türgriff hinter meinem Rücken tastete, huschte mein Blick zu unserem Nachbarn zurück. Er schien zu ahnen, was ich vorhatte, noch bevor ich die Finger vollständig um das kühle Metall geschlossen hatte.
»Das würde ich mir an deiner Stelle zweimal überlegen.«
Er hatte ja keine Ahnung, dass ich für gewöhnlich nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal darüber nachgedacht hätte, wenn die Umstände andere gewesen wären. Ich hätte Cassidy gebeten auszusteigen und mich auf der Stelle bei ihm entschuldigt. Aber ich konnte nicht. Nicht wenn das hier mein rettender Neubeginn werden sollte.
»Tut mir wirklich leid, es geht nicht anders«, sagte ich also, ehe ich ins Taxi schlüpfte und die Tür hinter mir zuknallte.
Kaum hatte der Fahrer den Motor gestartet, verriegelten sich die Türen, sodass unser Nachbar sie nicht mehr öffnen konnte. Er schlug mit der flachen Hand gegen die Fensterscheibe und verzog das Gesicht. Dann wirbelte er herum und lief mit schnellen Schritten zurück zum Eingang seines Hauses.
Gott sei Dank. Ich sank tiefer in die Polster der Sitzbank und stieß einen Schwall Luft aus. Mein Herz pochte so stark, dass ich es im ganzen Körper spürte.
»Was zum Teufel war das denn?« Auch Cassidys Blick war auf die Haustür unseres Nachbarn gerichtet, die immer kleiner wurde, je weiter wir uns davon entfernten.
»Na ja, wir haben ihm eiskalt sein Taxi geklaut«, murmelte ich und stellte fest, dass es noch schlimmer klang, wenn man es laut aussprach.
Sie zuckte unbekümmert mit den Schultern. »Na und? Selbst wenn. Er wird darüber hinwegkommen.«
»Ich weiß nicht …« Ich schaute zum Himmel hinauf, der sich in den vergangenen Minuten noch weiter zugezogen hatte. »Hätten wir ihm nicht wenigstens anbieten sollen, ihn mitzunehmen? Es sieht nach Regen aus.«
Cassidy schnaubte und zog ihr Handy hervor, um geschäftig darauf herumzutippen. »Es ist superrührend, wie du dich um ihn sorgst, Gray. Aber wir haben gerade echt andere Probleme. Oder hast du vielleicht einen Plan B, mit dem wir es schaffen, in acht Minuten in der Kanzlei zu sein?«
Natürlich hatte ich keinen. Auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders gewesen. Mit einem Seufzen lehnte ich meinen Kopf gegen die Fensterscheibe und beobachtete, wie die Eindrücke der Stadt an mir vorbeizogen. Genau wie die Kanzlei meines Vaters lag die von Gold, Bright & Partners im Herzen Downtowns. Dadurch dass ich bis vor wenigen Tagen noch in Seaport gewohnt hatte, kannte ich die Gegend gut. Hohe Gebäude mit glänzenden Glasfronten, dichter Verkehr und viele Menschen. Downtown war die Heimat der großen Einkaufs-, Rechts- und Finanzviertel. Die meisten Bürogebäude befanden sich in der Umgebung des Regierungszentrums, darunter sowohl neue als auch ältere Bauwerke.
Ich mochte Downtown, eigentlich ganz Boston. Vor allem wegen der weitläufigen Parks und der Nähe zum Wasser, aber auch wegen der hübschen Vororte, die einen vergessen lassen konnten, dass man in einer Großstadt lebte. Das Einzige, worauf ich hätte verzichten können, waren die verstopften Straßen am frühen Morgen – besonders in einer Situation wie dieser. Der Verkehr lief nur zähflüssig, während die Zahlen auf der Uhr meines Handys umso schneller voranzuschreiten schienen.
»Wir müssen in drei Minuten da sein.« Cassidys Stimme zupfte am Rand meines Bewusstseins, mischte sich unter die Sirene eines Polizeiwagens und das Prasseln des Regens, der mittlerweile eingesetzt hatte. »Das schaffen wir doch niemals.«
Wem sagte sie das? Die Nervosität in meinem Bauch hatte sich zu einem regelrechten Klumpen verformt, der stetig größer wurde. Was, wenn sie ohne uns anfangen? Wenn wir irgendetwas Wichtiges verpassen und sie uns das in irgendeiner Form anlasten?
Ich öffnete das Fenster einen winzigen Spalt, um mit geschlossenen Augen mehrmals tief durchzuatmen. Ganz gleich, dass die feinen Tropfen meine Wangen binnen Sekunden mit einem feuchten Schleier benetzten.
Als ich die Lider kurz darauf wieder aufschlug, blieb mir ein entsetzter Laut in der Kehle stecken. Neben mir an der Ampel, direkt in der schmalen Lücke zwischen den Autos, entdeckte ich unseren Nachbarn – auf einem Fahrrad. Der Regen lief ihm in Rinnsalen über das Gesicht, und seine Kleidung war gänzlich durchnässt. Zu allem Überfluss funkelte er wütend in unser Taxi hinein, weshalb ich das Fenster unverzüglich wieder schloss.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir brach der Schweiß aus, als ich tiefer in meinen Sitz sank, der mich zu meiner Enttäuschung allerdings nicht verschluckte. »Cass?«, piepste ich.
Sie hörte mich nicht, weil sie mit dem Taxifahrer sprach. »Gibt es nicht noch irgendeinen anderen Weg, den wir nehmen können?«
Der Fahrer dachte nach, wobei er sich über den ungepflegten Bartschatten an seinem Kinn strich. »Ich könnte hier gleich links abbiegen und versuchen, ob es über die State Street schneller geht.«
Cassidy nickte. »Klingt nach einem Plan.«
Die Ampel sprang auf Grün, und die ersten Autos fuhren an.
Unser Nachbar warf mir durch eine Wolke aus Abgasen einen letzten vernichtenden Blick über die Schulter zu. Dann trat er wieder in die Pedale und fuhr geradeaus über die Kreuzung, wohingegen wir nach links abbogen. Es hätte mich erleichtern sollen, nur lastete mir mein schlechtes Gewissen so schwer auf den Schultern, dass beim Aufatmen kein Gefühl der Befreiung folgte. Hoffentlich stand ihm keine weite Fahrt mehr im Regen bevor. Bei dem Gedanken daran, dass er sich unseretwegen etwas einfangen könnte, wurde mir schlecht.
Immerhin schien es, als wäre der Umweg des Taxifahrers tatsächlich die bessere Wahl gewesen. Knappe sieben Minuten später setzte er uns vor der Kanzlei ab, ohne sich für den doppelten Zuschlag zu bedanken.
Obwohl ich schon einmal vor dem imposanten Gebäude von Gold, Bright & Partners gestanden hatte, empfand ich es nicht weniger einschüchternd. Es war ein vierstöckiger föderalistischer Bau, dessen Fassade aus rostrotem Backstein bestand und von kunstvoll verziertem Fries geschmückt wurde. Die rechteckigen Sprossenfenster mit weißen Metallrahmen trugen ziervolle Gesimse als Kronen. Den Eingang bildete ein massives bogenförmiges Portal, durch das man in die imposante Empfangshalle gelangte. Rechts und links von der breiten Flügeltür, die einst zu einem alten Feuerwehrhaus gehört hatte, standen zwei Kübel mit rund geschnittenen Lorbeerbäumen. Der bloße Anblick genügte, damit die Erinnerung an mein Bewerbungsgespräch aufflackerte und sich Feuchtigkeit in meinen Handflächen sammelte.
Einen ganzen Monat lang hatte ich mich auf dieses Interview vorbereitet, mir die größten Kanzleifälle angesehen und auf jede mögliche Frage eine passende Antwort zurechtgelegt. Und trotzdem hatte mich jede dritte davon unvorbereitet erwischt. Wie hätten Sie im Fall XY als Richterin entschieden? Welche drei Gegenstände würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? Wie stehen Sie zum Gebrauch der Miranda-Belehrung?
Die schwerste Frage, die mir gestellt worden war, hatte jedoch gelautet: »Auf Ihren Zeugnissen steht ein anderer Nachname, warum haben Sie ihn geändert?Undwas treibt Sie ausgerechnet zu uns, Ms … Hoffman?« Denn wiesollte man jemandem erklären, dass man anstelle der Kanzlei des eigenen Vaters lieber in der seiner größten Konkurrenz arbeiten wollte?
Ich hatte der geschäftsführenden Partnerin Natalie Gold nicht den wahren Grund genannt, allerdings auch nicht gelogen. Immerhin stimmte es, dass ich nie die engste Bindung zu meinen Eltern gehabt hatte. Und dass ich etwas erreichen wollte, ohne meine Beziehungen zu nutzen oder mich auf meinen Nachnamen zu berufen.
Der Gedanke schien ihr gefallen zu haben. Möglicherweise war es aber auch nur der, künftig die Tochter des Konkurrenten im Team zu wissen.
Cassidy und ich betraten den großzügigen Vorraum, der mit smaragdgrünen Marmorfliesen ausgelegt war, passierten eine Reihe von Fahrstühlen mit gebogenen Holzrahmen und gelangten schließlich an den Empfangstresen. Er bestand aus dunklem Mahagoniholz, genau wie die dahinterliegende vertäfelte Wand, in die das goldene Logo der Kanzlei eingraviert war: ein rundes Siegel mit einer Justizwaage, über der in edlen Goldlettern Gold, Bright & Partners geschrieben stand.
Ich erkannte die ältere Dame, die mit dem Telefon am Ohr einige Klicks auf ihrem Computerbildschirm tätigte, sofort von meinem Bewerbungsgespräch wieder. Heute war sie allerdings nicht allein. Neben ihr saß ein junger Mann im Anzug, den ich auf den ersten Blick auf Anfang dreißig schätzte. Sein glattes schwarzes Haar war ordentlich zurückgekämmt, das Lächeln auf seinen schmalen Lippen warm und freundlich. Yuki Matayoshi stand auf seinem Namensschild.
»Willkommen bei Gold, Bright & Partners«, grüßte er uns freundlich. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Cassidy war von unserem schnellen Laufschritt ähnlich außer Atem wie ich, weshalb sie die nächsten Worte nur gepresst hervorbrachte: »Ja, hi. Mein Name ist Cassidy Lind. Und das hier ist Gracie Ca–«
»Hoffman«, fuhr ich schnell dazwischen und warf ihr einen mahnenden Seitenblick zu. »Gracie Hoffman. Wir haben ein Meeting mit Natalie Gold. Wir gehören zu den neuen Anfängerinnen. Ich meine Associates.«
Ich wusste nicht, warum ich mich korrigierte. Wir mochten zwar ein abgeschlossenes Jurastudium vorzuweisen haben, doch waren wir in den Augen der Leute hier wahrscheinlich trotzdem nichts anderes als blutige Anfängerinnen, die kaum Erfahrung hatten. Diese erlangte man typischerweise während der ersten drei bis sechs Jahre in der Kanzlei, bis man – je nach Leistung früher oder später – die Möglichkeit hatte, zu Senior Associates aufzusteigen, denen in der Hierarchie die Junior- und Senior-Partnerinnen und -Partner folgten.
Der junge Mann linste kurz auf die teuer aussehende Uhr an seinem Handgelenk. »Sie sind spät dran.«
Sein Lächeln blieb, aber der Unterton seiner Stimme schwankte, als könnte er sich nicht recht zwischen Freundlichkeit und Strenge entscheiden.
»Es gab leider ein paar Probleme mit unserem Taxi«, entgegnete Cassidy mit zerknirschter Miene. »Tut uns wirklich leid.«
Er nickte verständnisvoll. »Der Verkehr?«
»Oh, ja. Eine Katastrophe, also echt.« Sie stützte sich mit einem Ellbogen auf dem hohen Tresen ab und wickelte sich eine Haarsträhne um den Finger. »Da fährt man morgens extra überpünktlich los und kommt trotzdem zu spät. Nicht mal fürs Frühstück hat es gereicht.«
Überpünktlich also?
»Tja, willkommen in meinem Leben.« Der Rezeptionist gab ein Seufzen von sich, das ehrlich frustriert klang. Doch schon in der nächsten Sekunde war er wieder zu seiner anfänglichen Professionalität zurückgekehrt. »In Ordnung. Kommen Sie mit, ich bringe Sie zu Mrs Gold.« Er schob seinen Stuhl zurück und bedeutete uns, ihm zu folgen.
Wir liefen unter einem großen Torbogen hindurch, stiegen zwei kleine Treppenstufen hinunter und standen kurz darauf in der eindrucksvollen Lobby, die – wie ich bei meinem Interview erfahren hatte – als das grüne Herz der Kanzlei galt. Sobald man sie sah, verstand man auch, warum. Es war eine dreistöckige Empore mit Lichtkuppeldach, bestehend aus dicken Holzsäulen und -balustraden, um die sich die Arme grüner Kletterpflanzen gewickelt hatten. Großblättrige Philodendren rankten sich an den Säulen hinauf, während Strelitzien und Palmen in großen Töpfen die Sitzecken mit den dunkelgrünen Kunstledersofas schmückten. Zwei mit weinrotem Teppich ausgelegte Treppen führten rechts und links auf die Laufgänge im ersten Obergeschoss. Dort befand sich laut der Empfangsdame, die mich beim letzten Mal zu Natalie Golds Büro geführt hatte, ein Teil der Büroräume der Zivilrechtsabteilung – der andere Teil im zweiten Obergeschoss. Die dritte Etage beherbergte die etwas kleinere Strafrechtsabteilung.
Unsere Schuhabsätze klackerten auf dem Parkett, und von allen Seiten wurden uns flüchtige Blicke von gehetzt aussehenden Menschen in edlen dunklen Anzügen und Kleidern zugeworfen. Mit jedem von ihnen wurde mir bewusst, dass ich mit meinem Outfit den einzigen bunten Farbklecks in einem Meer aus gedeckten Tönen bildete. So viel zur Ufernähe.
Wir durchquerten die Kolonnaden im Erdgeschoss, bogen in einen schmaleren Gang ab, von dem mehrere vertäfelte Türen abgingen, und blieben schließlich vor einer davon stehen. Nach einem kurzen Klopfen öffnete der Rezeptionist sie, weshalb ich automatisch die Luft anhielt. »Natalie? Ich habe hier noch zwei Nachzüglerinnen für Sie.«
Natalie Gold war die Erste von insgesamt acht Personen, auf die mein Blick beim Betreten des lichtdurchfluteten Konferenzraumes fiel. Bereits bei meiner ersten Begegnung mit ihr hatte ich mich gefragt, wie es ihr über die Jahre hinweg gelungen war, trotz ihres nervenaufreibenden Jobs optisch so jung geblieben zu sein. Immerhin dürfte sie inzwischen schätzungsweise Mitte fünfzig sein. Sie hatte ihr schwarzes Haar im Nacken zu einem strengen Knoten zusammengebunden, lediglich zwei lose Strähnen umspielten ihr weiches Gesicht. Dazu trug sie große Creolen und einen cremefarbenen Hosenanzug, der den goldenen Schimmer ihrer gebräunten Haut betonte. Allerdings war es nicht allein das, was sie leuchten ließ. Es war vor allem das, was sie ausstrahlte: Macht, Charisma, Selbstbewusstsein. Sie erinnerte mich an meine Stiefmutter; eine toughe Frau, deren Kritik man fürchtete, weshalb man alles dafür tat, um Fehler zu vermeiden.
Neben ihr erkannte ich zudem ihre Assistentin, mit der ich mehrmals über Mail kommuniziert hatte, und den zweiten namensgebenden Partner der Kanzlei wieder, der meinem Vorstellungsgespräch ebenfalls beigewohnt hatte.
Alistair Bright war ein schmächtiger, adrett gekleideter Mann mit dünnen Silberfäden im Haar und scharfen, leicht vorstechenden Gesichtszügen, die mich an einen Greifvogel erinnerten. In seinem Blick lauerte etwas so Wachsames, dass es mir während des Interviews schwergefallen war, ihm in die eisblauen Augen zu sehen. Vielleicht verdankte er dieser Taktik seinen Erfolg im Gerichtssaal.
»Guten Morgen. Entschuldigen Sie die Verspätung. Es gab leider ein paar Komplikationen auf dem Weg hierher«, brachte Cassidy zögerlich hervor.
Komplikationen. Ich fragte mich, ob die größte Komplikation inzwischen angekommen war, wo auch immer sie erwartet wurde.
»Setzen Sie sich bitte.« Natalie deutete auf den langen Konferenztisch, an dem bereits drei junge Männer und zwei Frauen saßen. »Ich sagte gerade, dass ich es ganz nett fände, wenn wir uns alle in einer kurzen Vorstellungsrunde miteinander vertraut machen würden. Besonders zu Beginn ist es ratsam für Sie, Kontakte zu knüpfen. Auch wenn Sie früher oder später wahrscheinlich beginnen werden, einander die Köpfe einzuschlagen.«
Na, wenn das nicht verlockend klingt.
Ich nickte zustimmend und steuerte den freien Stuhl neben dem jungen Mann mit der Brille und dem kupferroten Haar an. Im Gegensatz zu den anderen trug er nämlich ein warmes Lächeln auf den Lippen und rückte mir sogar den Stuhl zurecht.
Cassidy nahm zu meiner Linken Platz, den Blick neugierig auf den Typen mir gegenüber geheftet, der mit seiner steinernen Miene aussah, als würde er in diesem Moment alles lieber über sich ergehen lassen als eine Vorstellungsrunde. Ich konnte es ihm nicht verdenken. In solchen Runden wurde mir jedes Mal wieder bewusst, wie schlecht ich darin war, über mich selbst zu sprechen. Sie gaben mir das Gefühl, etwas sagen zu müssen, von dem ich wusste, dass die Leute es hören wollten. Nicht weil ich glaubte, dass es sie interessierte. Eher weil ich davon überzeugt war, dass es sie zufriedenstellte, zu hören, dass man mit dem Strom schwamm und nicht dagegen.
Natalie setzte sich auf die Tischkante. »In Ordnung. Ich würde vorschlagen, wir –«
Ein kräftiges Klopfen an der Tür schnitt ihr das Wort ab.
»Das ist dann wohl Nachzügler Nummer drei«, brummte Alistair Bright, der jetzt auf der anderen Seite des Raumes mit verschränkten Armen an einem der Fensterrahmen lehnte.
Die Tür flog auf, und ein junger Mann stolperte herein. Er wirkte abgehetzt, seine Kleidung tropfte, und das Haar klebte ihm platt an der Stirn. Ich wusste, wer er war, noch bevor er den Mund öffnete. Immerhin hatte ich ihm erst vor einigen Minuten das Taxi vor der Nase weggeschnappt …
»Verzeihen Sie meine Verspätung«, stieß er unter beschleunigtem Atem hervor. »Ich war kurzfristig gezwungen, auf mein Fahrrad umzusteigen.«
Mein Herz sackte beim Klang seiner Stimme in eine tiefe Grube, und plötzlich spürte ich sein Wummern überall.
Das kann nicht sein. Das ist unmöglich.
Alistairs buschige Augenbraue schoss in die Höhe. »Ziemlich viele Komplikationen für meinen Geschmack heute.«
Natalie musterte meinen Nachbarn von Kopf bis Fuß, eine besorgte Falte auf der Stirn. »Du liebe Güte, Sie sind ja vollkommen durchnässt. Kann ich Ihnen irgendetwas bringen lassen?«
Er winkte ab, aber ich bemerkte die roten Flecken an seinem Hals trotzdem. »Nur keine Umstände, Ma’am. Das trocknet schon wieder.«
»Gut, wenn Sie meinen … Nehmen Sie Platz.« Natalie wies mit ihrem Kinn auf den Konferenztisch, an dem wir saßen.
Erst jetzt schien er die übrigen Personen im Raum richtig wahrzunehmen. Er blickte bei seinem Gang zum einzigen freien Stuhl flüchtig in die Runde, wobei er zunächst etwas zu lange an Cassidy hängen blieb. Dann landeten seine blassgrünen Augen auf mir, und sein Schritt geriet für den Bruchteil einer Sekunde ins Wanken. Eilig senkte ich den Kopf, um einen Teil meines Gesichts hinter einem rotblonden Schleier zu verstecken.
Erst nachdem er sich gesetzt hatte, schielte ich wieder verstohlen zu ihm hinüber. Er war aus seinem durchnässten Mantel geschlüpft und überprüfte eilig, ob der Stoff seines weißen Hemdes an irgendwelchen Stellen durchsichtig geworden war – was nicht der Fall war. Lediglich an seinen Oberarmen schimmerte ein wenig Haut durch.
»Da wir nun endlich vollzählig sind, beginne ich doch noch einmal damit, meine Kolleginnen und Kollegen vorzustellen, die manche von Ihnen vielleicht auch schon aus Ihren Bewerbungsgesprächen kennen. Zum einen meinen langjährigen Geschäftspartner Alistair Bright. Und zum anderen meine rechte Hand Ms Hodge, die sich Tag für Tag für mich durch einen Berg von Unterlagen wühlt.«
Mit einer ausschweifenden Handbewegung schloss Natalie zunächst Alistair ein, dann ihre Assistentin. Ms Hodge war eine zierliche junge Frau mit Brille, deren hochgebundener Zopf fröhlich auf und ab wippte, als sie uns allen zunickte.
»Des Weiteren möchte ich Ihnen Ms Isabell Fraser vorstellen. Sie arbeitet nun schon seit fast acht Jahren bei uns und wurde erst kürzlich zur Partnerin ernannt. Auch sie wird Ihnen, genau wie Alistair und ich, als Mentorin zur Seite stehen.«
Am anderen Kopfende des Tisches erhob sich eine Frau, die ich bis eben beinahe vollständig ausgeblendet hatte, weil sie sich weder bewegt noch ein Wort von sich gegeben hatte. Sie wirkte noch recht jung für eine Partnerin, vielleicht Anfang oder Mitte dreißig. Ihr feuerrotes Haar, das im Licht der Deckenbeleuchtung glänzte, ergoss sich in sanften Wellen über ihren schwarzen Rollkragenpullover.