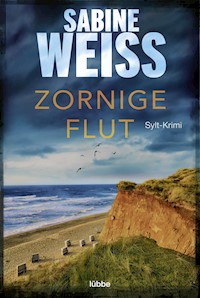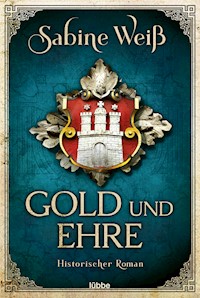
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Historischer Roman um den Bau des Hamburger Michels, Krieg und Frieden und die Freiheit, sein eigenes Glück zu suchen
Nach einem verunglückten Experiment wird Benjamin von seinem Vater nach Hamburg geschickt. Anfangs tut sich der junge Architekt schwer so fern der Heimat. Er wird belogen und betrogen, doch bald lernt er Menschen kennen, auf die er zählen kann - allen voran Lucia, die stehlen muss, um das Überleben ihrer Familie zu sichern. Sie fasziniert ihn, auch weil sie blitzgescheit ist. Als Benjamin von seinem Vater zurück nach Amsterdam gerufen wird, bleibt sie zurück. Kann dennoch mehr aus ihrer Verbindung werden?
Folgen Sie Sabine Weiß’ Helden ins spannende 17. Jahrhundert, und erleben Sie Amsterdam und Hamburg von einer neuen Seite!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungVersePersonenverzeichnisProlog1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162EpilogGlossarAnmerkung und DankÜber dieses Buch
Ein großer Historischer Roman um den Bau des Hamburger Michels, Krieg und Frieden und die Freiheit, sein eigenes Glück zu suchen Nach einem verunglückten Experiment wird Benjamin von seinem Vater nach Hamburg geschickt. Anfangs tut sich der junge Architekt schwer so fern der Heimat. Er wird belogen und betrogen, doch bald lernt er Menschen kennen, auf die er zählen kann – allen voran Lucia, die stehlen muss, um das Überleben ihrer Familie zu sichern. Sie fasziniert ihn, auch weil sie blitzgescheit ist. Als Benjamin von seinem Vater zurück nach Amsterdam gerufen wird, bleibt sie zurück. Kann dennoch mehr aus ihrer Verbindung werden? Folgen Sie Sabine Weiß’ Helden ins spannende 17. Jahrhundert, und erleben Sie Amsterdam und Hamburg von einer neuen Seite!
Über die Autorin
Sabine Weiß, Jahrgang 1968, arbeitet nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstudium als Journalistin. 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Historischen Roman, der zu einem großen Erfolg wurde und dem viele weitere folgten. Im Sommer 2017 erscheint ihr erster Kriminalroman, »Schwarze Brandung«. Unabhängig davon, ob sie gerade einen Krimi oder einen Historischen Roman schreibt: Sabine Weiß liebt es, im Camper auf den Spuren ihrer Figuren zu reisen und direkt an den Schauplätzen zu recherchieren. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nordheide bei Hamburg.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Karte: Markus Weber, Guter Punkt, München
Einband-/Umschlagmotive: © shutterstock.com: Oliver Hoffmann | Chokniti Khongchum | Marzolino | Filipchuk Maksym | leoks | Olena Zaskochenko; © commons.wikimedia.org: Wmeinhart
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1009-1
luebbe.de
lesejury.de
Meinen Eltern gewidmet, die in der Hamburger St. Michaelis Kirche getraut wurden
Zeigt der Venetier Stadt sich mitten in den Wellen/
Hamburg wird gleicher Art sich dir vor Augen stellen.
Ligt Antorff schön umbwällt/und trägt der Vestung Lob/
So ligt es Hamburg gleich/doch gleichwol niemals ob.
Vergöldt sich Amsterdam aus des Neptunus Reiche/
Hamburg hat des Neptuns und Ceres’ Reich zugleiche.
O vielbeglückte Stadt! Bleib nur in Einigkeit
So nennt man dich mit Recht die Schönste dieser Zeit.
Johann Huswedel, übersetzt durch Georg Greflinger
Sankt Petri de Rieken
Sankt Nikolai desglieken
Sankt Catharinen de Sturen
Sankt Jakobi de Buren
Sankt Michaelis de Armen
Daröber mag sick Gott erbarmen
Volkstümlicher Vers über die fünf Hamburger Hauptkirchen
Personenverzeichnis
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet
Niederlande
Benjamin Michielsz Aard, Architekt und Maler aus Amsterdam
Michiel Vicentsz Aard, sein Vater, Architekt und Politiker
Daan, sein Bruder, Architekt und Politiker
Samuel van Sanders, Benjamins Onkel und Entrepreneur
Mademoiselle Charlotte von Gerulfing
Theo Krisz Aard, Schiffschirurg und Benjamins Cousin
Yorick Nicklefs, Steuermann
Johan de Witt, Politiker*
Prinzessin Amalia von Solms*
Prinz Wilhelm II.*
Prinz Wilhelm III.*
Prinzessin Mary Henrietta Stuart*
Michiel de Ruyter*
Daniël Stalpaert*, Amsterdams Stadtbaumeister
Jacob van Campen*, Architekt
Hamburg
Lucia Kaven, Tochter eines Steinhändlers
Tobias, ihr Bruder
Hinrik Broders, Handelsgärtner
Oliver Cooper, englischer Kaufmann
Abraham Senhor Teixeira*
Manoel Teixeira*
Königin Christina von Schweden*
König Charles II. von England *
Jean-Baptiste Colbert*
Kardinal Mazarin*
Prolog
Hamburg, Anno Domini 1600
Erst hatte es nur gedröppelt, dann gepieselt, und jetzt pladderte es. Dass Jürgen vom Holte sich für die pelzgefütterte Schaube entschieden hatte, erwies sich bei diesem Schmuddelwetter als Fehler, denn der Mantel hing ihm regenschwer an den Schultern. Sein Barett war so vollgesogen, dass das Wasser ihm von der Mütze in den Nacken lief. Bei jedem Tritt schmatzte der Matsch in seinen Schuhen. Vor ihm glitt einer der Ratsherren im Schlamm aus und wäre beinahe gestürzt, wenn er ihn nicht im letzten Moment noch aufgefangen hätte.
Jürgen schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass es zu regnen aufhören möge. Der Weg von der Hamburger Stadtmauer bis zum Friedhof hinter dem Millerntor war auch so beschwerlich genug. Eine derartig unwürdige Bestattung hatte niemand verdient, der Tote schon gar nicht. Basilus war als Schreiber für ihn und die anderen Kirch- und Leichnamsgeschworenen tätig gewesen und hatte sich in der reichen Pfarrei Sankt Nikolai verdient gemacht. Vor allem aber war er mein Freund, dachte Jürgen, und wünschte dem Toten die gnädige Hand Gottes.
Heute verlangte der Herrgott ihnen allerdings viel ab. So heftig schüttete es jetzt, dass Jürgen die Sargträger nur noch schemenhaft erkennen konnte. Die Kerzen waren schon lange verloschen. Bald schwimmen die Heringe an uns vorbei. Jürgen versuchte, das Kratzen in seinem Hals zu ignorieren.
Endlich hatten sie den Kirchhof zwischen dem Ziegelfeld und dem Garten des Bürgermeisters erreicht. Das Geviert war so glitschig, dass einer der Sargträger der Länge nach hinschlug. Gerade noch konnte verhindert werden, dass der schlichte Holzsarg im Dreck landete. Das schwarze Tuch, das den Sarg bedeckte, war allerdings über und über besudelt. Hastig spulte der Pastor die Gebete ab, immer wieder unterbrochen durch lautstarke Hustenanfälle. Jürgen konnte es niemandem verdenken, der sich nicht auf diesem neuen Friedhof beerdigen lassen wollte. Derart lieblos in die Grube zu fahren, auf einem öden Acker und ohne Glockengeläut, war unwürdig. Und doch war die Einrichtung dieses Friedhofs vor den Toren der Stadt nötig gewesen, das wusste er als Angehöriger einer Familie, die mit Bürgermeistern und Ratsherren die Geschicke der Stadt lenkte, sehr wohl. Pestwellen und andere Seuchen hatten in den vergangenen Jahren zahllose Opfer gefordert. Dennoch wuchs Hamburg unaufhaltsam weiter, nicht zuletzt durch die Menschen, die vor dem Krieg aus den Spanischen Niederlanden in die Freie Reichsstadt flohen. So überfüllt war die Hansestadt, dass vor den Stadtmauern zahllose Häuser und Hütten errichtet worden waren. Es war beinahe so, als entstünde eine neue Stadt, schutzlos und ohne die Annehmlichkeiten Hamburgs.
Der Pastor sprach immer schneller. Der Sarg wurde mehr ins Grab geworfen als gesenkt, und die Trauernden eilten auseinander, als könnten sie es kaum erwarten, endlich nach Hause zu kommen. Jürgen sehnte sich ebenfalls danach, am bollernden Kachelofen einen warmen Würzwein auf seinen Freund zu trinken, einfach wegzulaufen aber war ungehörig. Es musste sich etwas ändern. Er richtete sich auf. Er würde dafür sorgen, dass an diesem Kirchhof eine Kapelle errichtet wurde, damit es mit dieser Unsitte ein Ende hatte. Denn ging es im Leben nicht darum, die Würde zu wahren, auch angesichts von Widrigkeiten?
1
Amsterdam, 30. Juli 1650
Benjamins Finger drohten an der Windmühlenkappe abzurutschen. Trotzdem schob er sich weiter durch die Luke. Der Regen peitschte ihm um die Ohren, und der Wind zerrte an den Flügeln der Mühle. Durch die Bewegung des Oberkammrads auf der Flügelwelle vibrierte das wettergegerbte Holz; das dumpfe Rumpeln der Mechanik ging ihm durch Mark und Bein. Als er die Regentropfen aus den Wimpern blinzelte, zersprangen diese zu Lichtreflexen. Wie eine verlöschende Glutpfanne lag Amsterdam vor ihm. Eine Stadt zwischen Sumpf und See, zwischen Moor und Meer. Vereinzelt schimmerten Lichter in den Häusern. Aschgraue Wolken taumelten über den mondlosen Himmel, vermischten sich mit dem Rauch, der aus unzähligen Schornsteinen quoll. Die hitzige Energie dieser Stadt schien verflogen. Hätte es nicht schwarz auf weiß in seinem Almanach gestanden, hätte er bezweifelt, dass tatsächlich Hochsommer war.
Ein Blitz zuckte über das Firmament. Wie schade, dass das Gewitter so weit weg war! Es hätte seine Forschungen um einen weiteren Aspekt bereichert. Noch einmal ließ der Neunzehnjährige seinen Blick auf der hügeligen Landschaft nassglänzender Dächer und spiegelnder Flächen ruhen. Amsterdam war zweifellos eine Wasserstadt. Da war der Fluss Amstel, der sich in die Grachten ergoss. Es gab das IJ, den Meeresarm der Zuiderzee, der an den Hafen brandete. Die Sumpfadern und Seen. Und natürlich das Haarlemmermeer, das sich im Südwesten der Stadt stetig weiter ausbreitete. Ein Jammer, dass die Bürgermeister sich nicht durchgerungen hatten, den Waterwolf zu bändigen, dieses landfressende Wasserungeheuer! Dabei hatte der Ingenieur Leeghwater einen ausgefeilten Plan entwickelt, wie das Land trockengelegt werden könnte. Aber angeblich kosteten die einhundertsechzig Windmühlen mit ihren Wasserpumpen zu viel Geld. Ein kurzsichtiges Urteil, fand Benjamin. Was war diese Investition schon gegen den Ertrag des Landes, das sie gewinnen würden? Waren sie, die Holländer, nicht die Beherrscher des Wassers, die Herren der Ozeane?
Am Horizont kündigte ein schwefelgelbes Glimmen den Sonnenaufgang an. Je stärker das Licht durchbrach, desto dünner schienen die Regenschleier zu werden. Ob eine Verbindung zwischen dem Schein der Sonne und dem Abklingen des Unwetters bestand? Auch das wäre eine Frage für seine Forschungen.
Benjamin schauderte, als der Regen seine Jacke durchdrang und ihm über den Rücken perlte. Es kam ihm vor, als ob sich Nässe nicht unbedingt segensreich auf den menschlichen Körper auswirkte. In Gedanken notierte er sich, mit Theo darüber zu beraten oder den Arzt Nicolaes Tulp dazu zu befragen, dessen Vorlesungen an der Illustren Schule er gelauscht hatte und dessen öffentliche Sektionen er stets besuchte. Die Leichenöffnungen waren zwar etwas gruselig, erhellten den Geist aber ungemein.
Endlich riss Benjamin sich von dem Anblick Amsterdams los und wandte sich wieder seinem Vorhaben zu. Vorsichtig setzte er die Füße auf die Leiste. Das schmale Holz, das die Kappe der Windmühle einfasste, war glitschig. Natürlich wäre einer der Kirchtürme für seine Zwecke besser geeignet gewesen, dort aber sah man derartige Experimente nicht gerne. Jungen Männern unterstellten die Küster ohnehin, sie würden nur Unfug treiben. Nicht ganz unberechtigt, das musste Benjamin zugeben, denn auch Theo und seine Freunde machten sich einen Spaß daraus, beim nächtlichen Kolf-Spiel mit Ball und Schläger auf Fensterscheiben zu zielen.
Er schob sich vor, sah hinunter. Obgleich der Regendunst den Abgrund harmlos erscheinen ließ, wusste er, dass ein Sturz tödlich sein konnte. Aber was tat man nicht alles im Dienste der Wissenschaft?
Stück für Stück balancierte er vor, bis seine Hände den sicheren Halt aufgeben mussten. Nur noch seine Zehenspitzen trugen ihn. Hart schlug sein Herz in seinem Brustkorb. Wie lebendig er sich fühlte! Die Mechanik des Herzschlags – noch so ein Rätsel der Natur, über das er oft mit Theo diskutierte.
Der Gedanke verflog so schnell, wie er gekommen war. Am liebsten hätte er seiner Erregung in einem Schrei Luft gemacht, doch damit hätte er die Aufmerksamkeit der Wächter auf Theo und sich gelenkt und unnötigen Ärger provoziert.
Plötzlich hörte er den gedämpften Ruf seines Cousins. Was wollte Theo ausgerechnet jetzt? Benjamin neigte sich ein wenig über die Kante. Böen brachten seine langen Haare und die Rockschöße seines Mantels zum Flattern. Theos Gesicht schien als heller Schemen im Dunst auf.
»Wo bleibst du denn? Ich bin klitschnass, und mir ist kalt. Hast du sie scho-? Bist du irre geworden?« Theo hatte Benjamin offensichtlich gerade entdeckt. »Was tust du da? Erst gestern musste ich die zerschmetterten Glieder eines Matrosen versorgen, der vom Mast gefallen war. Das war kein schöner Anblick, das sage ich dir! Die Knochen hatten sich durch das Fleisch gebohrt. Ich weiß schon, warum ich nicht zur See fahre wie mein Alter.«
Nicht das schon wieder! Und jetzt schon gar nicht! »Ruhig! Du verrätst uns noch!«, unterbrach Benjamin ihn. Er tastete sich weiter vor. Dann lehnte er sich gegen die Mühlenkappe, eine Hand an der Dachkonstruktion, und löste mit der anderen das Seil vom Haken. Vorsichtig zog er die Kette mit den Behältnissen zu sich heran. Am besten notierte er gleich hier den Wasserstand. Unten wären die Untersuchungsergebnisse möglicherweise bereits verfälscht. Und hing wissenschaftliche Erkenntnis nicht von Genauigkeit ab?
Nachdem er die Schlaufen mit dem Seilende zusammengeknotet hatte, baumelten die Gläser wie eine funkelnde Traube. Langsam balancierte er zurück. Die Seiten seines Notizbuchs flatterten neben der Luke, nur schwach vom Schein der Öllampe erhellt, die er ein Stück weiter im Inneren der Mühle abgestellt hatte.
»Ich höre Leute auf den Straßen. Komm schon, wir müssen fertig werden! Ich kann nicht noch mehr Ärger brauchen«, rief Theo.
»Gleich!«
Benjamin wollte sich gerade auf den Mühlenboden ziehen, als ein Windstoß sein Notizbuch erfasste und zu seiner Öl-Uhr trug. Die Flamme hatte lange gebrannt, und der Ölstand zeigte den Morgen an. Es war mehr Zeit vergangen, als er gedacht hatte. Das Papier flatterte heftiger im Wind. Gleich würden seine kostbaren Beobachtungen und Entwürfe Feuer fangen und verbrennen! Was tun? Das Seil konnte er nicht loslassen, dann wäre das Experiment vergebens gewesen und die teuren Gläser würden zerbrechen. Außerdem war die baufällige Mühle ab morgen in den Händen der Zimmerleute und eine Wiederholung des Versuchs unmöglich. Schon kokelte eine Ecke des Papiers. Instinktiv löste Benjamin die Finger von der Holzkante, um das Buch zu retten. Die Glastraube schwang, das Gewicht des Seils zog ihn gen Abgrund, seine Füße verloren auf der Kante den Halt, er wankte. Unter sich hörte er Glas klirren. Sein Herz überschlug sich. Endlich gelang es ihm, sich in eine Ritze zwischen den Holzsparren zu krallen.
Der Wind wehte zornig klingende Wortfetzen zu ihm: »Was machst … denn! Willst … erschlagen?«
Benjamin zog sich in Sicherheit. Seine Hände zitterten, als er die durchnummerierten Gläser aufstellte, eines nach dem anderen überprüfte und seine Beobachtungen notierte.
»Lass … abhauen. Hast … Kirchenglocken nicht … muss zum Dienst … Außerdem … kalt … Mistwetter … kann doch kein Sommer sein«, schimpfte Theo weiter.
Um genau das herauszufinden, sind wir hier, dachte Benjamin, ganz konzentriert auf seine Aufzeichnungen. Die Ergebnisse würde er sofort analysieren und den anderen Gelehrten mitteilen.
Ehe er die Mühlenkappe schloss, sah Benjamin noch einmal über das Land. Inzwischen hatte die Nacht den Kampf gegen den Tag verloren. Die Wolken wurden vom Wind in Stücke gerissen. Vielleicht bekämen sie doch mal wieder mehr als ein paar trockene Stunden.
In der Nähe des Amstellaufs bemerkte er eine Bewegung. Kurz bedauerte er, dass er sein Fernrohr nicht dabeihatte. Waren das Reiter? Und warum hatten sie es so eilig?
»Komm jetzt endlich!«
Benjamin kniff die Augen zusammen. Tatsächlich! Zwei Reiter preschten zum Stadttor. Auf das Pferd des einen war ein großer Sack geschnallt. Es könnte einer der Postkuriere sein, die zwischen Amsterdam und anderen Handelsstädten pendelten. Aber der zweite …
Da stimmte etwas nicht. Eine Vorahnung ergriff ihn. Benjamin bugsierte das Gläserbündel und sein Notizbuch in den Sack und lief die Mühlentreppe hinunter, sprang über die maroden Bretter, stolperte, nahm das Klirren kaum wahr, kam endlich unten an. Ohne eine Erklärung abzugeben, huschte Benjamin auf dem Wall entlang Richtung Stadttor. Im Schutz einer Mauer versteckte er sich.
Theo lief ihm fluchend nach. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Da unten sind Stimmen zu hören. Gleich kommt die Wache!«
»Das Tagesgeschäft bricht an – niemand wird sich dann noch über uns wundern.«
Theo hockte sich neben ihn, sprang aber gleich wieder hoch. »Godverdomme! Jetzt habe ich mir den neuen Radmantel eingesaut!«
»Still!« Benjamin lauschte dem Wortwechsel, der leise zu ihnen drang. Die Stadtwache diskutierte offenbar mit den beiden Reitern.
»Überfall, sagt Ihr? Mijnheer Bicker schickt Euch, der Drost von Muiden? Eine Armee? Und woher wollt Ihr das wissen?«
Eine überreizte Stimme antwortete: »Das sagte ich doch gerade! Dieser Kurier kommt aus Hamburg. Im Gooi, nahe Hilversum, stieß er auf die Truppen unseres Statthalters. Kavallerie und Fußsoldaten, so weit das Auge reicht. Schwerbewaffnet und wild darauf, Amsterdam zu überfallen und auszuplündern. Mit einem Soldaten hat dieser Kurier hier geredet. Der hat Ungeheuerliches herausposaunt: Prinz Wilhelm lässt zwölftausend Mann gen Amsterdam ziehen. Er will die Stadt unterwerfen.«
»Unsinn, das würde der Oranier nie tun. Weshalb sollte er uns angreifen? Und warum sollten die Soldaten mit dem Kurier sprechen? Wenn überhaupt, wäre es doch ein geheimer Angriff!«
Ein weiterer Mann redete jetzt, das musste der Kurier sein: »Die Armee hat sich im Unwetter verlaufen und nach dem Weg gefragt!«
»Ha! Soldaten, die sich verlaufen – dass ich nicht lache!« Die Stadtwache lachte trotz seines Ausrufs schallend.
»Bei dem Wetter habe selbst ich in der Heide- und Waldlandschaft des Gooi den Pfad kaum gefunden, obgleich ich ständig dort unterwegs bin.«
Jetzt ergriff wieder der erste Mann das Wort: »Drost Bicker wird demnächst mit seiner Kutsche hier eintreffen. Wenn die Armee des Prinzen Amsterdam überrennt, weil die Stadt nicht für den Angriff gerüstet ist, seid Ihr schuld! Ich werde unserem Bürgermeister von Eurem Widerstand berichten. Cornelis Bicker wird das nicht gutheißen.«
»Nun wartet doch, Mijnheer …« Der Wachmann klang jetzt verunsichert.
Theo stieß Benjamin den Ellbogen in die Seite. Obgleich das Gesicht seines Cousins halb von dessen ausladendem Filzhut verschattet war, konnte Benjamin die Anspannung erkennen. »Glaubst du dem Kurier?«, fragte Theo.
»Warum sollte jemand sich diese Geschichte ausdenken?«
»Ein Angriff auf uns – zuzutrauen wäre es diesen kriegssüchtigen Oraniern! Wozu brauchen wir die überhaupt? Ein Adelshaus wie ihres frisst lediglich unsere Steuern. Wir sind eine Republik mündiger Bürger. Andere Länder kommen auch ohne Könige und Prinzen aus!«
Während Theo sich in Rage redete, stand Benjamin dem Thema eher gleichgültig gegenüber. Sein Urgroßvater war einst für den ersten Wilhelm von Oranien tätig gewesen und hatte diesen geschätzt. Der Oranier hatte damals den Aufstand gegen den spanischen König angeführt, zu dessen Reich Holland zu jener Zeit noch gehört hatte. »Wir sollten nicht undankbar sein. Ohne Wilhelm den Schweiger hätten wir vielleicht nie die Freiheit errungen –«
»Und uns nie von der Unterdrückung durch Papst und Katholizismus befreit, ich weiß. Außerdem verdient ihr Architekten und Künstler gut am Adel. Trotzdem –«
»… ist jetzt keine Zeit für politische Disputationen«, fiel Benjamin ihm ins Wort. »Lass uns verschwinden. Ich muss meinen Vater informieren.«
Theo sprang auf und richtete seine Kleidung so, dass sie besonders lässig aussah. Offen stehendes Hemd, wallende grüne Hosen, gelbe Schleifen – diese bunte Schlampigkeit war nicht nur bei ihm ein Protest gegen die strenge calvinistische Tracht. »Jeetje!«, schimpfte er, während er den Dreck von seinem rot unterfütterten Radmantel klopfte. »Wenn mein Vater erfährt, dass wir beide hier herumgelaufen sind, muss ich mir wieder eine Predigt anhören! Aber nicht mehr lange, dann –«
»Meinst du, ich dürfte das meinem Vater gegenüber erwähnen? Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. Und zwar schnell.«
Nicht nur, dass er sich des Nachts aus dem Haus geschlichen hatte, auch dass er sich mit seinem Cousin traf, war Benjamin verboten. Seit er denken konnte, waren ihre Väter zerstritten. Warum, wusste niemand – er zumindest nicht. Auf jeden Fall betrachtete sein Vater Michiel seinen Halbbruder Kris als Schande für die Familie und als Hemmschuh für seine politische Karriere. Den Kontakt zum anderen Familienzweig hatte Michiel seinen Söhnen daher streng untersagt.
Aufgeschreckt sah Benjamin sich um. Ein erster Hirte trieb sein Vieh auf den Stadtwall. Gleich würde er sie sehen. Lange würde es auch an der Amstelschleuse nicht mehr ruhig bleiben. Er trennte sich von Theo, denn er hatte ein gutes Wegstück vor sich. Hätte doch eine der Windmühlen auf der anderen Seite des Stadtwalls leer gestanden! Aber dann hätte er die Reiter nicht entdeckt.
An der Binnenamstel sprang Benjamin in sein Ruderboot. Nachdem er seinen Beutel mit den Gläsern und dem Schreibzeug verstaut hatte, legte er sich in die Riemen. Wie Scherenschnitte zeichneten sich die Giebel der Grachtenhäuser vor dem Himmel ab: einige wenige einfache Spitzgiebel uralter Holz- und Fachwerkhäuser, Lagerhäuser mit schlichten Schnabelgiebeln, traditionelle stufenförmige Treppengiebel und die modernen, mit Voluten verzierten Halsgiebel. Wie Paläste sahen manche Häuser mit ihren kolossalen Säulen aus. Von vielen kannte er den Architekten. Etliche hatte sein Großvater, andere sein Vater entworfen. Großvater Vincent hatte einst sowohl am Entwurf als auch am Bau des Grachtengürtels mitgewirkt und sich später selbst ein Grundstück sichern können. Heute wäre diese Fläche in einer der besten Lagen Amsterdams vermutlich unbezahlbar. Nur die Häuser in der Heren- und Keizersgracht waren noch teurer, weil die Grundstücke größer waren und kaum Handwerker oder Kaufleute die Wohnqualität mit ihrer Arbeit minderten. Benjamin war stolz, wie seine Familie diese Stadt, die er so sehr liebte, mitgeprägt hatte.
Beim Sinnieren war er aus dem Takt geraten, und er zog wieder heftiger an den Rudern. An der Prinsengracht war noch alles ruhig. Ein einzelnes Licht schimmerte durch die Fensterläden ihres Hauses. Säulengeschmückt und mit üppigen Dekorationen verziert warb es für den Architekturstil seines Vaters. Als Michiel Vicentszoon Aard das Haus umgebaut hatte, war es das modernste weit und breit gewesen. Bereits wenige Monate später war er allerdings übertrumpft worden. So war es in Amsterdam mit allem: Einander zu übertreffen schien die liebste Beschäftigung der wohlhabenden Poorter zu sein. Albern, wie Benjamin fand. Da war ihm die Wissenschaft lieber. Zahlen und Fakten trogen nicht.
Benjamin band das Boot fest und kletterte die Leiter an der Kanalwand hoch. In seinen Augen wirkte ihr Grachtenhaus mit seinen Verzierungen ein wenig in die Jahre gekommen. Als Architekt eiferte er dem klassischen Baustil eines Palladio oder Scamozzi nach. Dieser Stil war zeitlos, weil er auf den antiken Grundlagen der Ästhetik beruhte und keinen modischen Schwankungen unterlag. Alles war würdevoll und klar, Überflüssiges ließ man einfach weg. Ein Baustil für die Ewigkeit.
Er sah sich um. Unvorstellbar, dass diese friedliche Stadt durch ein Heer bedroht sein sollte. Ohnehin war es unglaublich, dass jemand es wagte, sich mit der Weltmacht Holland anzulegen. Sofort mussten Maßnahmen ergriffen werden. Sie mussten sich verteidigen! Vater musste umgehend den Rat zusammenrufen. Was Benjamin ihm berichten konnte, war genau die Art Information, nach der der geachtete Architekt, Kaufmann und Baudezernent Michiel Vicentszoon Aard hungerte. Unter diesen Umständen würde er seinem Sohn sogar verzeihen, dass er sich aus dem Haus gestohlen hatte.
2
Im Erdgeschoss in der Prinsengracht war alles still. Dass die Magd aber auch eine solche Schlafmütze war! Das fahle Morgenlicht fiel auf Gemälde, Landkarten und Entwürfe, die die Halle schmückten. Laut klangen Benjamins Schuhe auf dem Marmorboden aus schwarzen und weißen Fliesen. Stracks lief er die breite Treppe hoch. Aus dem Zimmer des Bruders drangen Geräusche. Daan war also schon wach. Er musste sofort erfahren, was los war.
Benjamin riss die Tür auf und machte einen Schritt in das Zimmer. In Daans Bett regte sich etwas. Aber … Die Worte blieben ihm im Hals stecken. Unter den Decken bäumte sich jemand auf, das Laken rutschte herunter, legte einen Oberkörper frei, nackte, volle Brüste, die im Takt zweier Körper wippten. Hitze schoss Benjamin ins Gesicht. Er floh, doch es war zu spät. Er wurde das Bild des Liebespaares nicht los. Daan … wie konnte er nur, wo er doch in der Kirchengemeinde den Saubermann spielte! Und Antje … nie wieder würde er der Magd in die Augen sehen können!
»Benjamin? Bleib stehen!« Hinter sich hörte er ein scharfes Zischen, das Tappen bloßer Füße auf dem Boden. Doch er wollte seinen Bruder nicht sehen, nicht mit ihm reden. Er beschleunigte seinen Schritt, klopfte heftig an die Tür des Vaters. Gleich darauf stand Michiel Vicentszoon Aard vor ihm.
Sein Vater trug noch Nachtmütze und Hausschuhe. Er war Anfang fünfzig und machte mit den Hängewangen und dem Bauch, der sich unter dem Hausmantel wölbte, einen gemütlichen Eindruck. In der Hand hielt er seine Pfeife, und kurz fragte sich Benjamin, ob sein Vater diese nicht einmal im Schlaf losgelassen hatte.
Ungnädig zupfte Michiel an seinem Ohrläppchen. »Weshalb störst du mich vor meiner Morgenpfeife? Du weißt doch, dass ich den ganzen Tag Sitzungen wegen des Turms der Nieuwe Kerk und der Sandsteinlieferungen aus Bentheim und Bremen haben werde.«
»Ich dachte, es würde Euch interessieren, wenn ein Angriff auf Amsterdam bevorsteht, Vater.« Benjamin sprach ruhig, bebte innerlich aber vor Aufregung und Kälte; feucht klebte die Kleidung an seinem Körper.
»Ein Angriff auf Amsterdam, wie lächerlich! Das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Wer sollte es wagen, uns anzugreifen?«
»Der Statthalter.«
Michiel klopfte in einer unwirschen Geste die Pfeife aus, sodass die Krümel in seine hohle Hand fielen. »Der Statthalter legt sich bestimmt nicht mit uns an. Wir Amsterdamer leihen ihm schließlich Geld für seinen Hofstaat und finanzieren sein Heer.«
»Und doch hat der Kurier aus Hamburg sehr überzeugend geklungen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er die Truppen selbst gesehen, ja, sogar mit einem der Soldaten gesprochen.«
»Ein Kurier aus Hamburg? Du hast wohl schlecht geträumt!«
»Im Gegenteil. Ich habe seine Worte genau gehört. Der Kurier hat am Muiderschloss haltgemacht und den dortigen Drosten gewarnt, dann ist er hierhergeprescht.«
»Mijnheer Bicker ist geritten?«, fragte sein Vater ungläubig, denn Gerard Bicker, der Stammhalter der reichen und mächtigen Regentenfamilie, war für seine Leibesfülle bekannt.
»Nein, der Bote kam in Begleitung eines Bicker’schen Dieners. Ich nehme an, dass die Stadtwache die beiden zu den regierenden Bürgermeistern bringt und diese eine Notsitzung der Vroedschap veranlassen. Der Rat wird –«
»So, das nimmst du an«, unterbrach sein Vater ihn. »Ich wusste nicht, dass du dich neben deinen diversen Forschungen jetzt auch mit politischen Geschäften beschäftigst, statt dich deiner Arbeit zu widmen. Du hast dich also wieder einmal allein des Nachts in der Stadt herumgetrieben, obgleich ich es dir untersagt habe?«
»Amsterdam wird angegriffen! Wollt Ihr denn gar nichts tun?«, brach es aus Benjamin heraus.
»Natürlich werde ich etwas tun. Was denkst du denn!« Michiel stopfte Pfeife und Tabakkrümel kurzerhand in die Tasche seines Schlafrocks. »Ich werde sofort …« Er verstummte, als er sich die Mütze vom Schädel zog. Die wenigen schütteren Haare, die die kahle Platte einfassten, standen in alle Richtungen ab.
»Ihr müsst zu den Bürgermeistern stoßen«, insistierte Benjamin. »Die haben bestimmt auch gerade erst mit dem Kurier gesprochen. Ihr müsst den Rat zusammenrufen. Ihr müsst –«
»Selbstverständlich!«, schnitt sein Vater ihm das Wort ab. »Helft mir, mich anzukleiden. Daan, wecke Antje, sie soll mir ein schnelles Frühstück bereiten. Eil dich – glaubst du, ich wüsste nicht, dass du dich dort hinten im Gang versteckst und lauschst?«
Daan trat zu ihnen. Seine Wangen waren knallrot. Immerhin hatte er inzwischen ein Hemd übergeworfen. »Ja, Herr Vater. Ich gebe der Magd sofort Bescheid«, sagte er und warf Benjamin einen warnenden Blick zu.
»Anschließend wirst du die Vecht hochfahren und überprüfen, ob Mijnheer de Jongs Vorschläge für das Landhaus umsetzbar sind.«
Benjamin merkte auf. An der Vecht besaßen viele reiche Amsterdamer Bürger Landhäuser. In diesen grünen Oasen verbrachten sie die Sommermonate, wenn in der Stadt die Hitze unerträglich war, die Grachten zu stinken anfingen oder sich Seuchen ausbreiteten. Wenn es um Bau oder Umbau ging, ließen sie sich nicht lumpen, weshalb die Architekten aus dem Vollen schöpfen konnten. Entsprechend begehrt waren die Aufträge. Auch Benjamin hatte bereits Landhäuser entworfen, doch sein Vater hatte ihn noch bei keinem Auftrag zum Zuge kommen lassen. Michiel vertrat die Ansicht, sein Sohn müsse sich langsam hocharbeiten, aber Benjamin fehlte dafür die Geduld. Er war doch schon beinahe mit seiner Ausbildung fertig.
»Ich werde doch nicht aufs Land fahren, wenn dort Angreifer ihr Unwesen treiben!«, protestierte Daan.
»Da werden schon keine sein. Und wenn, dann werden sie sich kaum für dich interessieren.«
Daan schien nicht überzeugt. »Es geht um den Hof und die Zufahrt zum Landhaus?«, fragte er widerstrebend.
»Ja, natürlich. Der Entwurf ist fertig. Schön, fest und nützlich, wie es sich gehört. Der Cortile ist mit seiner Säulenreihe von vollendeten Proportionen. Schlanke Säulen nach korinthischer Ordnung. So soll es sein, und doch will er gerade diesen Hof ändern lassen. So sind die Auftraggeber nun mal: wankelmütig und unwissend.« Michiel schnaubte missfällig. »Ärgerlich ist, dass de Jong bei Philips Vingboons ebenfalls einen Entwurf bestellt hat und sich aus unseren beiden den besten aussuchen will. Der hat offenbar zu viel Geld.«
»Das ist wirklich unerhört«, stimmte Daan zu. »Aber seit Vingboons dieses Buch veröffentlicht hat, rennen ihm die Auftraggeber die Türen ein.«
Benjamin nickte. Ihr ärgster Konkurrent entstammte einer vielköpfigen Malerfamilie, war geschäftstüchtig und wurde zudem von seinen Brüdern unterstützt, die Kupferstecher und Verleger waren. Vor zwei Jahren hatten diese die Entwürfe ihres Bruders in einem Prachtband herausgebracht und weithin verbreitet. Neben dem Buch Architectura Moderna, das vor allem die Werke des Amsterdamer Baumeisters Hendrick de Keyser feierte, war Vingboons’ Werk das wichtigste, wenn es darum ging, Amsterdamer Bauten in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Seither konnte sich Vingboons vor Aufträgen kaum retten. Angeblich fragten sogar ausländische Interessenten an. Benjamins Vater hatte dieser Erfolg so gewurmt, dass er seine Entwürfe ebenfalls hatte drucken lassen. Die erste Auflage der Architectura Aard hatten sie eigenhändig in Amsterdam unter die Leute gebracht. Einige Ausgaben waren durch befreundete Kaufleute auch in anderen Handelsstädten gelandet, was ihnen ebenfalls vereinzelte Anfragen gebracht hatte.
»Jetzt will auch noch Julius Vingboons in die Fußstapfen seines Bruders treten«, beklagte Michiel. »Als hätten wir in der Stadt nicht genügend Konkurrenten! Aber wir werden nachziehen! Ob in Amsterdam oder an der Vecht – wir werden ihm das Feld nicht überlassen!«
Benjamin folgte seinem Vater in dessen Kammer. Die Bettdecke der Mutter war aufgeschlagen, als würde sie gleich schlafen gehen. Obgleich ihr Tod bereits ein Jahr her war, spürte Benjamin einen Stich. Der Todesfall war ein Schock für sie gewesen. Sein Vater und sein Bruder trösteten sich damit, dass Lenora nun in einer besseren Welt war. Benjamin hingegen tat sich mit dem Glauben schwer, seit zwei seiner drei Geschwister binnen weniger Tage von Fiebern oder sonstigen Krankheiten dahingerafft worden waren. Damit war er nicht der Einzige. Andererseits gab es unter seinen Freunden auch Wiedertäufer, Katholiken, Muslime und Juden, die ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Jenseits hatten. Da niemand weiß, wie es nach dem Tode weitergeht, sollte man sich vielleicht einfach die Jenseitsvision aussuchen, die einem am besten in den Kram passt, dachte er.
Kurz überlegte Benjamin, ob er seinem Vater von Daans und Antjes Stelldichein erzählten sollte, aber er hielt den Mund. Im Zweifelsfall würde sein Vater Antje hinauswerfen, und dann musste ihr Männerhaushalt ohne die Fürsorge einer Magd auskommen. Er pflückte eilig ein Hemd von der Kleiderstange, den flachen spitzenumsäumten weißen Kragen sowie den braunen Seidenanzug samt Hut und Seidenstrümpfen.
Während er sich ankleidete, dachte sein Vater laut nach: »Der Kurier hat die Truppen im Gooi getroffen, sagst du? Dann müssen die Angreifer jeden Augenblick hier sein! Und es waren wirklich so viele Soldaten? Gut, dass du mir so schnell Bescheid gegeben hast. Das ist meine Chance zu zeigen, was in mir steckt. Soweit ich weiß, ist nur einer der vier Bürgermeister in der Stadt, nämlich Cornelis Bicker. Die Regenten de Graeff und Huydecoper sind mir bereits gewogen. Bei der nächsten Ratswahl …«
Es war eines von Vaters Lieblingsthemen. Benjamin konnte beinahe mitsprechen. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen. Michiel hatte es nicht verwunden, dass er nach Großvaters Tod nicht dessen Posten in der Vroedschap bekommen hatte. Die sechsunddreißig Plätze wurden auf Empfehlung der anderen Regenten vergeben, und Amsterdams Stadtregierung war ein einziges Geklüngel, in dem ein Familienmitglied oder Freund dem anderen gut bezahlte Posten zuschob. Schon sein Großvater hatte erfahren müssen, wie langwierig und steinig der Weg in die Vroedschap war. Es gab einfach viel zu viele reiche Anwärter, die sich ihre Unterstützung erkaufen konnten. Zudem hatte ihre Familie einflussreiche Feinde, die einem Aufstieg im Wege standen.
»Schneller, nun mach schon! Ich muss sofort zum Rathaus.« Sobald Michiel angekleidet war, lief er in den Salon, in dem die Magd immerhin eine Lampe entzündet hatte.
Benjamin folgte ihm auf dem Fuß. »Ich begleite Euch«, bot er an.
»Mitnichten. Du hast genug zu tun. Abgesehen davon warte ich immer noch auf deinen Entwurf des Kutschhauses. Die Zeit drängt.« Michiel Vicentszoon Aard stopfte seine langstielige Tonpfeife, beträufelte den Tabak mit seiner Lieblingssoße mit Dörrpflaumengeschmack und entfachte ihn mit einem Kienspan an der Lampe. Tief sog er den Rauch ein.
Das Kutschenhaus! Diese Aufgabe war so langweilig, dass Benjamin sie vor sich hergeschoben hatte. Außerdem war an Arbeiten in dieser Situation nicht zu denken. »Ich melde mich bei den Freiwilligen. Ich kann kämpfen!«
»Das Kämpfen überlässt du anderen. Nur, weil du Tibaults Académie de l’espée studiert hast, bist du noch kein Soldat«, sagte Michiel und paffte dicke Wolken in die Luft.
»Beim Fechtunterricht habe ich mich wacker geschlagen. Aber gut, dann werde ich anderweitig helfen. Der Stadtwall ist an einigen Stellen baufällig. Wenn es um die Verteidigung Amsterdams geht, wird jede Hand gebraucht.«
»Deine Hand sicher nicht. Du bist doch kein Arbeiter.« Irritiert musterte Michiel ihn. »Wie siehst du überhaupt aus? Diese Schlampigkeit kennt man von euch Jungspunden schon, aber auch noch der Schmutz – ist das jetzt etwa auch Mode? Was sollen die Leute denken? Richte dich gefälligst her!« Er eilte hinaus.
Konsterniert blickte Benjamin in den großen Spiegel neben dem Kamin. Die strohblonden Haare klebten ihm feucht am Kopf und auf den Schultern, seine Wangen waren fleckig, sogar seine Augen wirkten regenblau.
»Wie siehst du überhaupt aus?«, ahmte er die Worte seines Vaters nach. »Nass und zerzaust wie eine Katze, die einen Guss abbekommen hat!«, gab er sich selbst die Antwort.
Sauer über die Zurechtweisung wischte er über die Flecken auf seinem Samtwams. Ein Seidenstrumpf war heruntergerutscht, der andere zerrissen. Kein Wunder, dass sein Vater ihn nicht ernst genommen hatte! Normalerweise hätte Benjamin die Magd gebeten, seine Kleidung zu richten. Nachdem er sie aber in einer derart kompromittierenden Situation gesehen hatte, war ihm das nicht möglich. Er kämmte seine langen Haare mit gespreizten Fingern durch und rieb sich den Dreck von der Hose. Dann zog er den Strumpf hoch.
Während er die Schleife band, wanderte sein Blick über die Gemäldegalerie. Der liebevolle Blick seiner viel zu früh verstorbenen Mutter. Die toten Geschwister in ihren Bettchen, ganz grau im Gesicht. Sein Großvater Vincent, der würdevoll auf ihn herabsah. Er trug eine altmodische schulterweite Rüschenkrause – wie hatte man sich in diesem Ungetüm überhaupt bewegen können? Die Großmutter hatte sich in einem Selbstporträt verewigt, das sie an der Staffelei zeigte. Im Hintergrund des Gemäldes war die Stadtsilhouette mit dem Festungswall zu sehen. Die Aards waren stolz darauf, dass Vincent einst auch als Festungsbauer in Amsterdam tätig gewesen war – warum also durfte er seine Heimat jetzt nicht verteidigen?
Unzufrieden ergriff Benjamin seinen Beutel mit den Gläsern und marschierte an den Bildern vorbei zur Treppe. Ihr Haus war geräumig, sodass auch er sein eigenes Studier- und Schlafzimmer hatte. Das Fenster ging zur Gracht hinaus. Milchiges Tageslicht fiel durch die feuchten Scheiben; immerhin schien es nicht mehr zu regnen. Wie sein Vater und sein Bruder hatte auch Benjamin die Wände mit Gemälden, Zeichnungen und Landkarten bedeckt. Holzmodelle von Gebäuden standen auf dem Parkettboden, dazu eine Staffelei. Auf seinem Tisch lag ein bunter Papierhaufen. Entwürfe en masse, einer fantasievoller und ausgefallener als der andere. Auf einem stand verschnörkelt »Kutschhaus«, mehr nicht. Dazu eine Menge angefangener Briefe. Etliche musste er nur noch siegeln und abschicken.
Benjamin machte auf seinem Schreibtisch Platz für die Gläser. Womit sollte er anfangen? Sollte er sich seiner Korrespondenz widmen? Erst gestern waren interessante Briefe aus Paris und London eingetroffen, die er beantworten wollte. Oder sollte er seine Forschungsergebnisse analysieren? Auf den ersten Blick hatte er den Eindruck gehabt, dass er in den Gläsern am Fuße der Windmühle mehr Regen aufgefangen hatte als an der Spitze – aber konnte das wirklich sein? Er könnte auch an seiner perspektivischen Studie im Stile Pieter Jansz Saenredams weitermalen. Dieser übertrug auf eine fantastische Art und Weise die Klarheit der Kirchenarchitektur auf die Malerei. Oder sollte er doch endlich das Kutschhaus entwerfen?
Unentschlossen packte er die Gläser aus. Ein weiteres Glas war auf dem Weg zerbrochen. Und wo war die Öl-Uhr? Hatte er sie nicht in den Beutel gelegt? Sollte er sie vergessen haben? Es war ein kostbares Stück, und in den metallenen Lampenfuß war der Familienname graviert. Benjamin sprang auf, ging in Gedanken seinen überhasteten Aufbruch durch. Nein, er konnte sie nicht in der Mühle stehengelassen haben. Hatte er Theo die Lampe in die Hand gedrückt? Oder sie vielleicht am Stadttor abgestellt?
In diesem Augenblick trat sein Bruder ein. Daan hatte sich angekleidet und einen schlichten haselnussbraunen Anzug gewählt, der zu seiner Augenfarbe passte. Kein Fussel verunzierte den Samt. Die aschblonden Haare umrahmten Daans rundes Gesicht, auf dem vereinzelte Pockennarben zu sehen waren, das Kinn war säuberlich rasiert. So klar und nüchtern sah er aus, als wäre er ein calvinistischer Prediger. Benjamin seufzte. Gegen seinen fünf Jahre älteren Bruder kam er sich wie ein halbes Jongetje vor.
Missbilligend blickte Daan auf die Unordnung und das getragene Leibhemd auf dem Stuhl. Was bildete sein Bruder sich ein, sich als überlegen aufzuspielen – er sollte sich lieber für das schämen, was er getan hatte!
Als habe er Benjamins Gedanken gelesen, fauchte Daan ihn an: »Willst du mir etwa Vorwürfe machen? Was platzt du in mein Zimmer hinein!« Er näherte sich Benjamin und baute sich vor ihm auf. »Wehe, du sagst ein Wort zu Vater!«
Wollte er ihn etwa einschüchtern? Benjamin richtete sich auf. »Dass du Antje das antust!«
Ein zufriedenes Grinsen huschte über Daans Gesicht. »Antust? Sie hat Spaß gehabt, das hast du doch gesehen.«
»Wenn sie schwanger wird, ist es kein Spaß mehr. Warum gehst du nicht zu den Meisjes van plezier wie die anderen –«
»Und hole mir bei den Huren die spanischen Pocken?«, unterbrach Daan ihn. »Nein, danke. Außerdem schickt sich das nicht für einen gottesfürchtigen jungen Mann wie mich.«
Benjamin konnte nicht anders. Er lachte auf.
Daans Augen funkelten. »Im Gegensatz zu dir lese ich täglich die Staatenbibel, besuche den Tempel und helfe in der Kirchengemeinde. Du solltest dich nicht so aufspielen. Kannst froh sein, dass Vater sich nicht eingehender mit deinen Experimenten beschäftigt. Wenn er wüsste, wie viel Geld du für Gerätschaften und Bücher abzweigst! Allein die Gläser und Linsen, die du in Auftrag gegeben hast!«
Benjamins Mund wurde trocken. Sein Bruder wusste davon? Mithilfe der Linsen wollte er ein Mikroskop bauen, wie er es in den Schriften der visionären Erfinder Drebbel und Galilei gesehen hatte. Gemeinsam mit Theo wollte er erkunden, was für das bloße Auge unsichtbar war. Seinen Cousin interessierten in erster Linie die Bestandteile des Menschen. Theo versuchte zu erforschen, ob Haare und Fingernägel lebten; schließlich wuchsen sie weiter, wenn ein Mensch tot war. Andererseits verspürte man keine Schmerzen, wenn man sie schnitt – es war seltsam. Ihn hingegen faszinierten die Baupläne der Natur, Muster von vollkommener Schönheit. Benjamin riss sich aus seinen Überlegungen. Möglicherweise konnte er seinen Vater überreden, Milde walten zu lassen. Andererseits hatte Michiel ihn schon wegen seiner letzten Ausgaben ermahnt.
»Von mir erfährt Vater nichts über euer Techtelmechtel«, gab Benjamin schließlich nach. »Aber du solltest Antjes Ruf nicht gefährden. Das hat sie nicht verdient.«
»Es war nur ein Ausrutscher, lass gut sein! Ich bedauere es bereits«, beteuerte Daan halbherzig. »Mein sündiger Leib ist mit mir durchgegangen. Ich muss mich ohnehin bald nach einer Braut umsehen, damit ich meinen Platz in der Stadt einnehmen kann.« Auch er hoffte, eines Tages im Stadtrat zu sitzen oder gar Bürgermeister zu werden.
»Solltest du nicht schon unterwegs sein?«, wechselte Benjamin das Thema. Er konnte diese Heuchelei kaum ertragen.
»Ich habe es bei diesem Wetter nicht eilig mit meiner Flussfahrt.« Daan sah sich um, nahm einige Papiere auf, überflog sie und ließ sie kopfschüttelnd wieder auf den Schreibtisch fallen. »Ich begreife nicht, warum du immer wieder riskierst, Vaters Missbilligung auf dich zu ziehen. Was sollen diese albernen Experimente? Warum kümmerst du dich nicht um deine Arbeit und deine Studien, wie Vater es von dir erwartet?«
»Diese Experimente sind Teil meiner Studien. Und sie sind ganz und gar nicht albern.« Knapp berichtete Benjamin, was er in den letzten Stunden getan hatte. »Die Forschungen über Temperatur und Wetter können sich segensreich auf Lage, Bauplanung und Bau eines Hauses auswirken.«
»Pure Zeitverschwendung! Du solltest dich lieber der Lektüre der architektonischen Klassiker verschreiben. Schon den Architekten der Antike war bekannt, mit welchen Mitteln man am Bau mit aufgeweichtem Erdreich oder Frost umgeht.«
»Glaubst du, ich wüsste diese Schriften nicht längst auswendig? So einfach ist das nicht! Was meinst du, warum Physiker und Mathematiker wie die Signori Galilei und Torricelli sich diesen Fragen gewidmet haben? Wenn man im Voraus weiß, wann es regnen, stürmen oder frieren wird, kann man Bauarbeiten ganz anders planen.«
»Du bist weder Physiker noch Mathematiker, sondern Maler und Architekt.«
»Genau. Und als Architekt will ich Häuser bauen, die bestmöglich mit den Elementen harmonieren. Das Wasser soll den Menschen dienen, statt Mauern und Dächer anzugreifen. Türme sollen in den Himmel wachsen, ohne vom Sturm zerbrochen zu werden. Dächer –«
»Spinnerei!«, machte Daan seinen Ausführungen ein Ende. »Widme dich lieber deinem Auftrag oder bereite dich wenigstens auf deine Arbeit am Stadhuis vor.«
»Da gibt es nichts vorzubereiten.« Natürlich war es eine Ehre, am Bau des Stadhuis mitwirken zu dürfen, aber derzeit war man noch mit den Grundmauern des monumentalen neuen Rathauses beschäftigt, was Benjamin langweilig fand.
Daan sah ihn prüfend an. »Ich dachte, du würdest ebenfalls auf eine Große Tour gehen wollen. Die ist von Vater ja auch als Belohnung gedacht«, sagte er.
Benjamin hob die Schultern. »Ich weiß nicht. Früher mag so eine Vergnügungs- und Bildungsreise notwendig gewesen sein, um die Werke der berühmten italienischen Baumeister in natura studieren zu können. Aber heute sind wir den anderen Nationen weit voraus. Denk an die Baukunst eines de Keyser, eines van Campen oder eines Pieter Post! Was die Gemälde angeht, sind niederländische Künstler ohnehin tonangebend. Und wenn ich wirklich einen Tizian oder Raffael sehen will – dann bitte ich um Zutritt zu einer Amsterdamer Kunstsammlung. Jeder Poorter ist stolz, wenn er mit seinem Besitz glänzen kann. Hier ist der Marktplatz der Welt, auch was Kunst angeht.«
Ungeduldig war Benjamin zum Fenster gelaufen, verwundert, dass die ersten Arbeiter und Bürger, die vorbeikamen, noch vollkommene Ruhe ausstrahlten. »Außerdem ist heute kein normaler Arbeitstag. Amsterdam wird angegriffen – begreifst du das nicht? Wir dürfen nicht untätig herumsitzen!« Ratlos rieb er sein Kinn, auf dem ein paar Stoppeln sprossen. »Ich verstehe allerdings nicht, warum der Statthalter Amsterdam angreifen sollte. Ja, gut, der Rat der Stadt hat bei seinem letzten Besuch nicht nach seiner Pfeife getanzt, aber das ist doch kein Grund, zu den Waffen zu greifen!«
Sein Bruder lächelte nachsichtig. »Da siehst du es. Du solltest dich mehr mit der allgemeinen Lage und weniger mit deinen wissenschaftlichen Liebhabereien beschäftigen.« Er warf mit spitzen Fingern das Leibhemd vom Stuhl und setzte sich. Es würde also ein längerer Vortrag werden. Allein die Aussicht machte Benjamin nervös.
»Prinz Wilhelm, der zweite dieses Namens, gibt sich herrschaftlich. Dabei ist er nichts als ein hoher Beamter«, begann Daan und betrachtete seine makellos sauberen Hände und den Siegelring, den er zur Volljährigkeit erhalten hatte.
Hoffentlich betet er mir jetzt nicht das politische System der Republik vor, dachte Benjamin, denn das kannte jedes Kind. Früher hatte der Statthalter den spanischen König vertreten, dem die siebzehn niederländischen Provinzen gehörten. Nach dem Befreiungskrieg unter Wilhelm von Oranien spaltete sich das Land in die Spanischen Niederlande im Süden, die nach wie vor katholisch waren, und die Republik der sieben Provinzen im Norden, die den reformierten Glauben pflegten. In diesen Generalstaaten wurde der Statthalter von den Provinzen eingesetzt. Üblicherweise übernahmen die Nachkommen Wilhelms die Statthalterschaft in den Provinzen Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel und Gelderland, während die Abkömmlinge seines Bruders Jan von Nassau das Amt in den nördlichen Provinzen Groningen und Friesland erhielten. Schließlich waren die Oranier die höchsten und reichsten Adeligen des Landes. Als Generalkapitän der Truppen hatte der Statthalter zudem den höchsten militärischen Rang inne.
»Der Zwist zwischen der Provinz Holland und Prinz Wilhelm ist hauptsächlich über die Zukunft der Streitkräfte entbrannt«, dozierte Daan jetzt. »Der Statthalter will sein stehendes Heer in voller Stärke behalten, das sind immerhin etwas mehr als sechsundzwanzigtausend Mann sowie dreitausend Pferde – und Amsterdam soll sie bezahlen.«
»Nicht nur Amsterdam.«
»Natürlich nicht, Dummkopf! Die Generalstaaten zahlen das Heer gemeinsam, aber davon trägt Holland fast sechzig Prozent, wovon Amsterdam etwa die Hälfte übernimmt.«
Benjamin missfiel Daans Ton. Gleichzeitig musste er sich eingestehen, dass er mit Politik wenig am Hut hatte. »Wenn wir das Heer bezahlen, dürften sich die Soldaten erst recht nicht gegen uns wenden.«
»Die Armee hört auf den Befehlshaber, nicht auf den Geldgeber. Aber was sollen wir noch mit einem derart großen Heer? Seit dem Frieden von Münster droht der Republik keine Gefahr mehr. Niemand wagt es, sich mit uns anzulegen. Wer könnte es auch? Spanien ist nur noch ein Schatten seiner selbst und bekriegt zudem gerade Frankreich. England ist nach der Hinrichtung von König Charles im letzten Jahr eine Republik, aber durch und durch zerstritten. Und Frankreich ist mit Spanien, der Fronde und dem Bürgerkrieg beschäftigt.«
Eine Fronde war eigentlich eine französische Wurfschleuder, der Begriff hatte sich aber als Bezeichnung für Meinungsäußerungen gegen den Königshof durchgesetzt, die in den letzten Jahren in Aufstände gemündet waren, das wusste Benjamin. Vor allem Königin Anna von Österreich und der italienische Kardinal Mazarin, die für den elfjährigen König Ludwig XIV. regierten, waren umstritten.
»Portugal legt sich mit uns an«, präzisierte Benjamin, obgleich er sonst kein Besserwisser war.
Daan seufzte. »Das ist korrekt. Die Portugiesen ertragen nicht, dass wir sie in den Kolonien verdrängt haben. Ihnen geht es um Brasilien und den lukrativen Sklavenhandel. Es ist ein kostspieliger Krieg, bei dem …«
Benjamins Gedanken waren bereits weitergesprungen, außerdem wollte er den langen und ebenso langweiligen Vortrag seines Bruders abkürzen. »Möglicherweise kann Oom Samuel zu Amsterdams Gunsten vermitteln. Wir sollten ihm schreiben.«
Sofort ergriff er Tinte und Schreibfeder. Sein Onkel stand in den Diensten des Hauses Oranien und verfügte über Einfluss bei Hofe, abgesehen davon war er ein wohlhabender Geschäftsmann. Benjamin bewunderte Samuel jedoch vor allem wegen seiner umfassenden Gelehrsamkeit. Er war ein Virtuose der Künste und Wissenschaften.
Daan erhob sich. »Überlass das lieber Vater. Hier geht es um eine wichtige politische Angelegenheit, von der du nichts verstehst. Ich mache mich an die Arbeit. Und auch du solltest dich deiner Aufgaben besinnen.«
Als sein Bruder gegangen war, fühlte Benjamin sich beschämt. Wie so oft war es Daan gelungen, das Gespräch zu wenden. Eigentlich hatte sein Bruder den gravierenderen Fehltritt begangen – warum ging es ihm, Benjamin, dann jetzt schlecht? Und egal, was alle sagten: Er musste etwas tun!
Er lief hinunter in die Küche und spähte um die Ecke, um Antje nicht zu begegnen. Als er sich vergewissert hatte, dass die Luft rein war, schenkte er sich ein Glas Buttermilch ein und trank diese im Stehen.
»Soll ich Euch das Frühstück bereiten?«, hörte er eine Stimme hinter sich und verschluckte sich fast. Antje war mit zwei frischen Brotlaiben vom Bäcker eingetreten. Die braunen Locken unter der Haube, eine gestärkte Schürze. Zupackend und patent wirkte sie, wie immer. Trotzdem sah Benjamin sie vor seinem inneren Auge nackt und erregt. Sein Blut geriet in Wallung, was ihn verlegen machte. Sie schien ebenso beschämt, denn sie mied seinen Blick und begann, hektisch mit Brettern, Schalen und Messern zu hantieren.
»Nein, danke.« Er stellte das Glas ab. »Ich habe keine Zeit.«
»Aber Ihr müsst doch etwas essen, Mijnheer. Möchtet Ihr ein Broodje Kaas?«, fragte sie eilfertig.
»Nein!«, sagte Benjamin. Die Situation war ihm mehr als peinlich. Er schickte sich zum Gehen an.
Antje berührte seinen Arm. Flehend sah sie ihn an. Ihre weichen Gesichtszüge unterstrichen das Geduldige, Gutmütige in ihrem Wesen. »Bitte, sagt es nicht Eurem Vater, Mijnheer. Ich habe noch fünf Geschwister im Beemster. Meine Familie rechnet mit meinem Lohn.« In ihren Augen glitzerten Tränen. »Ich mag Euren Bruder. Sehr sogar. Es kommt nicht wieder vor, das verspreche ich. Lasst mich Euch ein Brot schmieren, bitte.«
Als ob dann alles vergessen wäre! Dennoch gab Benjamin nach. »Aber eile dich!«
Sie schnitt krachend den Brotlaib auf, beschmierte die Scheibe mit frischer Butter und legte geschnittenen Kräutergouda darauf. Benjamin nahm das Käsebrot auf die Hand, er würde es unterwegs essen.
»Die Abdrücke Eurer Schmutzschuhe in der Halle habe ich übrigens schon aufgewischt. Vergesst nächstes Mal die Hausschuhe nicht!«, rief sie ihm noch nach, als wäre nichts geschehen.
Just als er auf die Straße trat, begannen alle Glocken Amsterdams zu läuten. Zugleich erklangen in einiger Entfernung die Schläge von Trommeln. Dieses Zusammenspiel war so selten, dass es die Bewohner der Stadt sogleich in helle Aufregung versetzte. Noch während der Alarm durch Grachten, Gassen und über Plätze hallte, flogen die Fensterläden und Türen auf. Es war, als ob die Häuser selbst die Augen aufrissen und auf den Kanal starrten. Bewohner liefen – teils noch im Nachtrock – auf die Straße.
Benjamin stopfte das Brot in seine Tasche und eilte mit den Neugierigen zur Stadtmitte, wo das Trommeln seinen Ursprung hatte. Er querte Keizersgracht und Herengracht, passierte die Stadtsteinhauerei. Normalerweise schaute er gern bei seinem Freund Quentin vorbei und betrachtete die Arbeit an den Statuen, die dessen Lehrmeister, der flämische Bildhauer Artus Quellinus für das neue Stadhuis herstellte. Heute aber hatte er dafür keine Zeit.
Je näher er dem Zentrum kam, umso aufgeladener wurde die Stimmung auf den Straßen. Die Mitglieder der Schützengilden versammelten sich, manche legten noch im Lauf ihre Schärpen um. Er sah Frauen auf die Knie fallen, die Hände gen Himmel recken und um Gnade vor dem Weltuntergang flehen; ihrem Verhalten und der schlichten Tracht nach zu urteilen, handelte es sich um Wiedertäuferinnen. Aber auch die Kaufleute hatten achtlos ihre Preislisten oder Zeitungen unter den Arm geklemmt und diskutierten. Turbanträger und chinesische Händler bestaunten verständnislos das Geschehen. Zugleich gab es auch etliche Menschen, die die Nachricht nicht zu beeindrucken schien, die ihren Fisch, ihren Käse und ihr Obst und Gemüse am Markt auslegten oder mit ihren Kutschen spazieren fuhren.
Schließlich folgte Benjamin dem Nieuwezijds Voorburgwal bis zum Dam, wo die Druckereien gerade ihre Auslagen bestückten. Erst am Hauptplatz der Stadt hielt er inne. Wie so oft beschämte Benjamin der Anblick. Der Dam war die historische Keimstätte der Stadt. Hier war der erste Damm errichtet, hier waren die ersten Häuser erbaut worden. Eigentlich sollte dieser Platz mit dem Rathaus die Macht Amsterdams verkünden. Benjamin dachte an die Bilder, die er vom Markusplatz in Venedig gesehen hatte. Dort war mit dem Markusdom, dem Dogenpalast, den Amtsgebäuden und dem Glockenturm auf beeindruckende Weise das weltliche, geistliche und kulturelle Zentrum der Stadt konzentriert. Der Dam jedoch war kaum mehr als ein Marktplatz für Waren und Neuigkeiten. Die Amsterdamer trieben weltumspannenden Handel, sie trugen die Krone der Welt – sie sollten ein repräsentatives Gebäude besitzen. Das Gegenteil war jedoch der Fall.
Derzeit herrschte auf dem Dam vor allem architektonisches Chaos. Da war zum einen das alte Rathaus an der Ecke zur Kalverstraat. Das säulengeschmückte Gebäude mit dem Walkiefer an der Fassade war so baufällig, dass die Bürgermeister, Regenten und sonstigen Honoratioren ständig damit rechnen mussten, dass es ihnen über dem Kopf zusammenbrach. Vor einigen Jahren hatte bereits die Turmspitze abgetragen werden müssen. Die Mauern waren brüchig und feucht, das Dach undicht, und aus den Ritzen sprossen Pflanzen. Auf der anderen Seite erhob sich die Nieuwe Kerk, deren Wiederaufbau nach dem Brand vor fünf Jahren noch nicht abgeschlossen war. Eigentlich sollte die Ratskirche den höchsten Turm der gesamten Niederlande bekommen. Vor allem das katholisch geprägte Utrecht und dessen Domturm wollten die calvinistischen Kirchenherren übertreffen. Doch der Turmbau zog sich hin. Bislang waren lediglich das Fundament und ein Sockel erstellt worden. Ohne den Turm aber wirkte die Kirche klotzig. Die alte Stadtwaage war hingegen zu klein für die viele Güter, die am Amstelufer angelandet wurden. Der einzige Lichtblick war die Amsterdamer Börse, für deren Bau sich der Architekt Hendrick de Keyser in London hatte inspirieren lassen. Hier kamen die Geldströme aus den gesamten Niederlanden, aus ganz Europa, ja, der ganzen Welt zusammen.
Schließlich wanderte Benjamins Blick zur Baustelle an der Nordseite des Dams. Dort, mit der Front zum Ufer, entstand das neue Rathaus. Es würde ein Palast werden, auf den Könige stolz sein könnten – nur dass es keinem Herrscher, sondern den Bürgern dienen sollte. Mehr als sechzig Grundstücke hatte man dafür angekauft, ganze Straßenblöcke dem Erdboden gleichgemacht. Auch das Fundament war kostspielig gewesen, schließlich waren in den Niederlanden Bäume Mangelware, und die Stämme mussten aus Norwegen importiert werden. Trotzdem waren mehr als dreizehntausend Pfosten im sumpfigen Erdreich versenkt worden. Wegen des Schwemmsands, auf dem Amsterdam ruhte, hatten siebzig Arbeiter jeden einzelnen Pfosten immer wieder hochziehen und hinunterrammen müssen, bis er fest saß. Auch jetzt dröhnte irgendwo in der Stadt das dumpfe Rumsen. Manchmal dachte Benjamin, dass diese Rammen das Leben der Amsterdamer so nachhaltig prägten, dass ihnen andere Orte totenstill erscheinen mussten.
Benjamin steuerte seine Arbeitsstelle nicht an, sondern folgte dem Menschenstrom zum alten Rathaus. Er schob sich an den Wartenden vorbei, durch den Säulengang und an der Vierschaar entlang, wo normalerweise Gericht gehalten wurde. Tagten die Bürgermeister noch im ersten Geschoss des baufälligen Turms? War sein Vater bei ihnen? Immer wieder fragte er einen der Umstehenden, ob es schon Neuigkeiten gebe.
In diesem Augenblick öffneten die Ratsdiener die Saaltüren. Ehrfurchtsvoll und gespannt zugleich drängten die Wartenden vor. Die Regenten hatten sich bereits von der langen Tafel erhoben, diskutierten aber weiterhin. Bürgermeister Antonie Oetgens van Waveren war offenbar von seinem Landsitz hergeeilt. Wie Cornelis Bicker trug er als Zeichen seiner Würde den schwarzen Anzug und die weite Mühlsteinhalskrause. Das Bürgermeisterquartett war jedoch nicht komplett, da Wouter Valckenier erst vor einigen Tagen verstorben und noch nicht ersetzt und Frans Banninck Cocq auf Reisen war.
Benjamins Vater stand bei den wichtigsten Männern der Stadt, den Bicker-Brüdern Andries und Cornelis, die mit Cornelis de Graeff und dem Regenten Johan Huydecoper van Maarsseveen redeten. Ältere Herren mit großen Hüten und dunkler Kleidung, die trotz ihres würdigen Auftretens wild gestikulierten. Unauffällig trat Benjamin näher. Er musste unbedingt herausfinden, welche Maßnahmen ergriffen wurden.
»Der Prinz ist als Statthalter der Diener der Provinzen, nicht unser Herr – das muss er begreifen! Wir haben uns schon viel zu lange von den Oraniern das Geld aus der Tasche ziehen lassen! Außerdem ist dieser Prinz noch ein Jongetje – er wäre nicht einmal alt genug, um in die Vroedschap einzutreten!«, rief Andries Bicker entrüstet. Mit einem spitzengesäumten Taschentuch tupfte er sich den Schweiß ab.
»Aber was sollen wir tun? Gegen zehntausend Mann werden wir nicht ankommen! Der Prinz wird die Stadt überrennen!«, sagte Johan Huydecoper. Der großzügige Liebhaber der Künste wirkte jetzt panisch.
Michiel zupfte an seinem Ohrläppchen, dann räusperte er sich. »Mit Verlaub, wir sollten Ruhe bewahren und uns an die Arbeit machen. Die Bewohner Amsterdams vertrauen darauf, dass wir … dass die Regenten das Richtige tun. Beschlossen habt Ihr es ja bereits.«
»Ruhe bewahren, genau darum geht es«, stimmte Cornelis de Graeff zu. »Das Haus Oranien wird schon zur Besinnung kommen. Bis dahin gilt es, viele Briefe zu verfassen und sicherheitshalber Maßnahmen zum Schutz der Stadt zu ergreifen.«
Michiel nickte heftig. Das Haus de Graeff war ihrer Familie schon lange verbunden, denn Cornelis de Graeffs Vater und Benjamins Großvater waren befreundet gewesen. Der alte de Graeff war ein gebildeter, freiheitlich denkender Mann gewesen, der sich für Architektur interessierte und sich für das neue Stadhuis starkgemacht hatte. Sein Sohn hatte zusammen mit den anderen Regentensöhnen den Grundstein legen dürfen.
Die Männer strebten auseinander. Benjamin wollte verschwinden, aber sein Vater hatte ihn bereits entdeckt. Mit erzürnt vorgereckter Pfeife kam er zu ihm. »Was willst du hier? Ich dachte, meine Anweisungen wären klar gewesen?«
Benjamin fiel eine Ausrede ein. »Ich wollte Euch vorschlagen, an Oom Samuel zu schreiben. Vielleicht kann er beim Prinzen ein gutes Wort für Amsterdam einlegen.«
»Was meinst du, was ich heute Morgen gleich als Erstes getan habe?« Michiel sah ihn durchdringend an. »Übrigens, rate mal, wen ich vorhin am Rathaus getroffen habe.« Er gab die Antwort selbst: »Kris. Mein Bruder wollte wissen, ob an den Gerüchten etwas Wahres dran ist. Woher hat er wohl so früh von dem Angriff erfahren?«
»So stimmt es also, dass wir bald angegriffen werden!«
»Offenbar lagert ein Teil des Heeres unter Graf Wilhelm Friedrich bereits vor Abcoude«, musste Michiel zugeben.
»So nah sind sie schon? Das ist ja nur sechs Meilen südöstlich von Amsterdam!«
Michiel nickte grimmig. »Wem sagst du das!« Prüfend blickte er Benjamin an. »Du hast doch nicht etwa Kontakt zur Familie meines Bruders, obgleich ich es verboten habe?«
Benjamin schluckte. Sollte er es leugnen? Er hob die Mundwinkel zu einem Lächeln. »Mijnheer de Graeff schien Eurer Meinung zu sein. Das ist doch sehr gut, oder?«, versuchte er abzulenken.
Michiels Blick wanderte zu den Regenten um Bürgermeister Oetgens, die sich am Ausgang berieten. Er wirkte beunruhigt. Oetgens hatte ihrer Familie beim Aufstieg in den Rat stets Steine in den Weg gelegt. »Ich bin gleichzeitig mit Mijnheer Bicker im Rathaus eingetroffen. Daher konnte ich helfen, alle zusammenzurufen und die Beratung vorzubereiten. Endlich kann ich beweisen, dass ich zu mehr fähig bin als dazu, Häuser zu entwerfen und die Bauvorhaben der Stadt zu prüfen.«
»Was wird jetzt passieren?«
»Der Ratsdiener verkündet auf dem Dam die Maßnahmen zum Schutze Amsterdams. Bürgermeister Bicker lässt die Stadttore verrammeln, die Brücken hochziehen, die Artillerie auffahren und acht Kriegsschiffe ausrüsten, um das IJ zu sichern. Zudem werden zweitausend Söldner ausgehoben. Wir hoffen, dass Banninck Cocq bald eintrifft, um das Kommando zu übernehmen.« Kurz zögerte er. »Es ist ein Jammer, dass Mijnheer Pauw sich aus der Politik zurückgezogen hat. Wir haben einen erfahrenen Unterhändler wie ihn dringend nötig. Einige Hitzköpfe erwägen sogar, die Deiche zu durchstechen.«
Benjamin war entsetzt. »Das würde unsere Leute ebenso gefährden wie die Angreifer. Und erst die Verheerungen, die die Fluten auf den Äckern anrichten würden!«
»Das habe ich ebenfalls eingewandt. Ich werde Meester Stalpaert dabei unterstützen, den Festungswall zu verstärken. Viel zu lange haben wir uns in Sicherheit gewiegt und die Stadtverteidigung schleifen lassen. Anschließend werde ich zu meiner Schützengilde stoßen.« Die Regenten waren verschwunden, und auf einmal hatte es auch Michiel eilig. »Kümmere dich um deine Aufgaben, und vergiss vor allem deine Arbeit am Stadhuis nicht. Du weißt, ich habe meine Beziehungen spielen lassen, um dir diesen Posten zu beschaffen.«
»Ich könnte –«
»Das neue Rathaus wird das Symbol unserer Macht, die Krönung unseres Standes«, unterbrach sein Vater ihn ungeduldig. »Größer und prächtiger als die meisten Königspaläste. Wir werden dieses Vorhaben wegen der größenwahnsinnigen Tat unseres Statthalters nicht verschleppen. Prinz Wilhelm wird unseren Alltag nicht mehr als unbedingt nötig durchkreuzen.«
3
s’Gravenhage
Mit voller Kraft schlug Samuel van Sanders den Lederball zurück. Johan hechtete los und traf den Ball erneut. Samuel musste rennen, holte aus, die Holzkante ächzte beim Treffer – gerade noch. Immerhin: ein glücklicher Schlag, der Ball war für seinen Freund kaum zu bekommen. Doch es war wie verhext: Johan parierte auch diesen. Er schien die Flugbahn vorhersehen zu können. Half mathematisches Genie etwa auch beim Tennis?
Samuel ging die Puste aus. Noch zwei Ballwechsel, dann war er geschlagen. Frustriert schleuderte er den mit Darmsaiten bespannten Holzschläger auf die Bahn. Gleich darauf überfiel ihn Scham. Was war das für ein Benehmen – und dann noch vor Johan de Witt, einem dieser ehrgeizigen Rechtsgelehrten, die man im Auge behalten musste! Da sein Vater Politiker war, könnte auch er in nächster Zeit bedeutende politische Posten gewinnen. Johan hatte wie Samuel an der Universität Leiden studiert, in Frankreich seinen Doktor gemacht und rundete nun bei einem angesehenen Anwalt seine Ausbildung ab. Dass Johan das Leben trotzdem auskostete, sich leidenschaftlich körperlich betätigte, musizierte und dichtete, machte ihn nicht zu einem schlechteren Juristen. Samuel genoss Johans Gesellschaft. Wie er hatte Johan eine Große Tour absolviert, über die er amüsant zu berichten wusste. Vor allem aber war Johan ein kluger Geist mit einem ausgesprochenen Talent für Mathematik.
Schwer atmend holte Samuel seinen Schläger zurück. »Unsere … Wette hast du … ja wohl eindeutig gewonnen. Der regenschwere Boden und die schwüle Luft machen mir zu schaffen.«
»Nimm es nicht so schwer. Wenn wir übermorgen im Doppel antreten, dürfte uns der Sieg sicher sein«, meinte Johan und schüttelte ihm die Hand. Mit seinen langen, beinahe schwarzen Haaren, dem schmalen Gesicht und dem Kinn, das Charakterstärke verriet, wirkte er gleichmütig wie eine antike Statue. Geschwitzt hatte er kaum.
»Das ist mein einziger Trost«, brachte Samuel hervor. Er stützte die Hände auf die Knie, um zu Atem zu kommen. In Augenblicken wie diesem spürte er, dass er dreiunddreißig und damit acht Jahre älter als sein Bekannter war. Aber was half es? Tennis, oder Kaatsen, wie sie es nannten, war nun mal ein beliebter Zeitvertreib der Haager Gesellschaft. Er konnte froh sein, dass Johan sich zu einem Doppel mit ihm bereit erklärt hatte. Da Samuel wegen seiner Geschäfte und anderer Vergnügungen kaum Zeit für das Training blieb, hatten sie sich zu dieser frühen Stunde verabredet. »Für den exzellenten Bordeaux, um den wir gespielt haben, ist es wohl zu früh. Darf ich dich nach diesem Sieg auf eine leichtere Erfrischung einladen?«, fragte er.
»Normalerweise gerne. Ich nehme aber an, dass daraus nichts wird.« Johans Blick ging über das Feld hinweg.