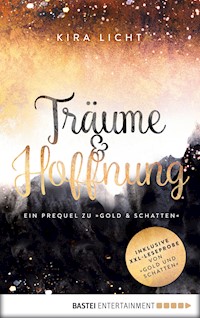6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Bücher der Götter - Dilogie
- Sprache: Deutsch
Teil 1 einer spannenden Dilogie rund um die griechische Götterwelt mitten in Paris.
Paris die Stadt der ... Götter!
Gerade erst nach Paris gezogen, verliebt sich die sechzehnjährige Livia Hals über Kopf in Maél. Seine Welt sind die düsteren Katakomben unter den Straßen der Stadt. Die beiden kommen sich schnell näher, doch der draufgängerischen Maél geht immer wieder auf Abstand. Was hat er zu verbergen? Und warum um alles in der Welt kann Livia plötzlich Botschaften hören, die Bäume und Pflanzen zuflüstern? Ist sie dabei, den Verstand zu verlieren? Als es Livia schließlich gelingt, die einzelnen Fäden miteinander zu verknüpfen, kann sie kaum glauben, welches Geheimnis sich ihr offenbart. Denn dass sie Maél kennengelernt hat, war alles andere als ein Zufall...
Lesen Sie auch das kostenlose Prequel "Träume und Hoffnung", das Maéls Ankunft im Paris der Zwanziger Jahre beschreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Teil 1 einer spannenden Dilogie rund um die griechische Götterwelt mitten in Paris Seit Livias 16. Geburtstag gehen seltsame Dinge mit ihr vor. Plötzlich kann sie die Stimmen von Pflanzen hören und mit ihnen reden. Auch der Umzug nach Paris vor ein paar Wochen hat nichts daran geändert. Zum Glück kann Livia sich ablenken, als sie den draufgängerischen und geheimnisvollen Maél kennenlernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Er verbringt seine Zeit am liebsten in den verbotenen Katakomben der Stadt. Was Livia noch nicht weiß: Er ist niemand geringeres als der Hadessohn – und sie eine Nymphe, deren Hilfe er dringend braucht …
Über die Autorin
Kira Licht wurde 1980 in Bochum geboren. Sie ist in Japan und Deutschland aufgewachsen und hat Biologie und Humanmedizin studiert, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München, unter Verwendung von Motiven von © JaneJJ / shutterstock; Anna Kutukova / shutterstock; kaisorn / shutterstock; sleep24Photo / shutterstock
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7335-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Die Schranke der Hölle
Wasser … bitte!
Ich zuckte zusammen und sah mich um. In Paris wurde man häufig von Bettlern angesprochen. Meist waren es Männer in dreckigen Parkas, die um Geld für ihre Hunde fragten. Oder Kinder, die mit weit aufgerissenen Augen für ihre hungernden Familien bettelten. Manchmal begegnete man auch Punks mit bunt gefärbten Haaren, die einen rotzig um Kleingeld anpöbelten. Aber von einem halb vertrockneten Löwenzahn um etwas Wasser gebeten zu werden, war, sagen wir mal so, eher ungewöhnlich.
Ich reckte das Kinn und starrte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Autos rauschten an mir vorbei, und ihr Luftzug bauschte den Saum meines Kleides. Ich würde mich einfach auf etwas anderes konzentrieren, bis die Ampel auf Grün umsprang. Lag ich gut in der Zeit? Ich warf einen Blick auf die zierliche Armbanduhr, die sich um mein linkes Handgelenk schmiegte. Man sah dem Lederarmband an, dass es nicht neu war. Auch die Vergoldung des Gehäuses war an so manchen Stellen abgerieben. Der große Zeiger zitterte wie ein Stängel im Wind, während er sich im Minutentakt voranschob. Die Uhr war ein Erbstück meiner Urgroßmutter, eine kostbare Erinnerung, eine Rarität, und ich liebte sie.
Wasser … bitte …
Die Stimme hallte durch meinen Kopf. Glasklar und absolut nicht zu ignorieren. Ich wusste, es gab Tabletten gegen so etwas. Gegen die Stimmen im Kopf und die Halluzinationen. Doch ich hatte Angst, mir Hilfe zu holen. Die Vorstellung, was für Auswirkungen eine endgültige Diagnose auf mein Leben haben würde, ließ mich schaudern.
Bitte …
Ich sah auf die Spitzen meiner Ballerinas und ließ den Blick dann wie zufällig über den Gehweg nach rechts wandern. Der Löwenzahn hatte sich einen unbequemen Platz zum Wachsen ausgesucht. Stängel und Blätter drängten sich durch eine schmale Fuge, die zwischen der Ampelsäule und dem Asphalt entstanden war. Sofort tat mir die Pflanze leid.
Ich bitte Euch …
Ist ja gut. Zum Glück musste ich die Antworten an meine Pflanzenfreunde nur denken. Das hatte ich vor einigen Wochen herausgefunden. Ich sah mich wie ein Geheimagent um, bevor ich eine kleine Wasserflasche aus meiner Schultertasche zog. Ich öffnete den Schraubverschluss und zielte dann ohne hinzusehen Richtung Pflanze. Es platschte, es spritzte, und mein rechter Fußrücken bekam eine unfreiwillige Dusche ab. Super. Und so unauffällig!
Ein Großteil der Leute, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen, war mit ihren Handys beschäftigt. Der Rest starrte auf das Ampelmännchen über mir. Schnell schraubte ich die Flasche wieder zu und steckte sie weg.
Ich danke Euch.
Gern geschehen.
Ich wurde vielleicht verrückt, aber immerhin sprachen die Stimmen im Majestätsplural zu mir. Irgendwie war ich mir sicher, dass es weitaus unhöflichere Ausprägungen dieser Krankheit gab.
Die Ampel sprang auf Grün um, und ich überquerte die Straße. Mein Bauch kribbelte vor Neugier. Nicht mehr lange, und ich sollte die Katakomben erreicht haben. Ich war mit der Metro nach Montparnasse bis zur Haltestelle Denfert-Rocherau gefahren. Nun ging ich direkt auf den gepflasterten Platz mit der großen Löwenstatue in der Mitte zu. Ich blieb kurz stehen, um mich zu orientieren. Dann entdeckte ich das dunkelgrün gestrichene Häuschen, das den Eingang der Katakomben markierte. Es schmiegte sich an eine Grünfläche, die von einem niedrigen Zaun umgrenzt wurde. Vermutlich handelte es sich um einen der drei kleinen Parks, die den Place Denfert-Rocherau umgaben. Ich hatte mich bewusst dafür entschieden, etwas zu besichtigen, in dem mich garantiert kein aufdringliches Grünzeug anquatschen würde. Doch nun hatte ich fast ein wenig Angst vor meiner eigenen Courage. Die uralten Sedimentschichten der Katakomben lagen mehr als 20 Meter unter der Straße. Genau 136 Stufen führten von dem hektischen Treiben der Gegenwart in eine 45 Millionen Jahre zurückliegende Vergangenheit. Das hatte ich in einem Reiseführer gelesen. Natürlich war ich gespannt auf die vielen kunstvoll arrangierten Knochen des unterirdischen Ossariums. Aber eigentlich interessierte mich dessen Geschichte viel mehr. In jedem Jahrhundert hatten die Menschen hier Spuren ihrer Zeit hinterlassen. Religiöse Insignien, lateinische Inschriften, Symbole der Freimaurer. Auch der Gedanke, dass so viele intellektuelle Persönlichkeiten der französischen Geschichte hier ihre endgültige Ruhestätte gefunden hatten, faszinierte mich. Marat, Montesquieu, Danton, Robespierre … Die Liste konnte man fast endlos fortführen.
Die Führung wurde von einem Archäologen des Pariser Stadtmuseums geleitet. Unbewusst lief ich etwas schneller. Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger konnte ich es noch erwarten. Als ich nach links sah, entdeckte ich eine weitere umzäunte Grünfläche, vermutlich ebenfalls einer der drei Parks von Montparnasse. Sollte der Sommer noch ein letztes Mal richtig Fahrt aufnehmen, wäre dies sicher ein hübscher Ort für ein kleines Picknick mit Freunden. Doch im Moment war ich gedanklich zu sehr mit den Katakomben beschäftigt, um einen genaueren Blick zu riskieren. Ich ging auf die Straße zu, die vom Platz abging. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich der Eingang zu den Katakomben. Eine Traube Menschen stand unweit des Häuschens. Andere hatten sich bereits in einer ordentlichen Schlange angestellt und schienen zu warten, dass die Tür sich öffnete. Touristen blieben stehen und machten Fotos. Auf dem breiten Gehweg vor dem Eingang ging es zu wie bei einem Volksfest. Verblüfft betrachtete ich das bunte Treiben. So viel Andrang hatte ich nicht erwartet.
Der Feierabendverkehr spannte mich auf die Folter. Die Pariser fuhren generell wie die Henker. Die halsbrecherische Fahrweise, mit der sie den majestätischen Löwen auf seinem Sockel umrundeten, war regelrecht filmreif. Die Reifen der Autos ratterten über das Kopfsteinpflaster wie Gewehrsalven. Alle schienen es eilig zu haben, nach Hause zu kommen und das verdiente Wochenende einzuläuten. Fast überhörte ich das Klingeln meines Handys, weil ich so darauf konzentriert war, eine Lücke im Straßenverkehr auszumachen, die groß genug war, um mich in meiner fünften Woche in Paris nicht schon zur Briefmarke verarbeiten zu lassen.
»Mom?«
»Liebes, hallo. Ich wollte dir nur noch mal sagen, dass du bitte vorsichtig sein sollst. Fass nichts an. Du warst gerade erst krank.«
»Ja, Mom.« Ich drehte mich von der Straße weg und spazierte ein Stückchen den Zaun des Parks entlang. Der Straßenlärm übertönte die Stimme meiner Mutter, und ich hatte keine Lust, jedes zweite Wort zu raten.
»Wie lange soll die Führung dauern?«
»Circa eine Dreiviertelstunde. Aber vor dem Eingang ist eine Schlange, und ich weiß nicht, wann sie aufmachen. Es kann also sein, dass es etwas länger dauert.«
Ich konnte das Missfallen in ihrer Stimme hören. »Wann soll es denn offiziell losgehen?«
»Um 17:30 Uhr. Wenn es pünktlich losgeht, bin ich um 18:15 Uhr fertig. Aber der Ausgang der Katakomben liegt drüben an der Rue Rémy Dumoncel. Das ist von hier aus ein Stück zu laufen bis zur Metro. Ich denke, ich bin so gegen 19 Uhr zu Hause.«
»Gut. Wir warten dann mit dem Abendessen auf dich.«
Ich ließ die Schultern hängen. »Mom, das braucht ihr nicht. Was, wenn es länger dauert?«
»Ich werde dir den Wagen schicken.«
Niemals! Es war peinlich genug, dass Dad als amerikanischer Botschafter auch hier in Paris einen Fahrer hatte. In Korea gehörte es zum normalen Straßenbild. Hier starrten einen alle fragend an oder machten sogar Fotos.
»Nein, Mom. Das ist absolut nicht nötig. Mit der Metro bin ich schneller. Außerdem, wie soll ich die Stadt denn kennenlernen, wenn ich nur in einer Limousine mit getönten Scheiben von A nach B gefahren werde? Das ist doch total bescheuert. Und außerdem ist es peinlich.« Ich war so in mein Gespräch vertieft, dass ich fast über einen Obdachlosen gestolpert wäre. Er saß, halb in eine Decke gewickelt, gegen den Zaun gelehnt und murmelte etwas in seinen langen Bart. Ich stammelte eine Entschuldigung.
»Was ist da los?«, wollte meine Mutter sofort wissen.
»Ich wäre fast in jemanden hineingerannt.«
Am anderen Ende der Leitung hörte ich sie missbilligend mit der Zunge schnalzen. »Mon dieu …« Es schien ihr ein weiterer Beweis zu sein, wie unfähig ich war, mich allein in Paris zu bewegen.
»Ich muss los, Mom.« Ich drehte mich um, um zurück zu dem Eingang der Katakomben zu sehen. »Die Schlange wird immer länger.«
»Ich schicke dir den Wagen.«
»Mom!«
»Bis später, Livia.«
»Mom, das ist so …« Die Verbindung brach ab. Ich starrte wütend auf das Display meines Handys. Sollte ich sie zurückrufen? Ich kannte meine Mutter. Sie war genauso dickköpfig wie ich. Wenn sie sich etwas vorgenommen hatte, dann wich sie nicht mehr davon ab. Einen kurzen Moment lang überlegte ich, die Führung früher zu verlassen und mit der Metro zu fahren. Doch ich verwarf den Gedanken wieder. Erstens wollte ich Moms Nerven nicht mutwillig noch mehr strapazieren. Zweitens würde sie vermutlich sofort die Polizei rufen und den Beamten so lange in den Ohren liegen, bis man mit einer Hundertschaft ausrücken würde, um nach mir zu suchen. Ich seufzte resigniert und ließ das Handy zurück in meine Tasche gleiten.
Als ich mich auf den Rückweg machte, kam ich wieder an dem Bettler vorbei. Bei genauerem Hinsehen sah der Mann noch verwahrloster aus. Sein langes Haar war verfilzt, der Bart ungepflegt und zerzaust. Die Decke, die seine Knie bedeckte, war zerrissen. Die Isomatte, auf der er saß, voller Löcher. Mit der Schulter hatte er sich gegen einen großen Seesack gelehnt, der so schmutzig war, dass man dessen ursprüngliche Farbe nicht mehr erraten konnte. Ich kämpfte gegen den Drang an, die Straßenseite zu wechseln, bevor ich ihn passieren musste. Innerlich ärgerte ich mich über mich selbst. Das war nur ein gebrechlicher, alter Mann, der vor sich hinmurmelte. Trotzdem sah ich unauffällig in eine andere Richtung, als ich an ihm vorbeiging.
»Du trägst das Wasser … das Wasser in dir. Und wenn der Himmel …« Die Stimme des Bettlers brach ab, und er hustete so stark, dass sein ganzer Körper bebte.
Ich blieb stehen. »Monsieur, geht es Ihnen gut? Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
Der Mann hob den Kopf. Ich wich erschrocken zurück. Seine blinden Augen bewegten sich suchend. Die Lider waren vernarbt und zuckten unkontrolliert.
»Du wirst das Wasser brauchen«, stammelte er. »Höre mir zu.«
»Äh, ja. Ich höre Ihnen zu.« Suchend sah ich mich um. Ob ich Hilfe holen sollte? Der Mann schien wirklich verwirrt.
»Wenn der Himmel fällt, wirst du das Wasser brauchen!« Er klang verzweifelt. »Das Wasser!«
»Das Wasser, okay.« Wie kam ich aus der Nummer jetzt wieder raus?
»Geh.« Der Mann stieß sich von dem Seesack ab. Sein ganzer Körper bebte. »Du musst gehen! Sofort!«
Ich brachte lediglich ein Nicken zustande. Hastig wandte ich mich zur Straße. Sie war leer. Die nächsten Autos erschienen erst wieder am Place Denfert-Rocherau. Die Luft um mich herum schien zu knistern. Es war vollkommen still. Sogar die Vögel in den Hecken des Parks schienen verstummt. Was passierte hier?
»Geh!« Der Mann brüllte so laut, dass seine Stimme irgendwann in einem Krächzen abbrach. Ich rannte über die Straße und noch ein ganzes Stück den Gehweg hinab. Erst dann drehte ich mich um. Der Mann saß noch an der gleichen Stelle auf dem Gehweg. Er gestikulierte wild ins Nichts. Mit klopfendem Herzen ging ich in Richtung Place Denfert-Rocherau. Obwohl der Mann sichtlich verwirrt war, fragte ich mich, was er mit seinen Worten gemeint hatte. Wasser? Himmel? War es Zufall gewesen, dass er mich fortschickte, gerade als die Straße wie leergefegt schien? Nun rauschten die Autos wie im Sekundentakt an mir vorbei. Eine vertraute Angst kroch wieder in mir hoch. War das gerade eben wirklich passiert? Oder hatte es etwas mit den seltsamen Veränderungen zu tun? Mit den Träumen? Den Stimmen und den Halluzinationen? Ich straffte die Schultern. Der Mann war krank. Verwirrt und alt. Vermutlich hatten Alkohol und Drogen sein Gehirn in einen Schweizer Käse verwandelt. Ganz sicher hatte das, was er gesagt hatte, nicht wirklich etwas mit mir zu tun. Er kannte mich ja gar nicht. Ich sollte aufhören, wie ein Hypochonder zu reagieren. Ich drehte mich ein letztes Mal um. Der Mann schrie nun zwei junge Mädchen an, die eingehakt an ihm vorbeispazierten. Ich war zu weit entfernt, um zu hören, was er rief. Die beiden Mädels zogen die Köpfe ein und beschleunigten ihre Schritte. Etwas erleichtert wandte ich mich um. Offenbar schien der Mann jeden Passanten mit irgendwelchen wirren Prophezeiungen zu verschrecken.
Nur wenige Meter Gehweg trennten mich jetzt noch von den Katakomben. Erneut machte sich das zarte Kribbeln der Vorfreude in meinem Bauch bemerkbar. Ich freute mich auf die Führung, schon seit wir in Paris angekommen waren. Jetzt würde ich mir dieses Erlebnis weder durch meine Mutter noch durch einen verwirrten Obdachlosen vermiesen lassen.
Ich verlangsamte meine Schritte, weil es vor dem Eingang so voll war. Noch war die Tür geschlossen. Eine japanische Touristengruppe, alle bekleidet mit beigefarbenen Bermudas und Polohemden, redete wild durcheinander. Man diskutierte wohl, ob es sich lohne, sich noch anzustellen. Überall im Internet stand, dass die Führung auf 200 Plätze begrenzt sei. Die nächste Führung würde erst morgen Nachmittag stattfinden. Also stellte ich mich zügig an in der Hoffnung, noch eine Karte zu ergattern.
Während ich wartete, entdeckte ich ein paar Jungs, die vor dem Zaun des Parks herumstanden und sich unterhielten. Sie waren ungefähr in meinem Alter. Zwei von ihnen trugen Shirts mit dem Wappen des elitären Louis-le-Grand-Gymnasiums. Sie lachten laut, zeigten sich gegenseitig irgendetwas auf ihren Smartphones und schienen nicht wirklich viel von ihrer Umwelt mitzubekommen. Einer von ihnen fiel mir sofort auf, und das nicht nur, weil er seine Freunde um gut einen Kopf überragte. Er besaß ein Gesicht, bei dem man sich sofort wünschte, malen zu können. Ausdrucksvoll, mit großen dunklen Augen und scharf geschnittenen Wangenknochen. Sein Kinn war gerade breit und kantig genug, um seinen Zügen einen aufregend männlichen Schliff zu verleihen. Er trug eine schwarze Röhrenjeans, die er bis über die Knöchel aufgerollt hatte, und dazu dunkelgraue Espadrilles. Ein Shirt mit tiefem V-Ausschnitt betonte seine sportliche Figur. Um seine Handgelenke wanden sich matt glänzende, grob gearbeitete Armbänder. Ein schmales Lederband hing um seinen Hals. Sofort fragte ich mich, wie wohl der Anhänger aussah, der unter seinem Shirt verborgen lag. Der Trageriemen einer Tasche, die er quer umgehängt und nach hinten gedreht hatte, teilte seinen Oberkörper in zwei gleich große Dreiecke. Von vorn sah der lederne Gurt fast aus wie Teil einer Kampfmontur.
Während ich näher auf den Eingang zuging, betrachtete ich ihn erneut unauffällig. Er schien älter als seine Freunde, obwohl er nicht wirklich älter aussah. Doch da war etwas an ihm, was ich nicht genau benennen konnte. Eine innere Ruhe, eine subtile Überlegenheit, gegen die seine Freunde wie ein lärmender Haufen Vorschüler wirkten. Ich wollte gerade wegsehen, da drehte er ruckartig den Kopf in meine Richtung. Sein ganzer Körper schien plötzlich unter Spannung zu stehen, wie die zum Bersten gespannte Sehne eines Bogens. Er sah mir direkt in die Augen. Sein Blick war fragend, aber gleichzeitig so scharf, dass ich in meiner Bewegung innehielt. Mein erster Reflex war zu flüchten, so sehr wirkte er plötzlich wie ein Jäger auf Beutezug. Das Lauernde in seiner Haltung verschwand nicht, selbst als er mir zulächelte. Ich lächelte zurück, ebenfalls reflexartig. Er hielt den Blick gerade lange genug, um jede Zufälligkeit Lügen zu strafen, dann drehte er sich wieder seinen Begleitern zu. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich die ganze Zeit über die Luft angehalten hatte.
In die Schlange vor dem Eingang war mittlerweile Bewegung gekommen. Ein Teil der Leute war bereits durch die geöffnete Tür verschwunden. Ich reihte mich ein, sodass ich dem Jungen den Rücken zudrehen musste. Jetzt noch einmal hinzusehen wäre mehr als auffällig gewesen. Ich widerstand dem Drang, auch wenn ich es ein wenig bedauerte.
Es ging erstaunlich schnell voran. Schon stand ich in dem Knick, den die Schlange machte, bevor es durch den Eingang ging. Ich warf einen raschen Blick nach links. Der Junge unterhielt sich wieder mit seinen Freunden, als wäre nichts geschehen. Enttäuscht drehte ich mich weg und ärgerte mich ein wenig, dass ich wirklich gedacht hatte, der attraktivste Kerl in Paris würde mit mir flirten.
Schon als ich durch die Tür in den Vorraum trat, wehte mir eine feuchte Kälte entgegen. Hoffentlich würde es in den Katakomben nicht noch frostiger werden. Die Spaghettiträger meines Sommerkleides würden mich garantiert nicht lange warm halten.
Der Mitarbeiter an der Kasse schenkte mir ein strahlendes Lächeln, das er mit einem einzigen Wort garnierte: »Ausverkauft.«
»Aber …«
»Moment.« Er wühlte neben der Kasse herum. Seine mausgraue Naturkrause wippte wie Hunderte kleiner Sprungfedern, als er sich zur Seite beugte. »Hier.« Er kam etwas ungelenk wieder hoch und breitete ein Hochglanz Din-A4-Blatt vor mir aus. »Das ist eine Ausstellung, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte.«
»Aber ich wollte doch …«
»Faszination Kalkstein«, unterbrach er mich feierlich.
»Kalkstein?«, wiederholte ich matt.
Er strich sich affektiert eine Locke aus der Stirn, die in derselben Sekunde zurück an ihren Platz schnellte. »Das ist eine wunderbare, wunderbare Ausstellung. Allein der Titel ›Faszination Kalkstein – Ein Rohstoff zwischen Vergangenheit und Moderne‹. Wunderbar.« Er sah mit glänzenden Augen zu mir. »Das weckt doch die Neugier!«
»Ich weiß ja nicht.« Ich legte den rechten Zeigefinger auf das glänzende Papier und zog es etwas näher zu mir. Ich wollte die Katakomben sehen. Die Inschriften, die Knochen, das volle Programm. Der Flyer wiederum verhieß eine »bunte Reise in die Welt des Kalksteins«. Soweit ich wusste, war Kalkstein weder bunt noch eine Reise wert.
»Die Führung macht heute Gérard Martinez. Ein renommierter Karbonatsedimentologe«, wisperte mein Gegenüber, als handle es sich um eine schwer vertrauliche Info.
»Und es geht nur um Steine?«
Ich erntete einen ratlosen Blick. »Wie? Nur um Steine? Aber das ist ein wunderbares, wunderbares …«
»Okay.« Ich seufzte. Jetzt war ich schon mal hier, dann wollte ich auch etwas unternehmen. »Ich nehme eine Karte.«
»Eine gute Wahl.« Er strahlte mich an, als hatte ich mich bewusst für die Ausstellung und gegen die Katakomben entschieden. Das war irgendwie … unheimlich.
Ich bezahlte, bekam meine Karte und dazu noch das Faltblatt mit den Infos.
»Sie werden abgeholt. Die Ausstellung findet in den Vorräumen der Katakomben, in den sogenannten ›Drei Galerien‹ statt. Sie beginnt zur gleichen Zeit wie die Führung durch die Katakomben. Zuerst geht die Gruppe runter, die die Katakomben besichtigt, dann folgt Ihre Gruppe. Aber machen Sie sich keine Gedanken, Gérard ist ein wunderbarer, wunder-barer …«
»Danke, Monsieur.« Ich wandte mich ab. Auf was hatte ich mich da bloß eingelassen?
Hinter mir war es noch voller geworden. Auch in der Mitte des Raumes drängten sich unzählige Besucher, die sich lautstark unterhielten. Da ich Gedränge nicht mochte, wich ich in Richtung eines der Fenster aus. Ich überflog den Flyer erneut. Bei den »Drei Galerien« handelte es sich um Vorräume der eigentlichen Katakomben, die zur Zeit der Industrialisierung ausgebaut und vergrößert worden waren. Heutzutage wurden sie für Ausstellungen, Vorträge oder als Filmset genutzt. Ich war erleichtert, als ich las, dass die Führung etwa genauso lang wie die durch die Katakomben dauern sollte. Daran hatte ich vorhin gar nicht gedacht.
An der Kasse drängte sich mittlerweile die japanische Reisegruppe umeinander und diskutierte in einer bunten Mischung aus Japanisch, Französisch und Englisch, ob man sich wirklich eine Dreiviertelstunde lang Kalkstein ansehen sollte. Ich teilte stumm ihre Bedenken. Mittlerweile war es so voll im Foyer, dass die Leute dichtgedrängt standen. Ich konnte nicht mal mehr den Eingang zu den Katakomben ausmachen und reckte ergebnislos den Kopf. Leider hatten mir meine Eltern nicht ihren superschlanken, hochgewachsenen Körperbau vererbt. Laut meiner Mom kam ich nach meiner Großmutter Serafine, die eine begnadete Patissière gewesen sein soll – was mich nur bedingt tröstete. Stand ich neben meinen Eltern, sah es immer so aus, als hätten sich zwei Elben aus unerfindlichen Gründen dazu entschlossen, ein Hobbitmädchen zu adoptieren. Ich hatte zwar weder Naturlocken noch behaarte Füße, aber der Rest kam ziemlich gut hin. Ich sah in Allem, was zurzeit modern war, irgendwie seltsam aus. Als ich aber Kleider im Fünfzigerjahre-Stil für mich entdeckt hatte, konnte ich mich mit meinen Kurven versöhnen.
Ich ging nun auf die Zehenspitzen, um einen besseren Blick in den Raum zu erhaschen. Doch ich hatte keine Chance. Jemand stieß mir mit seinem Rucksack vor die Schulter. Ich wich noch näher zum Fenster, das so schmutzig war, dass die Scheibe fast wie Milchglas wirkte. Zwischen den beiden Fenstergriffen hatte eine Spinne ihr Netz gebaut. Ich fiel zwar in der Gesellschaft von achtbeinigen Krabbeltieren nicht in Ohnmacht, aber auf meiner Schulter mussten sie trotzdem nicht unbedingt herumspazieren.
Die beiden Museumsmitarbeiter erschienen und stellten sich kurz als Michele und Gérard vor. Sie bläuten uns ein, auf gar keinen Fall die Hauptwege zu verlassen, denn sich in den Katakomben zu verlaufen wäre noch die harmloseste Konsequenz. Ein paar Touristen kicherten wie Teenager, als Gérard erklärte, dass man dieses kleine grüne Häuschen, in dem wir uns befanden, nicht umsonst auch als »Barrière d’Enfer«, Schranke der Hölle, bezeichnete.
Dann ging es los. Zuerst führte Michele seine Gruppe Richtung Eingang. Hinter mir wurde gedrängelt, weil ein paar Kurzentschlossene noch hinzugestoßen waren. Dann hob auch Gérard die Hand und ging voraus. Im Gänsemarsch liefen wir eine gewundene Treppe hinab, während die Luft immer kälter wurde. Unten angekommen standen wir in der ersten Galerie. In einer Wand klaffte ein schwarzes Loch, das wohl einen dieser berüchtigten Gänge darstellte, den man auf keinen Fall allein betreten sollte. Er war nicht besonders hoch, seine Wände nur roh behauener Stein, und er schien in einer pechschwarzen Unendlichkeit zu enden. Mit einem leicht mulmigen Gefühl im Bauch wandte ich meinen Blick ab. Wer würde dort freiwillig hineingehen? Genau so stellte ich mir den direkten Weg in die Hölle vor.
Gérard begann mit einer kurzen Einführung über die Katakomben und die Steinbrüche im Allgemeinen. Die Besucher verteilten sich in der kleinen Galerie, um jeden Zentimeter Platz zu nutzen.
Ich hatte erwartet, dass Gérards Stimme einen Hall erzeugen würde. Doch da war nichts. Es schien, als würde der graue Stein, der uns umgab, jedes Geräusch absorbieren, in sich aufsaugen, wie ein uraltes, nimmersattes Tier.
»Über 2000 Jahre lang dienten die Katakomben nur als Steinbrüche. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann man, die Stollen als Beinhäuser zu nutzen. Deshalb sind die Katakomben in zwei Bereiche einzuteilen. Die Steinbrüche, zu denen auch die drei Galerien gehören, und die sogenannten Ossarien, auch Beinhäuser genannt. Doch nun möchte ich Ihnen zuerst von der speziellen Zusammensetzung des Kalksteins erzählen, der …«
Ich hörte interessiert zu, bis ich spürte, dass mich jemand beobachtete. Instinktiv drehte ich den Kopf nach rechts. In dem verbotenen Gang, halb verborgen von der Dunkelheit, machte ich eine Silhouette aus. Eine große, schlanke, aber unverkennbar männliche Silhouette. Er hatte die Schulter lässig an die Steinmauer gelehnt, als fühlte er sich hier wie zu Hause. Während die meisten Besucher etwas unbehaglich oder gar eingeschüchtert wirkten, verriet seine Körperhaltung, dass er sich hier nicht wie ein Eindringling fühlte. Er verschmolz regelrecht mit den Schatten, der Dunkelheit, den Steinen. Bitte nicht, dachte ich. Heute war schon genug passiert. Genug, das mich erneut an meinem Verstand zweifeln ließ. Ich rechnete damit, dass die Gestalt sich gleich vor meinen Augen in Nebel auflösen oder einfach in der Dunkelheit verschwinden würde. Stattdessen machte sie einen Schritt nach vorn. Ich holte erschrocken Luft, bereit zu flüchten, sollte mich was auch immer angreifen. Graue Espadrilles, schwarze Röhrenjeans. Ich erkannte ihn, noch bevor sein Gesicht aus dem Schatten auftauchte. Der Junge von der Straße. Er war mir gefolgt. Er hatte mich beobachtet. Er …
Schnell drehte ich den Kopf weg. Mein Gedankenkarussell hatte gefährlich Fahrt aufgenommen. Ich versuchte, mich an die Notfalltechniken zu erinnern, die ich mir im Internet rausgesucht hatte. Tief atmen. Die Muskeln entspannen. Den Kopf mit etwas anderem ablenken. Ich kniff mir mit aller Kraft in den linken Unterarm. Ein scharfer Schmerz jagte durch meinen Oberkörper, doch er zog erfolgreich die Notbremse bei meinen Gedanken. Ich atmete erneut tief ein. Die eiskalte Luft ließ mich von innen heraus frösteln.
Okay. Jetzt noch mal von vorn. Der Junge war hier. Warum auch nicht, denn er hatte schließlich mit seinen Freunden in der Nähe des Eingangs herumgestanden. Wer sagte, dass er nicht genau wie ich darauf gewartet hatte, dass die Eingangstür sich öffnete? Wo war mein Problem? Er sah gut aus, er hatte mir zugelächelt, und nun hatte er mich so intensiv gemustert, dass ich es instinktiv bemerkt hatte. Jedes normale Mädchen würde sich geschmeichelt fühlen, und insgeheim hatte ich es mir noch vor wenigen Minuten gewünscht, und nun bekam ich statt roter Wangen eine Panikattacke. Ich holte ein letztes Mal tief Luft und sah dann unauffällig in Richtung Gang. Der Junge war verschwunden.
Gérard war mit seiner Einführung fertig und ging voraus in die nächste Galerie. Die Bunkerlampen tauchten den Raum in ein kaltes Licht, das den Stein bläulich schimmern ließ. Spuren von Quarz funkelten im Gestein wie von innen erleuchtet und ließen es fast ein wenig gruselig wirken.
In der Galerie Nummer Zwei ging es um die verschiedenen Arten von fossilem Kalkstein: Muschelkalk, Korallenkalk, Molluskenkalk, Crinoidenkalk und so weiter. Die Gesteinsbeispiele waren auf Sockeln präsentiert und im Raum verteilt ausgestellt, sodass man sie von allen Seiten betrachten konnte. Alle paar Meter waren Seitengänge in den Stein geschlagen worden. Doch sie waren entweder zu schmal, um bequem hindurchzugehen, abgesperrt oder halbherzig zugeschüttet worden.
Obwohl ich mir eingestehen musste, dass das meiste von dem, was Gérard erzählte, doch ganz interessant war, war alles, was ich wahrnahm, die eisige Kälte, die durch jede Pore meines Körpers in mich hineinzukriechen schien. Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper in dem sinnlosen Versuch, mich warm zu halten. Viele der Besucher hatten Pullover oder Strickjacken dabei, die sie nun überzogen. Ich hingegen hatte so sehr auf den Sommer vertraut, dass ich lediglich meine Sandalen gegen ein Paar Lederballerinas mit festen Sohlen getauscht hatte. Auf der Homepage der Katakomben wurde geschlossenes Schuhwerk empfohlen. Von Pelzmänteln war jedoch keine Rede gewesen. Ich rieb die Haut meiner nackten Arme, um die Gänsehaut zu vertreiben. Meine Fingerspitzen waren eiskalt.
Ich war so sehr mit meinem Aufwärmprogramm beschäftigt, dass ich fast den Anschluss verpasste. Peinlich berührt sah ich mich in der Galerie um. Ich war fast schon allein. Eine Dreiergruppe Frauen in den Vierzigern kicherte und bemühte sich aufzuschließen. Eine einzelne Gestalt stand im hinteren Teil des Raums. Ich erkannte ihn an seiner Silhouette. Der Junge guckte auf sein Handy, obwohl er hier unten garantiert keinen Empfang hatte. Er sah kurz hoch, direkt in meine Richtung, senkte dann aber wieder den Kopf. Ich hatte den Eindruck, er wartete, bis ich vorausging, um mir dann zu folgen. Mom wäre entzückt. Ich hatte einen persönlichen Babysitter gefunden. Ich verließ die Galerie. Und richtig. Kaum dass ich mich in Bewegung setzte, hörte ich seine Schritte hinter mir auf dem Steinboden. Sollte ich mich nun freuen oder gruseln?
Gérard führte uns durch einen schmalen Gang, der so abschüssig war, dass ich das zur Sicherheit angebrachte Geländer benutzte. Den glatten Sohlen meiner Ballerinas traute ich nicht so richtig.
Die Luft veränderte sich, wurde feuchter und roch seltsam dumpf und erdig. Ich überlegte, mich in dem Gang kurz umzudrehen, doch das traute ich mich nicht. Der Junge war direkt hinter mir. Ich spürte ihn, wusste, dass er da war. Fast so, als wäre ich eine Fledermaus, und die Wellen meines Echolots würden an ihm abprallen und zu mir zurückkehren. Ich bekam erneut eine Gänsehaut, dieses Mal allerdings nicht, weil mir kalt war. Obwohl ich ihn nicht kannte, störte es mich – von der kurzen peinlichen Panikattacke mal abgesehen – nicht, dass er so nah hinter mir war. Und das passte so gar nicht zu mir und meinem Verfolgungswahn.
Ich hörte die vielen »Ahs« und »Ohs« vor mir und beschleunigte meine Schritte. Offenbar schien es nun so richtig interessant zu werden. Der Anblick der vielen Fossilien – für die Ewigkeit versteinerte, stumme Zeugen einer Welt, die schon so lange vergangen war – hatte etwas Majestätisches. Ein riesiger Ammonit thronte auf einem Sockel aus Stein. Eine Gruppe Trilobiten war nur teilweise frei präpariert. So sah es aus, als würden die Gliederfüßer in diesem Moment aus dem Stein hervortauchen. Der gigantische Abdruck eines fossilen Farns wirkte wie ein modernes Wandtattoo. Die meisten Besucher zückten ihre Handys, um Fotos davon zu machen. Auch in der dritten Galerie gingen unzählige Gänge ab, alle mehr oder weniger blockiert oder mit Warnschildern versehen.
Den Jungen sah ich nicht, und auch als ich mich prüfend umdrehte, konnte ich ihn nicht entdecken. Er besaß offenbar das Talent, sich in Menschenansammlungen unsichtbar zu machen. Ich machte kurz ein paar Fotos, wich dann aber zur Seite aus, weil ich nicht im Weg stehen wollte. Allerdings hielt ich einen respektvollen Abstand zu den Wänden, denn von dort aus schien die Kälte wie eine Welle entlang in den Raum zu rollen. Mir war so eiskalt, dass selbst meine Zehen taub wurden. Verstohlen schielte ich auf meine Uhr. Ich überlegte, ob ich die Führung vorzeitig verlassen sollte. Meine Gänsehaut verschwand gar nicht mehr und ließ mich aussehen wie eine außerirdische Lebensform mit seltsam stacheliger Haut.
»Du siehst aus, als ob dir kalt wäre.« Die Stimme hinter mir klang dunkel, und ein Hauch von Spott schwang darin mit. Ich wusste, dass er es war, noch bevor ich mich zu ihm umdrehte. Nun, da er direkt vor mir stand, musste ich feststellen, dass er von Nahem genauso umwerfend aussah wie aus sicherem Abstand. Er war noch größer, als ich vermutet hatte. Seine Schultern waren breit genug, um sofort davon zu phantasieren, wie herrlich man sich an ihnen anlehnen könnte. Seine Arme wurden von schlanken Muskeln definiert, die dezent hervortraten, wenn er sich bewegte. Ich wollte etwas erwidern, war aber viel zu geblendet von diesem beeindruckenden Gesamtpaket.
Der Typ lächelte mich kurz an, dann drehte er seine Tasche nach vorn. Er zog einen leichten Cardigan hervor. Als er den Kopf hob, fiel das Licht der Bunkerlampe hinter mir direkt auf sein Gesicht, und als er mich ansah, hielt ich zum zweiten Mal an diesem Tag die Luft an. Seine Augen waren von einem tiefen, weichen Grau. Schummrig, dunkel, sexy. Das Grau einer Regenpfütze, auf der sich die letzten Strahlen der Abendsonne brachen.
In diesem Moment wünschte ich mir zum ersten Mal, dass eine meiner Halluzinationen Realität wurde. Passierte das hier wirklich? Es war zu perfekt, um echt zu sein.
»Bitte.« Er reichte mir die dunkelblaue Jacke mit fürsorglicher Selbstverständlichkeit. Auf Außenstehende musste die Geste so vertraut wirken, als hätten wir bereits im Sandkasten zusammen gespielt.
»Vielen Dank.« Mein Mund sagte die Worte, aber sie klangen wie aus weiter Ferne. Ich sollte aufhören, ihn anzustarren. Dringend. Jetzt. Sofort. Was sollte er von mir denken? »Das ist sehr nett.« Ich klang, als hätte ich den Satz auswendig gelernt.
Schnell schlüpfte ich in den Cardigan. Die Ärmel waren viel zu lang und bedeckten meine Hände komplett. Der Bund des Cardigans reichte ein gutes Stück über meinen weit fallenden Rock.
Mein Gegenüber machte einen Schritt zurück und zog die Stirn kraus. Dann legte er den Kopf schief wie ein neugieriger Vogel. »Interessant«, sagte er schließlich. »Sieht aus, als wärst du im Trockner eingelaufen.«
Ich musste lachen. Es war kein Spiegel nötig, um zu wissen, dass er recht hatte. Er fiel in mein Lachen ein.
»Ich bin Maél.« Er streckte mir die Hand hin.
»Livia.« Ich hob die Hand. Der überlange Ärmel des Cardigans hing herunter und verbarg meine Finger. Vermutlich sah ich aus wie eine zum Leben erwachte Vogelscheuche. Ich schob den Ärmel hastig hoch. »Jetzt sollte es funktionieren.«
Maél schüttelte meine Hand. »Hauptsache, die Frostbeulen verschwinden.«
»Stimmt.« Ich warf einen kurzen Blick auf unsere Hände. Meine hatte sich perfekt in seine geschmiegt. Maél sah aus, als wollte er noch etwas sagen. Ich ließ seine Hand los, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte.
»Und du gehst also auf die Louis-le-Grand?«, stieß ich hervor, um die Stille zu unterbrechen, und deutete auf das Wappen auf dem Cardigan.
»Richtig.« Er lächelte, und die Neugier, die in seinen grauen Schlechtwetter-Augen aufblitzte, ließ meinen Puls in die Höhe schnellen. »Du aber nicht, oder? Ich habe dich noch nie dort gesehen.«
Fakt war, meine Mom hatte gewollt, dass ich auf die Le-Grand ging, weil es die beste Schule in Paris war. Doch Dad hatte sich durchgesetzt, denn er wollte, dass ich einen internationalen Abschluss machte. »Nein, ich gehe auf die Internationale Schule. Ab Montag. Wir sind gerade erst hergezogen.«
Maél schien aufzuhorchen. Er sah mich an, wie ein Junge, der gerade erfahren hatte, dass er ein Auto zu Weihnachten bekommt. »Cool. Wo kommst du her?«
Ich wedelte mit beiden Händen, was vermutlich lässig ausgesehen hätte, wenn da nicht diese überlangen Ärmel gewesen wären. »Überall und nirgends.«
Sein Gesichtsausdruck war ein großes Fragezeichen.
»Diplomatenkind«, sagte ich. »Du weißt schon. Alle paar Jahre eine neue Stadt.«
»Klingt spannend. Besser als ein ganzes Leben lang mit den gleichen Leuten in der immer gleichen Stadt.«
»Aber man hat kein richtiges Zuhause. Und keine Freundschaften, die länger als drei Jahre dauern, weil man wieder umziehen muss.« Ich zuckte mit den Schultern. »Aber das wird sich ändern, sobald ich meinen Abschluss habe. Dann werde ich irgendwo studieren und mir anschließend einen Job suchen, für den ich nicht mehr ständig das Land wechseln muss.«
»Das wäre wirklich eine Verschwendung …« Er sah mich ernst an. Als ich nicht sofort antwortete, fügte er schnell hinzu: »Aber du hast ja noch ein paar Jahre Zeit, um dich zu entscheiden. Wie alt bist du?«
»16 Jahre.«
»Genug Zeit also.« Er zupfte spielerisch an einem meiner langen Ärmel. »Vorausgesetzt, die Jacke frisst dich nicht vorher auf.«
Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich glaube, ich würde der Jacke nicht schmecken.« Er hielt meinen Blick, und irgendetwas passierte da zwischen uns. Ich konnte das Knistern hören, spürte die Funken zwischen uns fliegen, als sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten. Maél atmete deutlich hörbar aus. Er schien es genauso intensiv zu spüren wie ich.
»Wenn du keine Lust mehr auf das Rentnerprogramm hier hast …«, Maéls Stimme klang rau. Er deutete mit dem Kopf vage nach rechts. »Drüben wird gerade eine Street-Art-Ausstellung vorbereitet. Da könnten wir mal vorbeischauen.«
Ich folgte der Richtung seines Kopfnickens. Dort war eine Wand, nur durchbrochen von einem schmalen Zugang, hinter dem vermutlich eine alles verschlingende Dunkelheit ungebetene Besucher mit einem bodenlosen schwarzen Gähnen begrüßte.
»Wo ist drüben?« Der Gedanke, noch mehr Zeit mit Maél zu verbringen, war verlockend hoch zehn. Auch der Gedanke, dass er offensichtlich seine Zeit mit mir verbringen wollte, ließ mein Herz schneller schlagen. Aber ich war mir relativ sicher, dass es »drüben« nur Steinwände, Dunkelheit und noch mehr eisige Kälte gab.
Im Hintergrund hatte Gérard seinen Vortrag wiederaufgenommen. Doch ich hatte nur noch Augen und Ohren für mein Gegenüber.
»Na, drüben eben.« Maél grinste auf eine unverschämt herausfordernde Art, die mir einen prickelnden Schauer die Wirbelsäule hinabjagte. Wieder deutete er mit dem Kopf kurz nach rechts, als würde das alles erklären.
Ich hatte Mom versprochen, direkt nach der Führung heimzukommen. Sie würde ausrasten, wenn ich nicht rechtzeitig zurück war. Sollte der Fahrer mich nicht am Ausgang der Katakomben einsammeln können, würde er sofort zu Hause anrufen. Mom würde daraufhin Dad verrückt machen, und zum Schluss wären sie sich einig, dass ich unsere Wohnung nur noch verlassen durfte, um zur Schule zu fahren. Der absolute Super-GAU. Obwohl wir schon fünf Wochen in Paris wohnten, tat Mom immer noch so, als könne ich hier verloren gehen. Wir hatten vorher in Seoul gewohnt. Seoul! Hallo? Gegen das Tag und Nacht piepsende, blinkende High-Tech Seoul war Paris ein verschlafenes Vorstädtchen.
Ich konzentrierte meine Gedanken wieder auf Maél und sein Angebot. Es war verlockend, aber ebenso war es bekanntermaßen gefährlich, mit Männern mitzugehen, die man nicht kannte. Und ich kannte Maél nicht. Er war ein Fremder, dem es aus unerklärlichem Grund nicht egal war, dass ich fror. Was, wenn Maél mich irgendwo in die Katakomben verschleppte, mich knebelte und fesselte und …
Maél schüttelte gespielt tadelnd den Kopf. »Da hat aber jemand eindeutig zu viele Horrorfilme gesehen.«
»Ich lese die Tageszeitung, das reicht schon.«
Ich konnte zusehen, wie sich in Zeitlupe ein Lächeln auf sein Gesicht malte. Sein Blick ruhte auf mir, und es schien, als betrachte er mich mit neu erwachtem Interesse. »Wovor hast du Angst?« Er kam näher, nur ein winziges bisschen, aber nah genug, dass ich den zarten Hauch eines Parfüms auf seiner Haut riechen konnte. »Dass ich dich entführe? Über dich herfalle? Dich mit einem alten Knochen knebele und ausbluten lasse?«
»Du hast eine ziemlich kranke Phantasie«, flüsterte ich.
»Dito, denn sonst wärst du doch schon längst mitgekommen.«
Ich seufzte.
»Also. Wovor hast du Angst?«
»Vor meinen Eltern.«
Maél sah mich ungläubig an, wich einen Schritt zurück und richtete sich zu voller Größe auf. »Was?« Das prustend hervorgestoßene Wort klang so laut in dem niedrigen Raum, dass einige Köpfe sich neugierig zu uns drehten.
Jemand machte »Pscht!«, worauf Maél den Mann so lange anstarrte, bis dieser wegsah. Ich konnte Maéls Temperament fast körperlich fühlen. Wie Lava, die unter einer Oberfläche brodelte und auf einen winzigen Riss wartete, um emporzubrechen. Als er sich jedoch zurück zu mir drehte, war er wieder die Ruhe selbst, so als habe er lediglich einen Schalter umgelegt. Fasziniert starrte ich ihn an.
Er zog die Augenbrauen hoch. »Alles okay?«
»Der Mann wollte doch nur, dass wir leise sind. Vermutlich ist er ein Lehrer. Die machen so etwas aus Gewohnheit.«
Maél schnaubte. »Er hat sich in etwas eingemischt, das ihn nichts angeht. Noch ein Wort mehr, und ich hätte ihn frikassiert.«
»Frikassiert?«, echote ich. »Hat das was mit Hühnerfrikassee zu tun?« So oder so machte er hoffentlich nur Scherze.
Maél überging meine Frage. »Deine Eltern, müssen wir sie jetzt anrufen und um Erlaubnis fragen?«
Ich zog ein Gesicht. »Du hast wohl keine Eltern, die sich dafür interessieren, wann du nach Hause kommst?«
Maéls Gesichtsausdruck veränderte sich für den Bruchteil einer Sekunde. Für einen kurzen Moment brach da etwas durch, das mich verwirrt zurückließ. Traurigkeit? Ratlosigkeit? Wut? Dann war der Moment vorbei, und Maél hatte sich wieder im Griff. »Ich will dich nicht überreden, Livia.«
Es war das erste Mal, dass er meinen Namen sagte, und die Art, wie er ihn aussprach, war das Schönste, was ich an diesem Tag gehört hatte. Bei ihm klang das L weich und verführerisch, und er zog die letzten beiden Vokale zusammen, sodass sie wie ein neuer, exotischer Buchstabe klangen. Plötzlich fragte ich mich, ob Französisch wirklich seine Muttersprache war.
Ich wand mich innerlich. Ja oder nein? Maél oder das Lob meiner Eltern? Seine Telefonnummer oder das gute Gewissen, eine vorbildliche Tochter zu sein?
»Ich kann aber höchstens eine halbe Stunde bleiben.« Komischerweise war ich mir sicher, dass er wusste, ich würde mit ihm gehen, noch bevor ich zusagte.
»Ich werde das mal eben klären.« Mit diesen Worten ließ Maél mich stehen, ging zu Gérard herüber und unterbrach dessen Vortrag. Ich hörte »Übelkeit« und »nach draußen gehen«, während Maél mit der Hand kurz in meine Richtung deutete. Gérard nickte und bot an, uns kurz den Weg zu zeigen. Doch Maél winkte ab. Einige der anderen Besucher warfen mir mitfühlende Blicke zu, als mich Maél an ihnen vorbeiführte. Ich hingegen nahm nur das Kribbeln wahr, das sich in meinem Körper ausbreitete, seit er meinen Arm scheinbar fürsorglich unter seinen gehakt hatte.
Maél führte mich aus der dritten Galerie und den engen, langen Gang hinauf zu Galerie Nummer zwei. Ich hatte vor lauter Nervosität noch keinen Ton herausgebracht. Maél war umwerfend, aber hatte ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Was, wenn er gelogen hatte? Wenn Maél gar nicht sein richtiger Name war? Wenn er …
Maél blieb abrupt stehen und drehte sich zu mir.
»Du hast immer noch Angst.«
Ich schüttelte schnell den Kopf. Konnte er meine Gedanken lesen, oder was?
Er zog ein leicht zerfleddertes Portemonnaie aus einer der hinteren Taschen seiner Jeans. Dann hielt er mir seinen Ausweis unter die Nase.
»Das bin ich.«
»Das ist doch nicht nötig«, stammelte ich, überflog das Dokument aber trotzdem kurz. Maél Anjou, 17 Jahre alt, wohnhaft in der Rue Dampierre, Paris.
»Doch, ist es.« Maél sah mich ernst an. »Mach ein Foto davon.«
»Nein …«
»Doch.« Seine Stimme verriet, dass er andernfalls keinen Schritt weitergehen würde. Ich zückte mein Handy und fotografierte seinen Perso.
»Drüben am Übergang zur ersten Galerie hat man schon wieder Empfang. Schick das Foto an wen auch immer du willst. Dann bist du auf der sicheren Seite.«
Zuerst dachte ich, er wäre vielleicht sauer, aber dann lächelte er mich an. »In einem Horrorfilm würdest du jetzt übrigens in einer dunklen Ecke ein Messer ziehen und mich abstechen. Denn es weiß ja jeder, dass immer die mit den unschuldigsten Gesichtern die Schlimmsten sind.«
Ich lachte. »Das denkst du also von mir?«
Er zuckte mit den Schultern und steckte seinen Ausweis weg. »Das wäre es mir wert.«
»Du bist verrückt.« Meine Wangen brannten vor Verlegenheit.
»Ha.« Er machte einen Schritt voraus. »Warte erst, bis du mich besser kennenlernst.« Dann drehte er sich zu mir um. »Und jetzt pack deine Messer zusammen und folge mir.«
Kopfschüttelnd holte ich auf. »Wohin gehen wir?«
Maél seufzte. »Du bist wie ein kleines Kind. Wohin gehen wir? Wann sind wir da? Wann gehen wir wieder zurück?«
Ich musste ihm erst einen Seitenblick zuwerfen, um zu erkennen, dass er sich lustig machte. Aber ich ignorierte es einfach. »Wieso frierst du eigentlich nicht?«
»Superhelden frieren nicht.« Er wackelte mit den Augenbrauen.
»Schon klar, Batman.« Ich sah ihn erneut an. Ich konnte einfach nicht anders. So als habe die Natur ihn darauf programmiert, unwiderstehlich zu sein. Dabei übersah ich allerdings eine Unebenheit im Boden und stolperte. Ich konnte es nicht verhindern, dass ich Maél anrempelte.
»Und du schubst also gerne kleine harmlose Jungs herum, ja?« Er rieb sich theatralisch den Oberarm.
Ich unterdrückte ein Glucksen. Maél war alles, aber das nun wirklich nicht. Ich murmelte eine Entschuldigung.
Sein schiefes Grinsen verriet mir, dass er mich schon wieder aufzog.
»Wir müssen da durch.« Er deutete mit dem Kopf auf einen schmalen Gang, vor dem ein gelbes Betreten-verboten-Schild an einer Kette baumelte.
Ich sah erschrocken zu ihm hoch. »Aber das ist nicht erlaubt.« Warum flüsterte ich automatisch?
Maél beugte sich nah zu meinem linken Ohr. »Ich weiß«, flüsterte er zurück.
Erschrocken wich ich ein Stückchen von ihm weg und verschränkte die Arme vor der Brust, was dank der überlangen Ärmel gar nicht so einfach war. Maél beobachtete das Schauspiel mit einer Spur stummer Verzweiflung im Blick.
»Wo ist diese Ausstellung?«
»In den Katakomben.«
»Warum nehmen wir dann nicht einen der offiziellen Gänge?«
»Weil die Ausstellung nicht in einem öffentlichen Teil der Katakomben stattfindet.«
Ich holte scharf Luft. Ich hatte davon gelesen. Von den illegalen Veranstaltungen, die in den nicht gesicherten Bereichen der Katakomben stattfanden. Von dem Hype, der davon ausging, und den vielen hippen Besuchern, die Fotos davon auf Instagram hochluden. Von den legendären Partys, den Razzien und der Polizeieinheit, die extra zur Bekämpfung der illegalen Aktivitäten gebildet worden war. Die »Cataphiles«, die »Katakombenfreunde«, wie sie sich nannten, legten sich regelmäßig mit der Polizei und den Museumsbehörden an. Sie hatten sich hier tief unter der Erde ihr eigenes, gesetzloses Reich geschaffen und scherten sich nicht um Brandschutzverordnungen und die Sicherheit ihrer eigenen Leben. Im Netz wurden sie verehrt und gefeiert. Die Presse nannte sie »leichtsinnig und lebensmüde«, die Behörden »Unruhestifter, die das Gesetz missachteten«.
Maél beobachtete mich und schien meine Reaktion abschätzen zu wollen.
»Du bist ein Cataphile«, sagte ich tonlos.
»Läufst du schreiend davon, wenn ich jetzt nicke?«
Ich schüttelte wortlos den Kopf, doch mein Herz schlug so heftig, dass es sogar Maél hören müsste. Auch er wirkte angespannt. Eine Ader an seinem Hals pochte in einem wilden Stakkato. Wieder verringerte er den Abstand zwischen uns. Wie automatisch wandte ich mich ihm zu. Meine verschränkten Arme lösten sich und fielen fast kraftlos wieder an meine Seiten.
»Ich kenne die Katakomben wie meine Westentasche.« Er hob die rechte Hand, als wolle er mir in einer beruhigenden Geste über den Arm streichen. Doch dann ließ er sie wieder sinken. »Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Jeder von uns weiß, welche Gänge sicher sind und welche nicht. Ich war das erste Mal mit 13 Jahren hier unten. Seit über vier Jahren bewege ich mich jede Woche in diesem Labyrinth. Es ist wie mein zweites Zuhause.«
Mom und Dad würden ausrasten, würden sie es je erfahren. Doch ich wollte jetzt nicht an sie denken. Ich konnte jetzt nicht daran denken. Alles, was ich fühlte, waren die Schmetterlinge, die tanzend in meinem Bauch aufstiegen, sobald Maél einen gewissen Abstand zwischen uns überwand.
»Zu der Ausstellung, zu der wir wollen, kommen auch Gäste, die keine Cataphiles sind. Niemand würde dafür einen Ort auswählen, an dem es nicht absolut unbedenklich ist. Das hier ist Stein, Livia, dafür gemacht, den Jahrhunderten zu trotzen.«
Ich nickte, sah ihn aber nicht an.
»War das ein Ja?«, fragte er leise.
Ich hob den Kopf. »Ja.«
Maéls Lächeln war so strahlend, dass es vermutlich gereicht hätte, um sämtliche geheime und nicht geheime Gänge der Katakomben zu erhellen.
»Dann komm.« Er ging zu dem Gang hinüber und sprang leichtfüßig über die Absperrung. Von der anderen Seite aus streckte er mir galant die Hand entgegen. »Darf ich bitten?«
Ich folgte ihm und schob dabei die langen Ärmel der Strickjacke nach oben. Vor der Kette raffte ich meinen Rock und ließ dann meine Finger in seine gleiten. Die Kette der Absperrung klirrte leise, als ich sie mit meinem Fuß streifte. Wir standen so nah voreinander, dass unsere Körper sich fast berührten. Die Schmetterlinge in meinem Bauch wirbelten wie in einem Hurrikan durcheinander.
»Das war doch gar nicht schwer«, flüsterte er. Er ließ meine Hand nicht los. »Fühlst du dich schon anders?« Die matte Dunkelheit ließ seine Züge wie mit Tusche skizziert scheinen. Sein Haar war so tiefschwarz, dass es mit den Schatten verschmolz. Wieder einmal wirkte er, als würde er genau hierhergehören. In die Schwärze, die Schatten, die Dunkelheit.
»Anders?«, flüsterte ich.
»Wilder, gesetzloser und am Rande der Legalität?«
Ich hätte ihm sagen können, wie ich mich gerade fühlte, aber das hatte wenig mit dem Besuch der illegalen Ausstellung zu tun.
Langsam, fast zögerlich, ließ Maél meine Hand los. Dann holte er eine Taschenlampe aus seiner Umhängetasche. »Wir haben nicht sehr viel Zeit. Von deiner halben Stunde wird nicht mehr allzu viel übrig sein. Pass auf, wo du hintrittst, und geh dicht hinter mir. Ich kann meine Taschenlampe erst anmachen, wenn wir ein Stück von der Galerie weg sind, damit wir keinen Lichtschein produzieren. Sicher ist sicher.«
»Verstanden.«
»Okay.« Maél ging voraus.
Ich folgte ihm in die Dunkelheit. »Maél?«
»Ja?«
»Wie genau habe ich mir das vorzustellen, wenn du jemanden ›frikassierst‹?«
»Das erkläre ich dir, wenn wir da sind, kleines Hühnchen.«
In diesem Moment zweifelte ich erneut, ob es eine gute Idee war, einem völlig Fremden in die Unterwelt von Paris zu folgen.
Kapitel 2
Rebellisch für Anfänger
Maél knipste die Taschenlampe an.
Endlich! Nur noch wenige Meter, und ich hätte mir vermutlich den Hals gebrochen. Zweimal war ich bereits mit der Spitze meiner Ballerinas gegen einen Stein getreten und fast gestolpert. Die Dunkelheit hatte mich eingehüllt, als sei ich in ein schwarzes Meer eingetaucht. Ein schwarzes, schrecklich stilles Meer. Dieses absolute Fehlen von Umgebungsgeräuschen versetzte mich in einen Zustand konstanter Alarmbereitschaft. So als würde mir mein Verstand instinktiv mitteilen, dass hier etwas nicht stimmte. Mittlerweile war ich mir sicher, dass mir ein wenig Lärm sehr viel lieber war als diese allumfassende, unnatürliche Stille. Maél vor mir verursachte zwar Geräusche, und ich machte etwa doppelt so viel Krach wie er, aber es fühlte sich falsch an, die einzige Geräuschquelle zu sein. Hinzu kam, dass man in dieser Dunkelheit einen gestörten Gleichgewichtssinn zu haben schien. Jeder Schritt wurde zum Wagnis, jeder Meter ließ scheinbar nur noch weitere endlose Meter folgen.
Jetzt, da der Schein von Maéls Taschenlampe den roh behauenen Stein erhellte, fühlte ich mich sofort besser. Das wenige Licht hatte offensichtlich eine beruhigende Wirkung auf mich. Ich blühte in dem dünnen Lichthauch auf wie eine Pflanze, wenn die Morgensonne endlich durch die Wolkendecke bricht. Ich seufzte so erleichtert auf, dass Maél sich im Gehen kurz zu mir umdrehte. »Hast du Angst im Dunkeln?« Er klang belustigt.
»Nein!« In der Dunkelheit meines Schlafzimmers hatte ich keine Angst. In der pechschwarzen Dunkelheit eines Kalksandsteinstollens, zwanzig Meter unter der Erde, war es wiederum durchaus okay, sich ein wenig mulmig zu fühlen. Das war zumindest meine Meinung.
»Bist du dir sicher?«
Ich ignorierte seinen amüsierten Tonfall. »Wie kommt man zu den Cataphiles? Gibt es ein Aufnahmeritual? Muss man ewige Treue und Verschwiegenheit auf einen Totenschädel schwören?« Zu der düsteren Umgebung würden diese Geheimbundzeremonien jedenfalls hervorragend passen. Die Luft war kalt und schien von einer seltsamen Konsistenz. Ich atmete tief ein. Es fühlte sich an, als würde ein Schwall kühles Wasser in meine Lunge strömen. Besonders unheimlich fand ich den Umstand, dass ich den Stein riechen konnte. Er schien einen fast metallischen Geruch zu verströmen, den ich sogar auf meiner Zunge zu schmecken meinte.
»Wir sind keine Sekte.« Maél klang ein wenig so, als habe ich seine Ehre beleidigt. »Und mit Schädeln haben wir auch nichts am Hut.«
»Aber es gibt hier unten doch haufenweise Schädel. Warum sollte man sonst hierherkommen?«
»Aus diesem Grund kommen vielleicht die Touristen her.«
Im nächsten Moment prallte ich gegen seinen Rücken. Ich gab einen überraschten Laut von mir. Schnell suchte ich Halt an der Wand zu meiner Rechten. Warum war er stehen geblieben? Seine Sohlen knirschten auf dem rauen Boden, als er zu mir herumschwang.
»Willst du sie sehen?«
Selbst im Dämmerlicht der Taschenlampe konnte ich erkennen, wie seine Augen leuchteten.
»Ich zeige dir mein Lieblings-Ossarium, wenn du willst. Die einzelnen Skelettknochen sind dort besonders kunstvoll arrangiert.«
Einen Moment lang betrachtete ich ihn nachdenklich in der schemenhaften Dunkelheit. Er war also nicht wegen der Schädel hier, bekam aber bei dem Gedanken an einen ganzen Haufen davon so glänzende Augen wie ein Kind am Weihnachtsabend. Das Wort »Widerspruch« erlangte hier eine ganz neue Dimension.
»Was sagst du? Eigentlich sollte ich schon bei meinen Leuten aufgetaucht sein. Aber für dich würde ich einen kleinen Umweg machen.«
Maél war definitiv keiner von der geduldigen Sorte. Es fehlte nur noch, dass er auf den Hacken wippte. Ich rekapitulierte kurz. Ich wollte die Ossarien gerne sehen. Es war einer der Gründe, warum ich mich zu einem Besuch der Katakomben entschlossen hatte. Niemals hätte ich mich wegen »Faszination Kalkstein« zum Place Denfert-Rocherau begeben. Nun bekam ich die Chance auf eine Einzelführung durch die Katakomben, auf die ich mich so gefreut hatte. Vermutlich fachlich nicht so kompetent und detailreich, dafür aber definitiv mit mehr Kribbeln im Bauch.
»Lieber nicht?« Maél sah mir forschend ins Gesicht. »Okay, dann lass uns weitergehen. Ich hätte schon vor einer halben Stunde da sein sollen.«
»Aber …«, setzte ich an. Dann brach ich ab.
»Ja?« Er lächelte schief.
Ich fühlte mich plötzlich wie ein Insekt, das sich in dem magisch schillernden Netz einer Spinne verfangen hatte. »Ich will.« Wie klang das denn jetzt bitte? »Ähm … Ich meine, ja, ich will.« Du liebe Zeit. Das machte es nicht besser. »Ich würde mir gern das Ossarium mit dir ansehen.«
»Bist du dir sicher? Es erwarten dich jede Menge Schädel und Knochen.«
Ich nickte, obwohl mir schon ein wenig mulmig war. Doch in das leichte Unwohlsein mischte sich nun eine große Portion Vorfreude. Ich würde endlich einen der Orte sehen, die so viel Geschichte repräsentierten. Ich war fasziniert von dieser Welt hier unten. Und je mehr Zeit ich hier verbrachte, desto größer wurde meine Sehnsucht, immer mehr davon kennenzulernen.
»Da bist du dir wirklich ganz sicher?« Er zog mich schon wieder auf.
»Klar. Jeder in unserem Alter sollte ein Lieblings-Ossarium haben.«
Maél unterdrückte ein Grinsen, das sah ich genau. Stattdessen kniff er die Augen zu Schlitzen zusammen und legte interessiert den Kopf schief. »Schließt man die Möglichkeit aus, dass du dich gerade über mich lustig machst, wäre das die richtige Einstellung.«
Ich legte gespielt eine Hand auf mein Herz. »DAS würde ich niemals machen.«
»Du bist ganz schön vorlaut für jemanden, der sich in einem 300 Kilometer weit verzweigten Stollennetz befindet …« Er beugte sich nah zu mir. »… und das ohne jede Orientierung.«
Er wollte mich aus dem Konzept bringen. Nein, falsch. Er brachte mich aus dem Konzept. Definitiv. Seine Nähe gepaart mit den provokanten Worten machte mich gewaltig nervös. Ich war eigentlich nicht »Miss Schlagfertig«, aber in diesem Moment hatte ich eine Idee, wie ich parieren konnte. Ich sah mit großen Augen zu ihm hoch. Dann umfasste ich eine der zierlichen Ketten, die um meinen Hals hing, als suchte ich dort nach Halt. »Aber …« Ich setzte zum ersten Mal den Augenaufschlag ein, den ich so lange vor dem Spiegel geübt hatte. »Aber ich habe doch dich«, wisperte ich. Dann wiederholte ich den Augenaufschlag.
Maél schluckte deutlich hörbar. Sein Blick heftete sich auf meinen Mund, glitt dann hinab zu den Fingern, die sich immer noch an die Kette klammerten, und dann zurück zu meinen Lippen. Die Stille zwischen uns war fast greifbar. Maéls Atmung schien sich beschleunigt zu haben. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem schnellen Takt, fast so, als sei er gerannt.
Ich hatte nicht geglaubt, dass diese sogenannten Waffen der Frau wirklich irgendjemanden aus dem Konzept bringen würden, schon gar nicht, wenn ich sie zückte. Ich hatte damit gerechnet, dass er lachen und mich weiter aufziehen würde. Doch dafür war der Moment nun zu lange her. Gerade eben war es noch ein Spaß gewesen, jetzt hatte sich die Stimmung zwischen uns merklich verändert. Ich fühlte mich wie ein Teil eines Kraftfeldes, mit Maél als meinem Gegenstück. Als er den Blick von meinem Mund löste und mir direkt in die Augen sah, stoben zwischen uns knisternde Funken in die Dunkelheit. Auch Maél schien es zu spüren, denn er holte scharf Luft. »Ich …« Er brach ab. Wieder glitt sein Blick zu meinem Mund. Energisch machte er einen halben Schritt weg von mir. So als müsse er der Energie, dem Knistern entkommen, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können.
Nur einen Atemzug später hatte er sich wieder gefangen und grinste mich provokant an. »Ich sage es gerne noch mal. Ich an deiner Stelle wäre lieber nicht so frech.« Er zupfte am leeren Bündchen einer meiner Ärmel. Meine Fingerspitzen reichten unter dem Stoff gerade mal bis zur Mitte der Unterarme. »Und jetzt komm. Wir wollen doch nicht, dass Mami und Papi sich Sorgen machen um ihr kleines, braves Mädchen.«
Er drehte sich um und zog mich hinter sich her. Gut, eigentlich zog er die Jacke hinter sich her. Denn dank ihrer Übergröße sah es tatsächlich so als, als trüge nicht ich sie, sondern sie mich.
Wir waren nur wenige Meter in dem Tunnel vorangekommen, als Maél langsamer wurde. In der Wand zu unserer Linken war eine Abzweigung aufgetaucht. Der Gang schien noch schmaler und niedriger zu sein. Ich warf einen skeptischen Blick auf den Eingang. Maél sah sich kurz zu mir um. Er schien sich versichern zu wollen, dass ich nicht doch noch einen Rückzieher machte.
»Die Katakombengruppe sollte diesen Raum bereits passiert haben. Aber sei zur Sicherheit trotzdem so leise wie möglich. Ein paar Meter vor dem Ausgang mache ich die Taschenlampe aus. Pass auf, wo du hintrittst.«
»Okay.« Ich heftete meinen Blick auf den Boden. Es lief auch richtig gut, doch da knipste Maél die Taschenlampe aus. Ich stieß prompt mit meinem großen Zeh vor einen Stein. Ich unterdrückte einen Schmerzenslaut. Falls ich die Katakomben noch einmal betreten sollte, dann nur in Trekkingschuhen oder Doc Martens mit Stahlkappen. Mein Geräusch war zwar leise gewesen, aber trotzdem machte ich mir Sorgen. Hoffentlich hatte ich uns nicht gerade auffliegen lassen!
Da aber keine Stimmen zu hören waren, beruhigte ich mich wieder. Die Besuchergruppe schien diesen Raum tatsächlich bereits verlassen zu haben. Das Geschrei, wenn wir plötzlich wie zwei Geister aus einem der verbotenen Gänge aufgetaucht wären, wollte ich mir lieber nicht vorstellen.
»Wir sind da.«
»Warum ist es so dunkel?«, wisperte ich hinter ihm. »Man sieht ja gar nichts.«
»Aus Kostengründen.« Maél knipste die Taschenlampe wieder an. »Die Räume sind mit Lichtschaltern ausgestattet. Wenn eine Gruppe den Raum verlässt, macht derjenige, der die Führung leitet, das Licht aus. Ich kann es aber nicht anmachen. Sie haben oben ein Mischpult, das anzeigt, wo Licht brennt. Jemand würde kommen, um nachzusehen, da die Führung schon durch ist.«
Ich war zu abgelenkt, um zu antworten. Der Anblick des Ossariums war grotesk und faszinierend zugleich. Um zu verhindern, dass mir staunend der Mund offenstand, lenkte ich mich damit ab, dass ich beide Ärmel der Strickjacke sorgfältig aufkrempelte. So hatte ich zumindest eine Unfallgefahr fürs Erste gebannt, das Staunen konnte ich dennoch nicht ganz abstellen.
Direkt auf den Steinboden waren Hunderte Knochen gegen eine Mauer gestapelt. Sortiert nach Größe, begannen sie mit den langen kräftigen Knochen der Oberschenkel und endeten mit den dünnen Knochen der Unterarme. Ganz oben lagen die Schädel drapiert. Die schwarzen Höhlen schienen einen direkt anzusehen. Die glatten bleichen Schädelkalotten, die vom Lichtkegel der Taschenlampe angestrahlt wurden, gaben dem Ganzen eine fast gespenstische Atmosphäre. Ich ging hinter Maél her bis zur Mitte des Raumes, um die geschickt gestapelten Knochen als Gesamtkunstwerk betrachten zu können. Die rohen Spuren des Tagebaus waren hier an den Wänden besonders deutlich zu sehen. Zusammen mit den vielen Knochen und Schädeln verliehen sie dem Raum ein apokalyptisch anmutendes Endzeit-Flair. Sogar die Luft hatte sich erneut verändert. Sie war immer noch kalt, doch es schwang ein eigentümlicher Geruch darin mit. Samtig und scharf zugleich, wie eine Prise fein gemahlener Pfeffer. Ich bekam eine Gänsehaut bei der Vorstellung, dass es die Knochen sein könnten, die diesen Geruch verströmten.
»Schau mal.« Maél wies auf eine Inschrift über dem Türbogen hinter uns.
Haltet ein, hier beginnt das Reich des Todes, war dort in eleganter Schrift in den Stein gemeißelt worden.
»Wie unheimlich«, flüsterte ich. »Das ist ja fast eine Drohung.«
»Es ist eine Bitte.« Maél hatte den Blick immer noch auf den Schriftzug gerichtet. »Eine Bitte um Respekt.«
Ich drehte fragend den Kopf zu ihm. Als habe er es gespürt, sah auch er zu mir. »Haltet ein bedeutet nicht: stopp, nicht weiter. Es heißt, geht in euch, seid respektvoll …« Er warf einen kurzen Blick auf die Knochen und sah dann zurück zu mir. »… memento mori.«
Ich hatte Latein in der Schule, deshalb wusste ich, was die Worte bedeuteten. »Denkt an eure eigene Sterblichkeit.«
Maél nickte. »Wenn ich die Fotos sehe, auf denen Touristen so albern vor den Knochen posieren, könnte ich ausrasten.«
Obwohl das ein ernstes Thema und ich absolut seiner Meinung war, musste ich lächeln. »Möchtest du die dann auch frikassieren?«
Maél verschränkte die Arme vor der Brust »Kein Wunder, dass deine Eltern dich an so einer kurzen Leine halten, so frech wie du bist. Du solltest dich nicht beschweren. Es dient vermutlich einzig und allein zu deinem Schutz.«
Ich wollte etwas ebenso Schlagfertiges erwidern. Nur leider fiel mir, wie so oft, nichts ein. »Du …«
»Ja?« Schon wieder so ein provozierender Blick.