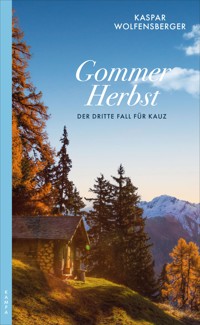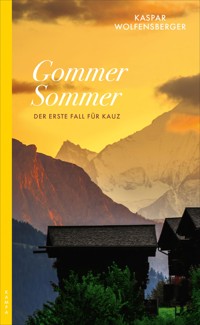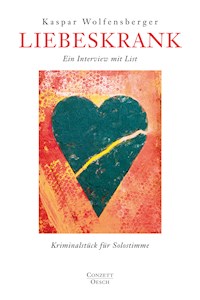17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kauz
- Sprache: Deutsch
Im schönsten Gommer Bergfrühling geschehen unschöne Dinge: Das Tauwetter fördert am Dorfrand von Münster eine Leiche zutage, und im Seniorenhaus Primavera häufen sich rätselhafte Todesfälle. Als dann auch noch der neue Gemeindepfarrer Emmanuel Mbembe kurz vor dem Abendmahl am Altar um Atem ringt, zusammenbricht und stirbt, begeben sich Kauz Walpen, der Üsserschwiizer Ex-Polizist mit Gommer Wurzeln, und sein treuer Begleiter Max, ein schwarzer Collie-Mischling, auf Spurensuche. Mbembe hat regelmäßig die Senioren der Gemeinde besucht und Kauz vor seinem Tod seine Sorgen anvertraut: Einige Bewohner des Altersheim hatten Angst, fühlten sich nicht sicher – und auch Mbembe selbst war die Seniorenresidenz nicht geheuer. Mehr so ein Gefühl, kein hinreichender Grund, zur Polizei zu gehen – so dachte er. Wusste der Priester aus Tansania doch mehr, als er zugegeben hat, und wurde zum Schweigen gebracht? Oder spielten gar rassistische Motive eine Rolle? Die Ermittlungen führen Kauz weit über das Goms hinaus und in der Zeit zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kaspar Wolfensberger
Gommer Frühling
Ein Fall für Kauz
Kriminalroman
Kampa
Über dieses Buch
Die Handlung dieses Romans ist reine Fiktion. Alle in der Erzählung auftretenden Figuren, auch wenn sie herkunfts- oder ortstypische Namen tragen, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und wahren Begebenheiten wären rein zufällig.
Einzelne Gebäude, Örtlichkeiten und Flurnamen, denen im Rahmen dieser Kriminalgeschichte eine Bedeutung zukommt, sind realen Objekten, Orten und Bezeichnungen im Goms nachempfunden, existieren in der beschriebenen Form jedoch nicht. Das im Roman beschriebene Grandhotel in Gletsch und das verlassene Hotel an der Furka-Passstraße sowie deren Geschichte haben gewollte Ähnlichkeit mit den realen historischen Hotels an gleicher Stelle; doch die jüngere Geschichte und die Besitzverhältnisse des Hotels Miraval sind erfunden.
Die Erzählung enthält vereinzelte Wörter, Sätze und kurze Passagen im Gommer Dialekt. Diese Stellen sind kursiv gesetzt. Für Leserinnen und Leser, die mit dem Gommertitsch nicht vertraut sind, folgt am Schluss des Buchs ein kleines Glossar.
Prolog
Der Mercedes 4MATIC hält auf dem Parkplatz unweit der Pfarrkirche. Ein Mann und eine Frau steigen aus.
»Puh«, sagt die Frau. »Was für ein Wetter!«
»Was will man?«, meint der Mann und wirft die Fahrertür zu. »So ist es hier oben eben um diese Jahreszeit.«
»Wie weit ist es?«, fragt sie nervös, zieht den Kaschmirschal enger und knüpft den Mantel zu.
»Nicht weit«, sagt er und zeigt der Furkastrasse entlang.
Sie stapfen durch den Schnee.
»Da?«, fragt sie skeptisch, als er vor einem historisch anmutenden Gebäude stehen bleibt.
Relais et Auberge du Sauvage steht in verwaschenen Lettern an der Fassade des Altbaus. Seniorenhaus und Residenz Primavera heißt es in diskreter Leuchtschrift über dem modernisierten Eingangsbereich mit der Glasschiebetür.
»Ja, hier wohnt sie jetzt. Pas mal, hein?«, näselt er und lächelt schief. »Kommen Sie«, sagt er und geht hinein.
»Sie werden erwartet«, sagt die Dame an der Rezeption, als der Mann die Frau vorstellt. »Ihre Angehörige sitzt dort hinten.«
Zusammen gehen sie durchs Foyer und bleiben vor der alten Dame stehen, die allein vor einem Paravent in einem Fauteuil sitzt. Sie hat schon ihren Wintermantel an und Stiefel an den Füßen. Verwundert sieht sie auf.
»Kennen wir uns?«, fragt sie unsicher.
»Aber Tante: Sieh mich an, ich bins.«
Die alte Dame schaut sie lange an.
»Ach so«, sagt sie dann. »Möchten Sie gerne Tee?«
»Nein, Tante. Wir machen einen Ausflug. Das haben wir doch abgemacht. Weißt du das nicht mehr?«
»Einen Ausflug? Wieso? Ist heute mein Geburtstag?«
»Überleg mal, Tante, wann hast du Geburtstag?«
Die alte Dame besinnt sich.
»Im Frühling, glaube ich«, sagt sie. »Oder?«
»Ist jetzt Frühling, Tante?«
»Ich weiß nicht.«
»Schau doch zum Fenster hinaus.«
Die alte Dame dreht den Kopf.
»Oh!«, ruft sie. »Wunderschön! Machen wir eine Blütenfahrt?«
Die Frau wirft dem Mann einen Blick zu.
»Ja, Tante«, sagt sie, »genau das haben wir vor: eine Blütenfahrt. Hast du den Ausweis dabei?«
»Welchen Ausweis?«
»Na, deinen Pass oder die Identitätskarte. Darf ich sehen?«, fragt die Frau und greift nach der Handtasche der alten Dame.
»Was erlauben Sie sich!«, protestiert diese, entreißt ihr die Tasche und presst sie an sich. Dann öffnet sie den Schnappverschluss und kramt in der Tasche.
Die Frau späht hinein.
»Gut«, sagt sie, als sie das rote Büchlein sieht. »Komm, wir gehen. Ich helfe dir«, fährt sie fort und fasst die alte Dame am Arm.
»Lassen Sie«, sagt die, schüttelt die Hand ab und steht auf. »Ich kann selber laufen.«
»Na dann, umso besser«, sagt die Frau, sieht den Mann wieder an und zuckt mit den Schultern.
Zu dritt gehen sie an der Rezeption vorbei hinaus. Die Frau in Weiß mit dem haubenartigen Kopftuch, die jetzt hinter der Rezeptionistin steht, nickt ihnen zu.
»Machen Sie’s gut«, flüstert sie. »Genießen Sie den Ausflug, Madame«, sagt sie zur alten Dame. »Aber nicht, dass Sie mir den Mantel draußen einfach wieder ausziehen, gell? Nicht wie neulich! Es weht ein garstiger Wind.«
Erster Teil
Letzter Sonntag im April. Tauwetter
Kauz stieg von seiner alten BMW und öffnete den Deckeldes Korbs, der auf dem Gepäckträger montiert war. Max sprang sofort heraus, als kenne er keine Altersgebresten.
Kauz schaute um sich. Merkwürdig, dachte er. Er war nun schon eine ganze Weile nicht mehr im Goms gewesen. In der Regel traf er seinen Speicher und das Dorf genauso an, wie er sie verlassen hatte, wenn er mal eine Weile weg war. Aber jetzt war alles anders. Eine seltsame Stimmung lag in der Luft.
»Komm«, sagte er. »Wir schauen uns um.«
Max bockte. Leise winselnd hockte er sich auf den Boden.
»Was ist? Hast du Angst?«, fragte Kauz.
Sein Hund zitterte am ganzen Leib.
»Komm schon. Dir passiert doch nichts«, sagte Kauz und nahm ihn an die Leine. Mit mulmigem Gefühl machte er sich zu einem Rundgang durchs Dorf auf. Er musste sich ganz neu orientieren. An der historischen Fassade stand nicht mehr Relais et Auberge du Sauvage, sondern Seniorenhaus und Residenz Primavera. Ein finster dreinblickender Türsteher stand vor dem Eingang mit der Glasschiebetür, einen Geißfuß in der Hand. Wozu braucht ein Türsteher ein Einbruchswerkzeug?, fragte sich Kauz. Max knurrte.
»Schnauze!«, knurrte der Mann zurück.
Max zog den Schwanz ein. Kauz hatte keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit dem ungehobelten Kerl.
»Komm, Max, wir gehen weiter«, meinte er.
Sie gingen an der Pfarrkirche vorbei.
Kauz blickte in die Höhe. Kampfschwalben segelten um den Kirchturm und flogen eine Attacke nach der andern. Wem sie galten, konnte Kauz nicht erkennen. An jeder Ecke der weiß getünchten Kirche und auch auf dem Friedhof waren seltsame Gestalten postiert. Sie trugen dunkle Kutten mit Kapuzen, sahen halb wie Mönche, halb wie vermummte Kämpfer aus. Was soll das?, dachte Kauz. Polizisten in Uniform ließen die Kirchgänger durch eine Metallschleuse passieren. Dahinter wurden die Menschen von weiteren Sicherheitsleuten gefilzt, ehe man sie in die Kirche einließ. Kauz hatte sich schon immer gewundert, dass man die Pfarrkirche von Münster mit ihrem kostbaren Flügelaltar jederzeit ungehindert betreten konnte. Aber wieso dieses Großaufgebot? Hatte die Polizei Hinweise auf einen bevorstehenden Kunstraub oder einen Anschlag erhalten?
Beklommen ging Kauz weiter. Dort, wo früher die Alpenrose ihre Stammgäste beherbergte und Passanten auf der kleinen Terrasse ihren Siedfleischsalat bei einer Stange Bier genossen, protzte ein Fünfsternehotel mit irisch-türkisch-römischem Bad und Wellnessoase mit Fernblick. Gommer Highland Resort stand an der Fassade. Um Gottes willen, dachte Kauz, als er sah, wie in Pelzmäntel gehüllte und mit Klunkern behängte Hotelgäste aus dem Hotel traten und in die auf sie wartenden Pferdekutschen stiegen. Hatte Anton Z’Blatten, der Gommer Napoleon, sein Projekt also doch noch durchgeboxt, einfach am anderen Ende des Dorfs? Wie konnte das alles nur an ihm, Kauz, vorbeigegangen sein?
Konsterniert setzte er seinen Rundgang fort.
Aus dem Dorfladen war ein riesiges Einkaufszentrum geworden. Mit Chinarestaurants, Turkish Barbershops, Nagelstudios und Designerläden. Die Furkastrasse war gesäumt von überdimensionierten Gebäuden in jenem Pseudochalet-stil, der in einigen Dörfern des Goms schon fast zum Ortsbild gehörte. Auch oben am Lawinenhang und unten zum Rotten hin standen gigantische Blöcke mit Ferienwohnungen und Luxusappartements.
Schlimm, dachte Kauz. Der Charakter des Dorfs ist hin. Jetzt sieht es hier fast schon aus wie in Crans-Montana.
Die einst gemütliche Schtazioo Münschter war kaum mehr zu sehen: Das alte Gebäude und der Bahnsteig standen unter einem massiven Betondach, getragen von hässlichen Metallpfeilern. Was hat das zu bedeuten?, fragte sich Kauz. Droht ein Bombenangriff? Ein schriller Pfiff ließ ihn herumfahren.
Seit wann hält der Glacier-Express in Münster?, stutzte er, denn eben fuhr der Zug mit den Panoramawagen ein und kam zum Stehen. Die Waggons strahlten in Eisblau und Pink, nicht mehr wie früher im heimatlichen Rot. Eine Woge asiatischer Passagiere ergoss sich auf den Bahnsteig.
Kauz hob den Blick – und erschrak.
Die Sesselbahn und die riesige Gondelbahn sah er zum ersten Mal. Wann waren die bloß gebaut worden?
Plötzlich kam ihm alles ganz unwirklich vor.
Was wurde da gespielt?
War er verrückt geworden? Litt er selber schon an Demenz? Oder an Amnesie? Hatte er einen Unfall gehabt und war im Koma gelegen? Sonst hätte er doch mitbekommen, was im Goms in letzter Zeit abging.
»Salü«, tönte es da hinter ihm.
Er fuhr herum. Wendelin Imfang sah ihn an.
»Wendel, du?!«, stammelte Kauz.
Fast hätte er Lebst du denn wieder? gefragt, aber ihm schwante, dass man das einen Untoten nicht fragen durfte.
»Fiiwoll«, sagte Wendel.
Mit ernstem Gesicht zeigte er zuerst aufs Dorf, dann talauf- und schließlich talabwärts. Mit Entsetzen sah Kauz die gigantische Brücke der neuen Umfahrungsstraße, die das einst intakte Hochtal entzweischnitt. Im Vergleich zu diesem Bauwerk waren die Hochspannungsleitungen, über die er sich lange Zeit fürchterlich aufgeregt hatte, geradezu filigrane Kunstwerke.
»Nummä wägäm Gääld«, sagte Wendel nachdenklich. »Nummä wägäm Gääld hend schi das alls gmacht. Äs ischt ä Schand!«
»Ja, es ist eine Schande«, gab Kauz ihm recht. »Das ist nicht mehr mein Goms. Ich glaube, ich muss da weg.«
»Das glöib i ö«, sagte Wendel.
Aber als Kauz ihm ins Gesicht sah, war es nicht mehr Wendel, der vor ihm stand, sondern ein junger Schnösel vom Typus eines HSG-Absolventen mit properem Haarschnitt, in Anzug und Krawatte, eine Mistgabel in der Hand.
»Mir solls recht sein«, sagte der süffisant. »Wir haben nichts dagegen, wenn ihr wieder geht. Von euch Üsserschwiizer haben wir die Nase voll. Von eurer Besserwisserei, eurem Biofimmel, eurem Pestizidverbot, eurem Wasser-, Landschafts- und Wolfsschutz. Von euren verdammten Zweitwohnungs- und Zersiedelungsinitiativen. Wir haben genug von all dem Zeug, mit dem ihr uns Berglern das Leben schwer macht. Von euren ätzenden Reklamationen, wenn mal ein Einheimischer mit seinem Suzuki über einen Wanderweg prescht. Wieso soll der auf euch Rücksicht nehmen? Ihr nehmt ja auch keine auf uns. Die Tempobegrenzungen und Fahrverbote haben wir für euch aufgestellt, damit das klar ist. Nicht für uns Gommer. Wir brauchen keine Verbote. Also lasst uns mit euren Reklamationen in Ruhe und höwwät ab.«
Arschloch, dachte Kauz.
»Was hast du gesagt?«, fragte eine Stimme.
Kauz fuhr abermals herum. Vor ihm stand der Türsteher, den er gerade noch vor der Residenz Primavera gesehen hatte. Aber der sah plötzlich aus wie der Güggäl.
»Nichts«, sagte Kauz.
»Aber gedacht. Arschloch hast du gedacht«, sagte der Güggälmann drohend. Anstelle des Brecheisens hatte er eine Pistole in der Hand. Lässig ließ er den Arm baumeln, dann hob er ihn und richtete die Waffe auf Kauz. Den packte eine heillose Angst. Er wollte sich verdrücken, aber er konnte sich nicht rühren. Da hatte er den Impuls, niederzuknien und um Gnade zu flehen. Ich habe ein Kind, ein Enkelkind!, war er drauf und dran zu wimmern. Nein, das tust du nicht!, dachte er im nächsten Augenblick. Denn ihm fiel ein, dass er ja Polizist war. Er griff in sein Holster. Doch da war keine Waffe. Mit leeren Händen stand er vor dem Bösewicht.
»Halt, Polizei!«, schrie er. »Hände hoch! Waffe nieder, oder ich schieße«, und hob den unbewaffneten Arm.
Max bellte wie verrückt.
Der Mann sah Kauz eiskalt an, schwenkte langsam seine Pistole und zielte auf Max.
»Zuerst der Köter, dann du«, sagte er.
»Nein!«, schrie Kauz.
Der Mann drückte ab.
Jäh schoss Kauz in die Höhe, schnappte nach Luft und griff sich an den Hals. Dann tastete er nach dem Wecker, der sofort aufleuchtete: Viertel nach sieben. Uff!, dachte er, schon wieder! Solche Albträume häuften sich in der letzten Zeit.
Er schob das rot-weiß karierte Federbett ans Fußende, schlug das grobe Leintuch zurück, stieg aus dem Bett, stieß das Fenster seiner Schlafkammer auf und holte tief Luft.
Das Weisshorn, im Dämmerlicht erst schwach zu sehen, stand noch dort, wo es immer gestanden hatte. Die Feldkapelle auch. Der erste Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn kam von Reckingen her angerollt. Ganz in Rot. Die Wagenfenster leuchteten heimelig. Wahrscheinlich sitzt kein Mensch da drin, dachte Kauz. Aber was solls? Service public. Die Welt ist jedenfalls noch in Ordnung. Er zog das Fenster zu und tätschelte Max, der sich aus seinem Korb herausmühte, den Kopf.
»Dich gibts auch noch, Gott sei Dank«, sagte er und atmete auf. »Komm!«, forderte er seinen Hund auf, schlüpfte in die Stiefel, griff nach seinen Kleidern und ging durch den Vorraum zur Außentreppe, die an der dunklen Lärchenholzwand nach unten führte. Der Unterbau seines mehr als dreihundert Jahre alten Speichers bestand aus einem einzigen Raum. Er feuerte den schwedischen Stahlholzofen an, den er sich geleistet hatte, als er den Speicher hatte erwerben können, füllte Max’ Futter- und den Wassernapf, nahm den Durchlauferhitzer in Betrieb und duschte in der kleinen Kabine, die er sich vor Jahren in der Ecke neben dem Schüttstein hatte einbauen lassen. Dann zog er sich an, setzte sich an den Holztisch, schnitt drei Scheiben Brot und ein Stück Käse ab, schmierte Butter auf die Brote, aß das erste mit Käse, das zweite mit selbst gemachter Holunderkonfitüre, das letzte mit Honig. Dazu schlürfte er seinen Kaffee, den er sich im italienischen Espressokocher auf der Kochplatte des Stahlofens gebraut hatte. Er schaute zum Fenster hinaus in die wenig einladende Landschaft.
Die Kirchenglocken läuteten.
Auch wenn er kein Kirchgänger war, er liebte das Glockengeläut. Hatte es schon immer geliebt, seit Kindsbeinen. Leute, die sich daran störten, konnte er nicht verstehen. Genauso wenig wie die, die sich über Kuhglocken aufregten.
Soll ich?, fragte er sich.
Ein wenig schreckte ihn sein Albtraum davon ab, den Weg zur Kirche unter die Füße zu nehmen. Aber er wusste ja, woher das dumme Zeug, das er geträumt hatte, stammte. Und nach jener Begegnung auf dem Dorfplatz – es war wenige Wochen her – hatte er sich vorgenommen, wenigstens einmal den Gottesdienst in der Pfarrkirche Münster zu besuchen. Mehr noch: Er hatte es versprochen.
Fünfeinhalb Wochen zuvor: 21. März
»Güetän Abend«, hatte der adrett gekleidete Herr gesagt,als sie sich unweit der Margarethenkapelle über den Weg liefen. Er trug einen sportlichen Daunenmantel und einen eleganten Filzhut. Dass er kein Walliser und erst recht kein Gommer war, wäre auch jedem Kind sofort klar gewesen.
Der Gruß überraschte Kauz, denn jeder Auswärtige, erst recht jeder Ausländer, hätte um diese Tageszeit Guten Tag, Hello oder Bonjour gesagt. Nur die Einheimischen wussten, dass man hier Güetän Abend sagte, wenn zwölf Uhr mittags einmal vorbei war. Es war aber schon kurz vor zwei gewesen.
»Sie reden ja wie ein Gommer«, sagte Kauz, blieb stehen und sah den Mann lachend an.
»Danke. Ich gebe mir Mühe«, lachte dieser zurück. Weiße Zähne strahlten aus dem runden, tiefschwarzen Gesicht mit der feinen Drahtbrille. Ein silberner Eckzahn blitzte.
»Machen Sie Winterferien?«, fragte Kauz.
»Nein, Hausbesuche.«
Kauz wurde neugierig.
»Dann sind Sie der neue Dorfarzt?«
Es hieß, der alte Doktor Kalbermatten habe endlich einen Arzt gefunden, den er zu seinem Nachfolger aufbaue. Dass es ein Ausländer sein würde, hatte man allgemein angenommen, denn welcher Schweizer Jungarzt würde sich schon im Goms niederlassen wollen? Aber einen Schwarzen hätte Kauz nicht erwartet.
»Nicht ganz«, sagte der Mann. »Der neue Dorfpfarrer. Das heißt, so neu auch wieder nicht. Ich bin schon ein Dreivierteljahr im Amt. Pfarrer Mbembe«, stellte er sich vor.
»Walpen«, sagte Kauz.
»Sie sind nicht katholisch, hab ich recht?«, rief der schwarze Geistliche und lachte laut heraus. »Und auch kein Einheimischer. Auch wenn Sie einen Gommer Namen tragen.«
Kauz staunte. »Das stimmt«, sagte er. »Jedenfalls nur ein halber Gommer. Aber woher wissen Sie das?« Kauz schwankte, ob er bei einem Ortsansässigen nicht vom Sie aufs Ihr wechseln sollte. Aber da sein Gegenüber ihn siezte, siezte er ihn auch.
Früher konnte Kauz davon ausgehen, dass Leute, die er gar nicht kannte, wussten, wer er war. Doch in letzter Zeit war es ruhig geworden um ihn. Es waren im Goms keine Gewaltverbrechen mehr passiert, und auch die Kleinaufträge waren allmählich ausgeblieben. Es störte ihn nicht, dass man nicht mehr in erster Linie den ehemaligen Polizisten in ihm sah. Sondern einfach den Kauz mit dem Hund.
»Weil alle Gommer in der letzten Zeit mindestens einmal zur Messe in die Pfarrkirche kamen«, erklärte der Pfarrer. »Aus reiner Neugier, wissen Sie. Sie wollten den Neuen aus Afrika mit eigenen Augen sehen. Aber an Sie kann ich mich nicht erinnern.«
»Ich war auch gar nie in der Kirche«, gestand Kauz. »Sie haben recht, ich bin nicht katholisch. Oder höchstens ein bisschen«, und schob nach: »Sie sprechen aber erstaunlich gut Deutsch.«
»Ich war Vikar und später Pfarrer in Salgesch. Dann sieben Jahre in Naters. Und Deutsch lernte ich schon in der Schule.«
»Wirklich? Na, dann verstehe ich …«
»Sie heißen Walpen. Aber man nennt Sie Kauz, nicht wahr?«
»Ja, doch wieso wissen Sie auch das noch?«
»Ihr Hund«, sagte Pfarrer Mbembe und zeigte auf Max, »und Ihre Augen«, er schaute ihm ins Gesicht.
»Nun ja«, schmunzelte Kauz, »die sind mein Erkennungsmerkmal.«
Schon bei den Pfadfindern hatte man ihn Kauz genannt. Er sehe aus wie eine Eule, hatte es geheißen. Er litt an einer angeborenen Schwäche der Lider, weshalb er die Augen nicht ganz öffnen konnte. Das verlieh ihm einen verschlafenen Gesichtsausdruck, selbst wenn er hellwach war.
»Mich erkennt man am schwarzen Grind«, sagte Pfarrer Mbembe trocken, »und Sie am schwarzen Hund. Und an Ihren Augen.« Er lachte wieder. Dann tätschelte er Max den Kopf. Der ließ es sich gefallen. »Max heißt er, nicht wahr?«
»Oh, auch das wissen Sie?«, staunte Kauz. Jetzt hatte er den Mann schon fast ins Herz geschlossen. Ohne es sich lange zu überlegen, fragte er: »Haben Sie’s eilig? Oder haben Sie Zeit für einen Kaffee?«
Außer mit Max hatte er schon eine ganze Weile mit niemandem mehr gesprochen. Warum nicht ein bisschen doorffä und vielleicht eine neue Bekanntschaft machen?, dachte er.
Der schwarze Pfarrer sah ihn verdutzt an, dann schaute er auf die Uhr. Kauz war plötzlich unsicher, ob man den Dorfpfarrer überhaupt auf einen Kaffee in die Beiz einladen durfte.
»Wieso nicht?«, meinte Mbembe. Er blickte um sich. Aber es war sonst niemand auf dem Dorfplatz. »Eine halbe Stunde, ja? In der Alpenrose?«
»Einverstanden.«
Sie machten kehrt, gingen durchs Hinterdorf Richtung Kirche hoch, dann ein Stück auf der Furkastrasse und nahmen schließlich den Fußweg zu Kauz’ Lieblingsbeiz. Es waren keine anderen Gäste dort. Touristen gab es in dieser Jahreszeit im Goms nur noch wenige. Pfarrer Mbembe nahm den Hut vom Kopf und setzte sich. Als die dampfenden Tassen vor ihnen standen und Max sich unter den Tisch verkrochen hatte, packte der Pfarrer die Gelegenheit beim Schopf.
»Ich hatte ohnehin vor, mit Ihnen zu reden, Herr Walpen.«
»Kauz«, sagte Kauz.
Das war ein Reflex. Es war ihm zur Gewohnheit geworden, einem, mit dem er sich zusammensetzte, bei der erstbesten Gelegenheit das Du anzubieten, indem er seinen Spitznamen nannte.
»Ich weiß, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleibe ich bei Walpen. Ist ja ein urchiger Gommer Name.«
»Auch gut«, erwiderte Kauz. Ihm war sein Vorpreschen nun etwas peinlich. »Ich meinte auch gar nicht, dass wir …«
»Ich hatte auch einen Spitznamen«, unterbrach Pfarrer Mbembe. »Mich nannten sie Duma.«
»Duma? Was heißt das?«
»Gepard. Auf Suaheli.«
Die Gaststube war gut geheizt. Pfarrer Mbembe stand noch einmal auf, schlüpfte aus seinem Mantel und legte ihn auf der Bank neben seinem Hut ab. Darunter trug er einen dunkelgrauen Pullover mit V-Ausschnitt über einem weißen T-Shirt. Kauz musterte den nicht sehr groß gewachsenen Mann mit den athletischen Schultern und dem schön geformten Kopf.
Gepard? Das passt, dachte er. Vermutlich hatte er früher eine drahtige Figur. Seine Bewegungen wirkten immer noch geschmeidig, aber es kam Kauz vor, als bemühe er sich um Gemessenheit. Der Pfarrer setzte sich wieder und nahm die Brille ab.
Die Hand am Kinn, fragte Kauz: »Und was hätten Sie zu besprechen gehabt, Herr Pfarrer?«
»Man hat mir gesagt, dass Sie früher Polizist waren. Und jetzt ein Detektiv.«
»Ja, das stimmt. Also?«
»Es geht um die alte Dame, die ich gleich besuchen werde. Sie hat mir seltsame Dinge erzählt.«
»Ach ja? Was für Dinge?«
»Sie wohnt in der Residenz Primavera, müssen Sie wissen.«
»Aha. Und?«
»Sie habe Angst, sagt sie. Angst, man wolle sie für immer dortbehalten. Sie sei in einem goldenen Käfig eingesperrt und wisse nicht, ob sie je wieder herauskomme.«
»Hmm.«
»Auch sagt sie, sie fühle sich in dem Haus nicht sicher.«
»Oh? Wieso denn?«
»Das kann sie nicht begründen. Es sei ihr einfach unheimlich. Vor allem, seit man diese Tote gefunden habe.«
»Die Tote vom Minschtigertal?«
»Ja, die. Sie wissen natürlich davon.«
»Nun ja, aber nichts Genaues«, wich Kauz aus.
Als vor zwei Wochen das Tauwetter einsetzte, hatten Schneeschuhwanderer am Rande des Minschtigertals unterhalb der Antoniuskapelle einen makabren Fund gemacht: Sie sahen einen Handschuh im Schnee, und als sie mit ihren Stöcken an der Stelle ein wenig herumstocherten, war ein Arm zum Vorschein gekommen. Dann eine Handtasche, ein Stück der Schulter, ein Mantelkragen, ein Schal.
Die Wanderer schlugen Alarm.
Polizei und Rechtsmediziner stellten fest, dass die Leiche längere Zeit unter den Schneemassen gelegen haben musste. Rasch wurde klar, dass es sich um eine Bewohnerin der Residenz Primavera handelte, die seit dem letzten Dezember vermisst wurde. Eine demente alte Dame aus dem Kanton Bern, die ausgebüxt war und sich draußen wohl verirrt hatte. Und dann von einem Schneebrett begraben wurde, das sich am Antoniushügel gelöst hatte. Sie konnte leicht identifiziert werden, weil ihr Pass in der Handtasche steckte.
Das wenige, das er wusste, hatte Kauz von seiner Freundin Ria Ritz erfahren. Ria Ritz, Postenchef der Kantonspolizei Goms in Fiesch, hatte schon die erfolglose Suche nach der Vermissten geleitet. Als man kürzlich die Leiche fand, rollte sie den Fall wieder auf. Die Staatsanwaltschaft Oberwallis leitete jedoch keine Untersuchung ein. Ein Unfall, hieß es, keine Dritteinwirkung.
Kauz war schon vor Jahren ein Freund der Familie Abgottspon-Ritz geworden, er wurde alle paar Wochen zum Nachtessen in Fiesch eingeladen. Da plauderte Ria ihrem ehemaligen Polizeikollegen gegenüber jeweils ein bisschen aus der Schule, obschon sie das eigentlich nicht durfte.
»Der Fall der Vermissten gab in der Weihnachtszeit natürlich viel Gesprächsstoff«, erklärte Pfarrer Mbembe. »Jetzt, wo man sie gefunden hat, reden die alten Leute erst recht von nichts anderem mehr.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Kauz.
»Die, die noch reden können, meine ich.«
Kauz nickte. Er wusste, dass es in der ehemaligen Auberge neben dem renovierten Trakt mit den Studios und Appartements und dem Neubau mit Luxussuiten auch einen Seitenflügel mit Betten für pflegebedürftige Alte und Demenzkranke gab.
»Die Frau, von der ich eben sprach, hat mich angefleht, ihr zu helfen. Sie wolle nach Hause«, nahm Pfarrer Mbembe den Faden wieder auf.
»Wieso Sie? Hat sie keine Angehörigen?«
»Sie sagt Nein.«
»Und? Hat sie ein Zuhause, in das sie zurückkönnte?«
»Sie besitze ein eigenes Haus, sagt sie. Eine große alte Villa mit Park am Vierwaldstättersee. Den Garten vermisse sie im Frühling ganz besonders. Man wolle sie aber nicht gehen lassen.«
»Wer wolle sie nicht gehen lassen?«
»Die Direktion des Hauses, sagt sie.«
»Seltsam«, Kauz fasste sich ans Kinn. »Oder ist sie nicht mehr ganz … Ist sie senil? Dement, meine ich.«
»Kann schon sein«, sagte der Pfarrer. »Da bin ich kein Experte. Manchmal ist sie ganz klar im Kopf, aber an anderen Tagen scheint sie mir ziemlich durcheinander zu sein.«
»Hat sie einen Beistand?«
»Erwähnt hat sie keinen.«
»Nun«, meinte Kauz, »was ist denn Ihr Anliegen?«
Kauz blickte in das Gesicht des schwarzen Pfarrers. Ein offenes, bubenhaftes Gesicht, trotz Amt und Würde. Und trotz bestem Mannesalter, Kauz schätzte den Mann auf höchstens fünfzig. Hinter den Brillengläsern freundliche, aufmerksame Augen. Das Kopfhaar bis auf wenige Millimeter getrimmt, der Mann schor seinen kugelrunden Schädel wohl regelmäßig kahl. Seine Stimme war sanft und passte zu seinem weichen Namen: Mbembe. Etwas lauter klang sie nur, wenn er aus vollem Hals lachte, und das tat er gern.
In diesem Augenblick betraten zwei Männer die Gaststube, Arbeiter von einer nahen Baustelle.
»-tän Abend«, sagten sie, setzten sich an den Nebentisch und riefen nach einer Schtangä. Die Biergläser vor sich, äugten sie zu Kauz und dem Pfarrer hinüber.
»Wissen Sie was, Herr Walpen?«, sagte der Pfarrer, der die Blicke aufgefangen hatte, und schaute auf die Uhr, »ich glaube, ich sollte mich auf den Weg machen. Wir reden bei anderer Gelegenheit weiter.«
»Gut. Ich begleite Sie ein paar Schritte, muss ja in dieselbe Richtung.«
Sie gingen durchs Oberdorf, statt den direkten Weg zu nehmen. Die Furkastrasse war derzeit kein einladender Spazierweg. Als sie ein Stück weit gegangen waren, blieb Pfarrer Mbembe neben einer Bank am Wegrand stehen.
»Setzen wir uns noch einmal?«, schlug er vor. »Gleich drückt die Sonne durch.«
Der Himmel riss auf, die Wolken verzogen sich. Pünktlich zum ersten Frühlingstag war die Temperatur erneut angestiegen, die Sonne schien warm auf die beiden Spaziergänger herab. Sie setzten sich auf die Bank mit Blick auf die Dächer von Münster, auf die Pfarrkirche und ins Tal hinunter. Pfarrer Mbembe knöpfte seinen Mantel auf, nahm den Hut vom Kopf und legte ihn neben sich auf die Sitzfläche. Er zeigte auf die Pfarrkirche und sagte: »Es ist eine Ehre, hier wirken zu dürfen. Wenn man nur schon an die Geschichte dieser Kirche denkt. Und an den Altar. Den kennen Sie, oder?«
»Ja, sicher. Mein Glückwunsch«, sagte Kauz.
»Das ist kein Verdienst, es ist ein Geschenk«, erwiderte Mbembe. »Aber auch eine Verpflichtung«, fügte er an. Er wandte sich Kauz zu: »Sie sind ein halber Gommer, sagten Sie, aber nur ein bisschen katholisch. Wie soll ich das verstehen?«
Kauz befand sich gerade in Laune, zu reden. Oft kam das nicht vor, und in der Regel brauchte es einiges, bis er etwas von sich preisgab. Aber aus irgendeinem Grund fiel ihm das heute leicht. Obschon er, Kauz, mit Pfarrherren sonst nicht viel am Hut hatte.
Es dauerte nicht lange und Pfarrer Mbembe hatte erfahren, dass Kauz der Sohn eines in die Üsserschwiiz abgewanderten Gommers und einer Zürcherin war. Dass er seinen Taufnamen Alois nicht ausstehen konnte und deshalb Kauz genannt werden wollte. Dass er kein Kirchgänger war, aber das Glockengeläut liebte und auf Wanderungen in jeder Kapelle, an der er vorbeikam, eine Kerze anzündete. Dass es hier im Goms Alte gab, die es seinem längst verstorbenen Vater heute noch übel nahmen, dass er dem Goms untreu geworden war und eine Üsserschwiizeri geheiratet hatte. Und erst noch eine Reformierte, die die zwei Kinder protestantisch erzog.
»Jaja«, meinte der Pfarrer, »ich kann mir schon vorstellen, dass so etwas den frommen alten Gommern sauer aufstößt. Haben Sie Familie?«
Er sei geschieden und habe einen Sohn. Der habe eine schwere Zeit hinter sich – Drogenprobleme, deutete Kauz an –, aber er habe sich gefangen und sei sogar selber Vater. Seraina heiße die Kleine.
»Oh, là, là, Sie sind Großvater? Und jetzt sind Sie also zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt? Halb Üsserschwiizer, halb Gommer. Und ein Tschugger.« Der schwarze geistliche Herr schien eine Vorliebe für saftige Wallissertitschi Weerter zu haben. »Gefiel Ihnen Ihr Beruf denn nicht mehr?«
Nun lag es auf der Hand, dass Kauz ihm auch von seiner unehrenhaften Entlassung als Chef der Abteilung Leib und Leben durch die Kommandantin der Zürcher Kantonspolizei erzählte, vom kurzen Gastspiel bei der Walliser Kantonspolizei, von seiner Rehabilitation und Wiederanstellung bei der Zürcher Kapo und der vorzeitigen Pensionierung bald darauf. Dass er seither als Ex-Polizist an der Lösung von mehreren schweren Kriminalfällen im Goms beteiligt gewesen war, davon sagte er nichts.
»Sie sind bestimmt ein weit gereister Mann«, meinte der Pfarrer unvermittelt, als Kauz mit seinem Rückblick fertig war. »Ihr Schweizer reist doch gern und viel.«
»Ich nicht«, antwortete Kauz. »Ich wüsste nicht, wozu und wohin. Mir gefällts hier.«
»Dann waren Sie also noch nie in Afrika?«, vergewisserte sich der schwarze Mann.
»Leider nein«, erwiderte Kauz.
Das leider war geflunkert, denn Kauz hatte nie die geringste Lust verspürt, dorthin zu reisen. Die beruflichen Berührungspunkte mit Afrika, oder besser gesagt mit Afrikanern, die es gegeben hatte, als er noch Chefermittler bei der Zürcher Kripo war, hatten ihn abgeschreckt. Drogendealer aus Nigeria, Zuhälter und Prostituierte aus Senegal, Stricher und Taschendiebe aus Tunesien, Messerstecher aus Marokko und Eritrea, Hochstapler aus Südafrika, Heiratsschwindler aus Ägypten. Nein, er hatte keinen Bock auf Afrika.
Aus mir hätte leicht ein Rassist werden können, dachte er. Oder bin ich vielleicht längst einer?, fragte er sich, neben dem schwarzen Pfarrer sitzend und ins Tal schauend.
Der Winter hatte sich in diesem Jahr ungewöhnlich früh verabschiedet. Der Anblick der schon stellenweise schneefreien Hänge auf der Sonnenseite des Tals und der löchrigen Loipe im Talgrund war keine Augenweide. Die Straßen und viele der Fußwege waren schneefrei, braun und schmutzig. Der Schnee auf den Häusern lag zwar noch ellenhoch, aber die üppige weiche weiße Decke auf den Dächern war inzwischen zusammengeschrumpft. Die Fichten und Lärchen standen öd und grau an den Bergflanken. Vereinzelt konnte man noch ein paar hartgesottene Langläufer sehen, die sich ihren Weg auf der weißen Spur bahnten, die jetzt an braun-weiß gescheckten Feldern vorbeiführte. Sinnlos standen die rosafarbenen Wegweiser für die Winterwanderer in der Gegend. Nein, keine Augenweide, dachte Kauz. Aber so ist das Goms eben im Frühling.
»Schön, nicht wahr?«, bemerkte der Pfarrer.
»Was?«, fragte Kauz abwesend.
»Die Sonne.«
»Ach so, ja.« Aber wir hatten ja eigentlich von Afrika gesprochen, dachte er.
Mit einigen der afrikanischen Straftäter hatte er bis zu einem gewissen Grad sympathisiert. Manchmal konnte er Verständnis dafür aufbringen, dass sie auf die schiefe Bahn geraten waren. Nur mit den Mädchenhändlern und den Drogendealern kannte er kein Mitleid.
Aber eigentlich war es Chantal, die ihm Afrika so richtig vergällt hatte. Sie war ganz verrückt gewesen nach Viersterne-Hotelarrangements in aller Welt. In die Türkei hatte er sie noch zu einem Badeurlaub in Antalya begleitet, aber die All-inclusive-Völlerei an den Büfetts und Bars, das Treiben an den Pools, am Strand und in den Wellnesseinrichtungen war ihm zuwider gewesen. Als sie ihm daraufhin mit Ägypten und der Dominikanischen Republik kam, hatte er ihr einen Korb gegeben. Dann hatte sie noch einen letzten Versuch mit einem in ihren Augen besonders attraktiven Angebot gemacht: »Sieh mal, Ostafrika. Kommst du mit?« »Kaum«, war seine Antwort gewesen. »Badeurlaub mit Tauchkurs in Mombasa, Landrover-Safari in Tansania«, hatte sie nachgedoppelt und den Hochglanzprospekt aufgeschlagen. »Hier, sieh mal: eine Woche Viersternehotel am Indischen Ozean, all inclusive. Dann sechs Nächte im Luxus-Zeltcamp in der Serengeti mit persönlichem Butler«, sie zeigte auf den Schwarzen Beau im Safari-Outfit. »Wär das nicht was?« »Auf keinen Fall. Das ist nichts für mich.« »Spielverderber! Dann reise ich halt allein!«, hatte sie gerufen und den Reisekatalog auf den Salontisch geklatscht. »Tu, was du nicht lassen kannst«, hatte er geblafft. Ihre Ehe war damals schon auf der Kippe gewesen, ihr Liebesleben längst erloschen. Als Chantal von ihrer Solo-Reise zurückkam, deutete sie an, sie habe in Kenia einen Einheimischen aufgegabelt. Einen Massai. Das seien noch Männer! Sie konnte es nicht lassen, auf die herausragenden Merkmale dieser Hirten und Krieger mit ihren langen Speeren anzuspielen. Auf ihre Anzüglichkeiten hatte er eine nicht besonders liebevolle Bemerkung fallen lassen. Was folgte, war eine unwürdige Auseinandersetzung, in der sie sich gegenseitig des Rassismus und Sexismus bezichtigten. »Du bist doch nur neidisch!«, hatte sie ihm zu guter Letzt an den Kopf geworfen.
Kauz wusste selbst am besten, dass seine Reaktion kindisch war, aber nach jenem wüsten Disput hatte er beschlossen, Afrika sei für ihn abgetan. Und jegliches Liebesleben noch dazu, ein für alle Mal. Abgesehen von zwei, drei missratenen Affären führte er seither ein Mönchsleben.
Wie der Pfarrer neben mir?, fragte sich Kauz. Er drehte den Kopf und sah Mbembe von der Seite an. Ob sich dieser blendend aussehende Schwarze wirklich an den Zölibat hielt? Ganz anders als die afrikanischen Ganoven weckte Mbembe bei ihm Interesse. Mehr noch, er empfand den Wunsch, den Mann näher kennenzulernen. Nun konnte er nicht mehr anders, er musste dem Pfarrer aus Afrika die Frage stellen, die ihm wohl schon tausendmal gestellt worden war.
»Wie hat es Sie denn in die Schweiz verschlagen?«
»Es hat mich nicht verschlagen«, antwortete Pfarrer Mbembe. »Es war immer mein Wunsch gewesen. Walliser Kapuziner haben dafür gesorgt, dass er in Erfüllung ging.«
»Wirklich? Wie kam das?«
Einen besonders redseligen Eindruck hatte Pfarrer Mbembe nicht gemacht, als sie in der Alpenrose saßen. Aber jetzt – vielleicht weil Kauz gerade so offenherzig aus seinem Leben berichtet hatte – brauchte Kauz nur diese eine Frage zu stellen, und schon erzählte der Priester aus Afrika seine Lebensgeschichte.
Pfarrer Mbembe
Emmanuel Zende Mbembe stammte aus Tansania. Er warim Örtchen Ifakara zur Welt gekommen und zur Schule gegangen. Dort, im Innern des ostafrikanischen Landes, hatten Schweizer Kapuziner zusammen mit Baldegger Schwestern vor hundert Jahren eine Missionsstation und ein Lepradorf aufgebaut. Aus einer Geburtsstation entwickelte sich über die Jahrzehnte ein Tropenspital, das Saint Francis Hospital, das weitherum den allerbesten Ruf genoss. Zur Mission gehörte außerdem eine von Kapuzinern und Baldegger Schwestern geführte Schule. Und Lehrwerkstätten, in denen junge Einheimische ausgebildet wurden. Kapuziner aus dem Wallis und aus der Innerschweiz brachten den einheimischen Schulabgängern solides Handwerk bei und machten sie zu Schreinern und Schlossern, Maurern und Gärtnern. Baldegger Schwestern bildeten die Mädchen zu Köchinnen und Näherinnen, zu Pflegerinnen und Hebammen aus.
Der kleine Emmanuel stand ganz im Bann der Kirche von Ifakara. Nur schon das von Bougainvillea umrankte Kirchenportal war ihm ein zauberhafter Blickfang. Der Glockenturm und das sonntägliche Geläut zogen ihn magisch an. Und erst das geheimnisvolle Treiben im Innern: die Gesänge, das Orgelspiel, der Weihrauch, die Gewänder, das Gold und der Prunk, die feierliche und trotzdem heitere Stimmung der Menschen, die Tänze, die Gebete, die Person und die Autorität des Priesters.
Dass der Kapuziner Pater Pirmin ein passionierter Fußballer war und in seiner braunen Kutte, das weiße Zingulum umgebunden, die Junioren von Ifakara trainierte, trug erst recht dazu bei, dass Emmanuel sich den Kirchenmännern und der Kirche verbunden fühlte. Man musste ihn nicht zweimal fragen, ob er Ministrant werden wolle. Mit Inbrunst widmete sich der Neunjährige dieser Aufgabe. Bald stand für ihn fest, dass er selber Priester werden wollte. Der junge Emmanuel wurde von den Kapuziner Patres und Fratres nach Kräften gefördert. Ganz besonders setzte sich Pater Pirmin für ihn ein. Der riet Emmanuels Eltern, den Knaben auf das Kasita Seminary im benachbarten Distrikt Mahenge und später auf ein Priesterseminar in Mwanza am Viktoriasee zu schicken. Auf seinem ganzen Lebens- und Bildungsweg wurde Emmanuel – zuerst aus der Nähe, später aus der Ferne – von Schweizer Missionaren begleitet und gefördert und hatte sich deshalb schon immer gewünscht, einmal die Schweiz kennenzulernen. Sein Weg führte den jungen Mann und angehenden Geistlichen erst nach Daressalam und dann an die Elfenbeinküste, wo er Französisch lernte, schließlich nach Rom. Dort studierte er weiter und wurde zum Priester geweiht. In der Petersstadt wurde er, wiederum von Walliser Kapuzinern, für ein Vikariat im Mittelwallis angeworben. Denn dort herrschte akuter Priestermangel. Ein paar Jahre vikarisierte er im Mittel- und Unterwallis, fünf Jahre war er Pfarrer in Salgesch, anschließend sieben weitere Jahre in Naters, ehe er ins Goms versetzt wurde.
Pfarrer Mbembe lernte Wallissertitsch – nur das bei den Wallisern beliebte Hüerägüet kam ihm nicht mehr über die Lippen, nachdem er einmal verstanden hatte, was es wörtlich bedeutete –, freundete sich mit den Gepflogenheiten der Schweizer, namentlich der Walliser an, auch mit Fondue, Raclette und Choleri, mit Fendant und Cornalin. Er studierte Schweizer Geografie und Geschichte und die Besonderheiten der direkten Demokratie. Des Gommers Lieblingsbeschäftigung, das Doorffä, war nicht so seine Sache, obschon auch in Tansania eifrig getratscht und geklatscht wurde. Je kleiner das Dorf, desto eifriger. Aber wie schon dort beteiligte er sich auch im Wallis kaum daran. Er hörte indes allen aufmerksam zu.
Im Winter übte er sich im Skifahren und Langlaufen, und nach ein paar Jahren war er schon ein ganz passabler Wintersportler. Manch einer blieb stehen und drehte sich nach dem Schwarzen um, wenn er im hellen Dress in seinem katzenartigen Laufstil über die Gommer Loipen glitt. Im Sommer stieg er auf sein Mountainbike und fuhr, allein oder mit ein paar sportlichen Burschen und Mädchen aus seiner Pfarrei, die Seitentäler hoch und über Stock und Stein wieder hinunter.
Als Kind fiel Emmanuel durch seinen Bewegungsdrang auf. Er entpuppte sich als talentierter Läufer und wurde ein begeisterter Fußballer. Als Theologiestudent in Daressalam entdeckte Mbembe einen Sport, in dem er sich austoben konnte und gleichzeitig sich zu disziplinieren lernte: Judo. Die sanfte Kampfkunst, so die Bedeutung des Wortes, entsprach ganz dem Wesen des angehenden Geistlichen. Er erkämpfte sich den schwarzen Gurt und brillierte an der Judomeisterschaft von Tansania. In Rom bildete er sich Jahre später, noch vor seiner Priesterweihe, zum Judotrainer weiter. In Naters trat er dem lokalen Judoclub bei und übernahm dort als Freiwilliger das Training der Kinder und Jugendlichen. In Zeitungen und Illustrierten erschienen Artikel über den »Judoka Gottes« aus Afrika. Wenn es Reportagen über Pfarrer Mbembe gab, so wurde er ebenso oft im Judodress abgebildet wie im Priesterornat. Bald hatte er im Kanton Wallis und darüber hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad. Als er ins Goms versetzt wurde, war es ihm ein Anliegen, auch die Gommer Jugend für diesen Sport zu begeistern. Er war erst wenige Monate im Amt, aber seine wöchentlichen Judokurse für Kinder und Jugendliche fanden schnell regen Zuspruch. Vielerorts lag es mittlerweile im Trend, sich in einem Kampf- und Selbstverteidigungssport zu üben. Da wollten die Gommer nicht hintanstehen.
»Soso«, sagte Kauz, »Sie locken die Gommer Burschen also mit Judo in die Kirche?«
»Nein. Ich locke niemanden in die Kirche«, erwiderte der Pfarrer. »Entweder sie kommen von sich aus, oder sie kommen nicht. Die Kirche ist dort, wo die Menschen sind, sage ich immer. Nicht umgekehrt. Also gehe ich zu ihnen. Man muss die Jungen dort aufsuchen, wo sie sind. Wo ihre Interessen liegen. Aber nicht nur die Botschä, auch die Meggä.«
»Wieso spielen Sie denn nicht Fußball mit ihnen? Das wäre doch viel populärer.«
»Das schon«, gab der Pfarrer ihm recht. »Früher war ich ja auch ein begeisterter Tschuttär. Aber im Land von Sepp Blatter warten sie nicht auf einen Fußballtrainer aus Tansania.« Er zeigte auf den noch mit Schneematsch bedeckten Fußballplatz in der Ferne. »Abgesehen davon kann man Judo das ganze Jahr über trainieren, nicht nur im Sommer.«
»Auch die Mädchen, sagen Sie?«
»Und wie! Die sind genauso talentiert wie die Knaben.«
»Aber die Eltern? Haben die keine Vorbehalte?«
Pfarrer Mbembe wandte brüsk den Kopf. Für einen Augenblick verfinsterte sich sein Gesicht.
»Was für Vorbehalte?«, fragte er zurück.
Eigentlich hatte Kauz nur wissen wollen, ob die Eltern damit einverstanden waren, dass nicht nur die Knaben, sondern auch die Mädchen am Training teilnahmen. Aber ihm wurde schlagartig klar, dass Pfarrer Mbembe aus der Frage etwas anderes herausgehört hatte.
»Meinen Sie dem Schwarzen Mann gegenüber?«, fragte der Pfarrer schon weiter. »Oder ob sie Angst vor Übergriffen auf ihre Kinder haben?«, fast so, als habe Kauz selbst diesen Verdacht geäußert.
»Weder noch«, versicherte Kauz.
Er erklärte, woran er gedacht hatte.
»Ach so«, meinte der Pfarrer und entspannte sich wieder. »Es gibt unter den Eltern natürlich welche, die sagen, Judo sei kein Mädchensport. Aber die meisten finden es toll, dass auch die Meggä mitmachen. Es geht in diesem Sport ja um die Stärkung des Selbstvertrauens. Aber da ich Ihre Frage falsch verstanden habe, Herr Walpen«, fuhr er mit einem feinen Lächeln fort, »gebe ich Ihnen noch eine andere Antwort: Nein, ich bin im Wallis keinen Vorurteilen begegnet, jedenfalls nicht mir persönlich gegenüber.«
»Das – freut mich«, sagte Kauz. Fast hätte er Das erstaunt mich gesagt.
»Vielleicht erstaunt Sie das«, fuhr der Pfarrer fort, als habe er Kauz durchschaut, »denn die Walliser, besonders die Gommer, sind ja ein eher konservativer Menschenschlag. Aber Rassisten sind sie deswegen noch lange nicht«, stellte er fest. Er dachte einen Moment nach, dann relativierte er: »Zugegeben, Fremdenfeindlichkeit gibt es überall, versteckten Rassismus sowieso. Aber wenn es im Goms Rassismus gibt, dann bestimmt nicht mehr als in den Städten. Eher weniger. Aus dem einfachen Grund, weil die Gommer gar nicht groß mit Schwarzen in Berührung kommen. Wenn doch«, schmunzelte er, »dann handelt es sich meistens um Priester aus Afrika oder Indien. Und vor einem Priester hat der Walliser, erst recht der Gommer, einen … einen Heidenrespekt!« Er legte den Kopf in den Nacken und lachte laut heraus.
Sie standen auf und gingen weiter. Mbembe blieb immer wieder stehen. Kauz hatte das Gefühl, er wolle ihm noch etwas anvertrauen.
»Spaß beiseite«, nahm der Pfarrer das Thema wieder auf. »Ich kann da zwar nur für mich persönlich reden, das lässt sich nicht verallgemeinern. Aber sagen wir so: Sie fremdeln vielleicht ein bisschen vor dem schwarzen Pfarrer, die Walliser, aber sie zeigen ihm keine Geringschätzung, sie schauen nicht auf ihn herab, ganz im Gegenteil. Wir fremdelten ja auch ein bisschen vor den weißen Priestern in Ifakara«, fügte Mbembe schmunzelnd an. »Damals, als wir Kinder waren, meine ich.«
»Wann war das?«
»In den 1970er-Jahren.«
»Oh?«, sagte Kauz und überlegte. »Dann sind Sie ja gar nicht mehr der Allerjüngste«, meinte er und lachte den Pfarrer entwaffnend an. Als das Haus Primavera in Sichtweite war, fiel es ihm wieder ein. Er blieb stehen. »Sie wollten mir noch etwas sagen. Doch da waren fremde Ohren …«
»Stimmt«, sagte Mbembe. »Die Sache ist die«, holte er aus.
Seit er in Münster sei, besuche er regelmäßig die Senioren der Gemeinde, auch die im Seniorenhaus und der Residenz Primavera. Es wohnten dort viele Alte, die den Besuch des Pfarrers erwarteten. Die ehemalige Auberge sei ja nicht nur eine Altersresidenz für Walliser und Üsserschwiizer mit dem nötigen Kleingeld, sondern auch ein Gommer Altersheim und eine Institution für Pflegebedürftige und Demenzkranke aus der Region. Diese Auflage hätten die Betreiber akzeptieren müssen, um eine Betriebsbewilligung für die Altersresidenz zu bekommen. Dann kam der Pfarrer zur Sache.
»Die alte Dame, die ich erwähnte, ist nicht die Einzige, die Angst hat«, erklärte er. »Es sind gleich mehrere, die sagen, es sei ihnen in dem Haus unheimlich. Vielleicht ist es nur eine Hysterie. Wegen diesem Leichenfund im Minschtigertal. Kann ja sein, dass sich die alten Menschen mit ihren Ängsten gegenseitig anstecken. Aber …«
»Ja?«
»Ich weiß nicht«, druckste der Pfarrer herum, »aber mir selber ist es auch nicht ganz geheuer, wenn ich in der Auberge bin.«
Er sagt Auberge, dachte Kauz. Auch als das imposante historische Haus noch ein Hotel war, hieß es bei den Gommern schlicht die Auberge. Relais et Auberge du Sauvage hatte bloß an der Fassade und in den Hotelprospekten gestanden.
»Nicht ganz geheuer? Wieso?«
»Ich weiß nicht. Einfach so ein Gefühl«, meinte er. Dann gab er sich einen Ruck: »Sicher bloß Einbildung«, erklärte er. »Jedenfalls kein hinreichender Grund, zur Polizei zu gehen, nicht wahr?« Er schaute Kauz verlegen an und schüttelte den Kopf, als ob er sich selbst nicht ganz ernst nehmen könne.
»Das sehe ich auch so«, sagte Kauz. Da er den Braten aber gerochen hatte, nahm er dem Pfarrer die noch unausgesprochene Bitte aus dem Mund: »Aber Sie denken, ich könnte mich einmal in der Auberge, das heißt im Seniorenhaus und der Residenz Primavera, umsehen. Und umhören, nicht wahr?«
»Würden Sie das tun?«, fragte Pfarrer Mbembe erleichtert.
»Sicher, das mache ich. Es interessiert mich selber auch, was im Goms für die Alten getan wird. Ich gehöre ja auch schon bald zu ihnen. Wie heißt die Frau, die Sie erwähnt haben?«
»Zumstadel. Anna Katharina Zumstadel.«
»Gut. Sie sagten, ihre Villa liege am Vierwaldstättersee. Hier bewohnt sie wohl eine Suite im Luxustrakt«, meinte Kauz.
»So ist es. Die größte und schönste.«
»Bin neugierig, sie kennenzulernen. Ich geh da entlang«, sagte Kauz und zeigte Richtung Lange Gasse. »Der Auberge mache ich später einen Besuch.«
»Was haben Sie denn vor?«
»Erst eine vage Idee«, antwortete Kauz. »Warten Sie’s ab.«
Sie gingen noch ein paar Schritte weiter.
»Wie wärs mit einem Kaffee oder Spaziergang in ein paar Tagen?«, fragte der Pfarrer. »Falls es etwas zu berichten gibt.«
»Gut«, antwortete Kauz, »ich schicke Ihnen meinen Kontakt«, und zückte sein Smartphone. »Schicken Sie mir Ihren?«
Er staunte manchmal selbst, wie selbstverständlich er all die Gadgets verwendete, von denen er früher keine Ahnung gehabt hatte. Xaver hatte ihm den Umgang mit den Apps beigebracht, vieles hatte er von Thomas, dem Ehemann der Polizistin Ria Ritz, gelernt. Der war ein Crack in solchen Dingen. Pfarrer Mbembe zog sein Smartphone aus der Manteltasche, und im Nu waren die Kontakte ausgetauscht.
Kauz wusste nicht, wie er sich verabschieden sollte. Er hatte keine Erfahrung im Umgang mit katholischen Geistlichen. Einem protestantischen Pfarrer würde er nach einem so persönlichen Gespräch beim Abschied die Hand drücken. Aber einem Priester?
Pfarrer Mbembe nahm ihm die Entscheidung ab. Er legte die Hände vor dem Bauch zusammen und nickte Kauz freundlich zu. Dann drehte er sich um und ging gemessenen Schritts Richtung Auberge.
Frühling im Haus Primavera
Tags darauf machte Kauz einen Spaziergang zur ehemaligen Auberge, die neuerdings Seniorenhaus und Residenz Primavera hieß. Max ließ er zu Hause.
»Güetä Tag«, sagte er, als er durch die Tür trat.
»Guten Tag«, erwiderte höflich ein junger Mann mit schwarzem Wuschelkopf hinter der Empfangstheke. Er war wohl keine zwanzig Jahre alt. »Sie wünschen?«
»Ich möchte mit dem Heimleiter sprechen.«
»Mit Diakon Imtobel?«
»Ist er der Heimleiter?«
»Er ist der Direktor des Hauses. Wen darf ich melden?«
»Mein Name ist Walpen.«
Der Rezeptionist griff zum Hörer, und wenig später holte ein Mittvierziger in Jeans und modischem Veston Kauz an der Rezeption ab. Der Stehkragen seines schwarzen Hemds war vorne durchbrochen, sodass das Kollar zu sehen war, jener weiße Krageneinsatz, an dem man den Geistlichen erkannte.
»Was kann ich für Sie tun, Herr Walpen?«, fragte er, als Kauz ihm gegenübersaß, und sah ihn aufmunternd an.
Mit seinem zuvorkommenden Auftreten, dem modischen Haarschnitt und seinem Outfit machte Diakon Imtobel auf Kauz mehr den Eindruck eines Hoteldirektors der jüngeren Generation als den eines Kirchenmannes.
»Ich bin pensioniert und habe freie Kapazität«, erklärte Kauz. »Ich würde mich gerne nützlich machen. Ich dachte, vielleicht können Sie Besucher … Begleiter – oder wie soll ich sagen? – Helfer brauchen, die den betagten Bewohnern Ihres Hauses Gesellschaft leisten.«
»Oh, das trifft sich gut«, meinte Imtobel erfreut. »Das heißt, dachten Sie an eine Anstellung oder an Freiwilligenarbeit?«
»Nein, keine Anstellung. Freiwilligenarbeit.«
Diakon Imtobel strahlte.
»Das vereinfacht die Sache. Dann werden wir bestimmt handelseinig«, meinte er. »Frauen melden sich nämlich zuhauf für Freiwilligenarbeit, da haben die Gomserinnen eine ganz starke soziale Ader.«
Gomserinnen?, wunderte sich Kauz. Mit s?
»Wir können gar nicht alle nehmen«, erklärte der Direktor. »Aber ein Mann hat sich noch nie gemeldet, da sind Sie der Erste. Sie sind pensioniert, sagen Sie. In welchem Berufsfeld waren Sie denn tätig, wenn ich fragen darf? Im sozialen?«
»In gewissem Sinn schon«, bestätigte Kauz. »Wissen Sie, im öffentlichen Dienst hat man immer …«
»Im öffentlichen Dienst? Alles klar. Unsere Gäste und Bewohner, das heißt, vor allem natürlich die Bewohnerinnen, werden sich freuen, wenn sich auch einmal ein Mann mit ihnen abgibt.«
Kauz merkte, dass Imtobel keine Ahnung hatte, wer vor ihm saß. Er zog ein Merkblatt hervor, bat Kauz um seine Personalien, ließ sich dessen ID vorlegen, stellte ihm ein paar Routinefragen und fertigte von den Papieren Kopien an. Beide unterzeichneten, und damit war die beidseits jederzeit kündbare unentgeltliche Zusammenarbeit für mindestens einen, höchstens drei Nachmittage pro Woche besiegelt. Beim Abschied drückte Diakon Imtobel Kauz eine Hochglanzbroschüre in die Hand. Damit er wisse, was das Haus Primavera seinen Senioren biete und welchen Werten sich die Betreiber verpflichtet fühlten. Dann lud er ihn zu einem Einführungsnachmittag am folgenden Tag ein. Man werde ihn durchs Haus führen und ihn den Bewohnern vorstellen.
Wieder im Speicher machte es sich Kauz im Klappsessel mit der flauschigen Decke gemütlich, drehte die kleinen, aber feinen Boxen seiner Minimusikanlage auf und scrollte auf seinem Smartphone auf Jazz und Blues. Zu den Klängen von Billie Holidays That’s Life I Guess studierte er die illustrierte Broschüre, die ihm Imtobel mitgegeben hatte. Max lag zu seinen Füßen und schnarchte.
»Residenz Primavera: Ihr Zuhause für den Zweiten Frühling Ihres Lebens«, stand auf dem Cover. Eine Bergfrühlingswiese, darauf ein Schwarznasenschaf, das in die Kamera blickte, im Hintergrund das Weisshorn, im Vordergrund das angeschnittene Bild eines typischen Gommer Stadels.
Wer in aller Welt wählt eine Residenz im Goms als Alterssitz?, fragte sich Kauz. Ein paar Walliser, die es sich leisten können, vielleicht. Aber sonst? Er schlug die Broschüre auf.
Auf einer Veranda mit viel Holz sah ihm ein glückliches Seniorenpaar aus Liegestühlen entgegen. Dasselbe Paar war auch auf der gegenüberliegenden Seite abgebildet, flott auf dem Gommer Höhenweg unterwegs. Schicke Wanderkluft, sportliche Walkingstöcke. Er blätterte weiter. An einem Teetischchen saß eine silberhaarige Dame mit Lesebrille, ein Buch in der Hand, eine Szene wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Film. Auf dem nächsten Bild schwang ein rüstiger Senior vor dem Hintergrund eines Golfplatzes einen Golfschläger. Er hatte ein braun gebranntes, fotogen zerfurchtes Gesicht und auffallend weiße Zähne.
Die brauchen bestimmt keinen freiwilligen Besucher, dachte Kauz. Aber ihm war klar, dass die echten Bewohner in etwas anderer Verfassung sein würden als diese Seniorenmodels. Die waren weder auf dem Golfplatz noch auf dem Gommer Höhenweg anzutreffen, sondern bestenfalls hinter ihrem Rollator.
Auf den nächsten Seiten wurde das Interieur der Residenz präsentiert. Elegante Studios und Appartements für eine oder zwei Personen. Luxuriöse Suiten im Attikageschoss mit Terrasse und grandioser Fernsicht. Ergänzt wurden die Illustrationen durch Bildausschnitte: ein Blumenstrauß, dekorativ zurückgeschlagene Bettwäsche auf einem elektrisch verstellbaren Bett, edle Bad- und Duscharmaturen, eine Etagere mit Kosmetikartikeln. Es folgte eine Ansicht des renovierten Hotelspeisesaals, angereichert mit Detailansichten: eine kunstvoll gefaltete Serviette, im Vier-Sterne-Stil angerichtete Speisen, ein fingerbreit gefülltes Rotweinglas. Dann der Blick ins Foyer, in Bibliothek und Andachtsraum. Ein Rundgang durch die hausinterne Arztpraxis mit Labor und eigener Apotheke, durch Therapie- und Wellnessbereich mit Gymnastiksaal, Physiotherapie, Gehbad. Der ganze Stolz des Hauses war aber offensichtlich eine Wohlfühloase mit kleinem Pool, Bambusgarten, Liegepritschen, Sauna und Massagekojen. Das Schlussbild veranschaulichte das zugehörige Behandlungsangebot: zarte Frauenhände auf überraschend jugendlichen Seniorenschultern.
Werbung für ein Altersheim der Luxusklasse, dachte Kauz. Allem Anschein nach an Üsserschwiizer gerichtet, die ihre wohlhabenden Eltern in den Bergen statt in einer Luxusresidenz am Zürich- oder Zugersee unterbringen wollten.
Er überblätterte das Editorial des Direktors und sah sich die Porträts des Leitungsteams an. Da war einmal Diakon Beat Imtobel, Master of Theology, Master of Business Administration und Master of Public Health, der Direktor des Betriebs. Sodann Schwester Aloysia Mechler, eine ältere, in weiße Tracht gekleidete Ordensfrau mit gütigem Gesichtsausdruck, Leitung Pflege und Betreuung. Schließlich Arabella Niedermayr, eine im Dirndl porträtierte fidele Person, Leitung Haus und Hotellerie.
Nun studierte Kauz die Bildlegenden und den Text der Broschüre. Der Tenor lautete: Wir sind für die alten Menschen da, wir kennen ihre Bedürfnisse. Wir stellen individuelle Betreuung in fürsorglicher Atmosphäre sicher. Das Goms bietet Gewähr für unverdorbene, die Selbstheilungskräfte anregende Umgebung. Wir respektieren die Leistungen der Schulmedizin, vertrauen aber auch auf die Heilkräfte der Natur. Zu unserem Team gehören ausgewiesene Expertinnen der Pflanzenheilkunde.
Wir sind ein christliches Haus, aber wir nehmen Menschen aller Glaubensrichtungen auf. Wir sorgen für das leibliche, seelische und geistige Wohl unserer betagten Gäste. Sollte Pflegebedürftigkeit eintreten, so sind wir in der Lage, die Gäste der Residenz temporär oder permanent auf unseren Pflegestationen zu betreuen, sodass eine Spitaleinweisung in den meisten Fällen vermieden werden kann. Wer zwischen den Zeilen lesen konnte, der las: Wir sind auch ein Sterbehospiz, der geistliche Beistand auf dem letzten Lebensabschnitt ist gewährleistet. Zuhinterst wurde die Trägerschaft des Hauses Primavera genannt: Firma Prosenex mit Sitz in Sitten, hieß es da.
Kauz legte die Broschüre beiseite und rieb sich die Hände. Er freute sich schon auf seinen Undercover-Einsatz. Max spürte seine Erregung, stand auf, reckte und streckte sich, gähnte ausgiebig, hockte sich dann neben ihn und schaute ihn aufmerksam an.
»Guter Hund«, sagte Kauz und kraulte dem treuen Kerl den Hals, dann die Brust, dort, wo der weiße Fleck im schwarzen Fell saß. Max blickte noch treuherziger und leckte sich das Maul. »Ach so, entschuldige«, sagte Kauz, stand auf und füllte den Futternapf.
Frisch geduscht und in sauberer Kleidung meldete sich Kauz beim Empfang des Hauses Primavera, und wenig später erschien eine junge Frau in adretter weißer Spitalkleidung.
»Ich bin Schwester Sonja«, stellte sie sich vor.
»Schwester? Ich dachte, so sagt man heute nicht mehr.«
»In Spitälern nicht, das stimmt«, bestätigte sie. »Dort würde ich mich mit Frau Altheer vorstellen. Aber unsere betagten Gäste können sich nicht mehr umgewöhnen. Wer in einer solchen Uniform daherkommt, ist für sie eine Schwester«, erklärte sie und fuhr mit den Händen über die Seiten ihres blütenweißen Outfits. »Mutter Aloysia hat deshalb angeordnet, dass wir uns mit Schwester anreden lassen sollen.«
»Mutter Aloysia?«, wunderte sich Kauz.
»Ja, Leitung Pflege und Betreuung. Sie will Mutter genannt werden. Aber zu mir können Sie einfach Sonja sagen.«
Sie nicht Iär, dachte Kauz. Eine Üsserschwiizeri.
»Kommen Sie«, forderte Sonja ihn auf und führte ihn zum rollstuhlgängigen Lift. »Ich darf Ihnen als Erstes die Residenz zeigen. Danach führe ich Sie durch die übrigen Abteilungen des Hauses.«
»Was sind das für Senioren, die das Goms als Alterssitz wählen?«, fragte Kauz. »Luxuriöse Altersresidenzen findet man sonst doch eher in Stadtnähe oder an einem See im Mittelland.«
»Es gibt drei Kategorien«, erklärte Sonja: »Einmal die, die sich dem Goms verbunden fühlen, weil sie hier über Jahre Wander- oder Langlaufferien machten. Dann die, denen es einerlei ist, wo sie wohnen, Hauptsache, Ambiente und Service entsprechen dem Niveau, das sie sich gewohnt sind. Und schließlich die, die gar nicht mehr realisieren, wo sie sind. Das sind Menschen, die von ihren Angehörigen hierher, wie soll ich sagen …«
»… abgeschoben wurden?«
»Jawohl. Aber das ist nicht der Sprachgebrauch des Hauses. Das sagen wir nur hinter vorgehaltener Hand. Gehen wir?«
Kauz hatte vor Jahren, als es die Auberge noch gab, in der Taffinerstube, deren Gourmetrestaurant, gespeist. Den Zimmertrakt des renommierten historischen Hotels hatte er sich angesehen, als sein Freund Alain Gsponer, der für das Goms zuständige Kriminalinspektor, hier einmal Logis bezogen hatte. Aus ihm unbekannten Gründen, vielleicht war der Betrieb einfach nicht mehr wie gewünscht gelaufen, hatten die Besitzer des Hauses vor drei, vier Jahren entschieden, den Gastbetrieb einzustellen und das Hotel zu verkaufen. Ein unbekannter Kaufinteressent, der angekündigt hatte, er wolle aus dem Haus ein Betagtenheim und eine Residenz für zahlungskräftige Senioren machen, erhielt den Zuschlag. Es gab Stimmen, die sagten, bei der Erteilung der Betriebsbewilligung an den neuen Eigentümer sei gemauschelt worden. Die Stimmen verstummten, nachdem dieser eingewilligt hatte, im Haus Primavera auch eine Pflege- und Demenzkrankenabteilung für betagte Patienten aus der Region einzurichten.
Das Innere des Gebäudes war kaum wiederzuerkennen. Es war ausgekernt und zum großen Teil neu gebaut worden. Sonja führte Kauz durchs Haus, ließ ihn hier in ein Studio oder Appartement schauen, da auf einen Balkon hinaustreten und dort einen Blick in eine Luxussuite werfen. Die düsteren Treppenhäuser und die verwinkelten Gänge mit den abgewetzten Teppichläufern waren hellen Korridoren und Aufenthaltsräumen gewichen, anstelle der engen Hotelzimmer mit Holzmöbeln und altmodischen Tapeten gab es moderne, helle Zimmer. Den Speisesaal des Hotels mit seinen alten Leuchtern und der bemalten Decke hatte man erhalten und sorgsam renoviert. Die komfortabelsten Wohneinheiten waren in einem geschickt in den alten Hotelkomplex integrierten Neubau untergebracht. Dessen Attikageschoss bestand aus Luxussuiten mit Terrasse und grandioser Fernsicht.
»Wir kommen gerade zur rechten Zeit, Herr Walpen«, sagte Sonja, als sie nach ihrem Rundgang im Salon standen. Dieser hatte nichts mit den sterilen Aufenthaltsräumen gemein, die Kauz aus anderen Altersheimen kannte. Es war ein geschmackvoll eingerichteter Raum mit kleinen Tischen, bequemen Stühlen, Fauteuils und Sofas mit Beistelltischchen. »Gleich gibts Kaffee und Kuchen, da kann ich Sie unseren Gästen vorstellen.«
Gäste?, dachte Kauz. Nicht Bewohner oder Pensionäre, schon gar nicht Patienten. Nein, Gäste werden hier betreut.
Der Salon war knapp zur Hälfte besetzt. In einer Sitzecke saßen zwei betagte Frauen. Die eine war, das Strickzeug auf dem Schoß, eingenickt, die andere las, vor sich hin flüsternd, in einem Buch. Vier noch recht rüstig wirkende Senioren, drei Frauen und ein Mann, hatten sich an einem runden Tisch zum Bridgespiel versammelt. In einer Ecke saß ein Greis in Anzug und Krawatte im Rollstuhl, die Zeitung vor sich, eine Lupe in der Hand.
Eine fein gekleidete gebrechliche Dame kam am Arm einer Betreuerin in hellblauer Arbeitskleidung herein. Sie war halbseitig gelähmt, schleppte ein Bein nach, Arm und Mundwinkel hingen herunter. Eine andere Betagte steuerte am Rollator denselben Tisch an. Eine dritte kam an zwei Krückstöcken herbei und gesellte sich zu ihnen. Sie setzte sich an den Tisch und schaute sich im Raum um.
»Wo bleibt denn Frau Zumstadel?«, fragte sie.
Kauz horchte auf.
»Unser Weihnachtsbaum?«, spöttelte eine andere.
»Die kommt sicher noch«, meinte die Frau mit dem Rollator. »Den Kaffee verpasst sie ja nie.«
»Jaja, an ihrem Einzeltischchen!«, doppelte eine Dritte nach.
»Ist doch besser so, oder nicht?«, meinte die Erste.
»Allerdings.«
Frau Zumstadel, so viel war schon mal klar, schien nicht sonderlich beliebt zu sein. Allmählich füllte sich der Salon, die meisten Plätze waren schon besetzt. Schwester Sonja klatschte in die Hände und wandte sich an die Anwesenden.
»Das ist Herr Walpen«, stellte sie Kauz vor.
Der Greis im Rollstuhl hob brüsk den Kopf und schaute mit zusammengekniffenen Augen in ihre Richtung.
»Herr Walpen ist freiwilliger Helfer im Haus Primavera«, sagte Schwester Sonja und erklärte, worin seine Freiwilligentätigkeit bestehen würde.
»Oh, ein Gesellschaftsherr?«, rief eine Dame in verhältnismäßig sportlichem Outfit, die am Tisch der Bridgespieler saß. »Wie charmant! Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns.«
Kauz lächelte höflich.
»Können Sie jassen?«, rief jemand. »Spielen Sie Schach?«, »Kennen Sie sich mit dem Handy aus?«, »Sind Sie gut zu Fuß?«, fragten andere. Das Ihr schien in diesem Kreis nicht üblich zu sein, in der Residenz siezte man sich offensichtlich. Wieder andere machten mit brüchiger Stimme Scherze, die Stimmen gingen durcheinander. Dem Greis im Rollstuhl war das zu viel, er hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu.
Kauz musste sich eingestehen, dass die Atmosphäre längst nicht so beklemmend war, wie er sie sich vorgestellt hatte. Im Gegenteil, fast wie im Prospekt: hell und freundlich, die Stimmung aufgeräumt. In diesem Augenblick betrat eine weitere Person am Arm einer Begleiterin den Salon. Im Vergleich zu den übrigen Gästen, die alle dezent oder diskret sportlich gekleidet waren, erschien diese alte Dame in exzentrischer Aufmachung: platinblondes toupiertes Haar, knallgelbe Hose, weiße Bluse, schwarzes Gilet, üppig rot geschminkte Lippen, dazu passend lackierte Fingernägel, Täschchen am Arm, Sonnenbrille.
Ein Raunen ging durch den Salon.
Der Weihnachtsbaum?, fragte sich Kauz.
Die Dame grüßte nach links und nach rechts, blieb zwei, drei Mal an einem Tisch oder bei einer Sitzgruppe stehen, und zwar immer dort, wo ein Mann saß. »Wie nett, dass Sie gekommen sind«, flüsterte sie das eine Mal, »Schön, Sie zu sehen, Herr … ehm. Einen angenehmen Tag noch«, das andere Mal. Dann steuerte sie ein Einzeltischchen an. Als sie saß, zog sich ihre Begleitperson zurück.
»Unser Paradiesvogel«, raunte Schwester Sonja. »Die müssen Sie unbedingt kennenlernen. Frau Zumstadel bewohnt eine Attikawohnung im Neubau.«
Nun setzte Kauz den Rundgang mit Sonja fort. Sie führte ihn zunächst durch die Räume des Seniorenhauses im renovierten Obergeschoss des ehemaligen Hotels, dann gingen sie weiter in die Pflege- und Demenzstation im alten Seitenflügel des Hauses. Dort sah es allerdings ganz anders aus als in der Residenz. Bedrückt ging Kauz nach der Besichtigung nach Hause.
»Das ist nichts für mich«, sagte er zu Max, als er wieder in seinem Speicher war. »Wie halten das die Krankenschwestern und die Zivis bloß aus?«
Pflege- und Demenzstation Primavera
»Hier kommen Sie nur mit Badge rein«, hatte SchwesterSonja gesagt, »das ist eine geschlossene Abteilung.« Der Gang durch die Pflege- und Demenzstation war für Kauz ein Albtraum gewesen. Der vordere, hellere Teil des Trakts mit den noch nicht vollständig dementen Kranken ging ja noch: Hier saßen Alte mit ihren Betreuerinnen im Kreis, sangen Kinderlieder oder bewegten im Sitzen ihre Arme und Beine. Gymnastik sei das, sagte Schwester Sonja. Andere wurden an einen Tisch gesetzt und zum Zeichnen, Kneten oder Basteln angeregt. Wieder andere rüsteten im Office unter Anleitung einer Betreuerin Karotten. Im Aufenthaltsraum wurden Spiele gespielt, Kinderverse aus dem Gedächtnis ausgegraben, Märchen vorgelesen, es gab Kaffee und eingeweichten Zwieback. Es lag nicht an den Räumlichkeiten, dass es Kauz hier nicht warm ums Herz wurde. Diese waren nicht einmal so übel, es waren ja alles ehemalige Hotelzimmer. Man hatte sogar versucht, mit freundlichen Farben eine lichte Atmosphäre zu schaffen. Nein, es war die Trostlosigkeit, die hier, trotz allem Bemühen um diese Kranken, herrschte. Doch was danach folgte, war noch weit bedrückender.