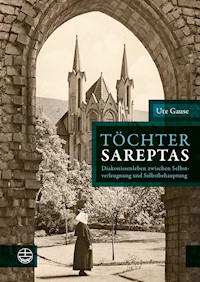20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Missbrauch in der Evangelischen Kirche - eine Fallstudie
Es ist nicht nur ein Problem der Katholiken. Auch in der Evangelischen Kirche vergingen sich – fast nur – Amtsträger an Menschen, die ihnen vertrauten und anvertraut waren. Wie konnte es dazu kommen? Warum blieben die Täter oft unbehelligt? Was erlebten die Opfer und was fühlen sie heute?
Diesen Fragen geht Ute Gause anhand des konkreten Falls eines Pfarrers, der über Jahrzehnte hinweg missbräuchliche Beziehungen zu meist jüngeren Frauen aus seinem jeweiligen gemeindlichen Umfeld unterhielt, nach. Der Bericht basiert auf der Analyse von umfangreichem Archivmaterial. Er bekommt besondere Anschaulichkeit und Tiefe durch Interviews, die die Autorin mit betroffenen Frauen und Personen aus deren Umfeld geführt hat.
Auf eindrucksvolle Weise macht dieses Buch in kirchengeschichtlicher Perspektive die Strukturen und Faktoren transparent, die Missbrauch in der Evangelischen Kirche ermöglichen. Zugleich gibt es Betroffenen eine Stimme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Ähnliche
Es ist nicht nur ein Problem der Katholiken. Auch in der Evangelischen Kirche vergingen sich – fast nur – Amtsträger an Menschen, die ihnen vertrauten und anvertraut waren. Wie konnte es dazu kommen? Warum blieben die Täter oft unbehelligt? Was erlebten die Opfer und was fühlen sie heute?
Diesen Fragen geht Ute Gause anhand des konkreten Falls eines Pfarrers, der über Jahrzehnte hinweg missbräuchliche Beziehungen zu meist jüngeren Frauen aus seinem jeweiligen gemeindlichen Umfeld unterhielt, nach. Der Bericht basiert auf der Analyse von umfangreichem Archivmaterial. Er bekommt besondere Anschaulichkeit und Tiefe durch Interviews, die die Autorin mit betroffenen Frauen und Personen aus deren Umfeld geführt hat.
Auf eindrucksvolle Weise macht dieses Buch in kirchengeschichtlicher Perspektive die Strukturen und Faktoren transparent, die Missbrauch in der Evangelischen Kirche ermöglichen. Zugleich gibt es Betroffenen eine Stimme.
Dr. theol. Ute Gause, geboren1962, ist Professorin für Reformation und Neuere Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat zur Geschichte der Diakonie gearbeitet, forscht zur Reformation und insbesondere zur Rolle und Bedeutung von Frauen innerhalb der Kirchengeschichte.
Ute Gause
»Gott habe ihm gesagt, er solle mich zur Frau machen«
Missbrauch in der Evangelischen Kirche – eine Einzelfallstudie
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2024 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © Ricardo – Adobe Stock.com
ISBN 978-3-641-32205-2V001
www.gtvh.de
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Gesellschaft und Kirche – angekommen in den 68ern
1.2 »Der Pfarrer ist anders«
1.3 Das Pfarrhaus
1.4 Die »revolutionäre Zelle« – Die Alternativen Christen (AC)
2. Der Pfarrer
2.1 Von der Kindheit bis zum Theologiestudium
2.2 Pfarrvikar und erste Pfarrstelle: Blauberg
2.3 Abschied und zweite Pfarrstelle: Bergedorf
2.4 Letzte Pfarrstelle: Riehl
2.5 Prozess und Entlassung aus dem kirchlichen Amt
3. Erfahrungsberichte
3.1 Interviews mit Betroffenen
»Ich habe ca. drei Jahrzehnte gebraucht, um mir selbst zu vergeben« – Die Studentin Yvonne B.
»Und verbunden mit diesem tiefen Gefühl: ›Ich brauch’ ihn als Seelsorger‹« – Die Betroffene Simone W.
»Es ging dann eher so […] um ihn und nicht um Opferschutz« – Der Fall Wiebke S.
»Als würd’ ich in einem Nebelsumpf drinstecken« – Die Geliebte Karla F.
Die langjährige Lebensgefährtin Beate K.: »Wir haben Hand in Hand gearbeitet.«
3.2 Interviews mit Bystander*innen
»Damals haben wir nicht gewusst, dass Gnadengaben und Charakter nicht identisch sind.« – Die Zeit bei den Alternativen Christen
»Und ich denke […], dass jetzt seine Bedürfnisse und das, was er gespürt hat, stärker waren als jetzt die Moralvorstellungen, auch für sich selber.« – Eine langjährige Freundin der Familie erinnert sich
»Also grundsätzlich – er war ein begnadeter, toller, begabter, kreativer, phantasievoller Pfarrer.« – Doris S. berichtet über ihre Zeit in Blauberg
»Im Grunde genommen war für uns damals der Alkohol ein größeres Thema.« – Gemeindemitarbeitende Frau J.
»Muss er da noch von der Kanzel ’runterfallen? Oder sich an einer Konfirmandin vergreifen?« – Gemeindemitglied Ricarda E.
Präses F.: »Ich bin mit einem seltsamen Gefühl nach Hause gefahren.«
»Mir täte es im Innersten weh, wenn behauptet würde, die evangelische Kirche wäre ein Machtapparat, der dem Missbrauch systematisch Vorschub leistet.« – Der Nachfolger im Amt
4. Die Landeskirche
4.1 Das Disziplinarverfahren: Der Fall kommt zur Sprache
4.2 Strategien des Pfarrers und fruchtlose Interventionen
4.3 Das Ermittlungsverfahren
5. »Wie konnte das geschehen?«
Sach- und Worterklärungen
Vorwort
Der folgenden Studie liegt ein Bericht zugrunde, den ich im Auftrag einer evangelischen Landeskirche angefertigt habe. Zum Schutz der Betroffenen ist diese Veröffentlichung vollständig pseudonymisiert. Alle genannten Namen und Orte sind frei erfunden; die Berufe, die bei einzelnen Personen erwähnt werden, üben diese nicht tatsächlich aus. Auch Jahreszahlen oder numerische Angaben wurden verändert, biographische Details, die die Identifikation von Personen ermöglichen würden, sind weggelassen.
Sämtliche Klarnamen der in der Studie genannten Personen können – so deren Einwilligung vorliegt – mit Hilfe einer Synopse entschlüsselt werden, die mit einer Sperrfrist versehen im Archiv der Landeskirche hinterlegt ist. Alle Interviews, zitierten Mails oder Briefe und sonstigen Belege aus Publikationen – die jetzt pseudonymisiert sind – können ebenfalls durch das Archiv erschlossen werden.
Ich danke meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ganz besonders danke ich den Betroffenen, die es durch ihren Willen, das Geschehene aufzuarbeiten, der evangelischen Kirche ermöglichen, einen Blick in bis heute herrschende Machtstrukturen zu werfen, Missstände zu erkennen und abzustellen. Auch Gemeindeglieder und Mitarbeitende, die Kenntnis von hier beschriebenen Sachverhalten hatten oder bekamen, haben sich für Gespräche zur Verfügung gestellt. Sie haben – ohne denunziatorisch zu sein – benannt, was zu bemerken war und was nicht. All diese Gespräche, Kontakte und Begegnungen haben mich persönlich bereichert, und ich danke allen, die mir ihre Zeit geschenkt haben.
Ein herzlicher Dank geht auch an meine Mitarbeiter*innen: Jennifer Mettner, die die Literatur beschafft hat, Lisa Peschkes und Julia Müller, die die Interviews transkribierten, und Benedikt Bauer und Julia Müller, die die Endkorrekturen mit mir gemeinsam vorgenommen haben. Für die sorgfältige Durchführung des letzten Korrekturgangs danke ich Jennifer Mettner besonders.
Barbara Lehmann und Julia Reinecke haben bei der Druckfassung unterstützt. Danke.
Mein Dank gilt den Mitarbeiter*innen im Archiv der Landeskirche, die mir unterstützend zur Seite standen. Sie haben mir nicht nur sämtliche Akten, die ich einsehen wollte, verfügbar gemacht, sondern mir auch einen Arbeitsraum zur Verfügung gestellt. Ich danke der Landeskirche, die es mir durch eine Zuwendung ermöglicht hat, eine Lehrstuhlvertretung zu finanzieren. Dem Gütersloher Verlagshaus und besonders Herrn Diedrich Steen danke ich für die wunderbar unterstützende Zusammenarbeit.
Schließlich danke ich meiner Schwester Silke und ihrem Mann, bei denen ich nach manchmal bedrückenden Interviews öfter übernachten durfte, für ihre Gastfreundschaft, für gutes Essen, guten Wein und die entspannende Nähe schnurrender Katzen.
Bochum, im Juli 2024
Ute Gause
1. Einleitung
Auftrag und Anliegen
Es hat mich zunächst überrascht, dass eine Landeskirche mit der Bitte an mich herantrat, eine Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs vorzunehmen. Als Kirchenhistorikerin, die zum 20. Jahrhundert und in diesem Zusammenhang auch mit Oral History, d. h. mit Methoden der Befragung von Zeitzeug*innen gearbeitet hat, hätte ich die Erwartung, Handlungsempfehlungen zu geben, nicht erfüllen können.
Tatsächlich war das Interesse der Landeskirche aber vor allem ein historisches: Es sollte in einem konkreten Fall das Ermöglichungsgefüge für Missbrauch untersucht werden. Die Zusammenhänge zwischen Macht und Charisma des Pfarramtes, zwischen einer entsprechenden Theologie und sexueller Gewalt sollten aufgeklärt und die kirchlichen Strukturen und Funktionsträger*innen, die mutmaßlich eine Aufdeckung verhinderten oder verzögerten, benannt werden. Dabei sollte die Untersuchung auch die Leitungsebene der Landeskirche sowie die Führungsebene in den Dekanaten/Kirchenkreisen umfassen, in denen ein Pfarrer arbeitet. Schließlich sollten Interviews mit Betroffenen und Bystander*innen die Muster sichtbar machen, nach denen der Täter vorging.
Die Landeskirche, auf deren Anfrage hin ich die Studie verfasst habe, hat es mir ermöglicht, den Aktivitäten des Täters auf umfassende Weise nachzugehen. Ich konnte ohne Einschränkungen zum Fall gehörende Personal- und Disziplinarakten, Visitationsberichte, Protokollbücher von Kirchengemeinden einsehen und auswerten. Dass diese Recherchen nur mäßig erfolgreich waren, verwundert nicht; denn man darf vermuten, dass das, was Ute Leimgruber im Blick auf die Dokumentation von Missbrauchsfällen an erwachsenen Frauen für die katholische Kirche feststellt, so oder ähnlich auch im Raum protestantischer Kirchen gelten dürfte: »Quod non est in actis, non est in mundo« – was nicht in den Akten steht, gibt es nicht.1
Mit den in den Akten erwähnten mittlerweile sämtlich pensionierten Oberkirchenräten, Prälaten und Dekanen, habe ich versucht Kontakt aufzunehmen. Nur eine ehemals kirchenleitende Person war zu einem Interview bereit. Alle anderen Personen lehnten ein Gespräch ab, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie meinten, sich nicht erinnern zu können. Eine Ablehnung wurde mit der Berufung auf Opferschutz für die Familie des mittlerweile verstorbenen Pfarrers und das Beichtgeheimnis begründet.
Das Pfarrerdienstrecht, das die Pflichten und Rechte einer Pfarrperson regelt, hatte lange Zeit sexuelle Übergriffe als Tatbestand pfarramtlichen Fehlverhaltens nicht im Blick. Lediglich im Hinblick auf Ehe und Ehescheidung gab es Regelungen. Mittlerweile sind – notgedrungen – Präzisierungen erfolgt. So urteilte die Disziplinarkammer der evangelischen Kirche von Westfalen im Jahr 2004: »Mag die Versuchung angesichts einer freizügigeren Grundhaltung der Gesellschaft zur Sexualität noch so groß sein, ein Pfarrer hat unbedingt Zurückhaltung zu üben und sexuelle Kontakte zu Jugendlichen zu vermeiden, wie dies im Verhältnis von Eltern zu Kindern selbstverständlich zu sein hat, sowie zu volljährigen Gemeindegliedern, die eine seelsorgerliche Betreuung erwarten.«2 Übte eine Pfarrperson diese Zurückhaltung nicht, so wurden solche Fälle als »Amtspflichtverletzungen« bewertet.
Wurden diese zur Anzeige gebracht und ein Disziplinarverfahren eröffnet, so endete dieses häufig mit einer Einstellung des Verfahrens: So wurden in der Nordelbischen Kirche zwischen 1993 und 2012 insgesamt nur sechzehn Disziplinarverfahren oder Vorermittlungsverfahren durchgeführt, die sich auf vierzehn Pastoren beschränkten. Nur in einem Fall kam es zu einer schwerwiegenden Disziplinarmaßnahme, über die Hälfte endeten mit der Einstellung des Verfahrens.3
Im Blick zu behalten ist, dass das Ziel des Pfarrer*innendienstrechts der Schutz des Amtes vor »schlechter Ausübung, Missbrauch und Entwürdigung« ist. Es soll die »Funktionstüchtigkeit des kirchlichen Dienstes« sicherstellen.4 Das hat in Bezug auf Dienstvergehen, die sich auf einen sexuellen Missbrauch beziehen, die bemerkenswerte Konsequenz, dass Betroffene als Zeug*innen gehört werden, weil die zur Beurteilung stehende Tat in der Perspektive des Dienstrechts möglicherweise das Amt beschädigt haben könnte. Diese Studie nimmt im entschiedenen Unterschied dazu die Betroffenen als diejenigen wahr, die nicht Zeugen eines abstrakten Vergehens am Amt wurden, sondern denen unmittelbar Schaden zugefügt wurde, die eben Opfer bzw. Betroffene waren.
Ich folge in der Verwendung des Begriffs »sexueller Missbrauch« dabei der Definition von Gerhard Schreiber, der darunter »das Ausnutzen eines wenigstens situativ bestehenden Machtvorsprungs, wie er aus Abhängigkeits-, Dominanz- oder Vertrauensverhältnissen und/oder entsprechenden Strukturen gleichermaßen hervorgeht wie damit einhergehen kann.«5
Wie wichtig es ist, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, hat im Rahmen der Debatte um Missbrauch in der katholischen Kirche Klaus Große Kracht deutlich gemacht, der festhält, dass nur so »den Betroffenen genau jene Wissenselemente zur Verfügung gestellt werden, derer sie bedürfen, um ihr Erlebnis in eine für sie stimmige Erzählung einbetten zu können«.6 Eine historische Aufarbeitung, die Kontexte transparent macht, Betroffene zu Wort kommen lässt und die in kirchlichen Institutionen wirksamen, die Tat begünstigenden sowie verschleiernden Mechanismen entlarvt, kann Betroffene unterstützen, das Erfahrene aufzuarbeiten. Große Kracht betont:
»Erst das Wissen darum, dass es weitere Opfer gibt, dass andere weggeschaut haben, bewusst nicht eingeschritten sind, dass der Täter strukturelle Ressourcen des Systems, in dem er sich bewegte, genutzt hat, um sich einen Machtvorteil gegenüber seinen Opfern zu verschaffen – all das und vieles mehr an Informationen kann den Betroffenen die Möglichkeit geben, aus dem Zwang der unverschuldeten Selbstbezüglichkeit auszusteigen und die ebenso soziale wie kognitive Isolation ihrer Erinnerungen, die für den Täterschutz so wichtig waren und sind, zu überwinden.«7
Der kirchengeschichtliche Zugang dieser Studie soll chronologisch anhand der Lebensstationen des Pfarrers seine handlungsleitenden Motive erkennbar werden lassen. Obwohl prinzipiell den Betroffenen der Vorrang gilt, ist es aus Verständnisgründen notwendig, das Kapitel »Der Pfarrer« voranzustellen.
Die Studie stellt eingangs knapp die Umbruchsdynamiken vor, die die gesellschaftliche und kirchliche Situation vor allem der 1980er- und 1990er-Jahre beeinflussten. Das zweite Kapitel stellt die Biographie des Täters in den Fokus. Diese beschränkt sich auf Lebensstationen, Fremd- und Selbsteinschätzungen und versucht, jeglichen Anklang an eine Apologie zu vermeiden. Ein besonderes Gewicht erhalten im dritten Kapitel die Interviews mit den Betroffenen und Personen aus dem Umfeld, die möglichst minutiös ausgewertet wurden, um die Strategien des Täters nachzuzeichnen. Im vierten Kapitel kommt einerseits die Kirche als Verwaltungs- und Kontrollinstanz in den Blick andererseits auch Aussagen von Betroffenen, Bystander*innen und Vertuscher*innen im Disziplinarverfahren.
Das fünfte Kapitel schließlich nimmt nochmals die agierenden Personen innerhalb ihres familiären und gemeindlichen Kontexts in den Blick und zeigt, an welchen Stellen die Kirche als Kontrollinstanz hätte eingreifen können. Individuelles und systemisches Versagen kommen in den Blick.
Den Anlass zur Fallstudie gab ein Opfer: eine Frau, die sich zwar spät, dann aber entschieden an die Landeskirche gewandt hatte. Obwohl ihr Fall bereits verjährt war, eröffnete die zuständige Landeskirche ein Disziplinarverfahren, das dann aber nicht weiter verfolgt wurde, als der zu dieser Zeit bereits pensionierte Pfarrer wegen eines Sexualdelikts gerichtlich verurteilt worden war. Die Betroffene blieb hartnäckig. Sie forderte die Landeskirche auf, eine Aufarbeitung vorzunehmen und festzustellen, ob ihre Erfahrung nur eine einzelne war, ob es weitere Betroffene gab, ob es Vorgesetzte gab, die vertuschten und was die Landeskirche wusste.
Diese Studie ist das Ergebnis ihrer Hartnäckigkeit. Ziel ist es, die Vorgänge insgesamt möglichst akribisch aufzuarbeiten und zu dokumentieren, zu analysieren und in den Gesamtrahmen von Kirche und Gesellschaft, Pfarrerbild und Theologieverständnis einzuordnen.
1.1 Gesellschaft und Kirche – angekommen in den 68ern
Die 1960er-Jahre stehen, plakativ gesprochen, für eine »Fundamentalliberalisierung und Demokratisierung und eine[r] Hinwendung zu postmaterialistischen Werten«.8 Das Studium, das Rolf R. – der Pfarrer, dessen Werdegang und Handeln diese Studie zum Gegenstand hat, – in Heidelberg beginnt, ist von den Studentenprotesten in dieser Zeit begleitet. Er beteiligt sich aktiv als Mitglied einer Gruppe, die sich »Alternative Christen« nennt. Die Aktionen der Gruppe entstehen nach Aussage des Gründers, Heiner R., aus dem Gefühl heraus, den als fast revolutionär wahrgenommenen Veränderungen der Zeit eine christliche Richtung geben zu wollen. Diese Motivation und ihr Kontext sind für den Theologiestudenten und späteren Pfarrer ebenso wie für die Betroffenen wichtig.
Sexualitätsdiskurse
Dabei ist nicht zuletzt auch der damalige breite Sexualitätsdiskurs innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Kirche zu berücksichtigen. In den 1970er- und 1980er-Jahren gehörte das Sprechen über Sexualität im linksalternativen Milieu dazu:
»Das ›Alles-über-den-Sex-Sagen‹ wurde zu einem Imperativ, um die vermeintlich ›echten‹ sexuellen Bedürfnisse freizulegen. […] Letztlich war es vor allem die Überschätzung und Mythisierung der Sexualität als Form der politischen Erlösung, welche zu den Kernmerkmalen dieser neu codierten linksalternativen Sexualitätsnorm wurde.«9
Dem Ausleben der Sexualität sprach man in diesem Milieu eine geradezu revolutionäre Wirkung zu,10 die den Leitwerten der Jahre der Nachkriegszeit mit ihrer »Orientierung an Hierarchien, Autoritäten und an materieller Existenzsicherung«11 entgegenstand.
Allerdings gab es bereits vor 1968 und dem Auftreten der neuen Linken eine Verschiebung der Diskurse über Sexualität und eine Veränderung im Umgang mit ihr. So gründete Beate Uhse 1951 in Flensburg einen Versandhandel, der unter dem Stichwort »Ehehygiene« Literatur zur Sexualaufklärung vertrieb sowie Verhütungsmittel, erotisches Bildmaterial und ebensolche Kleidung anbot. Schon Anfang der 1960er-Jahre erreichte das Unternehmen mit Werbemaßnahmen die Hälfte aller bundesdeutschen Haushalte.12 »Glückliche Ehen könnten nur auf Basis einer für beide Partner erfüllenden Sexualität gelingen – das war die Message, die bei den durch die Nachkriegswirren verunsicherten Deutschen bestens ankam und für steigende Verkaufszahlen sorgte.«13
Seit 1963 war es auch auf dem bundesdeutschen Markt außerdem möglich, die sog. »Anti-Baby-Pille« als hormonelles Kontrazeptivum zu erhalten. Zwar ließen sich die bundesdeutschen Ärzte beim Verschreiben des Präparates in der Regel von ihren sexualmoralischen Vorstellungen leiten, was dazu führte das einige nur dann bereit waren, zum Rezeptblock zu greifen, wenn eine verheiratete Frau mit mindestens drei Kindern nach der Pille fragte. Aber es gab Ausnahmen und mit der »Pille« hatten Frauen erstmals die Möglichkeit, mit fast einhundertprozentiger Sicherheit eine Schwangerschaft verhindern zu können.14
Mit den Sexualdiskursen in der Studentenbewegung bekamen diese Veränderungen eine neue Richtung und größere Dynamik. Insbesondere die Denker der sog. Frankfurter Schule, wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse, wurden zu Ideengebern, gegen eine »repressive Entsublimierung« der Sexualität vorzugehen. Gemeint war damit Folgendes: Indem Menschen sexuelle oder aggressive Impulse nicht unmittelbar ausleben, sondern produktiv umlenken, entsteht nach Freud kreatives Schaffen. Sublimierung wird so auch zum Motor der Kultur.
Die Frankfurter Schule kritisierte, dass in modernen Gesellschaften offenbar eine Entsublimierung erfolge, d. h. Menschen die Freiheit erhielten, ihren Triebimpulsen folgen zu können und der Tabubruch nicht mehr gesellschaftlich sanktioniert werde. Tatsächlich sei diese Wahrnehmung aber ein Irrtum. Denn Restriktionen und Kontrollmechanismen würden nur scheinbar gelockert. Vermeintlich entfesselte Freiheitsräume seien in Wahrheit schon wieder oder immer noch von repressiven Strukturen unterlegt, so dass man von einer »repressiven Entsublimierung« sprechen müsse. Während mit der Entsublimierung im Freud’schen Sinne etwas Positives gemeint war, verband sich mit Repression die Haltung der bürgerlichen Gesellschaft, sich gegen grundsätzliche Kritik zu immunisieren. Marcuse forderte, sich dem zu verweigern.15 Hier setzte die Kritik der 68er-Generation an der Institution der Ehe an. Sie fand ihren deutlichsten Ausdruck in den sog. Kommunen, die bürgerlichen Ehevorstellungen und der Monogamie eine Absage erteilten. Die Mitglieder der Kommunen folgten nicht nur der Idee, dass es möglich sein sollte, wechselnde Sexualpartner*innen zu haben; auch die gemeinschaftliche Erziehung von Kindern in Kinderläden war ein weiterer fester Bestandteil des Lebens in diesen Gemeinschaften.16
Daneben gab es aber auch weniger radikale, bürgerlichere Versuche, der Ehe als Institution und Lebensform eine andere Gestalt zu geben. So veröffentlichten Nena und George O’Neill 1972 ein Buch mit dem Titel »Die offene Ehe«, worin sie außereheliche Sexualkontakte ausdrücklich begrüßten.17
Dabei ist festzuhalten, dass bereits vor der sog. »sexuellen Revolution« das Sexualverhalten von Studierenden relativ freizügig war. Eine Studie von 1966 ergab, dass fast alle verheirateten Studierenden mit ihrem späteren Ehepartner, viele zuvor aber auch mit anderen Partnern, vorehelichen Geschlechtsverkehr hatten.18 Allerdings lebten auch viele Studierende abstinent. Sexuelle Beziehungen wurden in den 1960er-Jahren erst viel später aufgenommen, als das ab den 1980er-Jahren der Fall war. Eine Umfrage aus dem Jahr 1981 zeigt, dass Sexualität jetzt deutlicher zum Alltag der Studierenden gehörte und dass sexuelle Beziehungen bereits während der Gymnasialzeit bestanden; auch die Fluktuation von Beziehungen ist 1981 höher als 1966.19 Die 1981 befragten Studierenden fühlten sich seltener äußeren Vorschriften unterworfen, und gerade Frauen gaben 1981 häufigeren Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern an als ihre männlichen Kommilitonen. Dadurch gab es jedoch auch mehr ungewollte Schwangerschaften und Abtreibungen.20
Während 1966 von den befragten Studierenden 27 % bereits verheiratet waren, waren es 1981 nur noch 14 %, 1996 sogar nur 5 %. Schon 1966 gaben aber 67 % der Studierenden an, sexuelle Kontakte zu haben, ohne verheiratet zu sein. Ob die hohe Zahl verheirateter Studierender 1966 sich einer konfessionellen – katholischen oder evangelischen – Bindung verdankt, kann nur gemutmaßt werden, da die Studie die Konfessionszugehörigkeit nicht abfragte. Konstatiert werden kann: »Die Loslösung der Sexualität von der Institution Ehe ist im Untersuchungszeitraum also noch einmal vorangeschritten.«21
Auch die Formen des Zusammenlebens veränderten sich. Die klassische Kleinfamilie und damit die bürgerliche Ehe und Familie erlebte ihre Blütezeit während der 1950er- und 1960er-Jahre. Ab Mitte der 70er-Jahre wurde diese Lebensform mindestens ergänzt durch nichteheliche Lebensgemeinschaften, Patchworkfamilien, Alleinerziehende und selbstverständlich durch die Kommunen bzw. Wohngemeinschaften.22 Von diesen gab es 1966 bundesweit gerade einmal 100, 1968/69 etwa 1000, im Jahr 1971 bereits ca. 2000 und 1974 schon 10 000 – mit steigender Tendenz.23
Wandlungen kirchlicher Sexualmoral
Beide Kirchen mussten auf die sich wandelnde Wahrnehmung der Sexualität im gesellschaftlichen Diskurs und in der Lebensgestaltung der Menschen reagieren. Mit der Enzyklika »Humanae vitae« von 1968 bekräftigte die Katholische Kirche ihre traditionelle Lehre in Fragen der Sexualmoral. So lehnt die Enzyklika den Geschlechtsverkehr vor oder außerhalb der Ehe strikt ab und verbietet den katholischen Christen sämtliche »künstlichen« Methoden der Geburtenregelung.
Die Evangelische Kirche indes formulierte liberalere Positionen. Beispielhaft dafür ist die 1971 veröffentlichte »Denkschrift zu Fragen der Sexualethik«. Die Erarbeitung der Denkschrift war eine Reaktion auf die veränderte gesellschaftliche Lage, in der der öffentliche und mediale Umgang mit Sexualität weithin zu einer Selbstverständlichkeit geworden war und zudem durch Studentenbewegung und Frauengruppen thematisiert wurde. In der Kommission zur Denkschrift waren Juristen, Mediziner, Pädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten, Soziologen und Theologen vertreten, die sehr unterschiedliche Perspektiven und Meinungen in die Diskussion einbrachten. Letztlich setzte sich eine liberale Haltung weitgehend durch. So wird die Wahl von Verhütungsmethoden, die grundsätzlich nicht abgelehnt werden,24 der Gewissensentscheidung der Ehepartner überlassen, was auch die Wahl der »Anti-Baby-Pille« möglich macht. Die Denkschrift hält zwar am Primat der Ehe fest, erklärt aber im Abschnitt V, in dem es um das Sexualverhalten von Jugendlichen geht, den Geschlechtsverkehr von Verlobten oder fest Befreundeten für akzeptabel. Auch ein »bedingtes Ja zu Wohngemeinschaften mit Kleinfamilien und Alleinstehenden« wird ausgesprochen, »die gerade entstehenden Kommunen wurden jedoch abgelehnt«.25 Ehescheidung wird thematisiert und als Option zugestanden.26
Damit nahm die Evangelische Kirche Positionen auf, die Theologiestudenten, die der Studentenbewegung nahestanden, teilen konnten. Rolf Trommershäuser, der später in die DKP eintrat, und Reiner Vogels hatten sich in den ESG-Nachrichten Nr. 42 vom 28. Oktober 1968 zur überkommenen Sexualmoral der Kirche geäußert: Habe die Kirche mit ihrem Einsatz für »Sittlichkeit«, ihrer Sexualmoral noch einen empirisch-rationalen Zweck verfolgt, weil die »wirtschaftliche Versorgung der Frau nur in einer bürgerlichen Ehe gewährleistet war« und das Verbot vorehelichen Geschlechtsverkehrs ihrem Schutz diente, so sei dieses Verbot angesichts der »Wunschkind-Pille« nicht mehr plausibel. Auch die Maßgabe, Sexualität habe der Zeugung von Nachwuchs zu dienen, basierend auf der rationalen Grundlage, durch Enthaltsamkeit die Kinderzahl zu begrenzen, habe in einer Zeit, in der es sichere Verhütungsmittel gebe, keine Relevanz mehr. So fordert das Papier, sowohl den vorehelichen wie den innerehelichen Geschlechtsverkehr kirchlicherseits nicht mehr zu reglementieren, weil die Grundlage der früher rationalen Sexualmoral nicht mehr gelte:
»Die Verwerflichkeit vorehelichen Geschlechtsverkehrs und die Begrenzung des Geschlechtstriebs auf eine Funktion der Zeugung läßt sich nicht mehr empirisch-rational ableiten. Wer diese Sexualmoral weiterhin vertritt, verändert ihre einstmals humane Qualität: Aus der theologischen Begründung humaner Organisation des Geschlechtstriebs wird ideologische Absicherung des historisch überholten Triebverzichts.«27
Beide Autoren dieses Textes waren in der sog. »Celler Konferenz« aktiv, einem losen Zusammenschluss von Theologiestudierenden, Pfarrern und Vikaren, die im Kontext der Umbrüche von 1968 eine Revolution durch die Kirche und eine Revolution in der Kirche anstrebten. Insofern handelt es sich bei der zitierten Meinung nicht um eine Mehrheitsposition innerhalb der Kirche. Deutlich wird aber, dass die konservative evangelische Sexualmoral brüchig zu werden begann.
Franz Eder kommentiert die gesamtgesellschaftliche Entwicklung als eine, die heterosexuelle Männer zu den Nutznießern der Sexualisierung machte und Frauen zu Sexualobjekten.28 Dagegen setzte die Frauenbewegung auf eine autonome Sexualität und auf die Forderung nach Selbstbestimmtheit, forderte Emanzipation und Gleichstellung.29 Sexualaufklärung und Sexualerziehung schritten voran. »Die Grenzen des Pathologischen, der Sünde und des Sexualstrafrechts wurden dabei weitgehend demontiert.«30
Genau diese Liberalisierung konnte auch zur Gefahr werden, wie es beispielsweise am Versuch sichtbar wird, Pädophilie als normales Sexualverhalten darzustellen. Hier ist es vor allem der Frauenbewegung zu verdanken, dass Anstrengungen, eine »Normalisierung« zu erreichen, nicht zum Erfolg führten. Feministinnen, u. a. Alice Schwarzer, machten darauf aufmerksam, dass pädophile Sexualität ein starkes Machtgefälle habe und nicht freigegeben werden dürfe.31
1.2 »Der Pfarrer ist anders«
Im Horizont sich verändernder gesellschaftlicher Wirklichkeit war auch ein anderes für evangelische Identität wesentliches Merkmal Veränderungen unterworfen: das Pfarrerbild. Die im Folgenden beschriebenen Charakteristika des Pfarrerbildes und seine Umbrüche wie auch die des Pfarrhauses betreffen konkret auch die Situation des Täters, der mit Ehefrau und Kindern nach außen dem Ideal des offenen Pfarrhauses zu entsprechen sucht.
Das gesellschaftliche Pfarrerbild ist in dieser Zeit zwar im Wandel, aber doch stark von Traditionalität geprägt. Dass Frauen das Amt ausüben, ist gerade erst akzeptiert, das Pfarrerbild weithin ›männlich‹ konnotiert. Der Pfarrer ist Respektsperson, die nicht zu hinterfragen ist. Einige der Charakterisierungen, die Manfred Josuttis 1982 in seinem Buch »Der Pfarrer ist anders« vorgenommen hat, verdeutlichen, wie sehr der Pfarrer und das Pfarrhaus unter der Beobachtung von Gesellschaft und Gemeinde stehen. Vom Pfarrer wird erwartet, dass er »Repräsentativfigur« der Religion ist, und seine Gemeinde bestimmt ihr Verhältnis zu ihm häufig durch Übertragungsvorgänge: Er hat den Idealtypus moralischer Integrität zu repräsentieren.32
Im Kapitel »Der Pfarrer und die Macht« hält Josuttis fest, dass das Thema zwar tabuisiert werde, der Pfarrer in seiner beruflichen Praxis selbstverständlich aber Macht habe, die er vor allem als kommunikative Macht zur Beeinflussung anderer Menschen ausübe.33 Dabei eröffne gerade die Predigt Raum für Allmachtsträume.34 Allerdings müsse festgehalten werden: »Die Bestärkung der eigenen Person, die das Gespräch mit Hilflosen und Ratsuchenden liefert, die Möglichkeiten, die Predigt und Unterricht zur Beeinflussung anderer Menschen bieten, samt den darin enthaltenen Bemächtigungstendenzen werden kaum reflektiert.«35 Stattdessen werde der Aspekt des Dienstes in den Vordergrund gestellt, was letztlich aber die Autorität und Macht des Pfarrers verschleiere.36
Josuttis bezieht sich in seiner Analyse auf die Forschungen des amerikanischen Psychologen David McClelland, der Macht als ein Grundmotiv menschlichen Handels identifiziert und das Bestreben der Einflussnahme als eine Ausdruckform der Macht so beschreibt:
»Das Bestreben, Einfluß auszuüben, kann sich prinzipiell auf dreierlei Weise zeigen: (1) in heftigen Handlungen wie Tätlichkeit und Aggression; in Hilfeleistung, Beistand oder Rat; in der Kontrolle über andere; in der Beeinflussung und Überredung anderer oder in dem Versuch, andere zu beeindrucken; (2) in Handlungen, die Emotionen in anderen wecken …; (3) in dem Bemühen um Ansehen. Eine Person, die sich um ihr Ansehen sorgt, bemüht sich ganz vordergründig um Einfluß.«37
Für Josuttis ist es eindeutig, dass diese Formen der Einflussnahme zum Alltag des Pfarrers gehören. Jeder Pfarrer übt in seiner Funktion als Seelsorger durch seine Hilfeleistung immer auch gleichzeitig Macht aus.
Dass auch das Leben evangelischer Pfarrer von der Verschiebung sexualethischer Orientierungslinien betroffen ist, nimmt Josuttis im Kapitel »Der Pfarrer und die Sexualität« auf. Er konstatiert ein Brüchigwerden der überkommenen Vorstellungen vom Ehe- bzw. Sexualleben des Pfarrers, weist auf die zunehmende Zahl von Ehescheidungen und außerehelichen Beziehungen bei Pfarrern hin und fordert die Landeskirchen auf, zu reagieren.38 Der Anspruch der Gemeinde sei es, dass der Pfarrer ein Eheleben und ein Sexualverhalten in »idealisierter Normalität« an den Tag lege. Diesen Anspruch stützten die Landeskirchen, für die nach wie vor »die Ehe in ihrer jetzigen Form zu den zentralen Gegenständen der kirchlichen Lehrtradition« gehöre.39 Josuttis fragt demgegenüber an, mit welchen Gründen andere Formen der Partnerschaft, wie die offene Beziehung, die Wohngemeinschaft im Pfarrhaus oder die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft ausgeschlossen würden.40
Auf die Probleme, die sich im Hinblick auf den Pfarrberuf aus dem Festhalten am überkommenen Pfarrerbild einerseits und der sich immer stärker verändernden gesellschaftlichen Wirklichkeit andererseits ergeben, macht Josuttis zusammen mit Dietrich Stollberg 1990 ein weiteres Mal aufmerksam. Beide wenden sich dem Problembereich »Ehebruch im Pfarrhaus« wissenschaftlich zu.41 Den Umstand, dass Ehebruch auch im Pfarrhaus zu einer »alltäglichen Lebenskrise« geworden sei, führt Josuttis auf die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt zurück.42 Seit Ende der 60er-Jahre haben Ehescheidungen, Ehen ohne Trauschein sowie zerbrochene Pfarrehen zugenommen und auch Homosexualität im Pfarrhaus wird als alternative Lebensform nicht mehr ausgeschlossen.
Dem steht gegenüber, dass in der gemeindlichen und kirchlichen Wahrnehmung die »erzwungene Einheit von Beruf und Privatsphäre, die das Pfarrerdasein bestimmen«, bestehen bleibt.43 Die Lebensführung des Amtsträgers ist in dieser Perspektive ein konstitutiver Bestandteil des Amtes selbst und nicht etwas, das der Privatperson zuzurechnen wäre. Deshalb erfährt bei einer Auflösung seiner Ehe der Pfarrer die Trennung auch als eine Trennung von seiner Gemeinde bzw. muss sich vor dem Landeskirchenamt für seine Trennung und Scheidung verantworten.44
Im Hintergrund steht hier für Josuttis die Tabuisierung der Sexualität im Christentum:
»Gott liebt, und Gott will, daß die Menschen einander lieben. Aber immer geht es dabei um Agape und nicht um Eros oder gar Sexus, und nur an den Rändern der Kirche hat es immer wieder Versuche gegeben, Sexualität in mystisch sublimierter oder orgiastisch praktizierter Weise in das religiöse Leben einzubeziehen.«45
Der Raum, in dem Sexualität ihren Platz hat und – seit Luther – ausgelebt werden darf, ist die Ehe und nur sie. Der Pfarrer hat als Vorbild dieser Norm zu entsprechen, Nicht-Einhaltung wird sanktioniert. Je mehr sich gesellschaftliche Normen lockern, desto stärker lockern sich auch die Normen des Lebens im Pfarrhaus. Wie strikt die Normierung des Pfarrers war, illustriert zusätzlich dieses Beispiel: »Noch in den ersten Nachkriegsjahren war es in manchen Gemeinden für die Pfarrer unmöglich, ins Kino zu gehen oder in der Gemeinde öffentlich zu tanzen.«46
Konkret bedeutet das: Während vom Ende der 60er-Jahre an die gesamtgesellschaftlichen Konventionen im Hinblick auf die Ehemoral an Verbindlichkeit verlieren und eine Vielzahl neuer Lebensformen nebeneinander ausprobiert werden, bleiben die Konventionen im Hinblick auf Lebensform und Ehe des Pfarrers strikt. Verändern wird sich das erst im 21. Jahrhundert.
1.3 Das Pfarrhaus
Seit Luthers Zeiten war das Pfarrhaus geprägt von einem patriarchalen Standesdenken: »Der Hausvater hat die Verantwortung für das geistliche Leben und die Lebensführung der Mitglieder des Hauses.«47 Das Modell, wonach in einem Pfarrhaus ein Pfarrer und die ihm zuarbeitende Pfarrfrau leben, blieb in der Breite der landeskirchlichen Wirklichkeit bis in die 1980er-Jahre hinein prägend, in konservativeren Gemeinden hielt es sich noch länger.48 Erwartet wurde von den Ehefrauen der Pfarrer die »absolute Unterstützung des Ehemannes in seinem Pfarramt, aber auch in seinen privaten Anliegen«49, die Erziehung der Kinder und die Führung des Pfarrhaushalts, wobei eine hohe Kinderzahl mindestens bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war und als vorbildlich galt.50 Die Pfarrfrau sollte sich darüber hinaus in der Gemeinde bei Bibelstunden, Gemeindeveranstaltungen, Mütterkreisen usw. engagieren sowie nach Möglichkeit auch Alten- und Krankenbesuche übernehmen.51 Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gilt dabei die Pfarrfrau als diejenige, die für das Gelingen der Ehe verantwortlich ist, da sich der Pfarrer aufgrund seiner Pflichten nicht um Ehe und Familie kümmern könne.52
Wie anachronistisch im Vergleich zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung dieses Pfarrhaus-Modell nach und nach wurde, zeigt ein Gedicht, das der badische Landesbischof Hans-Wolfgang Heidland (1912–1992; Bischof von 1964 bis 1980) als »Lob der Pfarrfrau« verstanden wissen wollte und 1977 in alle badischen Pfarrhäuser schickte. Es wirkt wie ein Schwanengesang, wenn es dort u. a. heißt:
»Jetzt singe ich mit frohem Mund
Aus meines Herzens Lust,
ich mache von der Pfarrfrau kund,
was mir von ihr bewusst.
[…]
Ich weiß, daß sie aus Gottes Gnad
Dem Pfarrer ist beschert.
Durch sie die Kirche früh und spat
Gar große Hilf’ erfährt.
Wer wartet bis tief in die Nacht
Auf uns und lauscht dem Groll,
den als Geschenk wir heimgebracht,
ein traurig’ Protokoll.« […]53
Dieses Modell des Pfarrhauses und der »Arbeitsteilung« darin wird seit den 1960er-Jahren zunehmend infrage gestellt. Bereits 1966 wird auf einer Tagung des Evangelischen Pfarrfrauendienstes die Sorge formuliert, die zunehmende eigene Berufstätigkeit der Ehefrauen von Pfarrern könnte das Ende des evangelischen Pfarrhauses in alter Form zur Folge haben.54 Gerade einen eigenen Beruf auszuüben war für mit Pfarrern verheiratete Frauen aber von besonderer Bedeutung; denn angesichts der Tatsache, dass auch Ehen im Pfarrhaus ab den 1960er-Jahren häufiger geschieden wurden, konnten sie nur so eine eigene wirtschaftliche Absicherung unabhängig von ihrem Ehemann erreichen. Eine nur im Ehrenamt tätige Pfarrfrau hatte keine eigene Krankenversicherung und erwarb keine eigenen Ansprüche auf eine Altersversorgung.55
So kommt eine Entwicklung in Gang, in der der quasi öffentliche Charakter des Pfarrhauses mehr und mehr zurücktritt. Der Heidelberger Systematiker Heinz-Eduard Tödt konstatiert1984, mittlerweile habe sich im Pfarrhaus eine Privatsphäre herausgebildet.56
1998 heißt es im Pfarrdienstgesetz einer Landeskirche dann nur lapidar: »Das Pfarrhaus ist Dienstgebäude.« (§ 48 Abs. 1). Und 2014 kann Georg Gottfried Gerner-Wolfhard feststellen, dass das Ende bisheriger Vorstellungen vom evangelischen Pfarrhaus gekommen sei, und dass seine Zukunft die des ›leeren‹ Pfarrhauses sei, weil Pfarrer*innen Beruf und Privatleben trennen würden.57
1.4 Die »revolutionäre Zelle« – Die Alternativen Christen (AC)58
In den bewegten Tagen Ende der 1960er-Jahre wird für den Studenten Rolf R. die Begegnung mit Heiner Richter in Ludwigstal prägend. Richter leitete hier eine Beratungsstelle des »Weißen Kreuzes« (heute: »Evangelischen Fachverband für Sexualethik und Seelsorge Weißes Kreuz«), einer aus der Erweckungsbewegung entstandenen Organisation, die Menschen in Krisensituationen vor allem im Beziehungs- und Sexualbereich berät. Richter ist durch den Nationalsozialismus geprägt, bezeichnete sich als »gottgläubig«,59 fand dann aber nach dem Krieg während eines Krankenhausaufenthaltes zum Glauben. Obwohl Heiner Richter nur 17 Jahre älter ist als Rolf R., wurde er für einige Jahre für den suchenden Theologiestudenten zum Vorbild und zu einer Orientierungsfigur.
Rolf R. ist ohne Vater aufgewachsen und teilt die Erfahrung der Vaterlosigkeit mit vielen der in den 1940er-Jahren geborenen Menschen. Einige von ihnen finden in der in den 1960er-Jahren von Heiner Richter und seiner Frau gegründeten christlichen Kommunität einen Familienersatz und in Heiner Richter den ersehnten Ersatzvater.
Im Nachruf auf den verstorbenen Gründer schreibt eine Frau: »Heiner Richter war ein Lehrer, der echt lebendige Auseinandersetzungen zulassen konnte. So ein Sparringspartner für die vaterlosen Studenten damals.« Und ein anderer erinnert sich: »Mit heute 67 Jahren war ich ein ›Mann‹ der ersten Stunde und habe Heiner Richter viel zu verdanken. Hat er damals doch mein Leben als ›Ersatzvater‹ stark geprägt. Früh habe ich meinen eigenen Vater (mit 12 Jahren) verloren.« Und Rolf R. selbst betont:
»Ich traf einen, der mich ernst nahm und zuhören konnte. Er widerlegte nicht meine Theorien, an die ich mich klammerte, sondern fragte nach den Konflikten. […] es war aufregend zu sehen, wie aus der Erfahrung von Vergebung Impulse kamen zu Schritten der Versöhnung und wie andere einbezogen wurden in ein wirksames Leben unter Gottes Führung.«
Jutta und Heiner Richter
Der in den 1920er-Jahren geborene Heiner Richter meldet sich nach einer Zeit im Reichsarbeitsdienst als Kriegsfreiwilliger. Er gerät in sowjetische und amerikanische Kriegsgefangenschaft. Ab 1948 ist er Vorsitzender einer Zweigstelle des Weißen Kreuzes, ab 1950 arbeitet er dort in Vollzeit. Von1960 bis 1968 absolviert er ein Studium und wird danach erster Vorsitzender des Vereins Weißes Kreuz e. V. In dieser Zeit absolviert er eine Ausbildung zum Eheberater.
Richter ist seit den 1960er-Jahren ebenfalls Mitglied der Aktion »Sorge um Deutschland«, einer Gebetsgemeinschaft, die mit Unterschriftenaktionen gegen eine gesellschaftliche Entwicklung vorgehen will, die zu einer »Zersetzung« sowohl des Glaubens wie der Ethik führe.60 Die Aktivitäten der Aktion »Sorge um Deutschland« werden von einem Freundeskreis unterstützt, zu dem auch die Rothenfelder Evangelische Schwesternkommunität gehört, die sich im »evangelischen Sittlichkeitskampf« engagiert sieht.61 Die Mutter von Rolf R. hat sich als verwitwete Frau der Schwesternschaft angeschlossen. Seine zukünftige Frau steht der Gemeinschaft ebenfalls nahe. Auf einer der Konferenzen in Rothenfeld wird Rolf R. sie kennenlernen. »Sorge um Deutschland« arbeitet auch mit der Plakatmission der »aktion 365« zusammen, ist enger Kooperationspartner der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (AMD) und kooperiert mit der Jugendmission Davis Wilkersons, einem Zweig der charismatischen Bewegung.62 Die später von Richter gegründeten Alternativen Christen (AC) stehen zeitweise im Austausch mit Mitgliedern der sexualethischen Kommission der EKD.63
Richters Frau Jutta wird in den 1920er-Jahren als drittes von neun Kindern in Schlesien in einem lutherischen Pfarrhaus geboren. Sie legt das Abitur ab und will eigentlich Medizin studieren. Nach dem Reichsarbeitsdienst und dem Kriegshilfsdienst absolviert sie dann aber eine Lehre zur Krankengymnastin. Die Familie muss aus der Heimat fliehen und landet in einer Kleinstadt. Jutta macht im Katechetischen Seminar einer größeren Stadt eine Ausbildung zur Religionspädagogin und arbeitet in der Kleinstadt als Gemeindepädagogin. In den 1950er-Jahren heiratet sie Heiner Richter und gibt zugunsten der Familie ihre Tätigkeit als Gemeindepädagogin auf.
Heiner und Jutta Richter gründen in den 1950er-Jahren eine christliche Ehepaar- und Verlobtenschule. Sie werden zudem als Referent*innen zum Thema »Ehe und Familie« in den evangelischen Landeskirchen tätig. Das Ehepaar bekommt drei Kinder. Jutta Richter publiziert selbst unter anderem zum christlichen Eheverständnis. In ihren Schriften setzt sie sich differenziert mit den Ehevorstellungen der Zeit auseinander, spricht nur indirekt ein Nein zur vorehelichen Sexualität aus, hält aber insgesamt an einem binären Geschlechterbild fest, in dem die Frau wesentlich Mutter und Hausfrau bleibt und bereits am Tag der Eheschließung aufhören soll zu arbeiten.64 Das Buch erfährt als Longseller bis in die 1990er-Jahre hinein zahlreiche Auflagen und wird mit insgesamt über 80 000 Exemplaren verkauft.65
Anfänge und Anliegen der »Alternativen Christen« (AC)
Jutta Richter schildert in einer ihrer Publikationen, dass ihr ältester Sohn im Februar 1967 mit einem Flugblatt nach Hause kommt. Die Gruppe, die das Blatt in Umlauf bringt, will gegen restriktive Tendenzen bei der Sexualaufklärung von Schüler*innen vorgehen. Man lädt zum Vortrag eines Referenten aus Berlin ein und verspricht, Schülerinnen bei der Beschaffung der »Anti-Baby-Pille« behilflich zu sein. Das Ehepaar Richter ist alarmiert. Gegen solche Strömungen will es seine eigenen christlichen Werte setzen. Eine Konferenz für Schüler*innen und Studierende wird organisiert. Die Evangelische Schwesternkommunität Rothenfelde unterstützt das Unternehmen, indem es Mitarbeitende und ihr Gästehaus zur Verfügung stellt. Unter der Überschrift »Revolution in aller Munde – auch bei uns!« wird 1968 zur ersten Schüler*innen- und Student*innenkonferenz eingeladen. Es kommen junge Leute im Alter von 18 bis 30 Jahren aus allen Teilen der Bundesrepublik. Zwei Drittel der Teilnehmenden sind Männer, ein Drittel Frauen. Vertreten sind nicht nur Studierende und Gymnasiast*innen, sondern auch Schüler*innen von Fach-, Berufs-, Mittel- und Handelsschulen.66 Bis 1970 werden der ersten Tagung über 30 weitere gut besuchte Veranstaltungen folgen.
Damit ist ein Anfang gesetzt, ein Nukleus entstanden, aus dem die »Alternativen Christen« als Lebens- und Wohngemeinschaft hervorgehen werden. Im Hintergrund steht ein Aufbegehren gegen eine missionierend wahrgenommene atheistisch-marxistische Weltanschauung, der man als Christ*innen offensiv begegnen will. Bemerkenswert dabei ist, dass die AC die einzige evangelikale Gruppierung ist, die nicht sofort zu einer konfrontativen Abgrenzung übergeht, sondern versucht, das Bemühen um alternative Formen der Lebensgestaltung produktiv aufzunehmen.67
Die Familie Richter – das Ehepaar hat mittlerweile drei Kinder – gibt ihr eigenes Haus auf und zieht im April 1969 nach Heimbuch, um dort eine Großfamilie zu gründen.68 Auch ein Studien- und Forschungszentrum wird ins Leben gerufen. Es zeichnet sich durch konservative sozialethische Vorstellungen von Familie, Ehe und Sexualität aus und steht der evangelikalen Bewegung nahe.69
Heiner Richter geht es darum, eine »Revolution mit anderen Mitteln« zu erreichen. Was mit Schüler*innen- und Studierendenkonferenzen begonnen hat, gewinnt nun in einer Gruppe von »Alternativen Christen« Gestalt, die ein gemeinsames Leben einüben und zur Verantwortungsübernahme in Kirche und Gesellschaft befähigen wollen. Richter sieht ein Versagen der älteren Generation, die sich behaglich eingerichtet habe, und es den neuen radikalen Gruppierungen, wie beispielsweise dem SDS, überlasse, eine nicht-repressive Gesellschaft, neue Sexualnormen (wie die Anti-Baby-Pille schon für Schülerinnen) und eine tiefgreifende Umgestaltung der Gesellschaft anzustreben.70 Sein Gegenentwurf ist das spirituell geprägte Wohngemeinschaftsleben mit jungen Leuten. Einen seiner Artikel beschließt er mit den Worten: »Wir wollen nicht ablassen vom Gebet für die junge Generation, die radikalen Studenten und Schüler und uns selbst mit ihnen unter das Kreuz stellen.«71
Das Handeln der Alternativen Christen versteht Richter dabei ebenfalls als eine Revolution, die vier Grundlagen hat: »1. Die Freundschaft mit Jesus Christus 2. Der Einsatz für die Herrschaft Gottes heute 3. Die Gemeinschaft mit anderen 4. Der Kampf mit der Sünde«.72 In der Terminologie der Revolution heißt es: »Es geht heute um Herrschaftswechsel, um Umsturz aller bisher uns beherrschenden Autoritäten. Es geht um die Herrschaft Gottes und um die Verwirklichung des Willens Jesu in unserer Revolution.«73
Von Anfang an werden die Konferenzen auch als Erweckungsveranstaltungen wahrgenommen:
»Wenn nach dieser Tagung nichts geschieht, ist sie umsonst. Der Weg ist so einfach, denn Jesus wartet auf uns, uns das Leben zu geben. Er wartet auf uns, in innigste Lebens- und Liebesbeziehung mit uns zu treten. Er ist ja der Lebendige. Er ist ja unser Freund. Er ist wirklich dieser auferstandene königliche Herr. Er sucht Gefolgsleute, die Ihm zu Diensten stehen, die erfaßt sind: Welch ein Reich ist es, das wir mit ihm zu erbauen haben, dieses Reich Gottes! Dafür lohnt es sich wirklich, Opfer zu bringen. Aus den Opfern quillt das Leben.[Hervorhebung im Original, UG] Es ist doch der Wunsch unseres Herrn Jesu selber, daß überall Zellen entstünden, Kraftzellen, Glutherde in den Schulen, in dieser und jener Stadt, die anderen [sic.] erregen.«74
Und die jungen Teilnehmenden formulieren am Ende der Tagung ein Gebet, das eine Selbstverpflichtung darstellt:
»Mit Gottes Hilfe
Will ich mich täglich von
Jesus Christus revolutionieren lassen
Und dadurch in der Liebe Christi
Revolutionär werden überall,
wohin Gott mich stellt:
in meiner Familie,
in meiner Schule und Universität,
an meiner Arbeitsstelle,
in meiner Gemeinde
und in unserer Gesellschaft.«75
Der Impetus ist: Aus einer Erweckung soll die Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne Jesu Christi erfolgen. Indem er die »Grundlagen der Revolution« formuliert, greift Richter die Sprache der Jugend und vor allem der politisierten Jugend auf. Er wirbt für eine Veränderung, die aber mit Mitteln angestrebt wird, die sich von denen, die die als atheistisch-marxistisch wahrgenommene Studentenbewegung propagiert, deutlich unterscheiden. Zum Leben in der Gemeinschaft gehört es, das Revolutionäre und Andere im Zusammenleben zu erproben.
Der erste Kurs, um Mitarbeitende für diese Form der Lebensgemeinschaft auszubilden, findet im Studienzentrum im Sommer 1970 in Heimbuch statt: »Ein ausgewählter Kreis von rund 20 jungen Männern und Mädchen soll in vier Wochen eine grundlegende Ausbildung erhalten und miteinander eine revolutionäre Lebensgemeinschaft praktizieren.«76 Die Gedanken, die ein Theologiestudent, der am Kurs teilgenommen hat, zu den gemachten Erfahrungen festhält, lassen erkennen, dass die Übergabe an Gott bzw. Christus grundlegender Impuls für alles weitere Handeln ist. Es ist von »Gottes Totalitätsanspruch« die Rede.77
Die Großfamilie in Heimbuch organisiert eine eigene Konferenz-, Studien- und Seelsorgetätigkeit. Tagungen werden auch in größeren Tagungsstätten außerhalb veranstaltet. Dazu kommt die Mitarbeit bei den alltäglichen Aufgaben im Haus selbst: Kochen, Waschen, Bügeln, Putzen – Tätigkeiten, die vorwiegend von den jungen Frauen übernommen werden –, Hausmeisterei, »Tonbandarbeit und Filmverleih, Bibliothek und Archiv-Pflege, Sekretariat, … Gästebetreuung und Versandarbeit, Konferenzvorbereitung, Gartenarbeit und Druckerei mit allen dazugehörenden Nebenarbeiten«.78