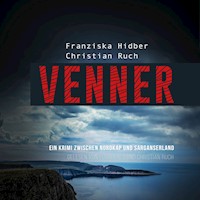Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Graubündens Geschichte während des Zweiten Weltkriegs ist aussergewöhnlich. Der Kanton war speziell betroffen von der Grenzsicherung und der Ankunft von Flüchtlingen. Aber auch die Anbauschlacht, die nationale Zensur oder die Herausforderungen im Umgang mit Spionage und vermeintlichen oder tatsächlichen NS-Sympathisanten sind Thema des Buches. Der Autor beleuchtet innerbündnerische Belange, die Wahrnehmung des Kriegs in der Bevölkerung sowie das Wissen oder Nicht-wissen über den Holocaust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1000
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Graubünden und der Zweite Weltkrieg
Alltag im Ausnahmezustand
Christian Ruch
Institut für Kulturforschung Graubünden (Hg.)
HIER UND JETZT
Einführung
Der Kriegsverlauf aus Bündner Perspektive
«Die Tragödie hat also begonnen» – Überfall auf Polen und drôle de guerre (September 1939–April 1940)
«Man kann nicht mehr froh werden» – Vom deutschen Angriff auf Nordeuropa bis zur Kapitulation Frankreichs (April–Juni 1940)
«Rundherum eingeschlossen» – NS-Deutschland als Herrscher über Europa (Juni 1940–Juli 1943)
«Ein unbeschreibliches Glücksgefühl» – Der Vormarsch der Alliierten (Juli 1943–Dezember 1944)
«Man konnte es fast nicht glauben» – Der Zusammenbruch des NS-Systems und das Kriegsende (Januar–Mai 1945)
Graubünden und der Luftkrieg
«Unerfahrenheit und Ungeschicklichkeit junger Flieger» – Luftraumverletzungen und Verdunkelung
«Dann krachte es, als ginge die Welt aus den Fugen» – Abstürze amerikanischer Bomber
«Bei seiner Landung glaubte er vorerst in Italien zu sein» – Landungen deutscher Flugzeuge
«Ein herzbetrübendes Bild sinnloser Verwüstung» – Bombenabwürfe
Das Wissen um den Holocaust
«Endlösung» – Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik
«Insel der Wissenden» – Die Schweiz und der Holocaust
«Da verschlug es unseren Leuten den Atem» – Und Graubünden?
Die Bündner Sicht auf Flüchtlinge
«Asylgewährung im Rahmen der Möglichkeiten unseres Landes» – Die rechtlichen Grundlagen und die Praxis der Schweizer Flüchtlingspolitik
«Nicht nur aus humanitären Gründen» – Die Flüchtlingslage und -politik in Graubünden
«Eine neue und wahrlich unerwartete Aufgabe» – Die Internierung von geflüchteten Soldaten und zivilen Zwangsarbeitern (1940–1945)
«Das liegt nicht im Willen der großen Mehrheit des Schweizervolkes» – Die Flüchtlingsdebatte ab Spätsommer 1942
«Echte Kinder ihres Sonnenlandes» – Die Flüchtlinge aus Italien (1943/44)
«Das Unterengadin ist ein ganzes Lazarett» – Die Flüchtlingsfrage beim Zusammenbruch des NS-Systems (1945)
Rationierungsmassnahmen und Anbauschlacht
«Einer zunehmenden Mangelwirtschaft gegenübergestellt» – Die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern
«Mit Gottes Hilfe – Auf an’s Werk!» – Die Anbauschlacht
Die Zensur
«Zur Wahrung der innern und äussern Sicherheit des Landes» – Die rechtlichen Grundlagen der Zensur
«Ein geschickter Tarnungskünstler sein» – Die Zensur der Bündner Presse 409
«Auf eigene Faust Diktatörlis spielen?» – Das Verbot des Theaterstücks «Der Mond ging unter» in Davos
«Mit Bestürzung und tiefem Unwillen» – Die Zensur der Rede von Standespräsident Gaudenz Canova
Eine «unterwürfige Haltung gegenüber dem grossmächtigen Nachbarn» – Die Kontroverse um das Bündner Bettagsmandat
«Unheilbarer Querulant und Kommunist» – Die Zensurmassnahmen gegen die Zeitschrift Neue Wege von Leonhard Ragaz
Die Abwehrmassnahmen
«Dubios! Scheint eine Spionin zu sein» – Die Abwehr von Sabotage, Spionage und Landesverrat
«Provozierend auftretende Deutsche» – Die Präsenz und die Aktivitäten der NSDAP, italienischer Faschisten und Schweizer Frontisten
Die vermeintlichen Anpasser
«Als Landesverräter medial hingerichtet» – Der Fall Hans Konrad Sonderegger
«Agent für nationalsozialistische Kulturpropaganda» – Der Fall John Knittel
«Unschweizerische Methoden der Pressedressur» – Die Eingabe der Zweihundert
Der Krieg der Presse, Pfarrer und Parteien
«Falsche Propheten» – Politische und konfessionelle Konfliktlinien
Schlussbetrachtung
Anhang
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Dank
Einführung
Als die Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK), auch bekannt als Bergier-Kommission, in den Jahren 2001 und 2002 ihren Abschlussbericht und zahlreiche Detailstudien vorlegte, konzentrierten sich die Resultate aufgrund der zeitlich wie finanziell und personell limitierten Ressourcen weitgehend auf die Gebiete der Wirtschafts- und Finanz- sowie der Flüchtlingspolitik. Eine Forschung, die bis auf die regionale oder sogar lokale Ebene durchgedrungen wäre, konnte so gut wie nicht umgesetzt werden. Deshalb war es naheliegend, dass die Kommission «auf die Stimulierung weiterer Arbeiten» hoffte.1 In Graubünden löste dies allerdings keinen grossen Forschungsboom aus, wie auch Jürg Frischknecht wenige Jahre nach dem Ende der UEK feststellen musste: «Die Jahre des Zweiten Weltkriegs» seien «in Graubünden noch wenig erforscht […], ungleich weniger als etwa im Kanton Tessin». Und er zitierte den Bündner Historiker Georg Jäger mit den Worten: «Generell ist die Zeitgeschichte Graubündens seit dem Ersten Weltkrieg wenig oder nur punktuell erforscht» und «die Flüchtlingspolitik» sei «eine der grössten Lücken in der Geschichtsschreibung unseres Kantons».2 Es entstanden zwar noch vor Abschluss der UEK vereinzelt Arbeiten zu Teilaspekten des Zweiten Weltkriegs wie etwa das Büchlein von Martin Bundi zu «Bedrohung, Anpassung und Widerstand» oder die Untersuchung zu den polnischen Internierten von Bettina Volland, doch umfassendere Darstellungen blieben aus. Auch das vierbändige «Handbuch der Bündner Geschichte» widmete dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Zeilen.3
Daran mitzuwirken, diese Lücke zu schliessen, ist Aufgabe dieser Untersuchung. Wobei betont werden muss, dass mit den parallel zu diesem Projekt laufenden Forschungen von Andrea Paganini, Mirella Carbone und Joachim Jung viel dazu beigetragen wird, die Jahre zwischen 1939 und 1945 in Graubünden besser zu erhellen. Wertvolle Erkenntnisse liessen sich auch aus bereits abgeschlossenen Untersuchungen von Adriano Bazzocco und Andrea Tognina4 sowie aus Arbeiten von weiteren Forschenden gewinnen.
Was diese Untersuchung nicht leistet: Sie ist keine Gesamtdarstellung Graubündens im Zweiten Weltkrieg. Wichtige Bereiche wie die bereits gut aufgearbeitete Militärgeschichte, der Tourismus, der Verkehr (so etwa die wirtschaftlichen Probleme der Rhätischen Bahn), die Substitutionsbemühungen im Treibstoffsektor durch die Hovag in Domat/Ems, zu der Regula Bochsler ein wichtiges Werk vorgelegt hat,5 die Expansion der Elektrizitätswirtschaft oder auch die Funktion und Rolle der Bündner Frauen bleiben, wiederum aus Gründen begrenzter Ressourcen, weitgehend ausgespart. Stattdessen fokussiert diese Arbeit auf ausgewählte Bereiche, in denen die Menschen in Graubünden ganz direkt mit den Auswirkungen des Krieges konfrontiert wurden und darüber kommunizierten. Der Begriff der Kommunikation ist dabei im Anschluss an den deutschen Soziologen Niklas Luhmann viel weiter gefasst als im üblichen Gebrauch – er umfasst alle Operationen, die zur Entstehung und Erhaltung eines sozialen Systems beitragen. Kommunikation als «die einzige genuin soziale» Operationsform ist nach Luhmann «die kleinstmögliche Einheit» eines sozialen Systems.6
Konkret geht es um folgende Fragestellungen:
Wie nahmen Bündnerinnen und Bündner den Kriegsverlauf wahr? Wie reagierten die gesellschaftlichen Funktionssysteme Politik und Medien?
Was wusste man von der geradezu industriell betriebenen Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden?
Wie reagierte man auf die Flüchtlingswellen, die Graubünden erreichten?
Mit welchen Massnahmen versuchte man, dem Mangel an lebenswichtigen Gütern zu begegnen?
Wie wurde der Plan Wahlen, die sogenannte Anbauschlacht, wahrgenommen?
Wie gestaltete sich die Berichterstattung in den Zeitungen, aber auch das politische und kulturelle Leben unter den Prämissen der Zensur?
Wie verhielt man sich angesichts möglicher Spionage und Sabotageakte gegenüber tatsächlichen und vermeintlichen Nazis, NS-Sympathisanten und Anpassern?
Und schliesslich: Warum kam es trotz aller kriegsbedingten Herausforderungen zeitgleich zu einem heftigen Propaganda-«Krieg» der Pfarrer, Presse und Parteien?
Kontinuität und Kontingenz
Bevor, ausgehend von den eben formulierten Fragestellungen, auf die konkreten Inhalte eingegangen wird, folgt einleitend die Skizzierung des theoretischen Rahmens, in dem die Untersuchung sich bewegt. Sie orientiert sich sozusagen leitmotivisch an den Begriffen Kontinuität und Kontingenz. Kontinuität soll in einem soziologisch-systemtheoretischen Kontext so verstanden werden, dass gesellschaftliche Funktionssysteme (z. B. Politik, Wirtschaft oder Medien) auf gewohnte und eingespielte Formen der Umweltbeobachtung und Systemerhaltung zurückgreifen können. Man könnte hier auch von Konstanz oder Invarianz sprechen. Mit Blick auf den Kanton Graubünden Mitte des 20. Jahrhunderts zählen dazu beispielsweise Verfahren wie Wahlen und Abstimmungen, Presse- und Gewerbefreiheit, aber auch traditionelle landwirtschaftliche Anbaumethoden und weiteres. Kontinuität (bzw. Konstanz oder Invarianz) kann man in diesem Sinne als «Operationalisierungserfordernis von Einschränkung» und damit als «Ausschaltung anderer Möglichkeiten»7 verstehen.
Diese anderen Möglichkeiten sollen als Kontingenz bezeichnet werden. Niklas Luhmann definierte Kontingenz als «etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet mithin Gegebenes (Erfahrenes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen.»8 Kontingenz ist also das auch anders Mögliche, das, wenn es eintritt, Kontinuität zumindest vorübergehend beendet und die aus ihr resultierenden Erwartungen enttäuscht.9
Nun liesse sich gegen den Kontingenzbegriff einwenden, dass er im Falle von Geschichte als Beobachtung von Beobachtung, also eine Beobachtung zweiter Ordnung, insofern banal beziehungsweise sinnlos ist, als das beobachtete Beobachten und Handeln immer kontingent ist. Darin unterscheidet sich Handeln von basalen biologischen, nicht-kontingenten Erfordernissen und Eigenschaften, die beispielsweise das Überleben eines Organismus sichern. Die Kontingenz des Handelns und der Systemprozesse auszuschliessen hiesse im Endeffekt auf Konzepte wie Schicksal, Vorbestimmung oder Teleologie zurückzugreifen. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Kontingenz, obschon theoretisch unendlich, in den jeweiligen Funktionssystemen Grenzen hat. Man kann also eine unendliche Kontingenz mitdenken, sie ist aber für das Funktionieren des Systems nicht mehr verfügbar. Niklas Luhmann hat dafür den Begriff der Kontingenzformel gewählt. Eine Kontingenzformel «zielt darauf ab, andere Möglichkeiten, die auch gegeben sind, zu unterdrücken». Diese «unterdrückte» Kontingenz «mag als mitlaufendes Wissen reproduziert werden, kann aber nicht mehr in Anspruch nehmen, den Sinn des Systems zu fixieren. Die offizielle Kommunikation orientiert sich an den Vorgaben der Kontingenzformeln und operiert damit auf der sicheren Seite vorgesehener Akzeptanz.»10 An anderer Stelle sprach Luhmann auch von «Stilvorschriften für die Bestimmungsleistungen» des jeweiligen Systems. Die Kontingenzformeln «müssen für eine unbestimmte Vielzahl von Situationen gelten, aber in jeder Situation etwas besagen, das heißt: etwas ausschließen und einschränkende Kommunikationen anleiten können».11
Eine Kontingenzformel ist also, etwas einfacher formuliert, eine Art «Totschlag-Argument, die Stoppregel für jeden weiteren Diskurs. Man akzeptiert oder verlässt den Handlungszusammenhang», denn «wer das letzte Argument, den letzten Grand, nicht akzeptiert, kann nicht weiter mitspielen. Er muss sich dann ein anderes Sprachspiel als Teilsystem der Gesellschaft suchen, in dem sein Problem besser gelöst wird.»12 Dazu einige Beispiele: Eine theistische Religion kommt definitionsgemäss nicht ohne die Kontingenzformel Gott aus.13 «Tritt im Religionssystem ein Ereignis ein, das allen religiösen Erwartungen und Rationalitäten widerspricht, d. h. das alle religiösen Erwartungen enttäuscht – wie beispielsweise das Erdbeben von Lissabon [im Jahre 1755] – dann gibt es nur ein Argument: Gott, der Unergründliche. Zweifelt irgendeiner an dem Inhalt einer Offenbarung, die in der heiligen Schrift (Bibel, Tora oder Koran) belegt ist, gibt es, wenn alle hermeneutisch exegetischen Argumente nicht geholfen haben, nur noch ein Argument: Gott.»14 Niklas Luhmann hat noch weitere Kontingenzformeln formuliert, so etwa Legitimität im Funktionssystem Politik,15 Lernziele im Bereich Bildung oder Gerechtigkeit im Funktionssystem Recht.16 Für die Wirtschaft hat Luhmann die Kontingenzformel Knappheit vorgeschlagen,17 und zwar, was die Neuzeit betrifft, als eine doppelte: Knappheit der Güter und Knappheit des Geldes,18 womit getreu der Formel, dass Zeit Geld ist, auch die Knappheit an Zeit subsumiert wäre. Jedenfalls liefert die Kontingenzformel Knappheit innerhalb des Funktionssystems Wirtschaft die Begründung für «Lieferschwierigkeiten, Hungersnöte, Ungerechtigkeiten in der Distribution von erwirtschafteten Gütern u.v.m. In dieser Form werden dann die Probleme der Wirtschaft, und das sind Versorgungsprobleme in der Gesellschaft, einerseits diskutierbar und andererseits jedem Diskurs entziehbar. Denn Mangel oder Knappheit der Güter macht jeden mundtot, der dagegen angehen will.»19 Auf politische Forderungen wie etwa Klimaschutz, eine bessere Gesundheitsversorgung oder Verteidigung, Kulturförderung, Ausbau von Infrastruktur und weiteres kann eigentlich immer mit dem Hinweis auf knappe finanzielle Ressourcen gekontert werden.
Kontingenzformeln 1939–1945
Welche Kontingenzformeln lassen sich nun in der Öffentlichkeit – verstanden als «gesellschaftsinterne Umwelt der gesellschaftlichen Teilsysteme»20 – und der Gesamtgesellschaft Graubündens (bzw. der Schweiz) zur Zeit des Zweiten Weltkriegs beobachten? Was waren die «Totschlag-Argumente» der Jahre 1939 bis 1945? Zunächst einmal der Krieg an sich. «Im Krieg», so der Historiker Ian Kershaw in seiner wegweisenden Hitler-Biografie, «fand der Nationalsozialismus zu sich selbst»,21 denn der Krieg war für Hitler «das unabänderliche Gesetz des ganzen Lebens».22 Mit ihm fiel nun die Maske der angeblichen Friedensbemühungen, endete die «grandiose Selbstverleugnung» (Hans-Adolf Jacobsen),23 entfesselte das NS-System den lange geplanten, gnadenlosen Kampf der vermeintlich überlegenen arischen Rasse um den ihr angeblich zustehenden Lebensraum im Osten und nahm die rassenideologisch motivierte Neuordnung Europas mit dem Deutschen Reich als kontinentaleuropäischer Hegemonialmacht buchstäblich ihren Anfang. Das war weit mehr als eine Korrektur des sogenannten Schmachfriedens von Versailles.
Unter diesen Prämissen konnte dieser Krieg nur ein totaler sein, nahm er doch auf die Zivilbevölkerung keinerlei Rücksicht. Total war dieser Krieg daher vom ersten Tag an, also lange bevor Reichspropagandaminister Goebbels in seiner berüchtigten Sportpalastrede vom 18. Februar 1943 den Totalen Krieg proklamierte. Schon der Erste Weltkrieg hatte für die involvierten Staaten die Züge eines Totalen Krieges getragen, indem nun das Kriegsgeschehen nicht nur unmittelbar entlang der Front Auswirkungen auf Bevölkerung und Funktionssysteme hatte, sondern auf die gesamte Gesellschaft eines kriegführenden Staates. So war es auch kein Zufall, dass im Ersten Weltkrieg in Deutschland der Begriff der «Heimatfront» aufkam.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen hatte General Erich Ludendorff 1935 in seinem Buch «Der totale Krieg» geschrieben: «Das Wesen des totalen Krieges beansprucht buchstäblich die gesamte Kraft eines Volkes, wie er sich gegen sie richtet.» Wie schon im Ersten Weltkrieg würden die feindlichen Mächte auch in einem zukünftigen Krieg danach trachten, «die seelische Geschlossenheit des Deutschen Volkes zu zerstören».24 Diese «seelische Geschlossenheit» sei «die Grundlage des totalen Krieges». Sie «allein befähigt das Volk, der schwerringenden Wehrmacht immer neue seelische Kraft zuzuführen, für die Wehrmacht zu arbeiten und in dem Ungemach des Krieges und unter den feindlichen Kriegshandlungen selbst sieg- und widerstandsfreudig zu sein».25 Erreicht werden könne die «seelische Geschlossenheit» nur «auf dem Wege der Einheit von Rasseerbgut und Glaube und sorgsamer Beachtung der biologischen und seelischen Gesetze und Eigenschaften des Rasseerbgutes».26
Ludendorffs Buch, das nach nur zwei Jahren eine Auflage von 100 000 Exemplaren erreichte, hat Goebbels’ Sportpalastrede zweifellos stark beeinflusst.27 Auch innerhalb des Oberkommandos der Wehrmacht sah man «Wehrmacht, Heimat und Volk durch ihre Wechselwirkung zu einem unteilbaren Ganzen verflochten».28 Goebbels hätte den Begriff des Totalen Krieges gerne bereits vor 1943 eingesetzt, war er doch der Überzeugung: «Das deutsche Volk wird es uns niemals übelnehmen, wenn es durch einige Monate in Lumpen gehen muß; es wird es uns aber nie verzeihen, wenn es sein ganzes Leben hindurch das Leben eines Bettlers führen muß!»29 Dies wäre jedoch dem unausgesprochenen Ziel nationalsozialistischer Politik, so etwas wie eine «Gefälligkeitsdiktatur» für die Deutschen zu sein, zuwidergelaufen und scheiterte am polyzentrischen Herrschaftssystem des Nationalsozialismus. Erst das Ende des sogenannten Blitzkriegs und die desaströsen Entwicklungen in Nordafrika sowie an der Ostfront (Stichwort Stalingrad) ermöglichten Goebbels im Berliner Sportpalast schliesslich die Ausrufung des Totalen Krieges: «Der Heldenkampf unserer Soldaten an der Wolga soll für jeden eine Mahnung sein, das Äußerste zu tun für den Kampf um Deutschlands Freiheit und unseres Volkes Zukunft und damit im weiteren Sinn für die Erhaltung unseres ganzen Kontinents. […] Aus den Breiten und Tiefen unseres Volkes dringt der Schrei nach totalster Kriegsanstrengung im weitesten Sinne des Wortes an unser Ohr.»30 Das alles gipfelte in den berühmt gewordenen Worten: «Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?»,31 worauf die Zuhörenden bekanntlich mit fanatischer Begeisterung reagierten.
Jenseits nationalsozialistischer und völkisch-rassistischer Ideologie und des mit ihr einhergehenden Fanatismus lässt sich der Totale Krieg sozialwissenschaftlich durch folgende Merkmale charakterisieren:
«totale Kriegsmethoden» durch eine hocheffiziente, industriell generierte Kriegstechnologie mit hohem Vernichtungspotenzial;
«totale Kriegsziele» mit der Absicht einer bedingungslosen Kapitulation wenn nicht sogar Vernichtung des Gegners;
«totale Mobilisierung» von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, selbstverständlich inklusive der «Heimatfront», so etwa Aufbau einer Kriegswirtschaft;
damit verbunden: die «totale Kontrolle» aller gesellschaftlichen Bereiche.
32
Damit sei die Frage verbunden, inwiefern die Schweiz trotz ihrer Neutralität vom Totalen Krieg betroffen war. Was die Kriegstechnologie betrifft, war die Schweiz vom Rüstungsniveau der Wehrmacht weit entfernt (man denke etwa an die Luftwaffe). Das Land wäre keinesfalls in der Lage gewesen, technologisch einen Totalen Krieg zu führen. Die Schweiz war aber insofern von «totalen Kriegsmethoden» betroffen, als sie hin und wieder – ob versehentlich oder nicht, sei momentan noch dahingestellt – das Vernichtungspotenzial der US-Bomberflotten zu spüren bekam, die nicht umsonst «Fliegende Festungen» genannt wurden. Das traf auch auf Graubünden zu. Das «totale Kriegsziel» wiederum wäre im Falle eines deutschen Angriffs zweifellos die bedingungslose Kapitulation der Schweiz gewesen. Eine «totale Mobilisierung» war zwar nicht permanent militärisch, aber insofern gegeben, als der Krieg vor allem in den Jahren 1939 bis 1943 das alles beherrschende gesellschaftliche Referenzthema, eben: die Kontingenzformel, war. Dem Krieg war alles andere unterzuordnen, an ihm hatte sich praktisch jedes gesellschaftliche Funktionssystem auszurichten und auf dessen Kontingenz zu reagieren: die Armee durch Vorbereitungen auf den Ernstfall eines Angriffs, die Landwirtschaft durch Reglementierung, Mehranbau und Massnahmen gegen den Personalmangel, die Presse durch eine zurückhaltende Berichterstattung beziehungsweise bei deren Missachtung durch Zensur, die Wirtschaft durch Rationierungsmassnahmen und so weiter. Insofern gab es zumindest Tendenzen in Richtung einer «totalen Kontrolle», auch wenn die Schweiz selbstverständlich ein demokratisch organisierter Staat blieb.
«Obwohl weitgehend in der Zuschauerrolle», sei die Schweiz «dennoch vom Krieg geprägt» gewesen, so Georg Kreis. Dies in Form von langen Militärdienstperioden und Versorgungsengpässen sowie aufgrund der geografisch und aussenpolitischen Existenz «in einem ausgesprochen feindlichen Umfeld».33 Kurzum: Auch die neutrale Schweiz konnte sich dem Totalen Krieg nicht entziehen und an der Kontingenzformel Krieg scheint damit kein Weg vorbeigeführt zu haben. Es liess sich allenfalls im privaten Bereich noch so tun, als sei kein Krieg – in der Kommunikation über Funktionssysteme war dies hingegen undenkbar. Die in Igis-Landquart aufgewachsene Zeitzeugin Annamaria Hartmann, deren Erinnerungen eine wichtige Quelle dieser Arbeit darstellen, schrieb: «Die Jahre des Zweiten Weltkrieges – also ein beträchtlicher Teil unserer Jugendzeit – sind für meine Generation etwas Ausserordentliches gewesen. […] Es waren für unser Land und uns Verschonte fast sechs beklemmende Jahre grosser Verunsicherung, Isolation und unklarer Zukunftsaussichten.»34
Allerdings stellt sich die Frage, ob die Kontingenzformel Krieg bis 1945 Gültigkeit besass. Es soll hier die These vertreten werden, dass spätestens mit dem Vordringen der Alliierten in Italien ab Sommer 1943 die Kontingenzerwartung dahingehend erweitert werden konnte beziehungsweise werden musste, dass eine Niederlage Deutschlands und damit das Kriegsende als Erwartungshorizont denk-, erwart- und einkalkulierbar wurde, nun also wieder Kontingenz jenseits des Kriegszustands existierte. Georg Kreis hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass man bereits 1943/44 mit «der markanten Intensivierung der Debatte um die innenpolitische wie die internationale Nachkriegsordnung» einen «frühen Aufbruch in die Nachkriegszeit […] in verschiedenen Bereichen ausmachen» konnte. Schon im Herbst 1942 schuf beispielsweise das Eidgenössische Politische Departement (heute: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) eine Abteilung für die diversen Nachkriegskonzeptionen im Ausland.35
Man könnte angesichts dieser zeitlich anscheinend nur eingeschränkten Gültigkeit der Kontingenzformel Krieg natürlich auch andere Kontingenzformeln in Erwägung ziehen, zum Beispiel jene der Bedrohung. Aber zum einen wich das Bedrohungsgefühl spätestens mit dem Aufbrechen der Schweizer Isolation durch die Ankunft der US-Streitkräfte an der Landesgrenze bei Genf im September 1944, zum anderen scheint bei näherer Betrachtung die Kontingenzformel Bedrohung keine gesamtgesellschaftliche Gültigkeit gehabt zu haben: Laut Georg Kreis war die Bedrohung zwar «ein objektives Faktum», «subjektiv wurde sie aber nicht von allen in der Schweiz gleich wahrgenommen».36 So wurde das Dritte Reich etwa im Bereich des Frontismus als alles andere als bedrohlich empfunden. Zudem hatte der Krieg auch faszinierende Facetten: Die Kontingenz in Form von abgestürzten US-Bombern, deren Trümmern man sich abenteuerlustig nähern konnte, aber auch von «Militäreinquartierungen, all den Umstellungen und Improvisationen, den gelegentlichen Turbulenzen», machten das Leben «spannend, ja manchmal gar prickelnd», so Annamaria Hartmann.37
Für den Bereich der Wirtschaft hat Luhmann wie bereits erwähnt die Kontingenzformel Knappheit vorgeschlagen. Sie wandelte sich unter Kriegsbedingungen zunehmend zum Mangel. Annamaria Hartmann erzählt, wie sie zu Kriegsbeginn neue Halbschuhe bekam und die Erwachsenen diese mit den Worten «Noch gutes Leder, wer weiss wie lange» kommentierten.38 Auch der behördlich verordnete Notvorrat stimmte auf Mangel ein.39 Der Mangel war also bereits ein Thema, als er noch gar nicht effektiv verbreitet war – und damit wurde er zur Kontingenzformel.
Für den Umgang mit Flüchtlingen soll, da es sich um einen Teilaspekt des Politischen handelt, auf die Kontingenzformel Legitimität zurückgegriffen werden. Legitimität soll im Anschluss an Luhmann verstanden werden «als eine generalisierte Bereitschaft, inhaltlich noch unbestimmte Entscheidungen innerhalb gewisser Toleranzgrenzen hinzunehmen. Damit bleibt aber offen, ob dieser Bereitschaft ein relativ einfaches psychologisches Motiv zugrunde liegt – etwa eine innere Befriedigung über einen Tausch von Gehorsam gegen ‹demokratische› Beteiligung – oder ob sie das Ergebnis einer Vielzahl von sozialen Mechanismen ist, die sehr heterogene Motivkonstellationen egalisieren.»40 Dabei müsse «deutlich unterschieden werden zwischen Akzeptieren von Entscheidungsprämissen und Akzeptieren von Entscheidungen selbst. Diese Unterscheidung ist besonders deshalb wichtig, weil der legitimierende Entscheidungsprozeß unter Ja/Nein-Bedingung operiert. Es macht einen großen Unterschied aus, ob diese Bedingung nur auf die Entscheidungsprämissen oder auch auf die Entscheidungen selbst angewandt wird. Man kann die Prinzipien und Normen bejahen, aus denen eine Entscheidung ‹gefolgert› wird, und die Entscheidung selbst doch ablehnen, weil sie logisch falsch oder auf Grund falscher Auslegungen oder falscher Tatsachenannahmen zustande gekommen sei. Und umgekehrt kann man Entscheidungen akzeptieren, ohne sich um die Werte zu kümmern, auf die sie sich berufen, in völliger Indifferenz, ja vielleicht unter Ablehnung ihrer Gründe als allgemeiner Entscheidungsregeln.»41
Legitimität wird, anders formuliert, «in der Sprache von Wertbeziehungen ausgedrückt», doch da diese «keine Direktiven für den Fall der Wertkonflikte enthalten, bleibt für alle praktisch-politisch relevanten Fragen ein Abwägungs- und Entscheidungsbedarf, der nur situationsabhängig, nur im Blick auf Durchsetzbarkeit, nur opportunistisch befriedigt werden kann. Legitimität ist also immer: Mitlegitimation des Opportunismus», so Luhmann.42 Mit anderen Worten: Legitimität ist «in ihrer Struktur abgestimmt auf die Autopoiesis [also die Selbsterhaltung und -reproduktion] des politischen Systems und auf dessen strukturelle Kontingenzen».43 Gerade dafür bietet die Schweizer Flüchtlingspolitik ein beredtes Beispiel: Der «Wertkonflikt» bestand im Widerstreit zwischen Mitmenschlichkeit und Schweizer Asyltradition einerseits und Sicherheit und Schutz vor «Überfremdung» andererseits, was die Flüchtlingspolitik strukturell kontingent werden liess. Diese Kontingenz wurde durch die Kontingenz von aussen – die sich verändernde politische Lage beziehungsweise die Kriegssituation mit den entsprechenden Auswirkungen in Form von Zu- oder Abnahme der Flüchtlingsströme – noch gesteigert.
Ähnliches zeigt sich im Bereich der Sicherheitspolitik mit Blick auf Spionage und Sabotage, nationalsozialistische und faschistische Umtriebe, Anpassungstendenzen, aber auch die unter Zensur gestellte Kriegsberichterstattung in den Medien. Auch hier sollen Wertkonflikte zwischen aussenpolitischer Rücksichtnahme und Pressefreiheit, Offenheit einer demokratischen Gesellschaft und Bekämpfung totalitärer Bewegungen (oder zumindest totalitärer Tendenzen) dargestellt werden, die im Rahmen des Legitimitätsdiskurses behandelt werden mussten – sofern es überhaupt zu einem solchen Diskurs kam. Denn die Kontingenzformel Krieg bot auch immer wieder die Möglichkeit, nicht diskutieren zu müssen, und sei es nur, weil man nicht diskutieren wollte.
Legitimation durch Verfahren
Luhmann hat Legitimität «als Korrelatbegriff zu Demokratie» verstanden.44 Hier gilt es nun zwischen Legitimität und Legitimation zu unterscheiden. Legitimität ist wie bereits ausgeführt die andere Kontingenzen ausschliessende Kontingenzformel; Legitimation macht diese Legitimität erst möglich, indem sie zugesteht, dass «Kontingenz notwendig ist – aber eben nicht in beliebiger Form. […] Operativ gesehen ist Legitimation immer Selbstlegitimation», denn sie muss «durch politische (als politisch erkennbare) Kommunikationen vollzogen werden», was etwa eine Legitimation durch das Funktionssystem Religion in der modernen Gesellschaft ausschliesst.45 Stattdessen erfolgt die Legitimation durch Werte, die aber wie gesagt in Konkurrenz zueinander stehen können und deren Gewichtung sich im politischen Diskurs unter gegebenen Bedingungen ändern können, man denke etwa an die Einführung des Vollmachtenregimes am Vorabend des Zweiten Weltkriegs mit seiner Kompetenzverlagerung von der Legislative zur Exekutive. Im politischen System der Schweiz war der Krieg zwar noch nicht zur Kontingenzformel geworden, dominierte aber den Erwartungshorizont: «Die Hoffnung der Völker, dass sie [die grosse politische Spannung] sich auf friedlichem Wege beilegen lasse, erscheint unsicher; wir müssen mit den Gefahren eines Krieges rechnen. Sollte er wirklich ausbrechen, so ist nicht abzusehen, ob er nicht die Ausdehnung des Weltbrandes der Jahre 1914–1918 annehmen könnte. […] Wir müssen Sie deshalb heute wiederum, wie zu Beginn des Weltkrieges im August 1914, ersuchen, uns eine allgemeine Vollmacht zu erteilen, um jederzeit diejenigen Massnahmen rechtzeitig treffen zu können, die aus den Ereignissen erforderlich sind. Wir werden uns bei Handhabung dieser Vollmacht selbstverständlich an die Verfassung und die bestehende Gesetzgebung halten, soweit es möglich ist; aber es liegt im Sinne der ausserordentlichen Ermächtigung, dass wir nicht unter allen Umständen an diese Schranken gebunden sein können», so der Bundesrat am 29. August 1939 in seiner an die Bundesversammlung gerichteten Botschaft zu den «Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechthaltung der Neutralität».46
Der aus Stampa im Bergell stammende Jurist Zaccaria Giacometti, Dozent für Öffentliches Recht an der Universität Zürich, kritisierte dieses Vorgehen des Bundesrates als verfassungswidrig. Zwar bedinge der Krieg durchaus, «wie die historische Erfahrung zeigt, eine Konzentration der staatlichen Macht bei der Exekutive»,47 doch werde deren zweifelhafte rechtliche Basis kaum diskutiert: «Die Vollmachten sind gewissermaßen Tabu. Sie erscheinen für viele gleichsam als jenseits von Gut und Böse stehend.»48 Eine derartige «Notrechtskompetenz von Staatsorganen» sei «nur dann rechtlich zulässig», wenn sie die jeweilige Verfassung vorsehe.49 Giacomettis Fazit: Das Vollmachtenregime sei «zwar politisch notwendig aber nicht legal», da «die geltende Bundesverfassung keine Notrechtkompetenzen enthält».50 Diese Kritik fand zwar damals keine mehrheitliche Zustimmung, ihr wurde aber insofern Gehör verschafft, als heute mit Art. 185 BV dem Bundesrat innerhalb der Bundesverfassung Notrechtskompetenz zugestanden wird – und zwar, wie schon Giacometti forderte, ein «intrakonstitutionelles», also nicht nur verfassungskonformes, sondern auch durch die Bundesverfassung selbst begrenztes «Notrecht».51
Möchte man sich Giacomettis Kritik anschliessen, liesse sich feststellen, dass das Vollmachtenregime während des Zweiten Weltkriegs sich zwar legitimieren liess (also Legitimität besass), aber nicht legal war. Was stattdessen geschah, könnte man mit Luhmanns berühmt-berüchtigtem Begriff der «Legitimation durch Verfahren»52 bezeichnen. Berühmt-berüchtigt deshalb, weil Luhmann vorgeworfen wurde, durch den Verzicht auf Begriffe wie Wahrheit oder Gerechtigkeit als Grundlage von Legitimation beziehungsweise Legitimität auch politische Unrechtssysteme wie das nationalsozialistische Deutschland mit seinen Vernichtungslagern legitimieren zu können. «Natürlich sollte man sich nicht in eine Position begeben, die solche Einrichtungen, wenn auch nur aus Versehen, mitlegitimiert.»53 Doch könne «kein politisches System […] seine Stabilität vom Erreichen so hoch gespannter Ziele» wie Wahrheit und Gerechtigkeit «abhängig machen», denn eine solche Auffassung verkenne, «die hohe Komplexität, Variabilität und Widersprüchlichkeit der Themen und Entscheidungsprämissen, die im politisch-administrativen System moderner Gesellschaften jeweils behandelt werden müssen. Dieser Komplexität moderner Gesellschaften kann nur durch Generalisierung des Anerkennens von Entscheidungen Rechnung getragen werden. Es kommt daher weniger auf motivierte Überzeugungen als vielmehr auf ein motivfreies, von den Eigenarten individueller Persönlichkeiten unabhängiges (und insofern wahrheitsähnliches!) Akzeptieren an, das ohne allzuviel konkrete Information typisch voraussehbar ist. Der Begriff des Akzeptierens muß entsprechend formalisiert werden. Gemeint ist, daß Betroffene aus welchen Gründen immer die Entscheidung als Prämisse ihres eigenen Verhaltens übernehmen und ihre Erwartungen entsprechend umstrukturieren. Ein solcher Einbau neuer Erwartungsstrukturen in die alte, identisch bleibende Persönlichkeit kann auf sehr verschiedene Weise geschehen und mehr oder weniger zentrale Persönlichkeitsstrukturen betreffen: durch Überzeugungswandel, Abstraktion von Regeln der Erlebnisverarbeitung, Umdeutung der Vergangenheit, Isolierung und Abkapselung der problematischen Themen, Bagatellisierung, weltmännische Resignation, Anlehnung an neue Umwelten usw.»54
Bei der Legitimation durch Verfahren geht es im Kontext der vorliegenden Arbeit (auch) immer wieder um Verwaltungsentscheidungen, so etwa im Bereich der Flüchtlingspolitik oder der Zensur. Dabei gilt: «Je höher die Komplexität eines Systems ist, die durch interne Prozesse abgearbeitet werden muß, desto zwingender wird eine systemimmanente Eigengesetzlichkeit, die in Organisationsformen und Verfahrensweisen Berücksichtigung erheischt. Damit wird es zunehmend schwieriger und eine Belastung für die erreichbare Rationalität, den Verwaltungsverfahren auch noch legitimierende Funktionen abzuverlangen.»55
Hinzu kommt das Moment der Enttäuschung. «Strukturen reduzieren die äußerste Komplexität der Welt auf einen stark verengten und vereinfachten Bereich von Erwartungen, die als Verhaltensprämissen vorausgesetzt und normalerweise nicht hinterfragt werden. Sie beruhen also immer auf Täuschungen, nämlich auf Täuschung über die wirkliche Komplexität der Welt, insbesondere über das wirkliche Handlungspotential der Menschen, und sie müssen deshalb auf Enttäuschungen eingerichtet sein.» Normalerweise ist das kein Problem, denn es lassen sich zwar Enttäuschungen «nicht wirksam ausschließen, aber Erwartungen können gleichwohl ziemlich enttäuschungsfest stabilisiert werden, wenn feststeht, daß die Erwartungen ‹trotzdem weitergelten werden› und dem Erwartenden Regeln für sein Verhalten im Enttäuschungsfalle an die Hand gegeben werden».56 Dies mag in Friedenszeiten gelten – da aber das Verfahren wie im Bereich der Flüchtlingspolitik aufgrund einer hochkontingenten Situation in Form von Aufnahme oder Rückweisung über Leben und Tod entschied, liefen Regeln für das «Verhalten im Enttäuschungsfalle» ins Leere und konnten den fluchtwilligen Menschen erst recht in Lebensgefahr bringen.
Gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik wird deutlich, dass das Vollmachtenregime nicht nur eine Machtverlagerung von der Legislative zur Exekutive darstellte, sondern auch von den Kantonen an den Bund. Es ist wohl kein Zufall, dass in der Botschaft vom 29. August 1939 die Kantone mit keinem Wort erwähnt wurden. Sie wurden mehr oder weniger zu einer Vollzugsinstitution degradiert, deren Regierung man bei unerwünschtem Verhalten rügen und in deren Verfahren man eingreifen konnte, wie die in dieser Arbeit dargestellten Fälle des Bündner Bettagsmandats 1943 und der Zensur der Rede von Standespräsident Gaudenz Canova zeigen. In der Flüchtlingspolitik hatte das Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer von 1931 den Kantonen grosse Autonomie eingeräumt, weil sie es waren, die nicht erwerbstätigen Ausländern Aufenthalt und Niederlassung gewährten. Allerdings konnte die Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) gegen kantonale Bewilligungen Einspruch erheben. Diese Kompetenz der Kantone führte dazu, dass bei der Flüchtlingswelle von 1938 nach dem «Anschluss» Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland eher aufnahmebereite Kantone den restriktiven gegenüberstanden, also keine «unité de doctrine» in der flüchtlingspolitischen Praxis herrschte. Mit Einführung der allgemeinen Visumspflicht unmittelbar nach Kriegsbeginn zog der Bund die flüchtlingspolitische Kompetenz an sich. So sah der Bundesratsbeschluss über die Änderungen der fremdenpolizeilichen Regelung vom 17. Oktober 1939 vor, dass der Bund Kantone dazu verpflichten konnte, Ausländerinnen und Ausländer auf ihrem Gebiet zu dulden, sofern und solange er oder sie «nicht aus der Schweiz entfernt werden kann», oder aber rechtswidrig eingereiste Personen auszuweisen.57 «Damit gewann der Bund gegenüber den Kantonen deutlich an Entscheidungskompetenz», es kam zu einer «Machtkonzentration bei der Polizeiabteilung des EJPD». Von den Kantonen «gab es keine prinzipielle Opposition gegen die Wegweisungspolitik des EJPD»58 – das Ansinnen des Bundes, die Flüchtlingspolitik einer möglichst totalen Kontrolle zu unterziehen, wurde nicht infrage gestellt. Und doch gab es in der Bündner Flüchtlingspolitik gewisse Nuancen in Form eines humanistischen Utilitarismus, wie ebenfalls in dieser Arbeit zu zeigen sein wird.
DER KRIEGSVERLAUF AUS BÜNDNER PERSPEKTIVE
«Was der morgige Tag uns bringen wird, wissen wir nicht»
«Selbstverständlich hat man auch Augenblicke,
wo ein inneres Zagen wach werden will.
Man hängt doch am Leben, an den Lieben zu Hause.
Man hat noch eine Zukunft vor sich, möchte auch
gerne wissen, wie es herauskommt, und möchte gerne
den Sieg des Rechtes, der Freiheit und Menschlichkeit
noch miterleben.»
Paul Schmid-Ammann
«Die Tragödie hat also begonnen» – Überfall auf Polen und drôle de guerre(September 1939–April 1940)
Der ungeheuren Wucht und Brutalität des deutschen Überfalls, denen sich Polen ab dem frühen Morgen des 1. September 1939 ausgeliefert sah, hatte das Land wenig entgegenzusetzen. Bis Mitte September wurde die polnische Armee durch die Luft- und Panzerstreitkräfte der Wehrmacht weitgehend ausgeschaltet. Die Kriegserklärungen Frankreichs und Grossbritanniens am 3. September zeigten keinerlei Wirkung. Nach dem deutschen Sieg und der Flucht der polnischen Regierung ins Exil einigte sich NS-Deutschland mit der Sowjetunion am 28. September über die Teilung Polens, in dessen östliche Gebiete die Rote Armee bereits am 17. September einmarschiert war. Da Frankreich und Grossbritannien Hitlers Friedensangebot unter Beibehaltung des geschaffenen Fait accompli ablehnten, war es nur eine Frage der Zeit, dass es zu Kampfhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich kommen würde. Sie blieben jedoch vorerst aus, was das Bündner Tagblatt etwas irritiert reagieren und die Frage «Was geht im Westen vor?» stellen liess.1
In der Schweiz war vom Ausbruch des Krieges kaum jemand überrascht, denn man hatte sich wenig Illusionen über die Konsequenzen der immer aggressiveren Politik des nationalsozialistischen Deutschlands gemacht. Die Frage, ob es Krieg geben würde, war Ende August auch in Graubünden das beherrschende Thema.2 «Die letzten Tage des Friedens vergingen ohne Hast, in ruhiger Erwartung des Krieges», schrieb Werner Rings. «Man richtete sich auf das Unvermeidliche ein. Touristen aus Europa und Übersee brachen ihre Ferien ab. Sie verließen die Schweiz. Viele in Extrazügen. Die Fremdenorte leerten sich.»3 Der Kriegsausbruch zog kaum Panik nach sich, doch «herrschte äusserst niedergedrückte und hektische Stimmung bei den Erwachsenen», erinnerte sich Annamaria Hartmann an ihre Kindheit in Igis-Landquart. «Dazu ein Kommen, Gehen, Organisieren und Heranrollen von Militärfahrzeugen.» Sozusagen hin und her gerissen zwischen Kontinuität und Kontingenz, sei ihr «seltsam ‹gemischt›» zu Mute gewesen: «Da die Kriegsdrohungen, das Ungewisse, die traurigen Abschiede» von den einrückenden Wehrmännern. «Und dort […] die Vorfreude aufs Wiedersehen mit Kameradinnen, Kameraden» nach dem Ende der Sommerferien,4 was so etwas wie Vertrautheit inmitten all der Ungewissheit und den tränenreichen Abschiedsszenen im Zuge der Generalmobilmachung versprach. Für den damals neunjährigen Marco a Marca aus dem Misox war die Mobilisierung dagegen eine willkommene Abwechslung von der alltäglichen Langeweile, wie er später rückblickend festhielt.5
Das Bündner Tagblatt vermittelte den Eindruck, dass manche angesichts der wochenlangen «Nervenprobe», die «allen europäischen Völkern auferlegt» worden sei, sogar erleichtert über den Kriegsbeginn seien, «indem sie ‹einem Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne Ende› den Vorzug zu geben bereit waren». Nur Optimisten hätten noch geglaubt, «daß die Kriegsgefahr gebannt werden könne. Es wäre auch wirklich zu 99 Prozent die Wahrscheinlichkeit vorgelegen, wenn … eben wenn. Dieses ‹Wenn› war der deutsche Reichskanzler und Führer, der sich in seiner Politik der unersättlichen Forderungen allzu weit festgelegt, festgerammt hatte, sodaß ein Zurückgehen mit seinem Führer-Prestige nicht vereinbar war.» Und resigniert fügte das Blatt hinzu: «Die Tragödie hat also begonnen. Die Würfel sind gefallen. Deutschland hat die Spannung auf die Art und Weise gelöst, wie sie befürchtet und erwartet werden musste. […] Unsere Heimat ist direkt nicht bedroht, aber muß auf alle Fälle und gegen alle Eventualitäten gerüstet sein. […] Gott schütze unsere liebe Schweiz und unser Volk!»6
Innen- und wirtschaftspolitisch hatte sich das Land gut auf einen drohenden Krieg vorbereitet. Auf militärischem Gebiet hatte die Generalstabsabteilung bereits im März 1939 die Auffassung vertreten, dass es «dringend notwendig» sei, «alle Vorkehrungen zu treffen». Entsprechend wurde der Befehl erteilt, «längs der Landesgrenzen und weiter rückwärts die an den Haupteinfallstrassen und Bahnlinien gelegenen Objekte [mit Sprengmaterial] zu laden und zündbereit zu machen. […] Des weitern soll[t]en sämtliche verteidigungsfähigen Grenzbefestigungen besetzt werden».7 Zu den Objekten, die mit Sprengladungen versehen wurden, zählte etwa die Salginatobelbrücke im Prättigau.8
Für Graubünden relevant war, dass die Verteidigung des Fürstentums Liechtenstein bei einem allfälligen deutschen Angriff nicht vorgesehen war, dass also «die Schweiz [sich] lediglich mit der Besetzung der Schweizergrenze begnügen sollte zur ausschliesslichen Verteidigung des schweizerischen Gebietes. Allerdings müsste in einem solchen Fall unser Zollkordon, der jetzt an der Ostgrenze Liechtensteins liegt, zurückgezogen werden und eine neue Zollbewachung zwischen der schweizerischen und liechtensteinischen Landesgrenze aufgebaut werden.»9 Bereits beim sogenannten Anschluss Österreichs hatte die Frage, was militärisch mit Liechtenstein geschehen solle, eine Rolle gespielt, wobei Deutschland der Schweiz klar gemacht hatte, dass ein Einbezug des Fürstentums in das Schweizer Abwehrdispositiv als Verletzung der Neutralität und eine «gegen uns gerichtete Massnahme» gesehen würde, die Konsequenzen nach sich ziehen könnte.10
Um das militärische Abwehrdispositiv stand es allerdings nicht zum Besten; es war bei Kriegsausbruch «paradoxerweise das am wenigsten weit gediehene; die Schweiz war diesbezüglich noch schlechter vorbereitet als 1914», so die UEK in ihrem Schlussbericht.11 Dies war nicht zuletzt die Folge schmaler Verteidigungsetats in den Zwanziger- und der ersten Hälfte der Dreissigerjahre, die «Hungerjahre» für die Armee gewesen seien. «An eine wirksame Panzerabwehr oder gar an Panzertruppen wagte niemand zu denken, schon aus Kostengründen nicht», und so brachte «erst das Jahr 1936» einen «sichtbaren Umschwung». Allerdings sei die Verbesserung der Ausrüstung bis Kriegsbeginn «zögernd, vorsichtig und bescheiden» geblieben, so Ernst Riedi.12 Damit befand sich die Landesverteidigung im Herbst 1939 weiterhin «in einem prekären Zustand. Die operativen Pläne fehlten, die schwere Rüstung genügte nicht, die Mobilität beruhte auf veralteten Voraussetzungen (zu viele Pferde, zu wenig Motoren), die Panzer- und die Flugwaffe waren praktisch inexistent. […] In besserem Zustand befand sich die Infanterie, und die geistige Haltung der Wehrmänner war zu dieser Zeit noch darauf eingestellt, einen erbitterten Verteidigungskampf zu führen.»13
Von den insgesamt 21 Fliegerkompanien schickte man nach einigen Tagen fünf wieder nach Hause, weil Flugzeuge fehlten. «Von den übrigen 16 Kompanien waren nur deren drei mit je sechs modernen, kriegstauglichen Jagdflugzeugen ausgestattet.»14 Doch nicht nur Kriegsmaterial fehlte, auch an strategischen Konzepten mangelte es. Nach dem Krieg vertrat General Guisan die Auffassung, «daß wir die größte Gefahr strategischen Ausmaßes während des ganzen Krieges vielleicht am Anfang jenes September 1939 liefen, wo wir mangels der Möglichkeit, sofort zwischen verschiedenen ausgearbeiteten Plänen oder Studien wählen zu können, nicht in der Lage gewesen wären, einen plötzlichen operativen Entschluß möglichst rasch und sicher in die Tat umzusetzen».15 Der Bundesrat teilte diese Lagebeurteilung hingegen nicht und betrachtete im Nachhinein «die Lage der Schweiz im Herbst 1939 bei weitem nicht als eine der gefahrdrohendsten».16
Wie die Schweizer beziehungsweise Bündner Bevölkerung diesen Krieg einschätzte, wird unterschiedlich gesehen. «Nur wenige Monate würde der Krieg dauern – das hatte jedermann gedacht», schrieb Marcella Maier.17 Anders der Historiker Peter Metz: Man sei allgemein davon überzeugt gewesen, «dass zwar ein langer Krieg bevorstehe (denn die kriegstechnische Überlegenheit des Angreifers war gewaltig), dass jedoch letzten Endes, nach Ausschöpfung aller Reserven und erfolgter Nachrüstung, erneut [also wie im Ersten Weltkrieg, C.R.] die Gruppierung der Alliierten mit der USA im Rücken obsiegen werde».18 Für diese Sichtweise spricht, dass beispielsweise die Engadiner Post bereits unmittelbar nach dem Angriff auf Polen die Frage stellte, ob «ein neuer Weltkrieg entfesselt» worden sei.19 Und in einer Annonce, die im Frühling 1940 für private Luftschutzmassnahmen warb, die «ernste Bürger- und Menschenpflicht» seien, sprach der Churer Stadtpräsident Gian Mohr davon, dass «alle einsichtigen Beurteiler der Weltlage […] mit einer langen Kriegsdauer» rechneten. Schliesslich stünden «sich ebenbürtige Gegner gegenüber, die nicht in einem sogenannten Blitzkrieg zu bodigen» seien. Bezeichnenderweise sprach Mohr bereits jetzt vom «totalen Krieg», der «keine Schonung und kein Erbarmen» kenne.20
Weitgehend Konsens bestand – auch zwischen den einzelnen Schweizer Sprachregionen – nun erst recht in der Ablehnung des NS-Systems, seiner rassistischen Ideologie und zerstörerischen Aussenpolitik. Hitler wurde «als der Hauptschuldige an der Entfesselung des Krieges bezeichnet».21 Der Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer identifizierte sich «zwar nie gross mit einer Kriegspartei, ‹man› war aber stets aus einer tiefen und auch geäusserten Abneigung sowohl gegen den Nationalsozialismus als auch – und in nicht geringem Mass – gegen das machtvolle Deutschland probritisch und, was erstaunt, schon 1942 mehr und mehr auch prorussisch eingestellt».22 Bei der Vereidigung von Bündner Armeeeinheiten nahm der für das Militärdepartement zuständige Regierungsrat Andreas Gadient denn auch kein Blatt vor den Mund: «Ungezügelte Machtgier, skrupelloser Wortbruch und hemmungslose Brutalität vergiften das Verhältnis der Völker zueinander.» Die Schweiz brauche nun «Tellenmut und Pestalozzigeist», sei sie doch «entschlossen, lieber mit Gewalt sich gegen ein Unrecht zu wehren, als aus Feigheit es zu dulden».23
Der von einem breiten nationalen Konsens getragene Verteidigungswillen zog die Mobilmachung der Grenztruppen (28. August),24 die Wahl Henri Guisans zum General (30. August), die Ausstattung des Bundesrats mit weitreichenden Vollmachten durch die Bundesversammlung (30. August),25 die Erklärung der Neutralität (31. August)26 sowie die Generalmobilmachung auf den 2. September27 nach sich. «Die aussenpolitische Lage hat sich in den letzten Tagen derart zugespitzt, dass es dringend notwendig erscheint, die Sicherheit der Landesgrenzen und den Schutz unserer Neutralität der Armee anzuvertrauen. Auf Vorschlag des Generals ist das eidg. Militärdepartement entschlossen, die Armee aufzubieten und kriegsmobil zu machen», hielt das Bundesratsprotokoll vom 1. September fest.28 Vor allem die Generalmobilmachung machte den Ernst der Lage deutlich. Für die Verteidigung der Bündner Aussengrenze vom Piz Tambo bei Splügen bis zum Rätikon nördlich von Schiers war die Gebirgsbrigade 12 zuständig, in die vier Regimenter Grenztruppen integriert waren.29 Sie sollte die Nord-Süd-Achse durch Graubünden sperren und somit dem Gegner – sprich: den deutschen beziehungsweise italienischen Streitkräften – den Durchmarsch durch die Schweiz verhindern. Unterstützt werden sollte die Verteidigung durch Festungsanlagen,30 deren Bau aber mit den politisch-militärischen Ereignissen kaum Schritt halten konnte, insofern war man «froh, dass kein sofortiger Angriff erfolgte und uns die Zeit blieb, die Verteidigung auszubauen und zu verstärken», wie es der damalige Korpskommandant Renzo Lardelli formulierte.31 Mit dem Bau der als strategisch besonders wichtig eingestuften Festungsanlage Crestawald im Hinterrheintal wurde im November 1939 begonnen. Sie sollte vor allem einen italienischen Angriff über die Pässe Splügen und San Bernardino abwehren.32
Der Beginn des Einsatzes gestaltete sich problematisch und liess keinerlei Aktivdienstromantik aufkommen. Feste Unterkünfte gab es zu wenige oder überhaupt nicht, sodass «die Kompanien am Valser- und am Safierberg bis Ende Oktober nur geschützt durch eine Zeltplane und eine Wolldecke auf eine Unterkunftsbaracke warten» mussten. «Jeder Balken, jedes Brett musste durch Saumkolonnen von Hinterrhein und von Splügen herangeführt werden.»33 Paul Zinsli, der im Hinterrheintal stationiert war, berichtete: «Es war nichts, aber auch gar nichts vorbereitet oder vorhanden. Keine Unterkunft, keine Kochstelle, kein Wasser in der Nähe – dieses musste man mit der Gamelle aus dem Hinter- oder Averserrhein holen. Man hatte, da die Posten dauernd bewacht und gesichert sein mussten, im Wald oder zwischen Steinblöcken zu ‹hausen› und sich zurechtzufinden. […] Jeder ging nun daran, sich so gut wie möglich ‹einzurichten›. Das Wetter war regnerisch und bereits ordentlich kalt. An kleineren, abgeschirmten Feuern – Feuer waren nachts verboten – versuchte man, sich einsatzbereit zu halten. Geschlafen wurde unter einer zwischen Felsen oder Bäumen aufgespannten Zeltblache, in den angefeuchteten Kleidern und eingewickelt in die ebenfalls feuchte Wolldecke.»
Der Motivation hätten diese misslichen Verhältnisse in den ersten Wochen jedoch nicht geschadet, «keine Klagen und kein Murren waren zu vernehmen. Man wusste, warum man hier war, und man verstand, dass die Mühen und Beschwernisse pflichtgemäss zu ertragen waren.»34 Selbst den an der Vorarlberger Grenze zu Graubünden stationierten deutschen Zöllnern fiel auf, dass die Schweizer Soldaten nur «sehr dürftig» ausgerüstet waren: «Wir bedauerten die armen Kerle ehrlich, die in 2 bis 3000 Meter Höhe unrasiert und fern der Heimat kältestarr auf eisigen Hochgebirgsgraten herumlungern mußten und nicht wußten warum. Der Anfang November jäh einbrechende Winter brachte ihnen die heiß ersehnte endgültige Ablösung.»35
Was die Wahl Guisans zum General betraf, gab es «ein Aufatmen: Jetzt ist ein guter Mann da (obwohl man wenig wusste über ihn), der hat den Überblick!», wie Annamaria Hartmann festhielt.36 Ulrich Gadient, Sohn des Regierungsrats Andreas Gadient und späterer Gross-, National- sowie Ständerat, erinnerte sich, dass Guisans Ernennung auch in seiner Familie «Freude und Zuversicht bereitet und Vertrauen in die Zukunft bewirkt» habe, «auf das wir uns auch in schweren Tagen stützen sollten».37 In der rückblickenden Wahrnehmung der Aktivdienstgeneration stieg Guisan teilweise sogar zum eigentlichen Staatslenker auf, weil er «der geschmeidigen, anpasserischen Haltung der Landesbehörde und der gedrückten Stimmung im Volk», die sich vor allem im Sommer 1940 zeigen sollte, einen «uneingeschränkten Widerstandswillen der Truppe» entgegengesetzt habe und so zur «Symbolgestalt schweizerischer Selbstbehauptung» geworden sei.38 Von den Soldaten sei Guisan «nicht nur hochgeschätzt» worden, «weil er der höchste Offizier der Schweizer Armee war, sondern auch weil er der Mann war, der es wirklich verstand die Geschicke unserer Armee zu leiten und unser Staatsschiff durch die unsichere Zeit und durch die Wogen der oft widerstreitenden Meinungen zu lenken. Wenn man ihm gegenüberstand, hatte man das bestimmte Gefühl es mit einem Mann zu tun zu haben, der wußte, was er wollte und der nicht eigennützige Interessen zum Ziele hatte. Darum vernahm man auch nie ein Murren in der Mannschaft, wenn der Besuch des Generals angesagt war. Vom Soldaten bis hinauf zum Kommandanten freute sich jeder, diesen klugen, und den von der gemeinsamen Sache stark überzeugten, Mann zu sehen oder wiederzusehen.»39
Angesichts der Erntezeit und des bevorstehenden Alpabzugs traf die Generalmobilmachung von 430 000 Mann vor allem die Landbevölkerung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. «Zurück blieben die Frauen und wehrunfähigen Männer oder eventuell Knechte», erinnerte sich der 1914 geborene Paul Zinsli, «Urlaub wurde nur in Ausnahmefällen bewilligt».40 Schon wenige Tage nach der Mobilmachung sah sich die Bündner Regierung veranlasst zu intervenieren und wandte sich an das Kommando der Gebirgsbrigade 12, um «den Wunsch zu unterbreiten, Sie möchten soweit als nur möglich eingehende Urlaubsgesuche von Wehrmännern berücksichtigen. […] In Graubünden als Grenzkanton steht, im Gegensatz zu den meisten andern Kantonen, der grösste Teil der Wehrmänner nicht erst seit der Generalmobilmachung, sondern seit dem 28. August im Dienst. Infolgedessen musste auch ein grosser Teil der Hilfsdienstpflichtigen schon auf den 28. August einrücken. Dadurch gerät besonders die Landwirtschaft in grosse Verlegenheit umsomehr, als infolge des schlechten Wetters die Emdernte erst begonnen hat und da und dort nicht einmal der Bergheuet ganz fertig ist. Das Getreide liegt vielfach auch noch auf dem Acker. Dabei hängt nicht bloss für die einzelne Familie, sondern für die gesamte Landesverteidigung viel davon ab, dass die Ernten rechtzeitig und in möglichst guter Qualität eingebracht werden können. […] Der Abwehrwille des Schweizervolkes und die Einsatzbereitschaft der ganzen Truppe sind von erfreulicher Geschlossenheit. Auch um diesen guten Geist in der Truppe zu erhalten, glauben wir Ihnen eine möglichst weitgehende Beurlaubung in den allernächsten Tagen so dringend empfehlen zu müssen.»41
Tatsächlich, so der Bündner Historiker Peter Metz, «erkannte die Landesbehörde diese Sachlage rasch und erliess schon am 6. Oktober [1939] weitherzige Vorschriften für eine Dispensation von unentbehrlichen landwirtschaftlichen Arbeitskräften. Über dringende Dispensationsgesuche entschied eine eigens vom Kanton eingesetzte zivile Kommission, die in Verbindung mit den Gemeinden jeden einzelnen Fall gründlich prüfte. Im ganzen wurden 4502 Gesuche behandelt, von denen 1839 bewilligt wurden, während die restlichen zur Urlaubserteilung oder zur weitern Behandlung weitergeleitet wurden. Zur Abweisung gelangten lediglich 721 Fälle.»42
Doch der Konflikt zwischen dem Personalbedarf des Militärs und jenem der Wirtschaft blieb bestehen. Der Kleine Rat setzte sich immer wieder für einzelne Berufs- und Personengruppen ein, um Dispensationen vom Aktivdienst zu erreichen, so etwa für das Alppersonal,43 für «unentbehrliche Gemeindefunktionäre»44 sowie für Landwirte und Jäger. Ende August 1941 schrieb der Kleine Rat an das Kommando der Gebirgsbrigade 12: «Aus zahlreichen Gemeinden gehen Anfragen und Gesuche ein, den Wehrmännern des Grenzschutzes wenigstens für einen Teil der Jagdzeit Urlaub zu bewilligen.» Die Kantonsregierung unterstützte dies, denn einerseits war der Kanton aus finanziellen Gründen an einer möglichst grossen Zahl Jagdpatente interessiert, andererseits wurde, so der Kleine Rat, «in keinem anderen Kanton […] die Jagd prozentual von soviel Einwohnern ausgeübt wie in Graubünden. […] Die Fleischversorgung spielt gerade auf nächsten Winter eine bedeutende Rolle. Zahlreiche Wehrmannsfamilien müssten überhaupt das ganze Jahr ohne Fleisch bleiben, wenn dem Wehrmann nicht dieser Jagdurlaub gewährt würde. Der Bergbauer betrachtet zudem diese paar Jagdtage als die einzige Pause und seine einzigen ‹Ferien› während der ununterbrochenen strengen Arbeit des Jahres.»45
Im ersten Kriegsherbst war jedoch, was in Graubünden als besonders einschneidend empfunden worden sein dürfte, die traditionelle Hochjagd auf Grundlage eines Bundesratsbeschlusses vom 22. September 1939 verboten. Dieser Beschluss untersagte die Jagd in «engeren Festungsgebieten»46 und als ein solches galt «der grösste Teil des Kantons. Aber auch in dem für die Jagd freigegebenen Gebiet ist nach eingezogenen Erkundigungen mit lokalen Verboten im Interesse der Landesverteidigung und der Sicherheit der Truppen zu rechnen. Der Grossteil der Jäger, die im Militärdienst stehen, könnte sich an der Jagd nicht beteiligen und würde dies begründeterweise als Benachteiligung empfinden.» Die Kantonsregierung beschloss daher die generelle Aussetzung der Jagd für das Jahr 1939.47 Dies führte jedoch zu vermehrten Wildverbissschäden, sodass Regierungsrat Luigi Albrecht vor dem Grossen Rat versprach, es werde im kommenden Jahr «beim Wild stark durchgegriffen».48 Tatsächlich wurde vor der regulären Hochjagd im September 1940 in einigen Bündner Kreisen eine Extrajagd auf Hirschwild angesetzt, dies vor allem in Mittelbünden, in der Surselva, im Prättigau und Bergell.49 Bereits im Mai war eine dreiwöchige Hirschjagd in Ackerbaugebieten mit starken Wildverbissschäden durchgeführt worden, denn die Zentralstelle für Kriegswirtschaft Graubünden und zahlreiche Gemeinden hatten «auf die Schwierigkeiten aufmerksam» gemacht, «die sich durch den Wildschaden für die Durchführung des durch Bundesratsbeschluss vom 20. Oktober 1939 vorgeschriebenen Mehranbaues im offenen Ackerland ergeben. […] Die Gemeindeackerbaustellen melden, dass die Bauern zum vermehrten Ackerbau nur bereit seien, wenn denselben gleichzeitig die Zusicherung gegeben werden könne, dass die Anpflanzungen gegen Wildschaden besser geschützt würden. Die grosse Arbeit des Umbruches und der Neuanpflanzung würde nicht geleistet, nur um dem Hirschwild neue Futterplätze zu verschaffen. Es liege dies auch nicht im Interesse einer vermehrten Landesversorgung.»50
Doch nicht nur auf dem Gebiet der Jagd hatte der Krieg Auswirkungen auf den Alltag. Bund und Kanton erliessen eine ganze Reihe von Vorschriften, die der aussergewöhnlichen Situation Rechnung trugen. Dazu zählten beispielsweise eine wegen der Mobilmachung gewährte Sistierung der Fristen bei rechtlichen Angelegenheiten, die Wehrmänner in Anspruch nehmen konnten,51 die Verordnung über vorübergehende Milderungen bei der Zwangsvollstreckung,52 die Einführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht für Männer und Frauen über 16 Jahre,53 die Möglichkeit, Arbeitslose zu Arbeiten für die Armee aufzubieten54 oder die Lohnausfallentschädigung für Arbeitnehmer im Aktivdienst.55 Hinzu kamen eine ganze Reihe von Einschränkungen in der Lebensmittel- und Treibstoffversorgung (siehe S. 338ff.) sowie «Weisungen an die Bevölkerung für den Kriegsfall». Letztere sollten Bevölkerung und Behörden «über ihre Stellung gegenüber einer feindlichen Armee» aufklären und vermeiden, «daß durch unbedachtes Verhalten der Bevölkerung die militärische Landesverteidigung beeinträchtigt oder die Bevölkerung selbst schweren Gefahren ausgesetzt wird».56
Zudem galt, «im Hinterland an Ort und Stelle auszuharren und soweit wie nur möglich die Armee und Kriegswirtschaft durch nützliche Arbeit zu unterstützen. Eine Evakuation der Gesamtbevölkerung im Hinterlande findet nicht statt, es sei denn, daß durch besondere militärische Befehle etwas anderes angeordnet wird. Die freiwillige Abwanderung und die Aufnahme der Abgewanderten in einem anderen Landesteil ist jedoch zuzulassen; vorbehalten bleibt die Benutzung der Straßen und Transportmittel für militärische Zwecke. […]. Ob die Bevölkerung von Ortschaften, die in der Kampfzone liegen, am Ort zu verbleiben hat oder evakuiert wird, richtet sich nach den Anordnungen der militärischen Befehlshaber. […] Wenn die Schweiz angegriffen werden sollte, wird sie ihr Gebiet mit allen Mitteln verteidigen.»57 Selbst mit dem Einsatz von Giftgas rechnete man, und so warb eine Churer Schlosserei im kantonalen Amtsblatt für ihre Gasschutztüren.58
Doch schien der Schweiz keine unmittelbare Gefahr zu drohen. Nach der schnellen Niederlage und Aufteilung Polens kehrten selbst in den kriegführenden Ländern Grossbritannien und Frankreich «fast wieder Routine und Alltag ein»,59 die Kontingenz des Krieges wich, wenn auch nur vorübergehend, einer neuen, anderen Kontinuität. Der Krieg entfernte sich von der Schweiz und verlagerte sich nach Finnland, das am 30. November 1939 von der Roten Armee angegriffen wurde. In dieser Phase des Krieges war in der Schweizer Bevölkerung laut Peter Metz von Sympathien für die Rote Armee noch nichts zu spüren, denn «das, was die finnischen Truppen, mannschaftsmässig hoffnungslos dem angreifenden Koloss unterlegen, unter Ausnützung des Geländes und seiner überlegenen sportlichen Fähigkeiten in der monatelangen Bedrängnis zu leisten vermochten», habe «das Herz jedes Schweizersoldaten höher schlagen lassen. […] Der Anschauungsunterricht aus diesem fernen Kriegsgeschehen bewies, dass auch ein kleines Land, wenn es seinen natürlichen Geländevorteilen und seiner eigenen Wehrbereitschaft vertraut, sich auch gegenüber einem weit überlegenen Gegner lange zu behaupten versteht und hiedurch seinen Untergang verhindert.»60 Und Annamaria Hartmann erinnerte sich: «Bekannt und bewundert für ihren mutigen Einsatz waren auch bei uns damals die finnischen Lottas (Soldatinnen) und sie wurden nach dem Russisch-finnischen Winterkrieg 1939/40 noch berühmter, nicht zuletzt durch den Roman ‹Tapfere kleine Lotta›, ein Buch, das ich richtig verschlungen habe.»61
Was die Situation in Mitteleuropa betraf, waren die Wünsche und Hoffnungen weiter Teile der Schweizerinnen und Schweizer wohl zwiespältig: Der Wunsch nach einem scheinbaren beziehungsweise zumindest vorläufigen Ende der Kampfhandlungen hatte sich mit der Niederlage Polens zwar schnell erfüllt. Allerdings «dürfte dieser Wunsch – bei der Mehrheit der Bevölkerung – von der Hoffnung verdrängt worden sein, dass das militärische Kräftemessen noch weitergehen möge und das Ergebnis des Kriegs nicht in der Etablierung einer vom ‹Dritten Reich› dominierten ‹Neuen Ordnung› bestehen würde. Die Einsicht, dass ein solcher Kriegsausgang der Unabhängigkeit der Schweiz ein Ende setzen würde, war weit verbreitet», heisst es im Schlussbericht der UEK.62 Teilweise herrschte angesichts der alliierten Passivität sogar der Eindruck, das Deutsche Reich sei unbesiegbar.63 Zudem stellte sich die Frage, was in unmittelbarer Nähe zur Schweiz – an der deutsch-französischen Grenze – geschehen würde, befanden sich doch beide Staaten weiterhin offiziell im Kriegszustand, ohne dass es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Wie lange würde dieser Zustand des drôle de guerre noch anhalten? Und musste man nicht befürchten, dass falls sich die Maginot-Linie Frankreichs tatsächlich als unbezwingbar erweisen würde, Deutschland versucht sein könnte, sie südlich, also über Schweizer Gebiet, zu umgehen?
Als am Montag, dem 20. November 1939, der Bündner Grosse Rat zu seiner regulären Herbstsession zusammentrat, liess Standespräsident Rudolf Toggenburg (Laax) die Ereignisse der vergangenen Monate Revue passieren: «Die Mobilisation der Wehrmacht» – gemeint war die Schweizer Armee – habe sich, auch dank der vermeintlich «ausgezeichneten Vorbereitungen, mit reibungsloser Schnelligkeit» vollzogen. «Nach einigen Stunden schon hatte der Schweizersoldat den ihm zugewiesenen Verteidigungsposten an der Grenze bezogen. Ein feindlicher Angriff wäre schon dann hart pariert worden. Die Mobilisation hat tadellos geklappt, sie kommt einer gewonnenen Schlacht gleich. […] Der Geist aller Truppen ist ein ausgezeichneter. Das Land kann sich auf seine Wehrmacht verlassen. Wir bringen unserer Armee volles Vertrauen entgegen. […] Das in unsere Armee gesetzte Vertrauen hat das gesamte Volk auch anläßlich der Generalswahl bekundet. Wie groß und gewaltig war die Begeisterung des ganzen Volkes bei dieser Wahl, wie herzlich ist General Guisan im ganzen Schweizerlande und insbesondere in unserer Bündner Kapitale begrüßt worden! Das Bild des ersten Schweizersoldaten ziert heute jeden Unterkunftsraum, jede Soldatenstube, jedes Bureau, den Salon des Reichen wie die Stube des Armen. Im Tale wie in der obersten Alphütte der Schweiz, wo unsere Soldaten treu wachen, überall prangt das Bild des Generals an der Wand.»64
Der Standespräsident ging aber auch auf die weitverbreite Unsicherheit der Lage ein: «Alle Menschen, alle Schweizer sind in diesen Stunden Träger schweren Leids geworden. Keiner unter uns ist ohne Sorgen persönlicher Art. Alle unter uns leiden unter der furchtbaren Not Europas. Diese Sorgen gelten vor allem unserem Heimatland und seiner Zukunft. […] Wir alle kennen die heutige Lage. Was der morgige Tag uns bringen wird, wissen wir nicht. […] Je besser wir gerüstet sind, je besser wir wachen, um so weniger laufen wir Gefahr, Schauplatz kriegerischer Vorgänge zu werden. Die Verteidigung des Landes und der Geist der Armee müssen aufs äußerste gesteigert werden. Keine Opfer dürfen verweigert werden. Wenn auch die Finanzlage des Bundes wie unseres Kantons sehr gespannt ist, so muß auch diese Sorge zurücktreten, wo es sich darum handelt, die Wahrung unserer Freiheit und die Unabhängigkeit unseres Landes zu sichern.» Für Graubünden bedeutete die Mobilmachung laut Toggenburg zudem eine grosse finanzielle Belastung: «Sie hemmt das Wirtschaftsleben, sie hemmt den Verkehr; unsere Bahn wird schwere Zeiten durchzumachen haben. Überdies werden mehrere Einnahmequellen des Kantons teilweise versiegen. Jeder von uns wird persönliche Opfer bringen müssen.»65
Zu diesen persönlichen Opfern gehörte auch, auf liebgewonnene Traditionen zu verzichten, so etwa die Fastnacht. Die Kantonsregierung teilte im Januar 1940 mit: «Auf Anfrage aus verschiedenen Gemeinden betreffend Erlaß eines kantonalen Verbotes für Fastnachtsveranstaltungen ist darauf zu verweisen, daß hiefür die Gemeinden zuständig sind […]. Auf Grund einer Aussprache im Kleinen Rat wird den Gemeindevorständen empfohlen, die Fastnachtsanlässe (Umzüge, Maskenlaufen und allgemeine Tänze) zu verbieten und die Verlängerung der Polizeistunde möglichst einzuschränken. Bei der ernsten Zeitlage hält der Kleine Rat Verbote betreffend die Fastnacht und Fastnachtszeitungen für begründet.»66 Diese Haltung galt auch für die übrigen Kriegsjahre. Ein Davoser Unternehmen für Theaterkostüme, das vom Fastnachtsverbot direkt betroffen war, schlug 1941 der Kantonsregierung vor, anstelle des närrischen Treibens doch «humoristische Ski-Abfahrten und Ideenkonkurrenzen, z. B. der beste Charakterkopf, in den Hotel-Bar-Räumen» zuzulassen.67 Davon wollte der Kleine Rat jedoch nichts wissen, auch aus aussenpolitischen Gründen: «Jeder Maskenbetrieb ausserhalb geschlossenen Räumen und geschlossenen Gesellschaften wird ausgeschlossen. Mit den Konkurrenzen in Charakterköpfen ist auch in geschlossenen Räumen Zurückhaltung am Platz, da erfahrungsgemäss politische Tendenzen damit verbunden werden.»68
«Man kann nicht mehr froh werden» – Vom deutschen Angriff auf Nordeuropa bis zur Kapitulation Frankreichs (April–Juni 1940)
Der eigenartige Schwebezustand in Mitteleuropa nach dem Sieg über Polen – nicht Frieden, nicht offener Krieg – endete am 9. April 1940 mit dem deutschen Überfall auf Dänemark und Norwegen. Er diente vor allem der Sicherung der Erzzufuhren aus dem schwedischen Kiruna über den eisfreien norwegischen Hafen Narvik und einer günstigen Ausgangsposition für den Seekrieg mit Grossbritannien im Nordatlantik. Die Besetzung Dänemarks sollte den Nachschub der deutschen Verbände in Norwegen sichern. Während Dänemark bereits nach einem Tag unter Protest kapitulierte, zogen sich die Kämpfe in Norwegen, das alliierte Verbände zu verteidigen versuchten, bis zum 10. Juni hin. Da beide Staaten sich zuvor für neutral erklärt hatten, nahmen die Schweizerinnen und Schweizer mit grosser Betroffenheit Anteil an den Geschehnissen, der Angriff «berührte das Schweizer Volk viel unmittelbarer als der polnische Krieg».69 Die Neue Bündner Zeitung schrieb: «Schneller als man befürchtete, ist das Verhängnis über die nordischen Neutralen hereingebrochen, und sie stehen vor der Gefahr, dem gleichen Schicksal wie andere Staaten anheimzufallen, deren ‹Schutz› die deutsche Wehrmacht übernommen hat. Es ist nur zu hoffen, daß diese Aktionen die Westmächte nicht unvorbereitet getroffen haben, denn ohne Intervention und Unterstützung der Alliierten werden sich die hartbedrängten nordischen Staaten gegenüber der starken deutschen Übermacht nicht lange halten können.»70 Aus seinen Sympathien für den «Freiheitskampf der Norweger» machte das Blatt keinen Hehl: «Überall» werde «tapferer Widerstand» geleistet, «die Mobilisierung schreitet rasch vorwärts und überall verlangt das Volk Waffen».71
Zurückhaltender berichtete Der Freie Rätier und vertrat die Auffassung: «Der Druck auf Norwegen wurde sowohl von deutscher wie von britischer Seite ständig erhöht. […] Hätte die Regierung von Oslo sich auf eine starke Wehrmacht stützen können, dann wäre es ihr auch leichter möglich gewesen, dem Druck der kriegführenden Großmächte mit Aussicht auf Erfolg begegnen zu können. So müssen nun die nordischen Königreiche die bittere Erfahrung machen, daß der Schwache immer im Unrecht ist.»72 Deutliche Kritik kam hingegen vom konservativen Bündner Tagblatt: «Wir haben es eben bei Schweden und Norwegen mit Staaten zu tun, die zu lange unter ihrer sozialistischen Herrschaft in Antimilitarismus machten und für die realen Notwendigkeiten blind wurden.» Nun aber, nach der Invasion, erwache «bei den Betroffenen wieder der alte Kampfesgeist».73
Das Armeekommando unter General Guisan erfüllte die Sorge, im Falle eines deutschen Überraschungsangriffs wie jenem auf Skandinavien nicht schnell genug reagieren zu können: «Das Heer wird nur dann seinen Aufgaben gerecht zu werden vermögen, wenn auf einen Schlag sämtliche Wehrpflichtige wieder zu den Waffen greifen. Neben dieser zwingenden Notwendigkeit ist es aber ebenso unerlässlich, den einrückenden Wehrmännern schon heute bekannt zu geben, dass man von ihnen nicht nur das unverzügliche Einrücken verlangt, sondern dass sie schon auf dem Wege zum Korpssammelplatz unter Umständen zum Schutze der Heimat kämpfen müssen. Die Gewissheit des Volkes, dass die bewaffnete Macht in der Lage ist, alle Versuche, den Widerstand im Innern zu brechen, zu zerschlagen, wird wesentlich zur Beruhigung beitragen und auch im Sinne einer Warnung an einen allfälligen Angreifer nützlich sein.»74 In der Engadiner Post wurde der Bevölkerung eingeschärft: «Wenn durch Radio, Flugblätter und andere Mittel Nachrichten verbreitet werden sollten, die den Widerstandswillen von Bundesrat und Armeeleitung anzweifeln, so sind solche Nachrichten als Erfindung der feindlichen Propaganda zu betrachten. Unser Land wird sich gegen jeden Angreifer mit allen Mitteln und aufs äusserste verteidigen. Die Zivilbevölkerung hat in einer solchen Lage Ruhe und Ordnung zu bewahren, sich in ihren Wohnungen oder Arbeitsplätzen aufzuhalten, alle Strassen und Plätze zu räumen und den Anordnungen der gesetzmässigen Behörden vollen Gehorsam zu leisten.»75
Die Eroberung Dänemarks und Norwegens war allerdings nur der Auftakt für eine aus Schweizer Sicht viel bedrohlichere Entwicklung: Am 10. Mai 1940 begann mit dem Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg der Westfeldzug und damit der Angriff auf Frankreich. Die Ereignisse dieses, wie ihn das Bündner Tagblatt nannte, «totalitären Kriegs»76 konnten aus Schweizer Sicht, sofern man nicht mit dem NS-System sympathisierte, katastrophaler kaum sein: Die Niederlande und Belgien kapitulierten Mitte beziehungsweise Ende Mai. «Ich erinnere mich noch», so Annamaria Hartmann, «wie unsere Eltern und Grosseltern schockiert waren von den Überfällen auf die kleinen Länder».77
Am 14. Juni konnte die Wehrmacht kampflos Paris besetzen, Frankreich kapitulierte am 22. Juni. Zudem hatte das faschistische Italien Frankreich und Grossbritannien am 10. Juni den Krieg erklärt, was etwa im Bündner Tagblatt eine breite Berichterstattung nach sich zog.78 Das schnelle Vordringen der Wehrmacht gegen Frankreich beeindruckte die Schweizer Bevölkerung, machte aber gerade deshalb auch Angst: «Die militärischen Leistungen der Wehrmacht, die Überlegenheit ihrer Panzerverbände, das taktisch-operative Vorgehen, das Zusammenspiel von Panzern und Stukas [Sturzkampfflugzeuge] imponierten uns. Gerade weil wir die Stärke der Wehrmacht kannten, machte sie uns grosse Sorgen», so der spätere Bündner CVP-Politiker Ettore Tenchio.79 Aber auch die wieder zu beobachtende Brutalität des deutschen Vorgehens liess Schweizerinnen und Schweizer erschaudern: «Grässliche Bombardemente der deutschen Luftwaffe über Holland, z. B. Rotterdam, empörten und erschreckten ungeheuer», notierte Annamaria Hartmann.80 Der Journalist Paul Schmid-Ammann schrieb an seine Frau: «Es ist ein unausdenkbares Mass von Verlusten, Not und Jammer, das nur ein Tag totaler Krieg von einem Lande fordert. Man kann nicht mehr froh werden, wenn man an das ungeheure Leid denkt, das jetzt Belgien, Holland und die Alliierten heimgesucht hat.»81