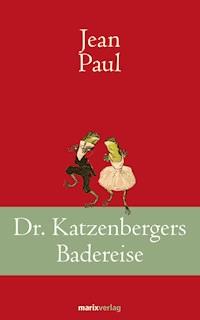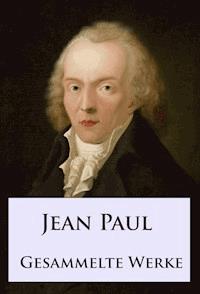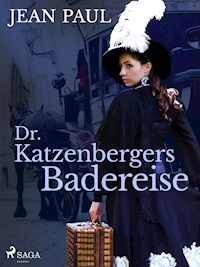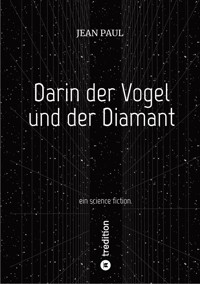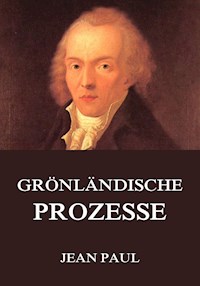
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jean Paul schrieb nach ersten literarischen Experimenten vor allem Satiren im Stile Jonathan Swifts und Christian Ludwig Liscows. Diese wurden in gesammelter Form 1783 als Grönländische Prozesse gedruckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grönländische Prozesse
Jean Paul
Inhalt:
Jean Paul – Biografie und Bibliografie
Grönländische Prozesse
I. Über die Schriftstellerei
II. Über die Theologen
III. Über den groben Ahnenstolz
IV. Über Weiber und Stutzer
V. Fragment aus einem zweiten Lobe der Narheit
VI. Über die Konfiskazion der Bücher
Beschluss
Zweites Bändgen
Vorrede
I. Unpartheiische Entscheidung
II. Beweis
III. Epigrammatischaphoristische Klagen
IV. Bittschrift aller deutschen Satiriker
V. Epigrammen
Grönländische Prozesse, Jean Paul
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849632973
www.jazzybee-verlag.de
Jean Paul – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Jean Paul Friedrich Richter, unter dem Namen Jean Paul berühmt gewordener Schriftsteller, geb. 21. März 1763 in Wunsiedel als Sohn eines Rektors und Organisten, gest. 14. Nov. 1825 in Bayreuth, verbrachte seine Kindheitsjahre, seit 1765, in dem Dorfe Joditz bei Hof, besuchte erst seit 1776 in dem nahen Schwarzenbach, wohin sein Vater versetzt worden war, regelmäßig die Schule, gewann aber die wesentlichsten Anregungen aus einer von früh an lebhaft, freilich auch wahllos betriebenen Lektüre, über die er in dicken Folianten ausführliche Auszüge eintrug. Um Ostern 1779 bezog er das Gymnasium in Hof. Durch den bald darauf erfolgten Tod des Vaters und der Großeltern geriet er mehr und mehr in materielle Bedrängnis, die ihn aber nicht hinderte, Ostern 1781 die Universität Leipzig zu besuchen, um Theologie zu studieren. Doch nahm er es mit den Studien (nur der Philosoph Platner fesselte ihn eine Weile) nicht sehr ernst und wandte sich bald ausschließlich der literarischen Tätigkeit zu, durch die er sich auch leichter über die äußere Not hinweghelfen zu können hoffte. Von bekannten Schriftstellern wirkten jetzt außer Hippel, der schon auf der Schule sein Lieblingsautor gewesen war, Rousseau und die englischen Humoristen und Satiriker stark auf ihn ein. Für sein erstes Buch, das nach des Erasmus' »Encomium moriae« verfaßte »Lob der Dummheit«, in dem er die Dummheit redend einführt, fand er keinen Verleger (es wurde erst lange nach Jean Pauls Tode bekannt). Besser ging es den des Dichters Eigenart schon deutlich verratenden »Grönländischen Prozessen«, die wenigstens einen Verleger fanden (Berl. 1783), wenn sie auch von dem Publikum und der Kritik sehr kühl aufgenommen wurden. Um den drängenden Gläubigern zu entrinnen, begab sich R. Ende 1784 heimlich von Leipzig hinweg und traf vom Frost erstarrt in Hof bei der Mutter ein, von wo es ihm auch in den nächsten Jahren nicht gelingen wollte, literarische Beziehungen anzuknüpfen, die seiner Not hätten ein Ende machen können. Erst zu Anfang 1787 bot sich dem Dichter wenigstens ein Unterkommen als Hauslehrer dar, er übernahm den Unterricht eines jüngeren Bruders seines Freundes Örthel in Töpen. Seine dortige Stellung war jedoch unbehaglich, und schon im Sommer 1789 kehrte er nach Hof zurück. Inzwischen schrieb er neue Satiren u. d. T.: »Auswahl aus des Teufels Papieren« (Gera 1789), die ebenso wenig Aufsehen erregten wie Jean Pauls Erstlingswerk. Im März 1790 übernahm er aufs neue ein Lehramt. Einige Familien in Schwarzenbach beriefen ihn zum Unterricht ihrer Kinder, und jetzt betrieb der Dichter sein Amt in angenehmen persönlichen Verhältnissen mit wahrhaft begeisterter Freudigkeit. Die Sonntagsbesuche in Hof gewährten erquickliche Erholung, und in dem damals mit seinem dortigen Freund Otto immer inniger geschlossenen Herzensbund erwuchs ihm ein köstlicher Besitz für sein ganzes späteres Leben. Um jene Zeit entstanden einige kleinere Humoresken: »Die Reise des Rektors Fälbel und seiner Primaner«, »Des Amtsvogts Freudels Klaglibell über seinen verfluchten Dämon« und das »Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Auenthal«. Sogleich nach Vollendung des »Wuz« begann R. einen großen Roman, dessen Plan ihn schon länger beschäftigte. Während der Arbeit zwar verflüchtigte sich der ursprüngliche Plan, die »Unsichtbare Loge« (Berl. 1793, 2 Bde.) blieb unvollendet; »eine geborne Ruine« nannte der Dichter selbst sein Werk, in dem neben einzelnen unvergleichlich schönen Stellen bereits die ganze Unfähigkeit Jean Pauls zu plastischer Gestaltung, die maßlose Überwucherung der phantastischen Elemente und alles, was sonst den reinen Genuß an seinen Dichtungen stört, zutage trat. Gleichwohl bildet das Erscheinen des Buches in Jean Pauls Leben einen Wendepunkt günstigster Art. Im Herbst 1792 legte er seine Hand an ein neues Werk, den »Hesperus« (Berl. 1795), der sich gleich der »Unsichtbaren Loge« eines großen Erfolgs beim Publikum erfreute. Seit dem Frühling 1794 wieder in Hof bei der Mutter weilend, schrieb er in den nächstfolgenden Jahren: »Das Leben des Quintus Fixlein« (Bayr. 1796), ein humoristisches Idyll wie das »Leben Wuz'«, nur in breiterer Anlage; die »Biographischen Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin« (Berl. 1796), ein Romantorso mit satirischem Anhang; die »Blumen-, Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten Siebenkäs« (das. 1796–97, 4 Bde.), in gewissem Sinne die beste Schöpfung des Dichters, der in den Persönlichkeiten des sentimentalen Siebenkäs und des satirischen Leibgeber die entsprechenden Elemente seiner eignen Natur zu verkörpern versuchte. Noch während der Arbeit an dem letztgenannten Roman empfing Jean Paul eine briefliche Einladung nach Weimar, von weiblicher Hand geschrieben. In der Ilmstadt, meldete die Briefstellerin, die sich Natalie nannte (welchen Namen der Dichter alsbald einer Gestalt im »Siebenkäs« anheftete), seien die besten Menschen von Jean Pauls Werken entzückt. Ohne Verzug folgte dieser dem Ruf. Seine Aufnahme übertraf alle seine Erwartungen; vor allen andern begegnete ihm Charlotte v. Kalb (die pseudonyme Briefschreiberin) mit glühender Verehrung. Jean Paul hat von ihr manche Züge für die Schilderung der hypergenialen Linda im »Titan« entlehnt. Zurückhaltender empfingen Goethe und Schiller den Hesperusverfasser, der sich in Weimar meist im Kreis des ihm wahlverwandten Herder bewegte. In jene Zeit fallen die Anfänge des »Titan«, die Abfassung des »Jubelsenior« (Leipz. 1797) und die Schrift »Das Kampanertal, oder: Die Unsterblichkeit der Seele« (Erfurt 1798). Im Sommer 1797 trat eine neue weibliche Gestalt auf die Lebensbühne des Dichters, Emilie v. Berlepsch, eine junge und schöne Witwe, mit der Jean Paul eine Reihe wunderlich exaltierter Szenen durchmachte. Fast hätte eine (vermutlich unglückliche) Heirat den dramatischen Abschluß gebildet. Im Oktober 1797 führte eine Reise nach Leipzig den nun berühmt Gewordenen auf den Schauplatz seiner einstigen Kümmernis, und jetzt drängten sich die Bewunderer um ihn. 1798 folgte auf Einladung der Herzogin Amalie ein abermaliger Besuch in Weimar. Nach einem kurzen Aufenthalt in Hildburghausen (Frühjahr 1799), wo er vom Herzog den Titel eines Legationsrats erhielt, ging Jean Paul nach Berlin, in der Absicht, sich dort dauernd niederzulassen. Im Mai 1801 verheiratete er sich daselbst mit der Tochter des Tribunalrats Meyer, aber eine vom König erbetene Versorgung blieb versagt. Von den damals entstandenen Werken sind hervorzuheben: »Palingenesien« (Gera 1798, 2 Bde.); »Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf« (das. 1799; unter den hier vereinigten kleinern Aufsätzen seien erwähnt: »Der doppelte Schwur der Besserung« und die »Neujahrsnacht eines Unglücklichen«) und die »Clavis Fichtiana« (Erfurt 1800), eine Satire auf den Fichteschen Idealismus; er widmete sie F. H. Jacobi, den er als den größten Philosophen der Zeit bewunderte. In Berlin behagte es dem Dichter nicht auf die Dauer; bald nach seiner Hochzeit nahm er seinen Wohnsitz in Meiningen, wo er zum Herzog Georg in vertraute Beziehungen trat und den »Titan« (Berl. 1800–03, 4 Bde.) vollendete. Doch schon im Mai 1803 verließ er Meiningen wieder und siedelte sich nach kurzem Aufenthalt zu Koburg in Bayreuth an, wo er bis zu seinem Tode wohnen blieb. Das nächste größere Werk des fortan in nur selten unterbrochener idyllischer Zurückgezogenheit lebenden Dichters war ein philosophisches, die »Vorschule der Ästhetik« (Hamb. 1805, 3 Bde.; Tübing. 1813), ein Buch voll geistreichster Einfälle, wertvoll in den über die Theorie des Komischen handelnden Abschnitten. Danach folgte die Abfassung der »Flegeljahre« (Tübing. 1804–05, 4 Bde.). Auch in diesem Roman, der zu den genialsten Schöpfungen Jean Pauls gehört und ihm selbst die liebste blieb, hat er die eigne Doppelnatur, die Gemütsinnigkeit und die humoristische Neigung seines Wesens, jene in dem weich gestimmten Walt, diese in dessen Zwillingsbruder Vult, zur Darstellung bringen wollen. In der »Levana, oder Erziehungslehre« (Braunschw. 1807, 3 Bde.; Stuttg. 1815, 4. Aufl. 1861; neue Ausg. von R. Lange, Langensalza 1893) sollten die in der »Unsichtbaren Loge«, im »Titan« und in den »Flegeljahren« in Romanform dargelegten Grundsätze theoretisch ausgeführt wiederkehren. Während der Zeit der französischen Fremdherrschaft schrieb Jean Paul zu eigner und seines Volkes Erheiterung die Humoresken: »Des Feldpredigers Schmälzle Reise nach Flätz« (Tübing. 1809) und »Doktor Katzenbergers Badereise« (Heidelb. 1809, Bresl. 1823), zwei Erzählungen von derbster Komik. Aber auch in ernsthafteren, wenngleich an satirischen Schlaglichtern reichen Schriften suchte er den gesunkenen Mut der Nation auszurichten, so in der »Friedenspredigt in Deutschland« (Heidelb. 1808) und den »Dämmerungen für Deutschland« (Tübing. 1809). Das letztere Buch, gedruckt in der Zeit, als Davout das Bayreuther Land besetzt hielt, legt auch deshalb ein schönes Zeugnis für Jean Pauls männlichen Mut und edlen Sinn ab, weil er es veröffentlichte, nachdem ihm soeben durch den ganz von dem französischen Imperator abhängigen Fürst-Primas v. Dalberg eine Jahrespension von 1000 Gulden ausgesetzt worden war. Nachdem diese Pension mit dem Großherzogtum Frankfurt 1813 zu Ende gegangen, bezog der Dichter seit 1815 einen gleichen Jahresgehalt von dem König von Bayern. Aus den spätern Lebensjahren Jean Pauls sind zu verzeichnen als bedeutendere Schriften: »Das Leben Fibels« (Nürnb. 1811), »Der Komet, oder Nikolaus Marggraf« (Berl. 1820–22, 3 Bde.), die beiden letzten größeren Arbeiten des Dichters in der komischen Gattung; ferner das Buch »Selina, oder: Über die Unsterblichkeit der Seele« (Stuttg. 1827, 2 Bde.) und endlich das Fragment einer Selbstbiographie, das unter dem im Gegensatz zu Goethe gewählten Titel: »Wahrheit aus Jean Pauls Leben« (Bresl. 1826) erschien und die Jugenderinnerungen des Dichters enthält. Einen tiefen Schatten warf auf Jean Pauls Lebensabend der Tod seines einzigen Sohnes, der 1821 als Student in Heidelberg starb. Seitdem kränkelte er und war zuletzt über Jahresfrist des Augenlichts fast gänzlich beraubt. König Ludwig I. von Bayern ließ ihm 1841 in Bayreuth ein Erzstandbild (von Schwanthaler) errichten.
Jean Paul nimmt eine eigentümliche und schwer zu bezeichnende Stellung innerhalb unsrer klassischen Literaturperiode und zwischen den sich drängenden Richtungen seit dem Beginn des 19. Jahrh. ein. Unzweifelhaft vom besten Geiste des 18. Jahrh., von dem »Ideal der Humanität«, beseelt, schloss er sich doch in seiner Darstellungsweise weit mehr an die frühern Schriftsteller als an Lessing, Goethe oder Schiller an. Die Engländer, vor allen Swift und Sterne, die Franzosen Voltaire und Rousseau, die ostpreußische Schriftstellergruppe Hamann, Hippel und Herder beeinflussten die Entwickelung seines Talents und führten ihn im Verein mit seinem eignen Naturell und seinem persönlichen Schicksal auf wunderliche Abwege. Gemeinsam mit unsern großen Dichtern blieben R. die Überzeugung von der Entwickelungsfähigkeit des Menschengeschlechts und ein freiheitlicher Zug; aber er gelangte niemals zu einer Entwickelung im höheren Sinne des Wortes. Der Abstand zwischen seinen frühesten und spätesten Werken ist ziemlich unwesentlich; die Widersprüche des unendlichen Gefühls und des beschränkten realen Lebens bildeten den Ausgangspunkt aller seiner Romane; aus ihnen gingen die weichen, wehmut- und tränenvollen Stimmungen hervor, über die er sich dann durch seinen unter Tränen hell lachenden Humor erhob. In der empfindsamen Zeit, in der Jean Paul auftrat, musste er den größten Erfolg haben; die schreienden Mängel seiner Darstellung wurden geleugnet; ja, sie scheinen in den meisten Kreisen gar nicht empfunden worden zu sein. R. gelangte nur in dem Idyll und in den besten Episoden seiner größeren Romane zu wirklich künstlerischer Gestaltung; meist wurden bei ihm Handlung und Charakteristik unter einer wuchernden Fülle von Einfällen, reflektierenden Abschweifungen, Episoden und fragmentarischen Einschiebseln verdeckt und erstickt. Verhängnisvoller noch ward für ihn die oben schon erwähnte Vielleserei, in der er ein Gegengewicht gegen die Enge seiner Verhältnisse gesucht hatte, und in ihrer Folge die leidenschaftliche Bilderjagd und Zitatensucht. Alle diese Mängel vereint drückten seinem Stil mit endlosen Perioden und unzähligen Einschachtelungen den Charakter des Manierierten auf, den der Dichter nur da abstreift, wo er von seinem Gegenstand aufs tiefste ergriffen und in innerster Bewegung ist. Gegenüber dem Enthusiasmus, der R. eine Zeitlang zum gefeiertsten Schriftsteller der Nation erhob, heftete sich die spätere Kritik wesentlich an die bezeichneten Unvollkommenheiten seiner Erscheinung. Während in seinen ausgedehnteren Werken, der »Unsichtbaren Loge«, dem »Hesperus«, dem »Titan« und »Komet«, nur einzelne glänzende Beschreibungen, humoristische Episoden oder jene zahlreichen »schönen Stellen« noch zu fesseln vermögen, von denen mehrmals besondere Sammlungen veranstaltet wurden, gewähren alle in ihren Hauptteilen idyllischen oder entschieden humoristischen Dichtungen einen weit reinern Genuss und lassen das Talent und die tieferen Eigentümlichkeiten besser hervortreten. Immer steht die liebevolle, reine Teilnahme bei ihm an allen Mühseligen und Beladenen, an den Armen, Bedrückten und Bedrängten im Vordergrund. Sein Blick für das Köstliche im Unscheinbaren, das Große und Ewige im Beschränkten ist tief und beinahe untrüglich; auch seine Naturliebe verleiht allen seinen Werken Partien von bestrickendem Zauber. Seine scharfe Beobachtung des Komischen wirkt unwiderstehlich, und alle diese Vorzüge erwecken lebhaftes Bedauern, daß dem Dichter das Erreichen klassischer, künstlerisch vollendeter Form versagt blieb. Richters Werke erschienen gesammelt in erster, aber ungenügender Ausgabe in 60 Bänden (Berl. 1826–38), besser in 33 Bänden (das. 1840–42; 3. Ausg. 1860–62, 34 Bde.) sowie in Auswahl in 16 Bänden (2. Ausg., das. 1865); ferner in der Hempelschen Ausgabe, mit Biographie von Gottschall (das. 1879, 60 Tle.; Auswahl 31 Tle.) und eine Auswahl in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur« (hrsg. von Nerrlich, Stuttg. 1882 ff., 6 Bde.). Nach des Dichters Tod erschien noch »Der Papierdrache« (hrsg. von seinem Schwiegersohn Ernst Förster, Frankf. 1845, 2 Bde.). Von verkürzenden Bearbeitungen, die den Dichter der Gegenwart näher bringen wollen, sei erwähnt die des »Titan« von O. Sievers (Wolfenbüttel 1878). Von seinen Briefen sind zu nennen: »Jean Pauls Briefe an Friedrich Heinrich Jacobi« (Berl. 1828); »Briefwechsel Jean Pauls mit seinem Freund Chr. Otto« (das. 1829–33, 4 Bde.); »Briefwechsel zwischen Heinrich Voß und Jean Paul« (hrsg. von Abr. Voß, Heidelb. 1833); »Briefe an eine Jugendfreundin« (hrsg. von Täglichsbeck, Brandenb. 1858). Die »Briefe von Charlotte v. Kalb an Jean Paul und dessen Gattin« (Berl. 1882) und »Jean Pauls Briefwechsel mit seiner Frau und Christian Otto« (das. 1902) gab Nerrlich heraus. Aus der zahlreichen Literatur über R. heben wir hervor: Spazier, Jean Paul Friedrich R., ein biographischer Kommentar zu dessen Werken (Leipz. 1833, 5 Bde.); die Fortsetzung von »Wahrheit aus Jean Pauls Leben« von Otto und Förster (Bresl. 1826–33, 8 Hefte); E. Förster, Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Jean Paul (Münch. 1863, 4 Bde.); Henneberger, Jean Pauls Aufenthalt in Meiningen (Meiningen 1863); Planck, Jean Pauls Dichtung im Licht unsrer nationalen Entwickelung (Berl. 1868); Vischer, Kritische Gänge, neue Folge, Bd. 6 (Stuttg. 1875); Nerrlich, Jean Paul und seine Zeitgenossen (Berl. 1876) und Jean Paul, sein Leben und seine Werke (das. 1889); Jos. Müller, Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart (Münch. 1894), Die Seelenlehre Jean Pauls (das. 1894) und Jean Paul-Studien (das. 1899); Hoppe, Das Verhältnis Jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit (Leipz. 1901); Reuter, Die psychologische Grundlage von Jean Pauls Pädagogik (das. 1902): Allievo, Gian Paolo R. e la sua Levana (Tur. 1900); Czerny, Sterne, Hippel und Jean Paul (Berl. 1904); F. J. Schneider, Jean Pauls Altersdichtung Fibel und Komet (das. 1901) und Jean Pauls Jugend und erstes Auftreten in der Literatur (das. 1905). Eine begeisterte, formvollendete »Denkrede auf Jean Paul« verfaßte Börne (1825).
Grönländische Prozesse
I. Über die Schriftstellerei
Ein Opusculum posthumum
Der Verfasser dieses Werkgens gab vor einem halben Jahre seinen unsterblichen Geist auf. Er war Famulus eines berühmten Professors; daher er auch nichts lernte. Er würde eben darum Kollegien gelesen und Beifal gefunden haben; allein er hatte zu wenig Geld, um sich ein lateinisches M oder D zur Zierde seines Namens kaufen zu können. Was er aber hatte, fras eine langwierige Krankheit auf, deren er hier erwähnt, und die ihn bis ins Alter und in das Lazareth begleitete, wo er starb, doch nicht, ohne sich unsterblich gemacht zu haben. –
Eine Priesterin der Venus, die ihre lezten Reize auf den weichen Altären ihrer Göttin geopfert, und deren Schönheit kein Käufer der Wollust eines verstohlnen Wunsches mehr würdigt, ist darum noch nicht auf dem Wege, gegen die alte Schande den Ruhm der Besserung einzutauschen, und auf den sichtbaren Wink der neuen Häslichkeit den Dienst des Vergnügens zu verlassen. Vielmehr wiederholt ihr Geist die Rolle des Körpers: denn sie wird aus einer Schülerin der Liebe die Lehrerin derselben, aus einer Hure eine Kuplerin; sie nährt sich von den Lastern, die sie nur lehren und nicht thun kan, sie beschaut ihr voriges Glük in der gelehrigen Wollust ihrer Eleven, und erleichtert sich dadurch das schmerzliche Andenken ihres iezigen Unwerths. – Eben so ich. Das Misvergnügen, nicht mehr schreiben zu können, lindere ich mir durch das Vergnügen, es andere zu lehren. Nämlich: ich widmete vor vielen Jahren meine rechte Hand mit allen ihren Muskeln dem weltberühmten Apollo; und gewis ich konte ihm kein wichtigeres Glied meines Körpers widmen. Denn schon der lere Raum in meinem Kopfe und Magen versprach der gelehrten Welt eine Feder, so unerschöpflich an Dinte, als das Krüglein iener Witwe an Öhl; und in einer lang anhaltenden Theurung war ich auf dem Wege, ein Polyhistor, wenigstens ein Polygraph zu werden. Allein o die verwünschte Gicht! die alle Muskeln des Genies lähmt, und die Schöpfer der Unsterblichkeit, diese Werkzeuge der Begattung mit den Musen, diese fruchtbaren Staubfäden, ich meine die fünf Finger, in einen schmerzlichen Krampf zusammenzieht! Denn kurz: an dieser Gicht starb meine Unsterblichkeit, weil keine neue Lorbern meinen erkämpften Ruhm behaupteten, und ich wurde eher vergessen als geheilt. Allein ob mir nun gleich iezt das Alter die hergestellte Gesundheit verleidet; obgleich die Überreste des vorigen Übels noch immer der gelehrten Republik die Flechsen meines Arms entziehen; so will ich doch durch eine neue Anstrengung meine verloschenen Gedanken zu einem Buche anfachen, und mit meiner Hand, ehe sie verweset, mir Lorbern pflanzen. Der Invalide lehrt exerziren, und ich lehre in diesem Werkgen, wie gesagt, schreiben. Das heist, ich entwikle die Ursachen der Autorschaft, als da sind Hunger, (aber nicht Sättigung,) Trunkenheit, (aber nicht Durst,) Jugend, Liebe u.s.w. Das heist, ich abstrahire aus den vortreflichsten neuen Schriftstellern die Erfordernisse eines guten Buchs z. B. die Schwulst u. so ferner. Ich habe meistens die schönen Wissenschaften im Auge, die Gemeinweide alles litterarischen Viehes, den Spielplaz der schriftstellerischen Jugend. –
Dem leiblichen Hunger der Schriftsteller verdankt das Publikum seine geistliche Sättigung. Einige Ärzte leiten aus dem Magen alle Krankheiten her; ich wollte aus demselben noch leichter den Ursprung der meisten Schriften erklären, und zeigen, daß weniger der Nervensaft des Gehirns als die unbefriedigte Galle des Magens an der Erzeugung eines Buchs arbeiten. Ein überfülter Magen schikt dem Kopfe alle Folgen der Überladung, nämlich Faulheit und Dumheit zu; warum solte ein lerer nicht das Dachstübgen der Sele besser erleuchten, warum sie nicht mit der Heiterkeit und dem Verstande begeistern können, durch deren Hülfe seinen Bedürfnissen abgeholfen wird? – Der Magen sezt einen Gelehrten, der seinen Körper nicht so wie seine Sele mit Luft und Wind nähren kan, in ein gelehrtes Feuer, und die von unten aufgestiegnen Dünste erhellen durch ihre Entzündung das ganze Ideengebiete des Autors so sehr, daß er lauter neue Wahrheiten sieht und dem Drange endlich weicht, sie durch die Presse mitzutheilen. Daher begünstigt eine Theurung die Erfindungskraft der gelehrten Republik ganz ungemein und ein Miswachs des Getraides verspricht eine reichliche Ernte von Büchern. Daher gleichen diese Stüzen des menschlichen Wissens den Thieren, bei denen nur der Hunger die Geschiklichkeit ihrer Kehle in Athem sezt; und die gepriesne Stimme der Wahrheit ist oft nichts als das verstärkte Knurren des unbefriedigten Unterleibs. Gleich der Höle des Äolus beunruhigt der Magen die Welt mit vier bekanten Hauptwinden. Das gelehrte Handwerk scheint auch folgender Sitte zu ähnlichen. In Scandino (im Gebiete des Herzogs von Modena) macht sich das Volk diese Lustbarkeit. Man behängt mit allerlei Eswaren den Gipfel eines Pappelbaums, den man von seiner Rinde und seinen Ästen entblöst. Nach den Lokspeisen seines Gipfels klettern die Bauernkerle, die erst nach vielen vergeblichen Versuchen ihr Ziel ersteigen und sich ihrer Belohnung bemächtigen. Eben so hängt an dem Lorberbaum nicht mehr der Reiz des Ruhms, sondern der Köder der Nahrung, nach welcher die schreiblustige Hand des Autors oft vergeblich hascht, und die sich endlich dem Besieger des schlüpfrigen Stams und dem Ersteiger des Gipfels überliefert. Jedem, auch noch so philosophischen Magen ist der längst verspottete horror vacui eingepflanzt – obwohl nicht allen Köpfen –; was Wunder, wenn die verlegne Sele stat Almosen zu samlen, Varianten, Lieder, Bemerkungen samlet, wenn sie von den Büchern, aber nicht von den Menschen bettelt, wenn sie, gleich verarmten Vätern, sich von dem Erwerbe ihrer geistlichen Kinder nährt, und wenn der Magen die Finger anreizet, nach der Unsterblichkeit zur Verlängerung des Lebens zu greifen? – Was Wunder frag ich: kein Wunder nämlich ists. Und wie sollte es auch, da der Eigennuz alle Wesen beselet? Er kämpfet in dem Heerführer um die blutige Beute, mit welcher das menschenfreundliche Kriegsrecht den Überwinder belohnet, und um den Ruhm, der erst durch ermordete Krieger athmet; er rüstet den ungekrönten Räuber mit Verachtung gegen die Drohung des Gesezes aus, und thut in ihm für den Strik, was er in andern für den Lorber thut. Er verlängert in der Feder des Advokaten Buchstaben, Perioden und Prozesse, und spielet durch die Künste des mit Aktenstaub bedekten Gewissens die rechtliche Uneinigkeit der Klienten auf ihre Enkel. Er angelt im Verliebten mit poetischen Schwüren nach Wollust und Geld, und krächzet aus dem feisten Abte die Lobrede der himlischen Nahrung. Kurz, er fesselt den ganzen vielfarbigen Haufen von Absichten an Eine Kette. Und nur dem Schriftsteller wolte man eine grössere Uneigennüzigkeit ansinnen, als die, sich mit ihrer Larve zu verschönern; nur er sollte sich an die prahlhaften Versprechungen der Vorreden zu binden haben? O so würde die Welt arm an Büchern und reich an Betlern sein; anstat der geistlichen Kinder würden ihre Väter sterben und die Weitschweifigkeit nur christliche Predigten vergrössern, und dicke Quartanten und dicke Bäuche seltner werden. Die vortreflichen heiligen Reden, die nun auf den Kanzeln, in den geheimen Gemächern und in den Kramläden ihre Bestimmung erfüllen, wären gleich anderm Ungeziefer, unbekant unter der Perüke ihres Verfassers gestorben, dem leren Raume der kritischen Zeitungen hätten Muster zu seiner Ausfüllung gefehlet; und die geistreichen Romane wären ungeboren geblieben, die nun den Geist der feinern Liebe durch modische Zoten bis zu der Köchin und dem Kutscher verbreiten, die die Langeweile von dem Golde verscheuchen, und die ermattete Wollust mit gedrukter Lokspeise anködern, die den deutschen Magen mit Eicheln und Konfituren blähen, ohne ihn zu nähren und die Dumheit aller lesenden Stände mit blumichtem Futter mästen. Diesem Hunger verdanken wir die Anstrengung, mit welcher der Dichter seine poetische Pfeife auf Unkosten seiner Lunge bläst, gleich gewissen Derwischen in Ägypten, die mit einem Stos in ihr Horn ihr Almosen fordern, oder den stummen Betlern, die durch ein tönendes Glökgen die Freigebigkeit um eine Gabe ansprechen. Diesem Hunger verdanken wir die Geschiklichkeit, mit welcher der Philosoph auf metaphysischen Seilen tanzt, auf den Beutel der mildthätigen Bewunderung hoffend, und mit welcher seine Ideen, gleich dem Rauche, in die Höhe wirbeln, wo, so viel er weis, neben dem Korbe sokratischer Abstrakzionen auch der sinlichere Brodkorb hängt. Ja diesem Hunger verdanken wir die Wahrheits- und Menschenliebe des Schriftstellers: denn nichts ist natürlicher, als daß die stechenden Säfte des Magens, die Uneigennüzigkeit aus ihrem Schlafe aufspornen, und daß ein Herz vol süsser Menschenliebe zu einem Magen vol bitterer Galle sich schlage. Ich habe selbst einen vortreflichen Schriftsteller gekant, dessen uneigennüzige Fruchtbarkeit an rührenden Bruchstükken das Publikum einem Stokke nagender Würmer in seinem Unterleibe zu verdanken hatte, welche unaufhörlich Ideen an den Magen abluden, der sie darauf durch die Nerven an das Gehirn und endlich an die Sele verschikte. Auf diese Weise waren die Feinde der Musen seine Musen; auf diese Weise vertraten verachtete Thiere bei diesen Meisterstüken des menschlichen Herzens die Stelle der Hebamme, eben so lokken in Arabien die Stiche eines gewissen Insekts aus der Esche das süsse Manna heraus, und eben so verbessern auf der Insel Malta gewisse Maden den Feigenbaum und zeitigen seine Früchte. – Wie sehr überbietet das Werk seinen Schöpfer; wie klein ist das Loch, woraus man oft Quartanten spinnt! – Allein eben dieses versöhnet mich mit dem scheinbar ungerechten Schiksale der Schriftsteller, die durch gedrukte Lügen dem verdienstvollen Beutel eines dummen Gönners ein erzwungenes Almosen abschmeicheln müssen. Denn der weise Apollo wuste zu gut, daß nur hungrige Jagdhunde am besten iagen, nüchterne Läufer am geschwindesten laufen, daß ein zaundürrer Pegasus länger als ein schweres Reitpferd bei Athem bleibe, daß man aus dem Kieselstein das Feuer herausschlagen, und aus dem gepolsterten Stuhle den Staub herausklopfen müsse – Darum stattete er seine Lieblinge mit Armuth aus, verbesserte ihre Sele auf Kosten ihres Körpers und gab ihnen wenig zu leben, damit sie ewig lebten.
Der Gedanke der Unsterblichkeit verzukkert also dem Schriftsteller sein ieziges bitteres Leben. Dies bringt mich auf die Betrachtung, daß Autoren nicht nur für ihren Magen, sondern auch für ihre Ohren schreiben, und Lorbern brechen, nicht nur um damit den Geschmak einer Rindfleischsuppe zu verbessern, sondern auch um sie um die Schläfe zu winden. Und dieser Endzwek ist auch erreichbarer als der vorige. Denn das Publikum bezahlt weniger karg als der Verleger, weil dieser die Belohnung in Geld und ienes sie in Wind auszahlt. Übrigens steht der kritische Ablas iedem für Geld, künftige Gegendienste u. s. w. feil, wie ich weiter unten von den Rezensenten zeigen werde, ieder wunderliche Heilige wird zum Gegenstande der Anbetung kanonisirt, und es giebt iezt der Unsterblichen eine solche Menge, daß man nur die neuesten kent und die übrigen schon vergessen hat. Die heutigen Journale, die Archive des schriftstellerischen Ruhms, sind daher nichts als eine Zusammenhäufung von Abbildungen der besten, deutschen Köpfe und ihrer Gaben, die endlich vom Ruhme der Kritiker selbst gekrönt wird – eben so ist ein Thurm in Ispahan, der aus lauter Ziegenköpfen, deren Hörner auswärts stehen, gebauet ist, und dessen Spize der Kopf des Baumeisters macht. – Hat dich der Zirkel deiner Bekannten einmal mit Bewunderung umräuchert, ein Klubb bartloser Rezensenten zum Erben des Nachruhms erkohren, oder gar ein Trup Nachahmer zum Führer einer gehörnten Herde ausgeblökt, und, was am meisten ist, ein Schok Weiber für den Kizel ihrer Thränendrüsen mit der Verewigung beschenkt: so glaube fest, dein Name sei der Zeit gewachsen, so troze dem Tadel unbekanter Klugen, so verachte die sichtbaren Zeichen deiner nahen Sterblichkeit, so füttere durch deine Fruchtbarkeit die gefrässige Vergessenheit sat, damit sie wenigstens etliche deiner Geburten verschone, und widerkäue in Gedanken deinen Ruhm, das Urtheil einer klügern Nachwelt hoffend, um deinen Muth in Verbreitung des Unsinns zu stärken, gleich der pythischen Priesterin, die sich durch gekäute Lorbern zur Raserei in heiligen Versen, erhob. Zwar hindert der unächte Kritiker die Beruhigung deines Ehrgeizes, durch unnüze Drohungen; allein im Grunde hindert er sie nur so lange, als das vorübergehende Gefühl deiner Schwäche ihm beifält, als dein Stolz ihn nicht widerlegt. Doch wil ich einige Perioden hin durch seine Sprache reden, um ihn hernach in der deinigen besser zu widerlegen. »Stolze Insekten, spricht dieser Herold der deutschen Schande, die ihr euch im warmen Stral der Abendsonne ein ewiges Leben träumt, oder auf dem Kothe, eure Wiege und eure Nahrung, den spielenden Glanz eurer Fliegeldekken bewundert, wie leicht kan euch der nächste Frost zerstöhren! Die heutigen Gözen des Tags riechen nach dem Weihrauch ihrer Verehrer; aber wie die Hunde bei verändertem Wetter stinken, so wird die kleinste Verbesserung des Geschmaks sie in den Abscheu der deutschen Nase verwandeln, und gleich einem Lichte wird ihr Ruhm kleiner werden, ie länger er glänzet. An diesem Ruhme werden sich die Zähne künftiger Mäuse wezen, und die Würmer – der Nachtrab des Todes – werden die gepriesnen unsterblichen Produkte noch früher als ihren sterblichen Schöpfer verdauen. Die Behältnisse des iezigen poetischen Feuers werden die Tobakspfeifen der Nachwelt anzünden, und den Pfeffer des Enkels umkleiden. Vorausgesezt, daß noch ein so später Tod sie verewigt, vorausgesezt, daß die Nachwelt sie durch die Spezereien der Rezensenten als Mumien, oder durch den scharfen Spiritus der Satire als seltne Misgeburten überkomt. Die Zeit wird dan die Flekken dieser Bücher, wie des Seehunds seine, vergrössern, und iedes Jahr ihnen in einer neuen Runzel das Zeichen seines vorigen Daseins zurük lassen. Die iezt streichenden Almanachs und übrigen Poetereien werden, gleich den streichenden Heringen, durch das Fortschwimmen im Flusse der Zeit immer magrer werden, die hinrauschenden Jahre den Kleister modischer Verschönerung abspülen, und die Sense der Zeit die iezigen Blümgen wegmähen.«Doch wird man diese verwelkten Blümgen auch einmal für kritische Ochsen, als Heu zum Wiederkäuen brauchen können. So sagt der Kritiker; natürlich, daß ihm kein Autor glaubt, weil ieder blos sich glaubt. Wie leicht läst sich das Zischen der Misbilligung, über die Stimme des eignen Beifals und über die Hofnung eines bessern Urtheils verschmerzen! Und diese Hofnung ist nicht ungegründet. Denn die billigere Nachwelt wird unfehlbar dem Verdienste der heutigen Autoren die iezige Verachtung mit doppelter Bewunderung vergüten, und diese vortreflichen Schriftsteller werden erst unsterblich werden, wenn sie gestorben sind. So schwellen in Persien die todten Körper auf; so stinkt der Same des Korianders auf der Pflanze, und gewint nach der Trennung von derselben Wohlgeruch. Erst im Grabe werden sie dem Feuer ihres Genies freien Wirkungslauf lassen können, wie die Bomben erst in die Erde fallen, ehe sie die feurigen Werkzeuge des Todes um sich schleudern; erst aus ihren modernden Köpfen wird der Lorber, gleich den Haren, hervorspriessen, eben so grünet das Mos auf den faulenden Köpfen der hölzernen Esel vor den Stadthoren. Wie der weisse Schleim, womit der Wurm in der Perlenmuschel die Öfnungen seiner Schale stopfet, nach und nach zur Perle reift, ebenso wird der Nervensaft der oftgedachten Schriftsteller, der für schlechte Zwekke und oft blos für die Verbesserung zerrissener Kleider verschwendet wird, mit der Zeit in den glänzenden Gegenstand der künftigen Bewunderung sich verwandeln und zu den aufgereihten Perlen der übrigen Genies sich fügen. Denn vielleicht, daß das Geschlecht der Kenner nicht ausstirbt, die nur Bücher, welche die Würmer angefressen, schmakhaft finden – und so fehlt den Produkten der heutigen Autoren zur Unsterblichkeit nichts als eine lange Vergeßenheit und die Zähne der Würmer; wie die Produkte des Rindviehes, die Käse, sich durch Alter und Milben dem Gaumen empfehlen. Auch die Wilden finden faulende Fische am wohlschmekkendsten. Ja noch mehr, künftige Kritiker werden die Geburten der iezigen Köpfe zu Lehrern ihren Zeitverwandten distilliren, wie der Chemiker aus verfaultem Urin leuchtenden Phosphor schaft; und ihre Dinte wird die vermoderten Reliquien der Genieinsekten zum neuen Leben erwekken, wie aus einer mit Rindsblut besprizten Krebsasche neue Krebse auferstehen.Mit dieser Auferwekkungskraft ist der unschäzbare Verfasser des Annulus Platonis begabt, welcher annulus 1781 schreib ein tausend siebenhundert und ein und achzig herauskam, und in welchem annulus der alchymistische Unsin, wie der Papagei in dem Ringe seines Bauers sich wieget. Von der Kunst solcher Kritiker hat also die heutige scheinbare Dumheit nach ihrem Tode die Verwandlung in Weisheit zu gewarten – eben so schuf sich Virgil aus einem toden Ochsen einen ganzen Schwarm von Bienen, eben so macht man aus dem wässerichten Gehirn des Potfisches Lichter – Gesezt aber auch, euer Ruhm hinkte eurer Schande auf zu langsamen Stunden nach; gesezt alle Eingänge zum Tempel der Ehre wären verschlossen, so steht doch jedem noch diese Hinterthüre offen. Denn nämlich, obgleich der Parnas durch die Umgrabung und Umwühlung von tausend schriftstellerischen Händen, unendlich an Fruchtbarkeit gewinnen mus; so ist doch ausgemacht, daß ihm durch die Verwesung aller dieser Glieder eine noch grössere zuwachsen müsse, wie man an einigen Orten die Weinberge nicht ohne Nuzen mit Ochsenklauen düngt. Wenn nun der Tod des Schriftstellers der Literatur frommet, so komt er auch dem Ruhme desselben zu statten – und so nährt die Verwesung seinen Lorber, so wurzelt auf seinem Grabe seine Unsterblichkeit. – Auf diese Weise ist jeder Schriftsteller seiner Verewigung versichert, und die Menge seiner Tadler beweist nur seine Untadelhaftigkeit, und ihr Sieg über das Leben seines Ruhms seine Vorzüge: denn je mehr Träger, desto vornehmer die Leiche. – Ja jede Schande sezt Ehre voraus; wer hängt, ist über die Erde erhaben. Und oft macht diese Schande berühmt und gros; eben so lassen die Rezensenten das Tadelhafte einer Schrift mit grössern Buchstaben drukken, eben so wird eine Mutter durch eine Misgeburt und ein Verbrecher durch den Pranger bekant. – Zu den obigen Gründen für die Verewigung der heutigen Schriftsteller fält mir eben ein Beyspiel aus den neuern Zeiten ein. Nämlich: wer hätte sich ie die Möglichkeit träumen lassen, daß Dichter des dreizehnten Jahrhunderts dem geschmakvollen Gaumen des achtzehnten behagen können, wer je den Minnesängern ihre iezige Auferstehung weissagen mögen? Und doch hat der Geschmak unter Friedrich und Joseph, die bestäubten Musen unter den schwäbischen Kaisern geplündert. Dieser lobenswürdige Fleis nun, der in den Bibliotheken, den litterarischen Gottesäkkern, nach altem Unrath scharret, wird auch auf unsere Nachkommen erben. Dann werden die künftigen Freunde des grauen Unsins, die jezigen Freunde desselben belohnen und zweite A-Z werden die poetischen Reliquien unserer Zeit für den Geschmak ihres Publikums verbessern, und sie von den verstorbenen Schönheiten säubern, – eben so kämte D. Kunastrokius Eselsschwänze klar, und rupfte die tauben Hare mit den Zähnen aus.Siehe Tristram Shandi's Leben. 1. Theil 7. Kapitel.
Allein nicht alle schreiben, um Ehre zu erhalten; einige auch, um sie andern zu nehmen. Von diesen nun, die der Neid zu ungerechtem Tadel begeistert, deren Ehrgeize fremde Schande schmeichelt, und die man kurz unter den Namen der Rezensenten befasset, von diesen weiter unten!
Das dichterische Feuer steht dem Schriftsteller nicht immer zu Gebote, und das Genie fällt eben so oft in Ohnmacht, als ein Frauenzimmer. – Dieser Ermattung nun helfen verschiedene künstliche Reizungen ab. Der Schöpferkraft des Weins verdanken wir manchen gereimten Unsin, und dem Schaume desselben manche Venus. Die Poeten und die Hunde nämlich verliehren ihren Verstand auf entgegengesezte Arten. Der Mangel an Getränken macht die Hunde närrisch, wütend oder dichterisch; allein nur der Überflus daran spricht den Dichter von seinem Verstande los, und spornet ihn über die träge Vernunft hinweg. Diese Hize des Weins stört den Unsin der Phantasie aus seinem Winterschlafe, und wekt die buntschekkigte Brut der Träume aus ihrem Schlummer; – aus allen Winkeln des Gehirns kriechen verborgene Einfälle hervor, jede Ähnlichkeit, jede die Stammutter einer Familie von Metaphern, samlet ihre unähnlichen Kinder um sich, und gleich einer wandernden Mäusefamilie, hängt sich ein Bild an den Schwanz des andern; – alle Saiten des hohlen Kopfes tönen zu einem gleichzeitigen Misklang, das Gedächtnis wirft seine gestohlnen Schäze aus, und wie Heu durch die Nässe, erhizt sich der zusammengeraubte Haufen von verwelkten Blumen durch das Getränke. Nur auf diese Weise kan der Parnas mit einem Bedlam weteifern, nur durch das Einsaugen einer solchen Lauge kan der Unsin zu einer pindarischen Höhe aufschiessen. Darum waren auch alle geflekte Thiere dem Bacchus heilig; – wenn man nämlich das buntaustapezierte Gehirn eines Musensohns mit einem vielfarbigen Thierfelle vergleichen darf. Daher ist begreiflich, warum Bacchus seinen Hörnerschmuk bald an- bald ablegte; vorausgesezt, daß durch das vorige die Ebbe und Fluth des dichterischen Unsins begreiflich geworden. – Daher verehre ich neben den huldreichen Mäzenen, deren Verdienste der Magen dem Schriftsteller in die Feder sagt, niemand mehr als die Spinnen. Denn eben diese beschüzen mit ihren Geweben die Trauben vor den gefräßigen Mükken, und bewachen den Wein, den die Gönner an die Poeten verschenken. Auf diese Weise hängt an der Fruchtbarkeit des Hintern der Spinnen die Fruchtbarkeit genieartiger Köpfe; auf diese Weise nuzen dem Parnas unter allen Spinnen die natürlichen am meisten. – Daher verehre ich neben den huldreichen Mäzenen auch die Esel. Denn die Näscherei eines Esels veranlaste die Beschneidung der Weinstökke. Dafür errichteten ihm die Nauplier in Argien ein steinernes Ebenbild; und das hölzerne Ebenbild desselben von den Stadtthoren möcht' ich fast der Dankbarkeit der Dichter anempfehlen, da noch über dieses seine langen Beine ihr Ätherleben füglich abbilden. – Allein der Wein ist ein zu kostbares Mittel der Begeisterung, er ist öfter der Endzwek als der Vater der Verse, und manches Weinlied hat der Durst gemacht. Auch verraucht für die vorgesezte Anstrengung des Vielschreibers sein Einflus zu bald, den oft überdies die darauf folgende Lerheit im Kopfe, auf dem Papiere und in der Börse verbittert. Mit Vorbeigehung des edlen Gerstensaftes, und der übrigen Getränke, deren Einflus auf den langsamen Nervensaft schon durch gedrukte Zeugnisse verewiget worden, komm' ich daher auf die äussere Hize, die das Blut reichlicher nach dem Kopfe treibt, und der geistigen Fischerin einen reichen Fischzug von Ideen verspricht. Die Sonnenhize wekt nicht blos schlafende Fliegen, sondern auch schlafende Ideen aus ihrer Erstattung, und vereiniget in dem Kopfe wie in der Atmosphäre Dünste zu Blizen. Ihre Wärme zeitigt Früchte und Bücher, und leitet den Nervengeist nach dem Kopfe, wie den Saft der Erde nach den Gipfel des Baums. Zu Rom sollen in den Monaten der grösten Hize die meisten Mordthaten geschehen. Wenigstens aus den Lenden des Maies mag bei uns manches Almanachsgedicht entspringen. Dazu ist im Mai die Hochzeit der Natur; und die Jungferschaft der Musen wird doch nicht allein den Begierden des Dichters trozen und seine Verse überleben wollen? Der Hundsstern ists, unter dessen Wuth der Hund in gefährlichen Geifer und der Dichter in nüzliche Verse ausbricht, und der beide an die Menschen hezt. Im Winter ist ein warmer Ofen der Vice-Apollo. Er schmelzet unähnliche Begriffe in einem Vers zusammen, und nährt unbefiederte und dem Ei der dunkeln Idee kaum entschlüpfte Hirngeburten mit dem beschleunigten Zuflus gestohlner Ideen – so nistet die Schubuteule an den heissesten Orten, wo die Sonnenhize das Aas für ihre Jungen in Brei auflöset. – – Aber o ihr Stüzen des deutschen Wizes, wendet nie an die Begeisterung zu viele Kosten, und schwizt und trinkt nie zu oft, oder zu sehr, damit ihr beides lange könnet; sonst würdet ihr euer theures Loben der Verewigung aufopfern, sonst würde der Pegasus gleich dem gezähmten Krokodil, seinen Reiter verschlingen. –
Wer solte wohl glauben, daß Krankheit zum Bücherschreiben eine Ursache, wenigstens eine Veranlassung werden könne? Oder vielmehr, wer solte es nicht glauben, da Apollo sowohl der Gott der Ärzte als der Musen, und also auch der Krankheiten wie der Bücher ist? – Einem kranken Körper ist die Sele die gröste Unthätigkeit schuldig, und sie mus ihn aller der Anstrengung überheben, die der rükkehrenden Gesundheit den Weg vertreten könte. Daher ist der Ruhe des Pazienten ausser dem Schlafe nichts bessers vorzuschlagen als das Bücherschreiben. Diese Arbeit entzieht den Geist allen Gedanken, ia sogar der Ermüdung lebhafter Träume und schränkt seine ganze Anstrengung auf die Handhabung einer leichten Feder ein. Diesem Nichtdenken sind wir daher manche Kunst zu denken schuldig: denn ohne Logik läst sich nichts leichter schreiben als eine – Logik. Und das Krankenbet mag die Wiege von manchen vortreflichen Betrachtungen gewesen sein, die Kranke für andere Kranke in den Druk gegeben, und die darum auch nicht für den gesunden Verstand geschrieben sind. Ja die Krankheit arbeitet oft selbst an dem Buche. Der Druk etlicher geprester Winde im Unterleib vermag das ganze Gebäude des Optimismus umzustürzen; ein verschleimter Magen trägt blühende Deklamazioneu gegen den Luxus, und gesalznes Blut würzt die Satire mit beissendem Wiz. Wie Gewächse zwischen Steinen besser gedeihen, so wuchs mancher Lorber durch die Steine in der Harnblase, um einige Zolle höher, und eine übelabgelaufene Aderlas versah einmal alle Almanachs des deutschen Reichs mit rührenden Elegien: so fliesset das Gummi aus den Bäumen, nach gemachten Einschnitten. Ich rechne zu meiner Glükseligkeit die Nachbarschaft eines Musensohns, der auf der Spize eines Parnasses von fünf Stokwerken weilet, und den Bachus und Venus mit der Schwindsucht beschenket haben. Wie die Zugvögel, kehret seine Krankheit im Frühlinge mit sichtbaren Äusserungen und mit ihr sein trauriger Gesang zurük. Sobald das Blut seinen Speichel färbt, so wimmert seine genieartige Lunge in youngischer Melodie. So verkündigen die blutigen Fleken im weissen Kothe der Stubennachtigal, die Ankunft ihres Gesangs. – Bücher sind oft nichts als Symptomen eines kranken Geistes. Predigten schreiben, heiss' ich, den Durchfall haben; dichten, das Fieber haben; epigrammatisiren, die Kräze haben, und rezensiren, die Gelbsucht haben. Nur das einzige Chiragra ist die Feindin der Musen und bindet der Schöpferin geistiger Meisterstükke die Finger. Des vortreflichen furor poeticus, oder der Tolheit, der heutigen Melpomene, wird weiter unten gedacht werden. –
Die ewige Jugend der Musen adelt die Jugend ihrer Söhne, junge Schriftsteller sind daher die besten. Dasselbe Vermögen, welches den Jüngling bald zum Vater vaterloser Kinder macht, berechtigt ihn zur Erzeugung anonymischer Bücher, und die Akademie erlaubt ihm die erste Schändung der Musen und der Mädgen. Seine Bedürfnisse, seine Fähigkeiten lokken ihn zum Gebrauch der Feder. Seine Bedürfnisse – denn an dem Orte, wo die Gelehrsamkeit zu Hause und im Schlafrok ist, wo die Weisheit mit Stok und Degen, in jeder Gasse ein Logis für sich und ihre bezahlenden Freunde gemiethet und wo der Katheder blos das Echo klingender Goldstükke ist, an diesem Orte kauft sich der Jüngling den Verstand seiner Lehrer um einen Preis, den der Wert der Sache nicht immer unterschreibt, an diesem Orte mus man daher das Publikum zu lehren anfangen, damit man selbst lerne und Bücher schreiben, um welche kaufen zu können, wie einige Wilden gegen ihre Kinder Weiber einhandeln. Mit dem Lohn gedrukter Epigrammen befriedigt man den Harkräusler und die Arbeit der innern Seite des Kopfs bezahlt die Zierde seiner äussern; zusammengeflikte Verse flikken den Rok, schmuziger Spas wäscht die Hemden und mit einem verdorbnen Allerlei erschreibt man sich ein Schaltjahr von Braten. Man singt da die Liebe, um sie bezahlen zu können. Übrigens hascht der Jüngling auch nach Luft, dem Elemente des Ruhms: daher lispelt er durch die Feder – das Sprachrohr der Fama – dem Ohre der Welt d. h. etlicher Bekannten seine Grösse zu. Sein Ehrgeiz weidet sich an der Verwunderung seiner Freunde, und wuchert gierig die gefälligen Mienen ein, die sie an seine Grösse verschwenden. Man stelle sich vor, wenn er, dieser Weltschöpfer in nuce, nun sechs Monate im Schweisse seines Angesichts Bilder, die ihm gleich sind, geschaffen und vom siebenten selige Ruhe erwartet; wenn alle Figuren seiner Gallerie in bunten Kleksen schimmern, für die er auf Kosten der Zukunft alle Muschelschalen seines Farbekästgens ausgeleret; wenn er seinem Kinde einen Pathen und sich das Pathengeld erbettelt hat – man stelle sich vor, sag' ich, mit welcher Wollust er dann das schön gebundne Buch – die vergoldete Nus ohne Kern – seinem Vater überschikken mag, der aus Vergnügen, den ersten geistigen Enkel, die erste Kraft der Muskeln seines Sohnes, zwischen den Fingern zu halten, das fruchtbare Feld mit Goldkoth, dem Exkremente des Glükkes, düngt. Freilich mus er in der Vorrede seinen Eigennuz mit einer menschenfreundlichen Larve zieren, und seine Absichten mit etlichen Lügen beschönigen. Denn die Liebe zu den Menschen, nicht zu den Huren; der Erwerb etlicher von Edlen geweinten Thränen, nicht des Weins; das volle Herz, nicht der lere Magen; die Befriedigung seiner bittenden Freunde, nicht der ungeduldigen Gläubiger – gaben ihm seinen Kiel in die Hand. Auch die Wahrheitsliebe