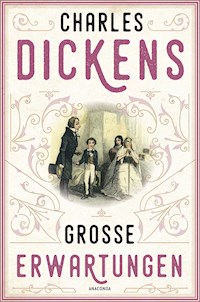
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gentleman müsste man sein, durch London flanieren und müßig gehen können. Für den armen Waisenjungen Pip aus einem Themse-Dorf ist solch ein Leben völlig außer Reichweite, bis ein unbekannter Gönner ihm genau dies ermöglicht. Und ihm damit den Fluch großer Erwartungen auflädt. Dieser atmosphärische Roman ist besiedelt von starken, geheimnisumwitterten Charakteren. Charles Dickens lotet hier die Untiefen der englischen Standesgesellschaft aus und treibt dabei ein fesselndes Spiel aus Schein und Sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charles Dickens
Große Erwartungen
Roman
Aus dem Englischen von Margit Meyer
Anaconda
Titel der englischen Originalausgabe:
Great Expectations (London: Chapman & Hall 1861).
Die Übersetzung von Margit Meyer erschien erstmals 1977
als ein Band der Gesammelten Werke in Einzelausgaben
von Charles Dickens bei Rütten & Loening in Berlin.
Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1977, 2008
© dieser Ausgabe 2020 Anaconda Verlag GmbH, Köln
Ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Frederick W. Pailthorpe (19th century), »This is wery [sic] liberal on your part Pip«, Great Expectations (c. 1885), Free Library of Philadelphia / Print and Picture Collection / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
ISBN 978-3-641-27636-2V002
www.anacondaverlag.de
1. Kapitel
Da meines Vaters Familienname Pirrip und mein Vorname Philip ist, konnte meine kindliche Zunge beide Namen nicht länger und genauer aussprechen als Pip. So nannte ich mich Pip und wurde auch von anderen Pip genannt.
Wenn ich Pirrip als meines Vaters Familiennamen angebe, so beziehe ich mich dabei auf dessen Grabstein und auf meine Schwester, Mrs. Joe Gargery, die den Schmied geheiratet hat. Da ich meinen Vater und meine Mutter niemals gesehen habe und auch nie ein Bild von ihnen zu Gesicht bekam (denn zu ihren Lebzeiten gab es noch keine Photographien), gingen meine ersten Vorstellungen über ihr Aussehen wider alle Vernunft von ihren Grabsteinen aus. Die Form der Buchstaben auf meines Vaters Grab erweckte in mir den Eindruck, dass er ein breitschultriger, untersetzter, brünetter Mann mit lockigem schwarzem Haar war. Aus dem Charakter der Inschrift »Georgiana, Ehefrau des Obigen« zog ich die kindliche Schlussfolgerung, dass meine Mutter sommersprossig und kränklich gewesen sein muss. Mit fünf kleinen Steinrhomben, von denen jeder etwa eineinhalb Fuß lang war und die neben ihren Gräbern in einer ordentlichen Reihe aufgestellt und dem Gedenken an meine fünf kleinen Brüder gewidmet waren – die das Rennen in diesem allgemeinen Lebenskampf außerordentlich zeitig aufgegeben hatten –, verbinde ich die mir heilige Überzeugung, dass sie alle auf dem Rücken liegend und mit den Händen in den Hosentaschen geboren sein mussten und dass sie sie in dieser Lebensphase niemals herausgenommen haben.
Wir wohnten im Marschland, unten am Fluss innerhalb der Flussbiegung, zwanzig Meilen von der See entfernt. Ich glaube, meine ersten, höchst lebendigen und nachhaltigen Eindrücke von der Gleichheit der Dinge habe ich an einem denkwürdigen, nasskalten Spätnachmittag gewonnen. Zu jener Zeit stellte ich mit Sicherheit fest, dass dieser trostlose, von Nesseln überwucherte Ort der Friedhof war und dass Philip Pirrip, verstorben in dieser Gemeinde, und Georgiana, Ehefrau des Obigen, tot und begraben waren und dass Alexander, Bartholomäus, Abraham, Tobias und Roger, die kleinen Kinder der Obengenannten, auch tot und begraben waren und dass die düstere, flache Wildnis jenseits des Friedhofs, die von Gräben, Dämmen und Toren durchzogen ist und auf der verstreut Vieh weidet, die Marschen waren und dass die tiefliegende, bleigraue Linie dahinter der Fluss war und dass die ferne, schroffe Gegend, aus der der Wind fegte, das Meer war und dass das kleine, zitternde Bündel, das vor allem Angst bekam und deshalb zu weinen anfing, Pip war.
»Halt den Mund!«, rief eine schreckliche Stimme, und ein Mann tauchte zwischen den Gräbern seitlich der Kirchenvorhalle auf. »Sei still, du kleiner Teufel, sonst schneid ich dir die Kehle durch.«
Ein furchterregender Mann, ganz in grobes Leinen gekleidet und mit einem großen Eisen am Bein. Ein Mann ohne Hut, mit zerrissenen Schuhen und mit einem alten Lappen um den Kopf. Ein Mann, der durchnässt und schmutzbedeckt war, der sich die Füße auf den Kieselsteinen wund gelaufen hatte, der von Nesseln gestochen und von Dornen zerrissen worden war. Ein Mann, der humpelte und zitterte, der funkelnde Blicke um sich warf, knurrte und mit den Zähnen klapperte, als er mich am Kinn zog.
»Oh! Schneiden Sie mir nicht die Kehle durch, Sir!«, flehte ich vor Entsetzen. »Bitte tun Sie es nicht, Sir!«
»Nenn uns deinen Namen!«, sagte der Mann. »Schnell!«
»Pip, Sir.«
»Noch mal«, sagte der Mann und starrte mich an. »Raus mit der Sprache!«
»Pip, Pip, Sir.«
»Zeig uns, wo du wohnst«, sagte der Mann. »Zeig die Stelle!«
Ich zeigte dahin, wo unser Dorf lag, auf der Ebene nahe der Küste zwischen den Erlen und beschnittenen Bäumen, etwa eine Meile von der Kirche entfernt.
Nachdem mich der Mann einen Augenblick angesehen hatte, stellte er mich kopf und leerte meine Taschen. In denen war nichts weiter als ein Stückchen Brot. Als die Kirche wieder am alten Fleck stand, denn er ging so plötzlich und kräftig vor, dass sie verkehrt rum vor mir stand und ich den Kirchturm unter meinen Füßen sah – als also die Kirche wieder am alten Fleck stand, da saß ich zitternd auf einem hohen Grabstein, während er heißhungrig das Brot aß.
»Du junger Hund«, sagte der Mann und schmatzte mit den Lippen, »was für dicke Backen du hast.«
Ich glaube, sie waren wirklich dick, obwohl ich zu dieser Zeit für mein Alter zu klein und auch nicht gesund war.
»Verflixt, dass ich die nich essen kann«, sagte der Mann mit einem bedrohlichen Kopfschütteln, »ich hab nich wenich Lust dazu!«
Ich brachte ernsthaft die Hoffnung zum Ausdruck, dass er es nicht tun möge, und klammerte mich an den Grabstein, auf den er mich gesetzt hatte, teils um mich darauf festzuhalten, teils um mir das Weinen zu verkneifen.
»Hör mal«, sagte der Mann, »wo is ’n deine Mutter?«
»Dort, Sir!«, antwortete ich.
Er ging los, rannte ein Stück, blieb stehen und wandte den Kopf.
»Da, Sir!«, erklärte ich schüchtern. »Georgiana. Das ist meine Mutter.«
»Oh!«, sagte er und kam zurück. »Und is das dein Vater neben deiner Mutter?«
»Ja, Sir«, sagte ich, »er ist auch tot, verstorben in dieser Gemeinde.«
»Hm!«, murmelte er dann und dachte nach. »Bei wem wohnst du denn, falls ich dich freundlicherweise leben lasse, worüber ich mir aber noch nich klar bin.«
»Bei meiner Schwester, Sir – Mrs. Joe Gargery, der Frau von Joe Gargery, dem Schmied, Sir.«
»Was, Schmied?«, sagte er und sah auf sein Bein hinab. Nachdem er mehrere Male finster sein Bein und mich betrachtet hatte, kam er näher an meinen Grabstein heran, griff mich mit beiden Armen und kippte mich so weit wie möglich nach hinten, wobei er mir durchdringend in die Augen sah und ich äußerst hilflos zu ihm aufschaute.
»Hör zu«, sagte er, »die Frage is, ob du am Leben bleibst oder nich. Du weißt, was ’ne Feile is?«
»Ja, Sir.«
»Und du weißt, was Proviant is?«
»Ja, Sir.«
Nach jeder Frage bog er mich noch ein bisschen weiter zurück, so als wollte er mir ein noch stärkeres Gefühl der Hilflosigkeit und Gefahr vermitteln.
»Du besorgst mir ’ne Feile.« Er bog mich wieder nach hinten. »Und du besorgst mir Proviant.« Wieder bog er mich nach hinten. »Du bringst mir beides her.« Und wieder bog er mich nach hinten. »Oder ich reiß dir Herz und Leber raus.« Und wieder bog er mich nach hinten.
Ich war so furchtbar verängstigt, und mir war so schwindlig, dass ich mich mit beiden Händen an ihn klammerte und sagte: »Wenn Sie mich bitte gütigst aufrecht stehen lassen würden, Sir, wäre mir vielleicht nicht übel, und ich könnte vielleicht mehr für Sie tun.«
Er gab mir einen ganz gewaltigen Schubs, so dass die Kirche über ihren eigenen Wetterhahn sprang. Dann hielt er mich an den Armen oben auf dem Stein aufrecht und fuhr in diesen schrecklichen Worten fort: »Du bringst mir morgen früh ganz zeitig die Feile und den Proviant. Du bringst mir das alles zur alten Batterie da hinten hin. Das machst du, und wehe, du unterstehst dich, ’n Wort zu sagen oder ’ne Andeutung zu machen, dass du jemand wie mich oder überhaupt irgend ’ne Person gesehen hast. Dann sollst du auch am Leben bleiben. Wenn du das nich machst oder auch nur im Geringsten von meinen Anordnungen abweichst, wird dein Herz und deine Leber rausgerissen, gebraten und gegessen. Nun, ich bin nich allein, wie du vielleicht denkst. Da hat sich noch ’n junger Mann mit mir versteckt, wo ich im Vergleich zu dem jungen Mann ’n Engel bin. Dieser junge Mann hört die Worte, die ich spreche. Dieser junge Mann hat ’ne geheime Art, die nur er hat, sich ’n Jungen zu greifen und an sein Herz und an seine Leber ranzukommen. Es is ganz umsonst, wenn ’n Junge versucht, sich vor diesem jungen Mann zu verstecken. Ein Junge kann seine Tür zuriegeln, kann im warmen Bett liegen und sich einwickeln und die Decke über ’n Kopf ziehn und sich behaglich und sicher fühlen, aber dieser junge Mann wird leise zu ihm hinschleichen und ihn rauszerren. Ich kann diesen jungen Mann nur mit großer Mühe hindern, dir jetz was zu tun. Es is sehr schwer, diesen jungen Mann von deinen Eingeweiden abzuhalten. Na, was sagst du?«
Ich sagte, dass ich ihm die Feile besorgen und ihm alle nur möglichen Essensreste bringen würde und früh am Morgen zu ihm zur Batterie hinkäme.
»Sage, dass der Herr dich tot umfallen lassen soll, wenn du das nich tust!«, sagte der Mann.
Ich sprach es ihm nach, und er nahm mich herunter.
»So«, fuhr er fort, »du denkst dran, was du versprochen hast, und du denkst an diesen jungen Mann, und nu gehste nach Hause.«
»Gu – gute Nacht, Sir«, stammelte ich.
»Sehr unwahrscheinlich!«, sagte er und ließ seine Blicke über die kalte, nasse Ebene schweifen. »Ich wünschte, ich wär ’n Frosch. Oder ’n Aal!«
Gleichzeitig umfasste er seinen schlotternden Körper mit beiden Armen – wobei er sich selbst umklammerte, als wollte er sich zusammenhalten – und hinkte auf die niedrige Friedhofsmauer zu. Als ich ihn gehen sah, wie er sich den Weg durch die Nesseln und Dornenbüsche, die die grünen Hügel einhüllten, bahnte, wirkte er in meinen kindlichen Augen wie einer, der den Händen der Toten auswich, die sich vorsichtig aus den Gräbern reckten, um ihn am Handgelenk zu packen und hinunterzuziehen.
Als er an die niedrige Friedhofsmauer kam, stieg er wie ein Mann darüber, dessen Beine erstarrt und steif sind, und drehte sich nach mir um. Als ich das merkte, machte ich eine Kehrtwendung und rannte los. Aber bald darauf guckte ich über die Schulter und sah ihn wieder auf den Fluss zugehen, wobei er sich noch immer mit beiden Armen umschlang und sich mit dem wunden Bein seinen Weg zwischen den großen Steinen hindurch bahnte, die hier und dort als Laufsteg in den Marschen liegen, für den Fall, dass schwere Regen niedergehen oder die Flut einbricht.
Als ich stehenblieb, um ihm nachzusehen, waren die Marschen nur noch ein langer schwarzer Streifen am Horizont, und der Fluss war auch nur noch ein Streifen am Horizont, doch nicht ganz so breit und so schwarz, und der Himmel war von einer langen Reihe unruhiger roter Streifen bedeckt, die mit undurchdringlichen schwarzen verwoben waren. In Höhe des Flusses konnte ich schwach die einzigen beiden Dinge in der ganzen Umgebung erkennen, die aufrecht zu stehen schienen: Das war einmal der Leuchtturm, nach dem sich die Seeleute richteten und der wie ein umgestülptes Fass auf einem Pfahl aussah und, von nahem besehen, ein hässliches Ding war. Das andere war ein Galgen, an dem einige Bande hingen, in die früher ein Pirat geschlagen war. Der Mann humpelte auf den Galgen zu, als ob er der Seeräuber wäre, der lebendig geworden und heruntergekommen ist, um sich selbst wieder aufzuhängen. Dieser Gedanke erschreckte mich maßlos, und ich glaube, die Tiere, die den Kopf hoben und ihm nachstarrten, empfanden ebenso wie ich. Ich sah mich in allen Richtungen nach dem schrecklichen jungen Mann um, konnte aber nichts von ihm entdecken. Dennoch fürchtete ich mich wieder und rannte ohne Pause nach Hause.
2. Kapitel
Meine Schwester, Mrs. Joe Gargery, war über zwanzig Jahre älter als ich, und sie hatte sich vor sich selbst und vor den Nachbarn große Achtung erworben, weil sie mich »mit eigner Hand« aufgezogen hatte. Da ich damals auch erst herausfinden musste, was dieser Ausdruck bedeutete, und da ich ihre harte und schwere Hand kannte und die Gewohnheit, sie gegen ihren Mann wie gegen mich zu erheben, kam ich zu der Ansicht, dass wir beide, Joe Gargery und ich, mit ihrer Hand aufgezogen wurden.
Sie war keine gutaussehende Frau, meine Schwester, und ich hatte den Eindruck, dass sie Joe Gargery mit eigner Hand dazu gebracht haben musste, sie zu heiraten. Joe war ein schöner Mahn, mit flachsblonden Locken zu beiden Seiten seines sanften Gesichtes und Augen von einem so undefinierbaren Blau, dass es schien, als hätten sie sich irgendwie mit ihrem eigenen Weiß vermischt. Er war ein nachsichtiger, freundlicher, gutmütiger, bequemer, dummer, lieber Bursche – eine Art Herkules an Kraft und auch an Schwäche.
Meine Schwester, Mrs. Joe, mit schwarzem Haar und schwarzen Augen, hatte eine derart rote Haut, dass ich mich manchmal fragte, ob sie sich womöglich mit einer Muskatreibe anstatt mit Seife wasche. Sie war groß und knochig und trug fast immer eine derbe Schürze, die hinten mit zwei Schleifen gebunden wurde und vorn einen viereckigen, uneinnehmbaren Latz hatte, der voller Steck- und Nähnadeln war. Sie rechnete es sich zum großen Verdienst an und machte es Joe gegenüber zum harten Vorwurf, dass sie diese Schürze so oft trug. Trotzdem sehe ich wirklich keinen Grund dafür, warum sie sie überhaupt umband oder warum sie sie nicht jeden Tag abband, wenn sie sie nun schon tragen musste.
Joes Schmiede grenzte an unser Haus, das wie die meisten Wohnhäuser damals in unserem Land ein Holzhaus war. Als ich vom Friedhof nach Hause gerannt kam, war die Schmiede verschlossen, und Joe saß allein in der Küche. Joe und ich waren Leidensgefährten und hatten als solche Heimlichkeiten miteinander. In dem Moment, als ich die Tür öffnete und vorsichtig hineinlugte, saß Joe der Tür gegenüber in der Kaminecke und machte mir die vertrauliche Mitteilung: »Mrs. Joe is schon ein Dutzend Mal draußen gewesen und hat nach dir geguckt, Pip. Und sie is jetz zum dreizehnten Mal draußen.«
»Wirklich?«
»Ja, Pip«, sagte Joe, »und was noch schlimmer is, sie hat Tickler bei sich.«
Bei dieser unheilvollen Nachricht drehte ich unentwegt den einzigen Knopf an meiner Weste und blickte niedergeschlagen ins Feuer. Tickler war ein Stock mit Pechdraht, der durch den Zusammenstoß mit meinem gepeinigten Körper schon ganz glatt geklopft war.
»Sie setzte sich«, sagte Joe, »und sie stand auf, und sie griff nach Tickler und stürzte wütend hinaus. Das tat sie«, sagte Joe, indem er bedächtig mit dem Schürhaken zwischen den unteren Stäben herumstocherte und ins Feuer blickte. »Sie stürzte wütend hinaus, Pip.«
»Ist sie schon lange weg, Joe?« Ich behandelte ihn immer wie ein großes Kind und nicht anders als meinesgleichen.
»Nun«, sagte Joe und warf einen Blick auf die Schwarzwälder Uhr, »der letzte Wutanfall is etwa fünf Minuten her, Pip. Sie kommt! Geh hinter die Tür, alter Junge, und binde das Rollhandtuch um.«
Ich befolgte den Rat. Meine Schwester, Mrs. Joe, die beim Aufreißen der Tür auf ein Hindernis stieß, erriet sofort die Ursache und wendete Tickler zur weiteren Untersuchung an. Zum Abschluss warf sie mich Joe zu (ich diente oft als eheliches Wurfgeschoss), der froh war, mich unter allen Umständen erwischt zu haben, und mich in die Kaminecke bugsierte und dort ruhig mit seinem großen Bein abschirmte.
»Wo bist du gewesen, du junger Affe?«, sagte Mrs. Joe und stampfte mit dem Fuß. »Sag mir sofort, was du gemacht hast, um mir Angst und Sorgen zuzufügen, oder ich hol dich raus aus deiner Ecke, und wenn du fünfzig Pips wärst und er fünfhundert Gargerys.«
»Ich bin nur auf dem Friedhof gewesen«, sagte ich von meinem Schemel aus, weinend und mein Hinterteil reibend.
»Friedhof!«, wiederholte meine Schwester. »Wenn’s nach mir ginge, wärst du schon lange auf dem Friedhof, und zwar für immer. Wer hat dich mit eigner Hand aufgezogen?«
»Sie«, sagte ich.
»Und warum hab ich das getan, möcht ich mal wissen?«, stieß meine Schwester hervor.
Ich wimmerte: »Ich weiß es nicht.«
»Ich auch nicht!«, sagte meine Schwester. »Ich würde es nie wieder tun! Das weiß ich. Ich kann ehrlich sagen, dass ich diese meine Schürze noch nie abhatte, solange ich lebe. Es ist schlimm genug, die Frau von ’nem Schmied zu sein (noch dazu von so ’nem Gargery), geschweige denn deine Mutter.«
Während ich unglücklich ins Feuer starrte, schweiften meine Gedanken von dieser Frage ab; denn der Flüchtling draußen in den Sümpfen mit den Fußschellen, der geheimnisvolle junge Mann, die Feile, das Essen und das furchtbare Versprechen, demzufolge ich einen Diebstahl unter diesem schützenden Dach zu begehen hatte, stiegen vor mir in dieser unbarmherzigen Glut auf.
»Hah!«, sagte Mrs. Joe und stellte Tickler an seinen Platz zurück. »Friedhof, was du nicht sagst. Ihr könnt ruhig Friedhof sagen, ihr beiden.« Nebenbei bemerkt, hatte einer von uns überhaupt nichts gesagt. »Ihr werdet mich noch auf den Friedhof bringen in den nächsten Tagen. Oh, werdet ihr ein feines Paar abgeben ohne mich!«
Als sie sich den Teesachen zuwandte, linste Joe über sein Bein hinweg auf mich herunter, als wollte er mich und sich vor seinem geistigen Auge abschätzen und überlegen, was für ein Paar wir tatsächlich unter den angekündigten traurigen Umständen abgeben würden. Dann setzte er sich, befühlte rechts seine flachsblonden Locken und den Bart und folgte Mrs. Joe mit seinen blauen Augen, wie das in stürmischen Zeiten immer so seine Art war.
Meine Schwester hatte eine bestimmte Art, unser Butterbrot zu schneiden, die sich niemals änderte. Zuerst presste sie das Brot energisch und fest an ihren Schürzenlatz, wo es manchmal eine Stecknadel und manchmal eine Nähnadel aufspießte, die wir hinterher in den Mund bekamen. Dann nahm sie etwas Butter (nicht zu viel) auf ein Messer und strich sie auf das Brot, als wollte ein Apotheker ein Pflaster auflegen, wobei sie beide Seiten des Messers mit enormer Gewandtheit benutzte und die Butter von der Kruste wegstrich. Dann wischte sie zum Schluss das Messer am Rande des Pflasters ab und sägte eine sehr dicke Schnitte vom Brot ab, die sie, bevor sie sie vom Brot trennte, in zwei Hälften teilte, von denen Joe die eine und ich die andere erhielt.
In der gegenwärtigen Situation wagte ich nicht, meine Schnitte zu essen, obwohl ich hungrig war. Ich spürte, dass ich für meinen furchtbaren Bekannten und für seinen Verbündeten, den noch furchtbareren jungen Mann, etwas reservieren musste. Ich wusste, dass Mrs. Joes Haushaltsführung von strengster Natur war und dass ich bei meinen diebischen Erkundungen möglicherweise nichts Brauchbares im Schrank finden würde. Deshalb beschloss ich, mein Butterbrot im Hosenbein verschwinden zu lassen.
Die große Portion Mut, die dazu notwendig war, das Vorhaben auszuführen, schien mir einfach entsetzlich. Es war, als ob ich mich dazu entschließen müsste, vom Dach eines hohen Hauses oder in tiefes Wasser zu springen. Und der ahnungslose Joe erschwerte die Sache noch mehr. Bei unserem bereits erwähnten Zusammengehörigkeitsgefühl als Leidensgefährten und bei seiner gutmütigen Kameradschaft mit mir war es unsere allabendliche Gewohnheit, zu vergleichen, wie wir uns durch unsere Schnitten hindurchbissen. Schweigend hielten wir sie dazu von Zeit zu Zeit zur gegenseitigen Bewunderung hoch, was uns zu neuen Anstrengungen anspornte. Heute Abend forderte mich Joe mehrmals auf, unseren üblichen freundlichen Wettstreit mitzumachen, indem er seine schnell verschwindende Schnitte zeigte. Er sah mich aber jedes Mal mit meinem gelben Becher Tee auf dem einen Knie und dem unberührten Butterbrot auf dem anderen. Schließlich dachte ich verzweifelt daran, dass mein Vorhaben ausgeführt werden musste, und das am besten in einer Weise, die unter den gegebenen Umständen am wenigsten wahrscheinlich scheinen musste. Ich nutzte einen Moment aus, als Joe gerade zu mir hingesehen hatte, und ließ mein Butterbrot im Hosenbein verschwinden.
Joe war offensichtlich von meiner – wie er es deutete – Appetitlosigkeit beunruhigt und nahm gedankenvoll einen Bissen von seiner Schnitte, die ihm nicht zu munden schien. Er behielt ihn viel länger als sonst im Mund, grübelte dabei eine Weile und schluckte ihn dann wie eine Pille hinunter. Er war eben dabei, erneut abzubeißen, und hatte seinen Kopf gerade in eine gute Angriffsposition gebracht, als sein Blick auf mich fiel und er sah, dass mein Butterbrot weg war.
Das Erstaunen und die Bestürzung, mit der Joe im Abbeißen innehielt und mich anstarrte, waren zu auffällig, als dass sie meiner Schwester hätten entgehen können.
»Was ist nun los?«, fragte sie scharf, als sie ihre Tasse absetzte.
»Hör mal, du weißt doch«, murmelte Joe und schüttelte sehr vorwurfsvoll den Kopf. »Pip, alter Junge! Du fügst dir Schaden zu. Irgendwo wird es steckenbleiben. Du kannst es nich gekaut haben, Pip.«
»Was ist nun los?«, wiederholte meine Schwester in schärferem Ton als vorher.
»Wenn du ein bisschen raushusten kannst, rat ich dir, es zu tun«, sagte Joe ganz entgeistert. »Sitten sind Sitten, aber deine Gesundheit is deine Gesundheit.«
In diesem Augenblick war meine Schwester ganz rasend, sie stürzte sich auf Joe und schlug, indem sie ihn mit beiden Händen am Backenbart packte, seinen Kopf eine Zeitlang gegen die Wand hinter ihm, während ich in der Ecke saß und schuldvoll zusah.
»Vielleicht wirst du nun sagen, was los ist«, sagte meine Schwester, ganz außer Atem, »du glotzendes, großes, angestochenes Schwein.«
Joe sah sie hilflos an, dann biss er hilflos ab und schaute wieder auf mich.
»Du weißt, Pip«, sagte Joe feierlich, mit seinem letzten Bissen im Mund und mit so vertraulicher Stimme, als ob wir beide ganz allein wären, »du und ich sind immer Freunde gewesen, und ich bin der Letzte, der dich jemals verpetzen würde. Aber so ein« – er rückte seinen Stuhl und sah auf den Fußboden zwischen uns und dann wieder auf mich –, »so ein ungewöhnliches Hinunterschlingen wie das!«
»Hat das Essen verschluckt, was?«, schrie meine Schwester.
»Du weißt, alter Junge«, sagte Joe, wobei er mich und nicht Mrs. Joe ansah, den Bissen noch immer in der Backe, »ich hab selber geschlungen, als ich in deinem Alter war, oft, und als Junge bin ich mit vielen Schlingern zusammen gewesen, aber wie dich hab ich nie jemand schlingen sehen, ’s is ’n Glück, dass du dich nich totgeschluckt hast.«
Meine Schwester bückte sich nach mir, zerrte mich an den Haaren hoch und sagte weiter nichts als die schrecklichen Worte: »Du kommst mit und nimmst was ein.«
Irgendeine Bestie von Mediziner hatte in jenen Tagen Teerwasser als eine gute Arznei wiederentdeckt, und Mrs. Joe bewahrte stets einen Vorrat in ihrem Schrank auf, da sie glaubte, dass die Wirkung mit dem üblen Geschmack übereinstimmte. In meinen besten Zeiten wurde mir so viel von diesem Elixier als auserlesenes Stärkungsmittel verabreicht, dass ich mir vorkam, als röche ich wie ein neuer Gartenzaun. An diesem besonderen Abend erforderte die Dringlichkeit meines Falles eine Pinte von dieser Mixtur, die mir zu meiner großen Erquickung in die Kehle gekippt wurde, während Mrs. Joe meinen Kopf unter ihren Arm klemmte, als würde ein Stiefel in einen Stiefelknecht geklemmt. Joe kam mit einer halben Pinte davon, wurde aber gezwungen, sie zu schlucken (was ihn sehr störte, denn er saß widerwillig schmatzend und meditierend am Feuer), weil ihm übel war. Wenn ich von mir ausging, würde ich eher sagen, dass ihm wahrscheinlich eher hinterher schlecht geworden ist, wenn ihm nicht vorher schon so gewesen war.
Das Gewissen ist eine schlimme Sache, wenn es einem Mann oder einem Jungen schlägt. Wenn aber bei einem Jungen diese geheime Last mit einer weiteren geheimen Last unten im Hosenbein zusammentrifft, wird es (ich kann es bezeugen) eine harte Strafe. Das Schuldgefühl, Mrs. Joe zu bestehlen (mir kam nie in den Sinn, dass ich Joe bestahl, weil ich in Verbindung mit dem Haushalt nie an ihn dachte), und dazu die Notwendigkeit, immer eine Hand auf mein Butterbrot zu halten, wenn ich saß oder mit irgendeinem kleinen Auftrag in die Küche geschickt wurde, machten mich bald wahnsinnig. Als dann die Winde von den Marschen her das Feuer zum Flammen und Glühen brachten, glaubte ich draußen die Stimme des Mannes mit der Fußschelle zu hören, der mich zum Schweigen verurteilt und erklärt hatte, dass er nicht bis morgen hungern könne und wolle, sondern gleich etwas zu essen brauche. Ein anderes Mal dachte ich: ›Was ist, wenn der junge Mann, der nur mit großer Mühe daran gehindert worden war, Hand an mich zu legen, von einer maßlosen Ungeduld übermannt wird oder sich in der Zeit irrt und glaubt, schon heute und nicht erst morgen mein Herz und meine Leber holen zu können!‹ Wenn jemals irgendwem vor Angst die Haare zu Berge gestanden haben, dann mir. Vielleicht ist das aber nie jemandem passiert?
Es war Heiligabend, und ich musste mit einem Kupferstock den Pudding für den nächsten Tag rühren, von sieben bis acht nach der Schwarzwälder Uhr. Ich versuchte es mit der Last an meinem Bein (und das erinnerte mich erneut an den Mann mit der Last an seinem Bein) und fand die Bemühung, das Butterbrot aus der Knöchelgegend zu manövrieren, äußerst schwierig. Glücklich entschlüpfte ich und deponierte diesen Teil meines Gewissens in meiner Bodenkammer.
»Hört mal!«, sagte ich, als ich mit dem Rühren fertig war und mich noch einmal in der Kaminecke aufwärmte, bevor ich nach oben ins Bett geschickt wurde, »war das Alarm, Joe?«
»Oh!«, sagte Joe. »Da is wieder ’n Sträfling weggelaufen.«
»Was bedeutet das, Joe?«, fragte ich.
Mrs. Joe, die Erklärungen immer selbst übernahm, sagte schnippisch: »Entflohen, entflohen.« Und verabreichte die Definition wie Teerwasser.
Während Mrs. Joe über ihre Handarbeit gebeugt saß, formte ich meinen Mund zu der Frage an Joe: »Was ist ein Sträfling?« Joe wiederum formte seinen Mund zu einer so komplizierten Antwort, dass ich außer dem einen Wort »Pip« nichts verstehen konnte.
»Gestern Abend is ’n Sträfling weggelaufen«, sagte Joe laut, »nach Sonnenuntergang. Und sie haben seinetwegen einen Warnschuss abgegeben. Und nun scheinen sie wegen eines anderen einen Warnschuss abzugeben.«
»Wer gibt das Signal?«, fragte ich.
»Der Teufel soll den Jungen holen!«, mischte sich meine Schwester ein und runzelte die Stirn über ihrer Arbeit. »Was für Fragen er stellt. Frag nicht, und du wirst nicht belogen.«
Ich fand, sie war sich selbst gegenüber nicht sehr höflich, als sie durchblicken ließ, dass ich von ihr Lügen zu hören bekäme, falls ich Fragen stellte. Aber sie war niemals höflich, es sei denn, wir hatten Besuch.
Zu diesem Zeitpunkt vergrößerte Joe erheblich meine Neugier, indem er die äußersten Anstrengungen unternahm, seinen Mund recht weit zu öffnen und ihn zu einem Wort zu formen, dass mir wie »ulkig« aussah. Deshalb zeigte ich natürlich auf Mrs. Joe und fragte: »Sie?« Aber Joe wollte davon nichts hören, öffnete wiederum weit seinen Mund und stieß ein äußerst emphatisches Wort hervor. Ich konnte das Wort aber nicht erraten.
»Mrs. Joe«, sagte ich und machte einen letzten Versuch, »ich wüsste gern – wenn Sie nichts dagegen haben –, woher das Signal kommt.«
»Gottes Segen für den Jungen!«, rief meine Schwester aus, als ob sie das nicht ganz so meinte, sondern eher das Gegenteil. »Von den Hulks!«
»Oh!«, sagte ich und sah Joe an. »Hulks!«
Joe hustete vorwurfsvoll, als wollte er sagen: Na, hab ich dir doch gesagt.
»Und bitte schön, was sind Hulks?«, fragte ich.
»So geht das mit diesem Jungen!«, rief meine Schwester, zeigte mit Nadel und Faden auf mich und schüttelte den Kopf. »Eine Frage beantwortet man ihm, und sofort stellt er ein Dutzend andere. Hulks sind Gefängnisschiffe, gleich hinter den Maaschen.« In unserer Gegend benutzen wir diesen Namen immer für Marschen.
»Ich möchte wissen, wer auf diese Gefängnisschiffe kommt und warum sie dorthin kommen«, sagte ich unsicher und in stiller Verzweiflung.
Das war zu viel für Mrs. Joe, die sich sofort erhob. »Ich werd dir mal was sagen, junger Freund«, sagte sie, »ich habe dich nicht mit eigner Hand aufgezogen, damit du den Leuten die Seele aus dem Leib quälst. Das wär ’ne Schande und keine Ehre für mich, wenn ich das getan hätte. Leute werden in die Gefängnisschiffe gesteckt, wenn sie morden und wenn sie stehlen und fälschen und alles mögliche Schlechte machen. Und immer fangen sie damit an, indem sie Fragen stellen. Nun aber ins Bett!«
Mir wurde nie gestattet, zum Zubettgehen eine Kerze mitzunehmen, und als ich in der Dunkelheit mit dröhnendem Kopf die Treppe hochstieg (denn Mrs. Joe hatte mit ihrem Fingerhut darauf Tamburin gespielt, um ihre Worte zu unterstreichen), spürte ich die schreckliche Gewissheit, dass die Gefängnisschiffe für mich bestimmt waren. Ich war direkt auf dem Wege dorthin. Ich hatte begonnen, Fragen zu stellen, und ich war im Begriff, Mrs. Joe zu bestehlen.
Seit jener Zeit, die nun lange genug zurückliegt, habe ich oft daran gedacht, dass nur wenige Menschen wissen, wie verschwiegen Jugendliche in ihrer Angst sein können. Ganz gleich, wie unsinnig die Angst auch sein mag, so ist es doch Angst. Ich hatte schreckliche Angst vor dem jungen Mann, der von mir Herz und Leber haben wollte; ich hatte schreckliche Angst vor meinem Gesprächspartner mit der Fußschelle; ich hatte schreckliche Angst vor mir selber, dem ein furchtbares Versprechen abgerungen worden war; ich hatte keine Aussicht auf Hilfe von meiner allmächtigen Schwester, die mich bei jeder Gelegenheit abwies. Ich mag gar nicht daran denken, was ich wohl mit meiner geheim gehaltenen Angst auf eine Forderung hin alles getan hätte.
Wenn ich in jener Nacht überhaupt schlief, dann nur, um mich mit einer gewaltigen Springflut flussabwärts auf die Gefängnisschiffe zutreiben zu sehen, wobei mir, als ich am Pranger vorbeitrieb, ein geisterhafter Pirat durch ein Sprachrohr zurief, dass ich lieber gleich ans Ufer kommen und mich hängen lassen sollte, anstatt es aufzuschieben. Ich fürchtete mich davor zu schlafen, selbst wenn ich todmüde gewesen wäre, denn ich wusste, dass ich beim ersten Morgengrauen die Speisekammer plündern musste. Das konnte ich nicht bei Nacht erledigen, weil das Licht nicht durch einfache Reibung erzeugt werden konnte; um welches zu erhalten, hätte ich es aus Feuerstein und Stahl herausschlagen und dabei solchen Lärm machen müssen wie der Pirat, der mit seinen Ketten rasselte.
Sobald der große schwarze Samtvorhang vor meinem kleinen Fenster graugesprenkelt wurde, stand ich auf und ging die Treppe hinab, wobei jede Diele auf meinem Weg und jede Spalte in jeder Diele hinter mir herrief: »Haltet den Dieb!« und »Stehen Sie auf, Mrs. Joe!« In der Speisekammer, die wegen des Weihnachtsfestes viel reichhaltiger als sonst gefüllt war, wurde ich heftig durch einen Hasen erschreckt, der an den Hinterpfoten aufgehängt war. Als ich mich halb umwandte, schien er mir sogar noch zuzublinzeln. Ich hatte keine Zeit zum Prüfen, keine Zeit zum Auswählen, keine Zeit, überhaupt etwas zu tun, denn ich hatte keine Zeit zu verlieren. Ich stahl etwas Brot, etwas Käserinde, ein halbes Weckglas voll Hackfleisch (das ich in mein Taschentuch zu der Schnitte vom Abend einband), etwas Branntwein aus einer Steinkruke (füllte ihn in eine Glasflasche um, die ich heimlich dazu benutzt hatte, oben in meiner Kammer jene berauschende Flüssigkeit, das spanische Lakritzenwasser, herzustellen, und ergänzte den Inhalt der Steinkruke aus einem Krug im Küchenschrank), einen Fleischknochen mit wenig Fleisch dran und eine schöne, runde, feste Schweinefleischpastete. Beinahe wäre ich ohne die Pastete losgegangen, aber es reizte mich, auf ein Regal zu steigen und nachzuschauen, was da wohl so sorgfältig verborgen in einer zugedeckten Steingutschüssel in der Ecke stand, und was ich fand, war die Pastete. Ich nahm sie in der Hoffnung, dass sie nicht zum baldigen Verbrauch bestimmt war und nicht so schnell vermisst werden würde.
Von der Küche aus führte eine Tür zur Schmiede. Ich riegelte diese Tür auf und fand unter Joes Werkzeugen eine Feile. Dann richtete ich die Riegel so, wie ich sie vorgefunden hatte, öffnete die Tür, zu der ich hereingekommen, als ich am Abend zuvor nach Hause gerannt war, schloss sie wieder und lief zu den nebligen Marschen.
3. Kapitel
An jenem Morgen war alles bereift und sehr feucht. Ich hatte die Feuchtigkeit schon draußen an meinem kleinen Fenster gesehen, als hätte sich dort die ganze Nacht über ein Kobold ausgeweint und die Scheibe als Taschentuch benutzt. Nun sah ich die Feuchtigkeit auf den kahlen Hecken und dem spärlichen Gras wie ein grobgewebtes Spinnennetz liegen, das sich von Zweig zu Zweig und von Blatt zu Blatt spannte. Auf jedem Geländer und jedem Zaun lag die Nässe, und der Nebel von den Marschen war so dick, dass ich den hölzernen Wegweiser, der den Leuten den Weg zu unserem Dorf zeigte, in das sich jedoch niemand verirrte, nicht erkennen konnte, bis ich dicht unter ihm stand. Als ich dann zu ihm aufschaute, während es herabtropfte, wirkte er auf meine bedrängte Seele wie ein Geist, der mich zu den Hulks verfluchte.
Der Nebel wurde noch dichter, je näher ich den Marschwiesen kam. So hatte ich den Eindruck, als ob nicht ich auf etwas zurannte, sondern als ob etwas auf mich zugerannt kam. Das war besonders für einen Schuldbeladenen unangenehm. Die Tore, Deiche und Wälle tauchten plötzlich im Nebel vor mir mit dem unmissverständlichen Ruf auf: »Ein Junge mit gestohlener Schweinefleischpastete! Haltet ihn!« Das Weidevieh trat unerwartet auf mich zu, starrte mich an und blies durch die Nüstern: »He, junger Dieb!« Ein schwarzer Ochse mit weißer Krawatte – der dadurch für mein aufgewühltes Gewissen einen Anflug von einem Geistlichen hatte – fixierte mich so unablässig mit seinen Blicken und bewegte sein stumpfsinniges Haupt mit so anklagender Gebärde, als ich mich umdrehte, dass ich schluchzend zu ihm sagte: »Ich konnte nicht anders, Sir! Ich hab es nicht für mich weggenommen!«, woraufhin er seinen Kopf senkte, eine Dampfwolke aus der Nase stieß und mit einem Ausschlagen seiner Hinterbeine und einem Schwanzwedeln verschwand.
Die ganze Zeit über lief ich zum Fluss hin, aber so schnell ich auch rannte, meine Füße wurden nicht warm. Die feuchte Kälte schien meinen Füßen anzuhaften wie die Fußschellen dem Mann, den ich jetzt treffen wollte. Ich kannte den Weg zur Batterie, immer geradeaus, denn ich war eines Sonntags mit Joe da gewesen. Und Joe hatte auf einer alten Kanone gesessen und mir versprochen, dass wir dort viel Spaß haben würden, wenn ich erst einmal sein Lehrling sei. Doch infolge des Nebels war ich zu weit nach rechts abgekommen und musste deshalb zurück – am Fluss entlang, an der Böschung mit dem Kies über dem Schlamm und den Pfählen, die die Flut abhalten. Als ich mich in großer Eile vorwärtsbewegte – ich hatte gerade einen Graben überquert, von dem ich wusste, dass er in der Nähe der Batterie war, und war gerade den Damm hinter dem Graben hinauf gekrabbelt –, sah ich den Mann vor mir sitzen. Er wandte mir den Rücken zu, saß mit verschränkten Armen und kippte im Schlaf immer nach vorn über.
Ich dachte, ich könnte ihn erfreuen, wenn ich mit dem Frühstück plötzlich vor ihm stünde; deshalb trat ich leise heran und tippte ihm auf die Schulter. Er sprang sofort auf, aber es war nicht derselbe Mann, sondern ein anderer!
Auch dieser Mann trug grobe Leinensachen und hatte eine Fußschelle und war lahm und heiser und durchgefroren; er glich in jeder Beziehung dem anderen Mann, bloß dass er ein anderes Gesicht hatte und einen flachen, breitkrempigen Fellhut aufhatte. All das nahm ich nur kurz wahr, denn ich hatte nur einen Moment Zeit dazu. Er fluchte, holte nach mir aus – es war ein schwacher Schlag, der mich verfehlte und ihn selbst beinahe umriss, weil er dabei stolperte – und rannte dann in den Nebel hinein, strauchelte dabei noch zweimal, und ich verlor ihn aus den Augen.
›Das ist der junge Mann!‹, dachte ich und fühlte einen Schmerz in der Herzgegend, als ich ihn erkannte. Ich hätte auch Schmerzen in der Leber gespürt, wenn ich gewusst hätte, wo sie liegt.
Bald war ich bei der Batterie, und dort wartete der rechte Mann auf mich, sich selbst umschlingend und hin und her humpelnd. Er schien die ganze Nacht hindurch so auf und ab gegangen zu sein. Offensichtlich war ihm schrecklich kalt. Ich vermutete fast, er würde vor meinen Augen umfallen und vor Kälte sterben. Seine Augen blickten so furchtbar gierig vor Hunger, dass es mir vorkam, als hätte er die Feile, die ich ihm gab und die er ins Gras legte, zu essen versucht, wenn er nicht mein Bündel entdeckt hätte. Diesmal stellte er mich nicht kopf, sondern ließ mich das Bündel öffnen und die Taschen auskramen.
»Was is in der Flasche, Junge?«, fragte er.
»Brandy«, sagte ich.
Das Hackfleisch schluckte er bereits in einer äußerst merkwürdigen Weise hinunter – mehr wie einer, der in Eile schlingt, als einer, der es verzehrt –, aber er ließ davon ab, um einen Schluck Schnaps zu nehmen. Die ganze Zeit über zitterte er so heftig, dass er nur noch den Flaschenhals zwischen die Zähne nehmen konnte, ohne ihn jedoch abzubeißen.
»Ich glaube, Sie haben Fieber«, sagte ich.
»Ich glaube auch, Junge«, sagte er.
»Es ist nicht gut hier draußen«, sagte ich zu ihm. »Sie haben auf den Maaschen gelegen, und die rufen Fieber hervor. Auch Rheuma.«
»Ich werde noch frühstücken, bevor sie mich umbringen«, sagte er. »Ich würd das sogar machen, wenn ich nachher an dem Galgen da drüben aufgeknüpft werden sollte. So lange werd ich schon den Schüttelfrost unterdrücken, das versprech ich dir.«
Er verschlang das Hackfleisch, den Fleischknochen, Brot, Käse und die Schweinefleischpastete, alles auf einmal, und starrte dabei misstrauisch in den Nebel um uns; oftmals hielt er im Kauen inne, um zu lauschen. Jedes wirkliche oder eingebildete Geräusch, jedes Klirren vom Fluss her oder das Atmen der Tiere auf der Marsch ließen ihn zusammenfahren, und er fragte plötzlich:
»Bist du auch kein Betrüger? Hast du auch keinen mitgebracht?«
»Nein, Sir, bestimmt nicht!«
»Auch keinem den Tipp gegeben, dir zu folgen?«
»Nein!«
»Gut«, sagte er, »ich glaube dir. Du wärst ja wirklich schon ein fieser Schurke, wenn du in deinem Alter helfen würdest, einen elenden Wurm zu jagen, der bis zum Umfallen gehetzt wird.«
Es klickte in seiner Kehle, als hätte er so etwas wie eine Uhr darin, die gleich schlagen wollte. Und mit seinem zerlumpten Ärmel wischte er sich über die Augen.
Mir tat seine Verlassenheit leid, und als er sich allmählich über die Schweinefleischpastete hermachte, wagte ich, ihn anzusprechen: »Es freut mich, dass sie Ihnen schmeckt.«
»Hast du was gesagt?«
»Ja, ich sagte, ich bin froh, dass sie Ihnen schmeckt.«
»Ja, danke, mein Junge.«
Ich hatte oft einen unserer großen Hunde beim Fressen beobachtet; jetzt stellte ich eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Hund und diesem Mann fest. Der Mann nahm kräftige, hastige Bissen, genau wie der Hund. Er schlang, ja schnappte beinahe nach jedem Bissen viel zu hastig und blickte während des Essens nach allen Seiten, als ob die Gefahr bestünde, dass jemand käme und die Pastete wegnähme. Er war überhaupt zu unruhig, um sie gebührend zu genießen, fand ich, oder jemanden beim Essen bei sich zu haben, ohne nach dem Zuschauer zu schnappen. In all diesen Einzelheiten war er dem Hund sehr ähnlich.
»Ich fürchte, Sie lassen nichts mehr für ihn übrig«, sagte ich zaghaft nach einer Pause, in der ich mit der Bemerkung gezögert hatte. »Es ist auch nichts mehr zu holen.« Die Gewissheit dieses Umstandes bewog mich zu diesem Hinweis.
»Übriglassen für ihn? Wen meinst du damit?«, fragte mein Freund und hörte auf, an der Pastetenkruste zu knabbern.
»Den jungen Mann, von dem Sie gesprochen haben. Der sich mit Ihnen versteckt hatte.«
»Ach so«, entgegnete er mit einem heiseren Auflachen. »Für ihn? Ja, ja, er will nichts zu essen.«
»Ich fand aber, dass er so aussah«, sagte ich.
Der Mann hörte auf zu kauen und sah mich durchdringend und äußerst überrascht an.
»Sah so aus? Wann?«
»Na eben.«
»Wo?«
»Da drüben«, zeigte ich, »wo er im Sitzen schlief und ich glaubte, Sie wären es.«
Er packte mich am Kragen und starrte mich so an, dass ich dachte, er wolle seinen früheren Plan, mir die Kehle durchzuschneiden, wahr machen.
»Angezogen wie Sie, wissen Sie, nur mit einem Hut«, erklärte ich zitternd, »und – und«, ich war bemüht, das taktvoll anzudeuten, »er brauchte aus demselben Grund wie Sie eine Feile. Haben Sie nicht gestern Abend das Signal gehört?«
»Dann wurde also doch geschossen!«, sagte er zu sich selbst.
»Ich wundere mich, wie Sie daran zweifeln konnten«, entgegnete ich, »denn wir haben das bis zu uns gehört, und das ist weiter weg, und dabei waren wir noch drinnen im Haus.«
»Ja, sieh mal«, sagte er, »wenn jemand mit wirrem Kopf und leerem Magen auf diesem Flachland allein is und vor Kälte und Hunger umkommt, hört er die ganze Nacht durch nichts anderes als Schüsse und Stimmen. Hört? Er sieht, wie er von den Soldaten in ihren roten, vom Fackelschein angeleuchteten Mänteln umzingelt wird. Hört seine Kennnummer, hört sich angerufen, hört das Klirren der Musketen, hört die Befehle: Achtung! Legt an! Haltet ihn fest im Visier, Leute!, und er wird festgenommen – und dann is gar nichts! Ich habe gestern Abend nich nur einen Verfolgungstrupp in Marschordnung kommen sehen – verflucht sei ihr Getrampel –, ich sah gleich Hunderte. Und was die Schüsse angeht: Nun, ich sah, wie der Nebel vom Geschützdonner aufgerissen wurde, bis es heller Tag war. – Aber dieser Mann«, er hatte das alles gesagt, als ob er meine Anwesenheit völlig vergessen hätte, »hast du irgendetwas an ihm bemerkt?«
»Er hatte ein arg zugerichtetes Gesicht«, sagte ich und rief mir Dinge ins Gedächtnis zurück, die ich kaum wahrgenommen hatte.
»Etwa hier?«, rief der Mann und schlug sich mit der flachen Hand recht unsanft auf die linke Backe.
»Ja, dort!«
»Wo steckt er?« Er stopfte das wenige übriggebliebene Essen in die Brusttasche seiner grauen Jacke. »Zeig mir, wo er langgegangen ist. Ich werde ihn niedermachen wie einen Bluthund. Verfluchte Kette an meinem wunden Bein! Her mit der Feile, Junge.«
Ich zeigte in die Richtung, in der der andere Mann im Nebel verschwunden war, und er blickte für einen kurzen Augenblick hoch. Er saß im feuchten Gras und feilte wie ein Besessener an seinem Eisen; dabei achtete er weder auf mich noch auf sein Bein, das an einer Stelle durchgescheuert und blutig war, mit dem er aber so grob umging, als wäre dort nicht mehr Gefühl drin als in der Feile. Ich fürchtete mich wieder vor ihm, als er sich so verbissen mühte, und ebenso hatte ich Angst, noch länger von zu Hause wegzubleiben. Ich sagte ihm, dass ich gehen müsste, aber er nahm keine Notiz davon. So hielt ich es für das Beste, mich fortzustehlen. Als letztes sah ich von ihm, wie er den Kopf über das Knie beugte und mühsam an seiner Fessel feilte und Flüche auf die Kette und sein Bein murmelte. Und als Letztes hörte ich von ihm, als ich in den Nebel hineinlauschte, sein Feilen.
4. Kapitel
Ich war darauf gefasst, dass ein Polizist in der Küche bereits auf mich wartete, um mich festzunehmen. Aber es war nicht nur kein Polizist da, sondern mein Diebstahl war noch nicht einmal entdeckt worden. Mrs. Joe war stark damit beschäftigt, das Haus für die Feierlichkeiten des Tages herzurichten, und Joe war vor die Küchentür befördert worden, um ihn der Kehrichtschaufel fernzuhalten – dieses Schicksal ereilte ihn immer früher oder später, wenn meine Schwester die Fußböden ihrer Wohnung bearbeitete.
»Wo zum Kuckuck hast du gesteckt?«, lautete Mrs. Joes Weihnachtsgruß, als ich und mein Gewissen eintraten.
Ich sagte, ich hätte mir die Weihnachtslieder angehört.
»Nun gut«, bemerkte Mrs. Joe. »Du hättest Schlimmeres machen können.« ›Wie wahr‹, dachte ich.
»Wenn ich nicht die Frau von ’nem Schmied und (was dasselbe ist) ’ne Sklavin wär, die ewig die Schürze umhat, hätte ich mir die Weihnachtslieder auch angehört«, sagte Mrs. Joe. »Ich hab ’ne besondere Vorliebe für Weihnachtslieder, und das ist der beste Grund dafür, dass ich mir nie welche anhöre.«
Joe, der sich nach mir in die Küche gewagt hatte, nachdem die Kehrichtschaufel zur Ruhe gekommen war, strich sich mit dem Handrücken harmlos über die Nase, als ihm Mrs. Joe einen Blick zuwarf. Doch als sie ihren Blick abwandte, kreuzte Joe heimlich seine beiden Zeigefinger und zeigte sie mir als Symbol für Mrs. Joes schlechte Laune. Das war so oft ihr Normalzustand, dass Joe und ich oftmals wochenlang mit unseren gekreuzten Fingern wie die Kreuzritter dastanden.
Wir sollten eine erlesene Mahlzeit zu uns nehmen: gepökelten Schweineschinken, Gemüse und zwei gefüllte Brathühner. Eine schmackhafte Hackfleischpastete war schon am vorhergehenden Morgen zubereitet worden (was erklärte, dass das Hackfleisch noch nicht vermisst wurde), und der Pudding war im Entstehen. Diese umfangreichen Vorbereitungen führten dazu, dass wir in Bezug auf das Frühstück recht kurzgehalten wurden, »denn ich werd jetzt nicht viel Wind machen und euch vollstopfen und lange abwaschen, bei dem, was mir noch bevorsteht, das sag ich euch!«
So wurden uns die Schnitten verabreicht, als ob wir zweitausend Mann bei einem Gewaltmarsch wären und nicht ein Mann und ein Junge zu Hause. Mit reumütiger Miene schluckten wir Milch und Wasser aus einem Krug im Küchenschrank. Währenddessen hängte Mrs. Joe saubere weiße Gardinen an und befestigte einen neuen geblümten Volant an Stelle des alten quer über dem breiten Kamin. Sie gab die gute Stube gegenüber dem Flur frei, was sonst zu keiner anderen Gelegenheit geschah und die den Rest des Jahres in einem kühlen Schleier von Silberpapier zubrachte. Das Gleiche galt für die vier kleinen weißen Steingutpudel auf dem Sims, jeder mit einer schwarzen Nase und einem Blumenkorb in der Schnauze, einer des anderen Ebenbild. Mrs. Joe war eine sehr reinliche Hausfrau, hatte aber die besondere Gabe, ihre Reinlichkeit zu einem größeren Übel als den Schmutz zu machen. Sauberkeit steht Frömmigkeit nahe, und manche Leute behandeln ihre Religion genauso.
Da meine Schwester so viel zu tun hatte, ging sie nur durch Stellvertreter zur Kirche, das heißt, Joe und ich gingen. In seiner Arbeitskleidung wirkte Joe kräftig und wie ein typischer Schmied, in seinen Sonntagssachen dagegen eher wie eine aufgeputzte Vogelscheuche. Nichts, was er anhatte, schien ihm zu passen oder zu gehören, und alles war ihm zu eng. Auch zu diesem festlichen Anlass trat er, als die Glocken fröhlich zu läuten begannen, aus dem Zimmer und bot in seinem schwarzen Sonntagsstaat ein Bild des Elends. Was mich betrifft, so muss meine Schwester mich für einen jungen Missetäter gehalten haben, den ein Geburtshelfer in Gestalt eines Polizisten (an meinem Geburtstag) aufgelesen und ihr übergeben hat, damit sie ihn im Sinne einer beleidigten Gesetzlichkeit behandele. Ich wurde stets behandelt, als ob ich darauf bestanden hätte, allen Geboten der Vernunft, Religion und Moral und den abratenden Stimmen meiner besten Freunde zum Trotz geboren zu werden. Selbst wenn ich einen neuen Anzug bekam, erhielt der Schneider den Befehl, ihn wie eine Art Zwangsjacke zu nähen und mir auf keinen Fall darin Bewegungsfreiheit zu lassen.
Es muss für mitfühlende Seelen ein rührendes Bild gewesen sein, Joe und mich zur Kirche gehen zu sehen. Was ich äußerlich litt, war jedoch nichts im Vergleich zu dem, was in meinem Inneren vorging. Die Ängste, die ich jedes Mal durchlitt, wenn sich Mrs. Joe der Speisekammer näherte oder den Raum verließ, waren nur mit den Gewissensbissen vergleichbar, die mich sonst wegen meiner Missetaten quälten. Unter der Last meines schrecklichen Geheimnisses sann ich darüber nach, ob die Kirche mächtig genug wäre, mich vor der Rache des schrecklichen jungen Mannes zu bewahren, falls ich mich dort offenbaren würde. Ich erwog den Gedanken, in dem Moment, da die Aufgebote verlesen werden und der Geistliche sagt: »Nun könnt Ihr Eure Meinung kundtun!«, aufzustehen und um ein vertrauliches Gespräch in der Sakristei zu bitten. Dabei bin ich gar nicht einmal sicher, ob ich mit diesem außergewöhnlichen Ansinnen unsere kleine Gemeinde in Erstaunen versetzt hätte, denn es war ja Weihnachten und kein gewöhnlicher Sonntag.
Mr. Wopsle, der Kirchenvorsteher, war zu Tisch geladen, desgleichen Mr. Hubble, der Stellmacher, und Mrs. Hubble sowie Onkel Pumblechook (Joes Onkel, aber Mrs. Joe nahm ihn für sich in Anspruch), der ein wohlhabender Getreidehändler in der nächsten Stadt war und seinen eigenen Kutsch - wagen fuhr. Das Essen war für halb zwei vorgesehen. Als Joe und ich nach Hause kamen, war der Tisch gedeckt, Mrs. Joe umgezogen, das Essen angerichtet und die Eingangstür für die Gäste geöffnet (was sonst nie der Fall war), und alles war bestens. Und noch immer kein Wort vom Diebstahl.
Die Zeit verging, ohne meinen Gewissensqualen Erleichterung zu verschaffen, und die Gäste trafen ein. Mr. Wopsle, der mit einer römischen Nase und einer großen, glänzenden Glatze versehen war, hatte eine tiefe Stimme, auf die er ungemein stolz war. In seiner Bekanntschaft vertrat man die Meinung, dass er den Geistlichen übertreffen würde, wenn ihm dazu freie Hand gelassen würde. Er verkündete selbst voller Zuversicht, er würde sich einen Namen machen, falls sich die Kirche dem Konkurrenzkampf »weit öffnete«. Da sich aber die Kirche nicht »weit öffnete«, war er, wie gesagt, unser Kirchenvorsteher. Er strafte die Amen fürchterlich, und wenn er den Psalm verkündete – immer den ganzen Vers –, blickte er zunächst in der Gemeinde um sich, als wollte er sagen: »Ihr habt unseren Freund da oben vernommen; teilt mir eure Meinung zu diesem Stil mit!«
Ich öffnete den Gästen die Tür (und erweckte den Eindruck, dass es bei uns üblich wäre, diese Tür zu öffnen); zuerst öffnete ich Mr. Wopsle die Tür, dann Mr. und Mrs. Hubble und zum Schluss Onkel Pumblechook. Mir war es übrigens bei Androhung schwerster Strafen verboten, ihn Onkel zu nennen.
»Mrs. Joe«, sagte Onkel Pumblechook, ein großer, schweratmender, langsamer Mann in mittleren Jahren, mit einem Fischmaul, einfältig dreinblickenden Augen und sandfarbenem Haar, das wie eine Bürste in die Höhe stand, so dass er aussah, als ob er am Ersticken gewesen und gerade zu sich gekommen wäre, »ich habe Ihnen als Weihnachtsgeschenk – ich habe Ihnen, Madam, eine Flasche Cherry mitgebracht und außerdem, Madam, eine Flasche Portwein.«
An jedem Weihnachtstag stellte er sich mit genau denselben Worten ein, als wäre das etwas ganz Neues, und trug die beiden Flaschen wie Hanteln. An jedem Weihnachtstag antwortete Mrs. Joe, wie sie es jetzt tat: »Ach, On-kel Pum-blechook, ist das aber nett!« An jedem Weihnachtstag erwiderte er: »Es ist nur recht und billig. Na, seid ihr alle wohlauf, und wie geht’s unserem Dreikäsehoch?«, womit er mich meinte.
Wir aßen bei diesem Anlass in der Küche und gingen in die gute Stube hinüber, um Nüsse, Apfelsinen und Äpfel zu naschen, was ein Unterschied war wie Joe in seiner Arbeitskluft und Joe im Sonntagsstaat. Meine Schwester war heute ungewöhnlich lebhaft und überhaupt in Mr. Hubbles Gegenwart wesentlich freundlicher als vor anderen Gästen. Ich habe Mrs. Hubble als eine kleine Person in Himmelblau mit Löckchen in Erinnerung, die sich nach wie vor jugendlich gab, weil sie Mr. Hubble geheiratet hatte – ich weiß nicht, in welch fernen Zeiten –, als sie viel jünger war als er. An Mr. Hubble erinnere ich mich als einen zähen, gebeugten alten Mann mit hochgezogenen Schultern, mit dem Geruch von Sägemehl und so stark gekrümmten Beinen, dass ich als kleiner Bursche immer durch sie hindurch Ausblick auf ein ordentliches Stück freies Gelände hatte, wenn ich ihn die Straße entlangkommen sah.
In dieser feinen Gesellschaft hätte ich mich fehl am Platze gefühlt, auch wenn ich nicht die Speisekammer ausgeraubt hätte. Nicht, weil ich im spitzen Winkel zum Tischtuch eingezwängt war, mit dem Tisch an der Brust und Pumblechooks Ellbogen in meinem Auge; auch nicht, weil mir nicht gestattet war zu sprechen (ich wollte gar nicht sprechen) oder weil ich mit den schäbigen Resten der Geflügelkeulen bewirtet wurde, beziehungsweise mit jenen unbedeutenden Teilen vom Schwein, auf die es sich in lebendem Zustand nichts einzubilden brauchte. Nein, das alles hätte mich nicht gestört, wenn sie mich nur allein gelassen hätten. Aber sie wollten mich nicht allein lassen. Sie schienen es für eine verpasste Gelegenheit zu halten, wenn sie nicht die Unterhaltung hin und wieder auf mich lenkten und mich piesackten. Ich kam mir vor wie ein kleiner, unglücklicher Stier in einer spanischen Arena, so wie ich von diesen Stachelstöcken der Moral gepeinigt wurde.
Schließlich setzten wir uns zu Tisch. Mr. Wopsle sprach mit theatralischem Pathos das Tischgebet – wie mir heute scheint, in einer Art religiöser Kreuzung aus Hamlets Geist und Richard III. – und beschloss es mit dem innigen Wunsch, dass wir dankbar sein mögen. Woraufhin mich meine Schwester scharf anblickte und in vorwurfsvollem Ton sagte: »Hörst du? Sei dankbar.«
»Junge«, sagte Mr. Pumblechook, »sei besonders denen gegenüber dankbar, die dich mit eigner Hand aufgezogen haben.«
Mrs. Hubble schüttelte den Kopf und fragte, indem sie mich mit der düsteren Vorahnung, dass aus mir nichts Gescheites werde, betrachtete: »Wie kommt das bloß, dass die Jugend nie dankbar ist?« Dieses moralische Rätsel schien für die Gäste zu schwer zu sein, bis es dann Mr. Hubble kurz und knapp löste: »Von Natur aus verdorben.« Alle murmelten »Stimmt!«, und sahen mich dabei besonders unfreundlich und anzüglich an.
Joes Position und Einfluss (falls überhaupt vorhanden) waren in Gegenwart von Besuch etwas schwächer als sonst. Immer aber half er mir und tröstete mich, wenn er konnte, in der ihm eigenen Weise, und zwar versorgte er mich bei den Mahlzeiten ständig mit Soße, sofern welche da war. Da es heute reichlich Soße gab, löffelte Joe an diesem Punkt über eine halbe Pinte auf meinen Teller.
Im weiteren Verlauf der Mahlzeit kritisierte Mr. Wopsle die Predigt in aller Schärfe und deutete an, welcher Art seine Predigt gewesen wäre (dabei ging er von der Hypothese aus, dass sich die Kirche »weit öffnen« werde). Nachdem er sie mit einigen Hauptpunkten seiner Darlegungen vertraut gemacht hatte, bemerkte er, dass er das Thema der heutigen Predigt für falsch ausgewählt hielt, was umso weniger entschuldbar sei, als, wie er hinzufügte, so viele Themen »auf der Straße lägen«.
»Stimmt genau«, sagte Onkel Pumblechook. »Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Sir! Eine Menge Themen liegen bereit, die nur aufzugreifen sind. Das wär nötig. Man braucht nicht lange auf ein Thema zu warten, wenn man es nur sehen will.« Nach kurzem Nachdenken fügte Mr. Pumblechook hinzu: »Sehen Sie sich nur das Schweinefleisch an. Schon haben Sie ein Thema! Wenn Sie ein Thema suchen, dann gucken Sie sich das Schwein an!«
»Wahrhaftig, Sir. Viele Lehren kann die Jugend aus diesem Text ziehen«, erwiderte Mr. Wopsle, und ich wusste, dass er das auf mich münzte.
(»Hör gut zu«, sagte meine Schwester während einer Pause zu mir.)
Joe gab mir noch etwas Soße.
»Das Schwein«, fuhr Mr. Wopsle in seiner tiefsten Stimme fort und zeigte mit seiner Gabel auf mich errötendes Wesen, als habe er mich beim Vornamen genannt, »das Schwein war der Gefährte der Verschwender. Die Gefräßigkeit des Schweins wird uns als ein Beispiel für die Jugend vorgeführt.« (Das traf, fand ich, auf ihn zu, der das Schweinefleisch als so fett und saftig gepriesen hatte.) »Was an einem Schwein verabscheuungswert ist, ist erst recht an einem Jungen verabscheuungswert.«
»Oder an einem Mädchen«, äußerte Mr. Hubble.
»Oder an einem Mädchen, selbstverständlich, Mr. Hubble«, pflichtete Mr. Wopsle ziemlich gereizt bei, »aber unter uns ist kein Mädchen.«
»Außerdem«, sagte Mr. Pumblechook und wandte sich jäh an mich, »denke daran, wofür du dankbar sein musst. Wenn du als Ferkel auf die Welt gekommen wärst …«
»Wenn ein Kind jemals als ein Ferkel auf die Welt gekommen ist«, sagte meine Schwester sehr nachdrücklich, »dann ist er es.«
Joe gab mir noch etwas Soße.
»Ja, aber ich meine ein vierbeiniges Ferkel«, sagte Mr. Pumblechook. »Wenn du als so eins auf die Welt gekommen wärst, könntest du dann hier sein? Du …«
»Höchstens in dieser Gestalt«, sagte Mr. Wopsle und wies mit dem Kopf auf die Bratenplatten hin.
»Aber ich meine doch nicht in dieser Form, Sir«, erwiderte Mr. Pumblechook, der es nicht leiden konnte, wenn man ihn unterbrach. »Ich meine, dass er sich mit den Älteren und den ihm Überlegenen unterhält und sich durch ihre Unterhaltung vervollkommnet und im Luxus schwimmt. Könnte er das sonst? Nein. Und was wäre dein Schicksal gewesen?«, wandte er sich wieder an mich. »Du wärst zum Marktpreis verkauft worden, und Dunstable, der Fleischer, wäre zu dir in den Stall gekommen, hätte dich vom Stroh aufgehoben und dich unter seinen linken Arm geklemmt und mit dem rechten seinen Kittel hochgestreift, um aus der Jackentasche ein Messer zu ziehen, und er hätte dein Blut vergossen und dir das Leben geraubt. Also kein Aufziehen mit eigner Hand. Kein Stück!«
Joe bot mir noch etwas Soße an, die ich mir aber nicht zu nehmen traute.
»Er hat Ihnen eine Menge Sorgen bereitet, Madam«, bemitleidete Mrs. Hubble meine Schwester.
»Sorgen?«, wiederholte meine Schwester, »Sorgen?« Und dann folgte eine fürchterliche Aufzählung aller Krankheiten, an denen ich schuld gewesen war, aller schlaflosen Nächte, die ich verbrochen hatte, aller hohen Gegenstände, von denen ich heruntergefallen war, aller Löcher, in die ich hineingestürzt war, aller Verletzungen, die ich mir zugezogen hatte, und all der Momente, in denen sie mich ins Grab gewünscht hatte, wogegen ich mich jedoch hartnäckig gewehrt hatte.
Ich glaube, dass sich die Römer mit ihren Nasen gegenseitig sehr gereizt haben. Vielleicht sind sie darum zu solch einem ruhelosen Volk geworden. Jedenfalls hat mich Mr. Wopsles römische Nase dermaßen geärgert, als meine Vergehen aufgezählt wurden, dass ich ihn am liebsten daran gezogen hätte, bis ihm Hören und Sehen vergangen wäre. Aber alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt ausgehalten hatte, war nichts im Vergleich zu den schrecklichen Gefühlen, die mich beschlichen, als die Pause nach der Aufzählung durch meine Schwester unterbrochen wurde und mich jeder mit Entrüstung und Abscheu (dessen war ich mir schmerzlich bewusst) anstarrte.
»Trotzdem«, sagte Mr. Pumblechook und führte die Gesellschaft wieder sanft auf das Thema zurück, von dem sie abgeschweift war, »gekochtes Schweinefleisch ist auch nahrhaft, nicht?«
»Trink ein Schlückchen Branntwein, Onkel«, sagte meine Schwester.
Du lieber Himmel, das musste ja kommen! Er würde ihn schwach finden, würde sagen, dass er schwach ist, und ich wäre verloren! Ich hielt mich mit beiden Händen unter der Tischdecke am Tischbein fest und erwartete mein Schicksal.
Meine Schwester ging nach der Steinkruke, kam damit zurück und goss den Branntwein ein. Sonst trank keiner. Der unglückselige Mann spielte mit seinem Glas – er hob es hoch, hielt es gegen das Licht, setzte es ab – und verlängerte meine Qual. Währenddessen machten Mrs. Joe und Joe flink den Tisch für die Schweinefleischpastete und den Pudding frei.
Ich konnte den Blick nicht von ihm wenden. Noch immer klammerte ich mich mit Händen und Füßen ans Tischbein und sah, wie das unglückliche Geschöpf das Glas spielerisch drehte, es hochnahm, lächelte, den Kopf zurückwarf und den Branntwein austrank. Gleich darauf wurde die Runde von unbeschreiblicher Bestürzung erfasst, da er aufsprang, sich mehrere Male mit erschreckenden, krampfartigen Bewegungen, wie von Keuchhusten geschüttelt, wand und zur Tür hinausstürzte. Dann sah man durch das Fenster, wie er sich gewaltsam nach vorn beugte und ausspie, dabei die hässlichsten Grimassen zog und offensichtlich nicht ganz bei Sinnen war.
Ich hielt mich fest, während Mrs. Joe und Joe zu ihm hinrannten. Ich wusste zwar nicht, wie ich es angestellt hatte, aber es bestand kein Zweifel darüber, dass ich ihn irgendwie getötet hatte. Es war in meiner schrecklichen Situation eine Erlösung, als er zurückgebracht wurde, die Anwesenden der Reihe nach ansah, als wären sie ihm nicht bekommen, und auf seinen Stuhl sank.
»Teer!«, stieß er hervor.
Ich hatte die Flasche mit Teerwasser aufgefüllt. Ich wusste, dass es ihm in nächster Zeit noch schlechter gehen würde. Wie ein Medium, von dem heute die Rede ist, bewegte ich den Tisch durch die Kraft, mit der ich ihn festhielt.
»Teer!«, rief meine Schwester verwundert. »Wie ist dort bloß Teer reingekommen?«
Onkel Pumblechook, der in dieser Küche die Hauptperson war, wollte nichts von diesem Wort und nichts von diesem Thema hören, winkte nur gebieterisch ab und verlangte nach heißem Gin mit Wasser. Meine Schwester, die verdächtig nachdenklich wurde, war vollauf damit beschäftigt, den Gin, heißes Wasser, Zucker und die Zitronenschale zu holen und alles zu mixen. Zumindest in dieser Zeit war ich sicher. Ich hielt mich noch am Tischbein fest, doch umklammerte es nun mit inbrünstiger Dankbarkeit.





























