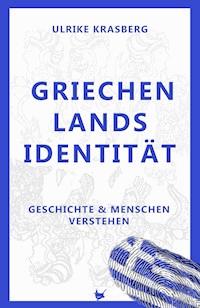Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Über ein Jahr lang arbeitete die Ethnologin als Aushilfskraft in vier Demenzwohngruppen. Ihre positiven Beziehungen zu den Bewohnern veranlassten sie dazu, die medizinische Diagnose 'Alzheimer' zu hinterfragen und über die kulturelle Bedeutung des Alters nachzudenken. Auf welchem Menschenbild beruhen die biomedizinische Forschung und der Umgang der Öffentlichkeit mit Alter und Demenz? Ließe sich dieses Bild nicht ändern, um die Integration und gesellschaftliche Teilhabe alter und dementer Menschen zu verbessern? Das Buch beschreibt das Leben in den Wohngruppen aus Sicht der 'Dementen' und der Pflegenden. Es bewertet den Verlust kognitiver Fähigkeiten und die damit einhergehenden, keineswegs nur negativen Persönlichkeitsveränderungen letztlich als ein Handicap wie andere auch. Wir lernen allmählich, Menschen mit Down-Syndrom oder Querschnittslähmung zu integrieren; ebenso müsste eine lebenswerte Gesellschaft alte und demente Menschen mit ihren typischen Verhaltensweisen im Alltag akzeptieren, anstatt sie abzuschieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Krasberg
«Hab ich vergessen, ich hab nämlich Alzheimer!»
Verlag Hans Huber
Programmbereich Pflege-Sachbuch
Ulrike Krasberg
«Hab ich vergessen, ich hab nämlich Alzheimer!»
Beobachtungen einer Ethnologin in Demenzwohngruppen
Verlag Hans Huber
Lektorat: Dr. Klaus Reinhardt
Herstellung: Jörg Kleine Büning
Bearbeitung: Ulrike Weidner, Berlin
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Basel
Druckvorstufe: punktgenau gmbh, Bühl
Druck und buchbinderische Verarbeitung:
AALEXX Buchproduktionen GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Anregungen und Zuschriften an:
Hogrefe Verlag
Lektorat Medizin
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
www.hogrefe.ch
1. Auflage 2013
© 2013 by Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-456-95278-9)
(E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-456-75278-5)
ISBN 978-3-456-85278-2
Inhalt
Inhalt
Einleitung
1 Leben ohne Arbeit?
2 Das Eigene und das Fremde
3 Früher kam der Sensemann
4 «Wo ist denn mein Bett?»
5 «Ich hab’ Rücken!»
6 «Eigentlich ist das nicht zu schaffen!»
7 Abschied vor dem Abschied?
8 Jeder von uns ist Kunst – gezeichnet vom Leben
9 Home, Ekstase, Inszenierung, Leibessicht, Ritual
Rückschau
Literatur
Deutschsprachige Literatur, Adressen und Links zum Thema «Demenz»
Einleitung
In dem Jahr, in dem ich 60 wurde, bekam ich ein neues Hüftgelenk. Es war eine mörderische OP, die ich mir lieber nicht detailliert vorstellte. Jedenfalls waren danach die heftigen Schmerzen weg, die mich vorher Tag und Nacht geplagt hatten, und nach wenigen Wochen konnte ich schon wieder ziemlich gut laufen. Was haben die Menschen früher gemacht, als es noch nicht diese wunderbaren Operationsmöglichkeiten und diese effektive Krankenhauspflege gab, die mich im wahrsten Sinne des Wortes ganz schnell wieder auf die Beine stellte? Als ich in den Wochen danach noch an Krücken gehen musste, fiel mir auf, wie viele Menschen mit Krücken unterwegs sind – die meisten in meinem Alter oder älter. Und zu dieser Gruppe der Älteren oder Alten gehörte ich jetzt offensichtlich auch. Bemerkungen wie: «Du bist doch noch jung, dein Alter sieht man dir nicht an», fand ich unpassend. Denn zumindest ich sah, dass mein Körper merkwürdige Veränderungen erfuhr: Die Haut auf der Unterseite der Oberarme glich immer mehr knitteriger Seide, davon abgesehen, dass das Gewebe darunter ziemlich schlabberte, die Adern auf meinen Händen wurden blaugrün und immer dicker und was in meinem Gesicht passierte war – gelinde gesagt – interessant. Was wird sich denn da noch alles verändern? Die Falten und Fältchen konnte ich mit Cremes ja noch besänftigen, aber die Proportionen verschoben sich irgendwie. Ich interpretierte die Veränderungen als allmähliche äußerliche Ausprägung meiner Persönlichkeit.
Mich beunruhigte alledings die Vorstellung, dass mein Körper ja nicht nur außen langsam verfiel, sondern dass es innen bei den Organen und Gelenken genauso aussah. Eine Frage der Zeit, wann das eine oder andere Organ schlapp machen würde. Gut, die Medizin kann es richten heutzutage, zumindest in den meisten Fällen, und wie effektiv die mittlerweile ist, hatte ich ja nun am eigenen Leib erlebt. Zähne, Augen, Ohren, Hüften, Knie – alles erneuerbar. Ich würde mich also auf kommende Reparaturarbeiten einstellen müssen. Aber so wie ich bis hierhin gelebt hatte, mit einem Körper, der selbstverständlich und fast ohne zu murren all das mitmachte, was ich ihm abverlangte, ohne groß darüber nachzudenken, diese Zeiten waren offensichtlich vorbei. So ist das also im dritten Lebensabschnitt, man kann sehr schön noch eine ganze Weile weiterleben, aber nicht ohne Schmerzen und medizinische Eingriffe. Meine Tante, 86 Jahre und immer noch sehr fit, gab mir in dieser Zeit durchs Telefon die weise Einsicht kund: «Wenn du über fünfzig bist, morgens aufwachst und dir nirgendwo was weh tut, kannst du davon ausgehen, dass du tot bist!»
Wohl fühlte ich mich in meinem Körper nur, wenn ich regelmäßig Sport in der Turngemeinde machte (manchmal bewältigte ich die Übungen sogar besser als jüngere Kursmitglieder!) und mich täglich, statt mit dem Auto oder der U-Bahn, auf dem Fahrrad durch die Stadt bewegte. Aber die Vorstellung, dieses Wohlgefühl nur erhalten zu können, wenn ich regelmäßig Sport machte, war wiederum etwas deprimierend. Sport war nie meine bevorzugte Freizeitbeschäftigung gewesen.
Vergnügen bereitete mir mein Beruf: Als Kulturanthropologin und Ethnologin an einem Forschungsprojekt zu arbeiten, das Leben in anderen Kulturen kennen zu lernen, mit Kollegen zu diskutieren und interessante Leute zu treffen, das hielt mich lebendig und depressionsfrei, meinen Körper spürte ich dann kaum. Und jetzt endlich hatte ich auch soviel Erfahrung und Knowhow, dass mir die Projekte immer besser gelangen, ich richtig zufrieden war. In dem Jahr, bevor ich 60 wurde, passierte aber dann wieder einmal, was ich als freischaffende Wissenschaftlerin schon oft erlebt hatte: eine Projektfinanzierung kam nicht zustande.
«[…] muss ich ihnen mitteilen, dass ihr Antrag auf Finanzierung ihres Forschungsprojekts leider nicht erfolgreich war.» Wie oft ich das schon gelesen hatte! Also mussten mein Kollege und ich eine neue Suche starten nach einem Förderprogramm, in das unsere Forschung passen würde. Das wurde immer schwieriger, weil sich die Fördereinrichtungen jeweils für ein paar Jahre auf bestimmte Themen in der Wissenschaft festlegten, die sie finanzieren wollten und das eigene geplante Forschungsprojekt dort nicht immer hineinpasste. Je nach Programm musste der Forschungs-antrag passend umgeschrieben werden, und dann hieß es wieder Monate warten, bis der Antrag das Prüfungsverfahren der Gremien durchlaufen hatte. Die Prozedur kannte ich zur Genüge. Forschungsgelder zu bekommen war immer auch ein Lotteriespiel. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass ich mehr Forschungsanträge schrieb als Forschungen zu betreiben. Wenn man all die Anträge zusammenpacken würde, käme ein ziemlich dickes Buch dabei heraus.
Aber nun wurde es wirklich schwierig. Meine Ersparnisse, die mich in der Wartezeit ernähren mussten, gingen dem Ende zu. Bis jetzt hatte ich immer Glück gehabt, konnte mich und meine beiden Kinder mit meiner wissenschaftlichen Arbeit ernähren. Aber nun wurde immer deutlicher, dass ich mit Ende Fünfzig an eine unausgesprochene Altersgrenze stieß. Der größte Teil der Forschungsgelder wird an den wissenschaftlichen Nachwuchs vergeben. Aber nur die wenigsten Nachwuchswissenschaftler bekommen eine feste Stelle, normal ist es, sich von einer befristeten Stelle zur anderen zu hangeln. Wenn man gut ist und immer wieder Projekte bekommt, motiviert das zum Weitermachen und dann ist man eines Tages plötzlich zu alt. Realitätstüchtigere Geisteswissenschaftlerinnen als ich hängen früher oder später ihre wissenschaftliche Ausbildung und berufliche Erfahrung an den Nagel und suchen sich eine «vernünftige Einkommensquelle». Eine meiner Kolleginnen züchtet jetzt sehr erfolgreich eine alte ägyptische Hunderasse für den Verkauf, eine andere Bienen, eine dritte lebt von Catering – weil sie so gut afrikanisch kochen kann. Manche Ethnologin heiratet einen wohlhabenden Mann aus der Oberschicht des Landes, in dem sie forscht. Etliche meiner männlichen Kollegen sind mit verbeamteten Lehrerinnen verheiratet. Auch die Lehraufträge an den Unis helfen nicht weiter, weil die Gelder für Lehraufträge so knapp bemessen sind, dass man nur alle paar Jahre einen bezahlten Lehrauftrag bekommen kann. Nachwuchswissenschafter lehren trotzdem, weil sie Lehrerfahrung in Bewerbungen nachweisen müssen. Die Studentenzahlen steigen und die Lehre wird weitgehend von unbezahlten Lehrkräften abgedeckt. Die Studierenden wissen nicht, dass sie an der Uni neben den wenigen Professoren und Stelleninhabern entweder von noch übenden Nachwuchswissenschaftlern oder von Ethnologen «hobbymäßig» neben ihrem oft berufsfremden Broterwerb unterrichtet werden.
Unter diesen Bedingungen ist der individuelle Konkurrenz- und Existenzkampf an den Instituten gnadenlos. Stutenbeißen, Mobbing, Intrigantentum, Sex zur Beförderung der Karriere, das «Stockholmsyndrom» zwischen Assistentin und Institutsleiterin, keine Scheußlichkeit wird im Existenzkampf ausgelassen und Seilschaften scheinen die Grundbedingung für eine feste Stelle zu sein. Wo immer ein Wissenschaftler/Ethnologe in der Berufswelt auftritt, bewegt er sich unter Konkurrenten. Besonders auf Tagungen der Fachverbände ist die persönliche Imagepflege ein Muss. Kein Wort, keine Geste, kein Blick, kein Kleidungsstück, das nicht bewusst gewählt wird. Und ganz besonders da, wo alles locker und «privat» zu sein scheint, ist die Inszenierung von größter Bedeutung. Das ist meine Berufswelt. Natürlich habe ich versucht, da mitzumachen, eine gute Performanz zu zeigen, sowohl beim Vortrag wie auch hinterher bei einer kleinen Runde im Altstadt-Weinrestaurant. – Diese Seite meines Berufslebens war unglaublich anstrengend!
Jetzt jedoch, weil ich die altersmagische 60 überschritten habe, scheine ich ziemlich plötzlich aus der Berufswelt heraus zu fallen. – Und was mache ich nun? Jedenfalls muss ich mir erstmal einen Job suchen. Aber ich wäre nicht Wissenschaftlerin, wenn ich nicht mal nachlesen würde, was meine Kollegen aus der Soziologie zum Thema «Alter» zu sagen haben. Was bedeutet es in unserer Gesellschaft, seinen Beruf aus Altersgründen nicht mehr ausüben zu können? Muss ich jetzt in Rente gehen – von der ich aber gar nicht werde leben können?
1 Leben ohne Arbeit?
Rente und Arbeit im Alter
Soziologen, die zum Thema «Alter» forschen, sind sich einig, dass die Trennung zwischen «jung» und «alt» wesentlich für die moderne Gesellschaft ist: zwischen Menschen, die arbeiten, um Geld zum Leben zu verdienen, und denen, die am Ende ihrer gesellschaftlichen Arbeitszeit angekommen sind und Rente bekommen. Diese Trennung ist deshalb so scharf, weil nur diejenigen angesehen sind, die Geld verdienen. Das ist etwas Besonderes im Vergleich zu vielen Gesellschaften weltweit, in denen Menschen im Alter große Anerkennung bekommen. Weil unsere Gesellschaft ein Sozialstaat ist, der für die alten Menschen sorgt, gibt es allgemein eine Rente für Menschen, die älter als 65 sind. Dabei wird sich durchaus auch Mühe gegeben, das Verteilungssystem den Bedürfnissen und Lebensweisen der Rentner anzupassen. So konnten bis vor kurzem Frauen schon mit 60 die Rente beantragen, allerdings bekamen sie dann weniger. In den 1940er-Jahren fiel auf, dass, wenn die Männer mit 65 Jahren in Rente gingen, ihre in der Regel jüngeren Ehefrauen (das wurde anhand des mittleren Altersunterschieds zwischen Ehemann und Ehefrau errechnet) noch arbeiten mussten. Da die Männer nicht gelernt hatten zu kochen oder die in einem Haushalt anfallenden Arbeiten zu erledigen und sich außerdem ohne ihre Frau langweilten, durften Frauen schon früher ihre Rente beantragen (Kohli 1992: 253).
Als dann aber ab den 1980er-Jahren immer weniger Menschen Arbeit hatten, hat man sich überlegt, dass man die Älteren ja auch schon ab 50 in Rente schicken könnte. Das ging aber nicht lange gut, weil in die Rentenkasse nicht genug Geld eingezahlt wurde, um all die zusätzlichen Frührentner zu versorgen. Also wurden die Beiträge erhöht, die alle Arbeitenden in die Rentenkasse zahlen müssen, und das Geld, das die Rentner zum Leben bekamen, gekürzt. Das ging schließlich soweit, dass heute ein großer Teil der Rentner von ihrer Rente nicht mehr leben können. Aber es gibt ja heute viele Arbeiten, die – obwohl die auch jemand machen muss – so schlecht bezahlt werden, dass man davon auch nicht leben kann. Dazu gehören Putzen in Büros, im Supermarkt die Regale auffüllen, in der Altenpflege helfen und vieles mehr. Eine Rente, von der man nicht leben kann und ein so genannter Minijob, von dem man auch nicht leben kann, ergeben zusammengenommen aber dann wieder soviel, dass man davon leben kann. Damit diesen Rentnern die Minijobs nicht ausgehen, haben viele Betriebe ihre Arbeit so organisiert, dass nur noch für wenige Arbeitsplätze genug Geld zum Leben gezahlt wird und viele kleine Minijobs entstanden. Das ist auch wirtschaftlich günstiger für die Betriebe.
Aber auch Rentner mit Minijobs haben kein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Denn angesehen sind nur Leute, die genug Geld haben, um ordentlich konsumieren zu können. Konsum ist wichtig für den Fortschritt in der Gesellschaft, und der wird am Konsumverhalten der Bürger gemessen. Wenn sie genug konsumieren, geht es der Wirtschaft gut. Deshalb werden am Jahresende über die Medien die Bürger davon unterrichtet, ob sie genug gekauft, das heißt konsumiert haben oder nicht. Rentner mit Minijob sind bei diesen kollektiven Anstrengungen keine große Hilfe.
Rentner mit Minijobs muss man sich nicht unbedingt als arm im Sinne von «nichts haben» vorstellen. Sie besitzen viele Dinge, aber sie geben weniger Geld dafür aus, die alten Gegenstände durch neue zu ersetzen. Allerdings hat sich das Konsumverhalten auch von denen verändert, die im Vergleich zu den Rentnern viel Geld verdienen. Wenn man alles schon hat, was es zu kaufen gibt, und nur noch das Alte durch Neues ersetzen kann, dann macht Shopping als Freizeitbeschäftigung nicht mehr soviel Spaß. Da das immer mehr Menschen so geht, ist in Sachen Konsum etwas Neues «auf den Markt gekommen»: Essen gehen und Kaffeetrinken als Lifestyle, Wellness-Wochenenden und Kreuzfahrten: Das ist Konsum als purer Genuss, hält die Wirtschaft in Schwung und man muss sich nicht um die irgendwann lästig werdenden Gegenstände zu Hause kümmern. Rein wirtschaftlich gesehen ist das fast so gut wie die Produktion und der Verkauf von Kriegsgerät, das ja auch ausschließlich für die Zerstörung hergestellt wird und immer wieder neu produziert werden kann. Ähnlich wie Sylvesterfeuerwerk.
Nicht alle Rentner müssen beim Konsumieren passen. Früher konnten die über 65-Jährigen von ihrer Rente gut leben, manche sogar sehr gut. Besonders die Beamten. Warum manche Berufsgruppen so hohe Renten bekommen und andere nicht, ist heute nicht mehr in allen Fällen einsichtig. Fest steht aber, dass viele heutige Rentner noch ein relativ hohes Einkommen und damit eine enorme Kaufkraft haben, die zum Wohle der Wirtschaft genutzt werden muss. Extra für sie werden altengerechte Gegenstände hergestellt. Zum Beispiel Telefone und Handys mit so großen Knöpfen und Zahlen, dass man sie ohne Lesebrille bedienen kann. Manche dieser Gegenstände – wie Koffer mit Rollen – haben sogar die Lebenswelt der Jüngeren erobert, nunmehr als schicke Konsumgüter.
Auch wenn die wohlhabenden Rentner aus volkswirtschaftlichen Gründen in den Konsum miteinbezogen werden, angesehen sind sie deshalb nicht. So versuchen viele mit allerlei kosmetischen und chirurgischen Maßnamen, mit sportlichen Aktivitäten und jugendlicher Kleidung Jung-Sein noch ein Weilchen vorzutäuschen. Aber spätestens dann, wenn in der vollbesetzten U-Bahn jemand aufsteht, um seinen Sitzplatz anzubieten, wird klar, dass da jemand Altes steht (den Sitzplatz in so einem Fall abzulehnen macht es auch nicht besser!). Kurzum: Die moderne Gesellschaft ist aufgeteilt in Jung und Alt, in die, die dazugehören und die, die aufgrund ihres Alters aussortiert wurden.
Als Bismarck 1889 die Rente einführte, galt sie ab dem 70. Lebensjahr (hauptsächlich für Männer). Dieses Alter erreichte allerdings nur ein Viertel der Bevölkerung, die meisten starben vorher. Die Überlebenden hatten im Durchschnitt noch acht Jahre Lebenszeit. Laut Statistischem Bundesamt haben heute 60-jährige Männer durchschnittlich noch 22 Jahre und Frauen noch 25 Jahre zu leben. Das heißt, ein Rentnerleben ist keineswegs mehr die Restzeit vor dem Tod, sondern wird dadurch definiert, nicht mehr am Erwerbsleben teilzuhaben. Da Arbeit weitgehend das Selbstkonzept in unserer Gesellschaft bestimmt, ist es für nicht mehr Erwerbstätige schwierig, eine neue Identität zu finden. Der «Bruch der Verrentung» kann durchaus ein individuelles Trauma sein. Wenn ich sage: «Ich bin Lehrerin», gehöre ich dazu. Sage ich: «Ich war Lehrerin», gehöre ich nicht mehr dazu. Meine subjektiv gefühlte Identität, die wesentlich über den Beruf bestimmt wird, ist zwar immer noch die gleiche, führt aber nun ins Leere.
Eigentlich ist die Rente eine soziale gesellschaftliche Errungenschaft. Die Festsetzung der Altersgrenze, ab wann der Staat die Rente zahlt, hängt zwar einerseits von den finanziellen Möglichkeiten des Staates ab – wie viel Geld steht für die Renten zur Verfügung, wie viel Arbeitslose gibt es, wie viel Gewinn bringen ältere Arbeitnehmer der Wirtschaft usw.? – andererseits greift das Datum der Verrentung tiefgehend in die individuelle Lebensgestaltung seiner Bürger ein. Von kritischen Journalisten wird immer wieder berichtet von Menschen, deren Lebensarbeitszeit zu lang ist, weil sie äußerst anstrengende Berufe ausüben. Andere, die mit spätestens 65 in die Rente geschickt werden, möchten gerne weiterarbeiten, weil die Rente nicht zum Leben reicht oder weil die Arbeit sie erfüllt und sie sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen können. Es sieht so aus, als ob die Menschen, die keinen «sozialversicherungspflichtigen» Arbeitsplatz haben, die also selbständig arbeiten, am glücklichsten sein könnten, weil sie den Absprung in den Abgrund des Alters nicht machen müssen und einfach weiterarbeiten können. Wobei die meisten von ihnen aber weiterarbeiten müssen, weil sie keine Ersparnisse haben und die Höhe ihrer Rente nicht zum Leben reicht. Es gibt ein zahlenmäßig kleines Grüppchen von über 60-Jährigen, die eine Art Ausnahme bilden. Es sind die Künstler: bekannte Schauspieler, die immer wieder Rollen bekommen, bekannte Schriftsteller und Maler, Reiche – wobei «reich» hier auch diejenigen meint, deren Rente über dem Durchschnittseinkommen liegt – und auch die, die als Selbständige einen Betrieb aufgebaut haben, mit dem sie viel Geld verdienen. Sie sind frei, bis zu ihrem Tod Arbeit und Leben nach ihren eigenen Wünschen und Maßstäben miteinander zu verbinden. Sie sind die Gruppe von Menschen, deren Leben ohne den, von außen aus gesellschaftlichen Zwängen aufgezwungenen Bruch der Verrentung verläuft. Die Rente bringt materielle Sicherheit – aber zu welchem soziokulturellen Preis?
Mittlerweile knirscht das Rentensystem: Weil nicht genug Geld in den Rentenkassen ist, weil man von der Rente oft nicht mehr leben kann, weil Menschen während ihres Berufslebens so wenig verdienen, dass sie davon keine private Altersversorgung ansparen können. Die, die Geld fürs Alter zurücklegen können, geraten vielleicht an betrügerische Finanzberater – wer kennt sich schon in Anlage- und Finanzgeschäften aus? Oder ihr der Bank anvertrautes Geld wird von der nächsten Bankenkrise vernichtet. Das Rentensystem knirscht aber auch, weil Menschen, die sich durch die allgemein gestiegene Lebenserwartung als mitten im Leben stehend empfinden, an einem von außen gesetzten Zeitpunkt, ihre Identität genommen wird, die eng mit ihrem Beruf verbunden ist. Dabei haben sie noch viele Jahre Leben vor sich, das sie aktiv gestalten könnten, bevor die Lebensphase des ganz hohen Alters biologisch tatsächlich so etwas wie «Ruhestand» erzwingt.
Zu den landläufigen Sprüchen über das Alter gehört auch: «Junge haben Zukunft, Alte Erinnerungen.» Das ist falsch! Beide haben beides. Die über 60-Jährigen gehen nur realistischer mit der Zukunft um. Wenn sie etwas planen, dann für die überschaubare Zukunft. Darin gleichen sie den Menschen in vielen afrikanischen Gesellschaften, in deren traditioneller Weltsicht kein Zukunftsbegriff im modernen Sinn existiert, das heißt eine Zukunft, die über die unmittelbar anstehende Zeit des «morgen» oder «nächste Woche» hinausgeht. Unser Zukunftsbegriff ist entstanden durch das moderne Berufsleben, durch die Abhängigkeit von Bankkrediten und Versicherungen und durch die umfassend installierte Gesundheitsvorsorge; all dies macht Zukunftsplanungen notwendig. Andererseits: wer kennt nicht das beklemmende Gefühl, wenn der Terminkalender schon im Januar bis in den Herbst hinein gefüllt ist, und sei es mit Verabredungen für Freizeitvergnügungen? Wie viele persönlichen Pläne werden immer weiter in die Zukunft verschoben bis zum «St. Nimmerleinstag»?
2 Das Eigene und das Fremde
Wie ich das Waldhaus kennen lernte
Ich muss also ganz schnell außerhalb der Uni Geld verdienen, wo auch immer. Aber was kann ich denn noch außer Kulturanthropologie? Ich klicke mich im Internet durch die Jobbörsen. In der Altenpflege werden ständig Aushilfen und Hilfskräfte gesucht. Ich zögere. Mich gruselt etwas vor dem Thema «Alter». Außerdem hat Altenpflege irgendwie ein schmuddeliges Image. Ich folge den Links in den Jobbörsen mal hierhin und mal dahin. Irgendwann lande ich dann doch wieder auf den Homepages von Altersheimen. Auf einer lese ich: Aushilfen gesucht für Wohngruppen mit Demenzkranken. – Demenzkranke? In mir erwacht eine gewisse Neugierde. Warum nicht in einem Bereich unserer Gesellschaft arbeiten, den ich überhaupt nicht kenne? So eine Art ethnologische Feldforschung im Pflegeheim? Ich wähle die Telefonnummer auf der Homepage. Am Handy spricht eine ganz sympathische Frau mit mir. Ja, sie suchen Aushilfskräfte. Ich könne am nächsten Tag ja mal vorbeikommen und mir das Emma-Bechthold-Haus ansehen.
Clarissa ist vielleicht zehn Jahre jünger als ich, sieht so aus wie ich: Jeans, T-Shirt, lockige, kurz geschnittene Haare. Sie ist angenehm freundlich, nicht von der aufgesetzten professionellen Art und auch nicht vom Typ «rustikaler Hausdrachen», wie ich mir das weibliche Führungspersonal in Heimen aller Art immer vorgestellt habe (und die tatsächlich auch an anderen Stellen im Haus arbeiten). Ich sage ihr, dass ich Ethnologin sei, von der Durchführung wissenschaftlicher Projekte lebe, mir gerade die Finanzierung eines Projekts abgelehnt wurde und ich mich jetzt vorübergehend anderweitig finanzieren müsse. Ich füge hinzu, dass ich noch nie in der Altenpflege gearbeitet habe, aber zwei Kinder großgezogen habe und Haushalt eigentlich immer ganz gerne gemacht habe. «Wenn Sie hier arbeiten wollen, lernen wir Sie an, das ist kein Problem!», sagt Clarissa und fügt dann mit einem Lächeln hinzu. «Sie haben eine positive Ausstrahlung, jemanden wie Sie können wir gut brauchen.» Wir sprechen über Krankheit, Tod und Sterben. Ich sage ihr, dass ich während meiner Feldforschungen schon mit Sterben und Tod konfrontiert wurde und über Bestattungsrituale geforscht habe. Sie nimmt es als Information, kein «oh, wie spannend!», was ich sonst oft höre. Sie schlägt vor, mir die Demenzwohngruppen im Waldhaus zu zeigen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!