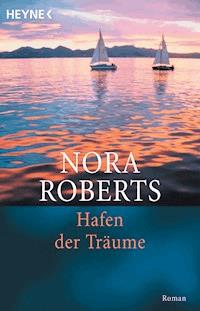
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Quinn-Saga
- Sprache: Deutsch
Der kleine misshandelte Seth erinnert Phillip Quinn an den traurigen Jungen, der er selbst einst war. Er will den letzten Wunsch seines Adoptivvaters erfüllen und das Kind bei sich aufnehmen. Doch dann taucht die schöne, kühle Sybill auf, die mit dem Jungen auf geheimnisvolle Weise verbunden ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Jahrelang hat der dreizehhnjährige Philip auf der Straße gelebt und sich mit Diebsthl, Einbruch und Prostitution über Wasser gehalten. Als ihn das Ärzteehepaar Stella und Ray Quinn adoptiert, ändert sich sein Leben auf einen Schlag: Von nun an lebt er in einer warmherzigen, fröhlichen Familie, mit zwei Brüdern, die ebenfalls adoptiert sind und aus ähnlichen Verhältnissen stammen, und darf endlich zur Schule gehen und etwas lernen. Siebzehn Jahre später — die Adoptiveltern sind mittlerweile beide gestobern — hat Phillip eine beachtliche Karriere hinter sich und arbeitet bei einer Werbeagentur. Ray hat seinen drei Söhnen ein ungewöhnliches Vermächtnis hinterlassen: Sie sollen sich um den zehnjährigen Seth kümmern, einen Jungen, der Phillip sehr an seine eigene schwierige Jugend erinnert. Gemeinsam kämpfen die drei Büder um das Sorgerecht für das Kind, denn sie wissen, dass Seths Mutter eher am Geld als an dem Jungen gelegen ist.
Da kommt die Bestsellerautorin Sybill in die Stadt, die eine geheimnisvolle Verbindung zu dem kleinen Seth hat. Sie will unbedingt verhindern, dass Seth von Phillip und seinen Brüdern adoptiert wird ...
Die Autorin
Nora Roberts zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen Amerikas. Seit 1981 hat sie über 200 Romane veröffentlicht, die in knapp 30 Sprachen übersetzt wurden. Für ihre internationalen Bestseller erhielt sie nich nur zahlreiche Auszeinchnungen,sondern auch die Ehre, als erste Frau in die Ruhmenshalle der Romance Writers of America aufgenommen zu werden. Nora Roberts lebt in Maryland.
Inhaltsverzeichnis
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem Wort ›Zuhause‹ verbinden wir die unterschiedlichsten Dinge. Kindern ein Zuhause zu bieten, kann gleichzeitig Herausforderung und Freude bedeuten. Die Glücklichen unter uns hegen lieb gewordene Erinnerungen an den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, mit seinen Traditionen und Gewissheiten. Der Roman Hafen der Träume handelt davon, sein Zuhause zu finden und es zu bewahren, für sich und die nächste Generation.
Durch Ray und Stella Quinn hat Phillip eine zweite Chance im Leben erhalten. Er hat nie vergessen, was diese zwei Menschen für ihn getan haben. Zusammen mit seinen Brüdern Cameron, Ethan und nun auch Seth ist Phillip bemüht, das gemeinsame Zuhause der Kindheit zu erhalten und ein Versprechen einzulösen, das er dem Mann gegeben hat, den er liebt. Phillip genießt sein Leben in Baltimore, die Museen, die Restaurants und die vielfältigen Begegnungen, aber er wird das gegebene Versprechen halten, auch wenn er seine Zeit aufteilen muss zwischen der Stadt und einem kleinen Ort an der Küste von Maryland, wo er Boote baut und einen Jugendlichen bei seinen Schulaufgaben betreut.
Ein Zuhause für seine Söhne, für alle seine Söhne, das hatte Ray schaffen wollen. Um dieses Versprechen zu halten und das gemeinsame Zuhause zu bewahren, muss Phillip den Jungen akzeptieren, den Ray in sein Leben und das seiner Brüder gebracht hat, und er bekommt es mit einer attraktiven Frau zu tun, deren Geheimnis das Leben aller Quinns verändern wird. Diese Frau braucht Phillips Vertrauen und sein Herz.
Um den Namen ihres Vaters rein zu waschen und ein Versprechen zu halten, das ihnen heilig ist, arbeiten die Quinns zusammen und beweisen, dass sie eine wirkliche Familie sind, zusammengeführt durch das Schicksal und die Großherzigkeit eines außergewöhnlichen Elternpaares.
Nora Roberts
Für Elaine und Beth, die in schwesterlicher Hingabe verbunden sind, auch wenn sie keine Spitzenkleider tragen oder brave Lieder singen.
PROLOG
Phillip Quinn starb im Alter von dreizehn Jahren. Da das überarbeitete und unterbezahlte Personal in der Notfallaufnahme des Baltimore City Hospital ihn jedoch nach neunzig Sekunden ins Leben zurückholte, war er nicht lange tot.
Für Phillip dauerte der Zustand lange genug.
Was ihn – für kurze Zeit – tötete, waren zwei Geschosse vom Kaliber 25, durch das geöffnete Seitenfenster eines gestohlenen Toyota Celica abgefeuert aus irgendeinem billigen Gewehr. Abgedrückt hatte ein guter Freund, soweit ein dreizehnjähriger Dieb auf den heruntergekommenen Straßen von Baltimore überhaupt jemanden für seinen Freund halten kann.
Die Kugeln verfehlten sein Herz nur knapp. Aber zum Überleben hatte es gerade gereicht, dachte Phillip später.
Das junge kräftige Herz, das auf traurige Weise abgestumpft war, schlug noch und pumpte sein Blut über die benutzten Kondome und Crackampullen in der stinkenden Gosse an der Kreuzung zwischen Fayette und Paca Road.
Der Schmerz hatte sich wie Spitzen scharfer Eiskristalle in seine Brust gebohrt. Es war ein gemeiner Schmerz, der ihn hinderte, in die alles auslöschende Bewusstlosigkeit zu versinken. Phillip lag hellwach auf dem Straßenpflaster und hörte die Schreie anderer Opfer und unbeteiligter Zeugen, kreischende Bremsen, das Geräusch startender Motoren und sein eigenes abgerissenes Keuchen.
Gerade eben hatte Phillip ein paar Elektronikgeräte an einen Hehler verkauft, die Beute aus einem Einstieg im dritten Stock, keine vier Blocks von hier. Mit den zweihundertfünfzig Dollar in der Tasche war er die Straße entlanggeschlendert, auf der Suche nach einem Dealer für ein Päckchen Heroin, das ihm die Nacht durchzustehen half. Phillip kam frisch aus dem Jugendgefängnis, wo er neunzig Tage Arrest abgesessen hatte, für einen anderen Einbruchdiebstahl, der mies gelaufen war. Deswegen brauchte er jetzt Bares.
Dann schien das Glück ihn verlassen zu haben.
Später würde er sich daran erinnern, dass er nur noch gedacht hatte: Scheiße, tut das weh, verdammt weh! Offenbar war er ins Schussfeld geraten. Die Kugeln hatten gar nicht ihm gegolten. In den wie in Zeitlupe ablaufenden drei Sekunden, bevor die Schüsse losgingen, hatte Phillip die Farben der Gang aufblitzen sehen. Es waren die Farben seiner eigenen Leute, einer der vielen Banden in der Stadt. Manchmal zog Phillip mit ihnen durch die Straßen und Gassen der City.
Wäre er nicht gerade aus dem Knast gekommen, hätte Phillip sich kaum an der besagten Straßenecke sehen lassen. Man hätte ihn gewarnt, er solle sich fern halten, und er läge jetzt nicht blutend am Boden, mit dem Gesicht auf dem schmutzigen Gitter eines Abflussschachts.
Lichtblitze zuckten, blau, rot und weiß. Grelles Sirenengeheul übertönte das Geschrei der Menschen. Polizei. Durch den klebrigen Nebel, in den ihn der Schmerz hüllte, spürte Phillip seinen Fluchtinstinkt erwachen. Im Geist sprang er auf, der behände und verschlagene Straßenjunge, und verschmolz mit den Schatten der Nacht. Doch bereits der Gedanke an diese Anstrengung trieb ihm kalten Schweiß ins Gesicht.
Phillip spürte eine Hand an seiner Schulter, und tastende Finger bewegten sich, bis sie den schwachen Puls an seiner Halsschlagader fanden.
Der hier atmet noch. Holen Sie die Sanitäter.
Jemand drehte ihn auf den Rücken. Phillip spürte einen unsäglichen Schmerz. Er wollte schreien, aber der Schrei in seinem Kopf löste sich nicht, wurde nicht zum Geräusch. Verschwommen sah er Gesichter über sich. Der harte Blick eines Polizisten streifte ihn, und er sah die grimmig entschlossene Miene des Unfallretters. Phillips Augen brannten von dem roten, blauen und weißen Licht. Jemand weinte. Das Schluchzen klang hoch und klagend.
Halt durch, Kleiner.
Warum? wollte er fragen. Warum durchhalten? Es tat weh, am Leben zu sein. Er würde dem Elend nie entkommen, auch wenn er sich selbst das Versprechen gegeben hatte, es eines Tages zu schaffen. Was von ihm noch übrig war, floss als rote Lache in den Rinnstein. Und alles, was er vorher sein Leben genannt hatte, war hässlich und abstoßend gewesen. Geblieben war ihm nur der Schmerz.
Wozu also der verdammte Unsinn?
Für eine Weile schwanden Phillip die Sinne, und er sank unter die Schmerzgrenze, hinab in eine dunkle, schmutzig rote Welt. Von ferne drang Sirenengeheul zu ihm, er spürte Druck auf seiner Brust und die ruckartige Bewegung, als der Rettungswagen losraste.
Dann wurde es wieder hell. Grelles weißes Licht drang durch seine geschlossenen Lider. Und er schwebte, während um ihn herum von allen Seiten Rufe ertönten.
Schussverletzungen, Brust. Blutdruck achtzig zu fünfzig, fallend. Puls flach und schnell. Setzt aus. Kommt wieder. Pupillen gut. Blutgruppe bestimmen. Wir brauchen Aufnahmen. Auf drei. Schnell.
Phillip schien unwillkürlich in die Höhe zu schnellen, dann sackte er wieder zusammen. Alles war ihm gleichgültig geworden. Selbst das schmuddelige rote Licht hatte sich in Grau verwandelt. Ein Schlauch wurde in seinen Schlund geschoben, aber Phillip versuchte nicht einmal mehr, sich durch Husten dagegen zu wehren. Er spürte den Fremdkörper kaum. Überhaupt spürte er kaum noch etwas, und dafür dankte er Gott.
Blutdruck sinkt. Wir verlieren ihn.
Verloren war ich schon immer, dachte Phillip.
Mit geringem Interesse beobachtete er das halbe Dutzend grün gekleideter Menschen in dem kleinen Raum. Sie standen um den hoch gewachsenen blonden Jungen versammelt, der auf einem Tisch lag. Überall war Blut. Sein Blut, erkannte Phillip. Er war es, der auf diesem Tisch lag, mit geöffneter Brust. Distanziert und gleichzeitig voller Sympathie blickte Phillip an sich herab. Keine Schmerzen mehr. Das ruhige Gefühl der Erleichterung ließ ihn beinahe lächeln.
Dann schwebte er höher hinauf, bis die Szene unter ihm mattweiß zu verschwimmen begann und die Geräusche nur noch Echos zu sein schienen.
Plötzlich durchfuhr ihn ein Schmerz. Die Gestalt auf dem Tisch bäumte sich auf, wie unter Schock. Phillip wollte sich entziehen, aber seine Gegenwehr war kurz und zwecklos. Er befand sich wieder in seinem Körper. Das Empfindungsvermögen kehrte zurück und damit die Verlorenheit.
Als Nächstes erinnerte sich Phillip, dass er, halbbetäubt dahindämmernd, seine Umgebung wie durch einen Schleier wahrnahm. Jemand schnarchte. Im Zimmer war es dunkel, und er lag auf einem schmalen, harten Bett. Durch eine mit Fingerabdrücken verschmierte Glasscheibe drang Licht herein. Geräte piepsten und gaben regelmäßige saugende Töne von sich. Um den Geräuschen zu entkommen, ließ sich Phillip erneut in die Tiefe sinken.
Zwei Tage dauerte der Schwebezustand. Er hatte sehr viel Glück gehabt. So sagte man ihm jedenfalls. An seinem Bett standen eine hübsche Krankenschwester mit müden Augen und ein Arzt, schmallippig und mit ergrautem Haar. Phillip glaubte ihnen kein Wort. Nicht, solange er sich sogar zu schwach fühlte, den Kopf zu heben, und ihn alle zwei Stunden mit der Verlässlichkeit eines Uhrwerks erneut dieser brüllende Schmerz überfiel.
Als die beiden Bullen hereinkamen, lag er wach, und seine Schmerzen waren durch Morphium gemildert. Dass es Polizisten waren, erkannte Phillip auf den ersten Blick. Trotz der Betäubungsmittel funktionierten seine Instinkte gut genug, dass er den Gang, das Schuhwerk und den Ausdruck ihrer Augen einordnen konnte. Den Blick auf die Erkennungsmarken, die sie ihm hinhielten, sparte er sich.
»Krieg ich ’ne Zigarette?« Diese Frage stellte Phillip jedem, der ins Zimmer kam. Der Nikotinmangel machte sich als ständig bohrende Gier bemerkbar, dabei wusste Phillip nicht einmal, ob er überhaupt fähig war, auch nur einen Zug zu machen.
Der erste Beamte setzte ein onkelhaftes Lächeln auf und trat neben das Bett. »Du bist zu jung zum Rauchen.«
Aha, der gute Bulle, dachte Phillip müde. »Ich werde mit jeder Minute älter.«
»Du kannst froh sein, dass du noch lebst.« Das Gesicht des zweiten Polizisten blieb hart, als er sein Notizbuch aus der Tasche zog.
Er war der böse Bulle, beschloss Phillip. Die Beobachtung amüsierte ihn beinahe.
»Das kriege ich die ganze Zeit zu hören. Was, zum Henker, ist denn passiert?«
»Das wollen wir von dir erfahren.« Der böse Bulle hielt den Stift über die aufgeschlagene Seite seines Notizbuches.
»Man hat mich mit ’ner Knarre niedergeschossen, verdammt.«
»Was hattest du in dieser Straße zu suchen?«
»Ich war auf dem Weg nach Hause.« Phillip hatte bereits entschieden, wie er seine Rolle spielen wollte, und schloss die Augen. »Genau kann ich mich nicht erinnern. Ich kam … aus dem Kino?« Er hob die Stimme, als stellte er sich die Frage selbst, und öffnete die Augen wieder. Der böse Bulle nahm ihm das offenbar nicht ab, aber was sollten die beiden machen?
»Welchen Film hast du gesehen? Wer war bei dir?«
»Hören Sie zu, ich weiß es nicht. Alles ist durcheinander. Ich ging über die Straße, und im nächsten Moment lag ich da, mit dem Gesicht am Boden.«
»Sag uns einfach, woran du dich erinnerst.« Der gute Polizist legte eine Hand auf Phillips Schulter. »Lass dir Zeit.«
»Es ging alles so schnell. Ich hörte Schüsse … wenigstens glaube ich, dass es Schüsse waren. Jemand schrie, und mir war, als würde mein Brustkorb explodieren.« Das kam der Wahrheit ziemlich nahe.
»Hast du den Wagen gesehen? Konntest du erkennen, wer geschossen hat?«
Beide Fragen bohrten sich in sein Gehirn, so als träfe Säure auf Stahl. »Ich glaub’, ein Auto hab’ ich gesehen … dunkle Farbe. Ganz kurz.«
»Du gehörst zu den Flames?«
Phillips Blick wanderte zu dem bösen Bullen. »Ich hänge manchmal mit ihnen rum, ja.«
»Drei der Leichen, die von der Straße gekratzt wurden, waren Leute von den Tribes. Sie hatten weniger Glück als du. Zwischen den Flames und den Tribes gibt es eine Menge böses Blut.«
»Kann sein.«
»Du hast zwei Kugeln abgekriegt, Phil.« Der gute Bulle legte sein Gesicht in Betroffenheitsfalten. »Ein paar Zentimeter weiter, und du wärst auf der Stelle tot gewesen. Du siehst aus, als hättest du Verstand. Ein gewitzter Bursche wie du wird doch nicht glauben, er müsste Arschlöchern die Treue halten.«
»Ich habe nichts gesehen.« Es war keine Frage der Treue. Hier ging es ums nackte Überleben. Wenn er sich weich kochen ließ, war er tot.
»Du hattest über zweihundert Dollar in der Tasche.«
Phillip zuckte mit den Achseln. Er bereute die Bewegung prompt, denn seine Schmerzgeister regten sich wieder. »Na und? Damit könnte ich immerhin die Rechnung in diesem Luxushotel bezahlen.«
»Werd’ bloß nicht frech, kleine Ratte.« Der böse Polizist beugte sich über das Bett. »Typen von deiner Sorte kriege ich jeden Tag zu sehen. Ihr seid keine vierundzwanzig Stunden draußen, und schon liegt ihr in der Gosse und verblutet.«
Phillip zeigte keine Regung. »Ist es ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen, niedergeschossen zu werden?«
»Woher hast du das Geld?«
»Ich kann mich nicht erinnern.«
»Du warst im Drogenbezirk, um dir Stoff zu besorgen.«
»Haben Sie Drogen bei mir gefunden?«
»Vielleicht. Du würdest dich ja doch nicht daran erinnern, oder?«
Gut gekontert, dachte Phillip. »Zum Henker, im Augenblick könnte ich was von dem Zeug gebrauchen.«
»Jetzt entspann dich erst mal.« Der gute Bulle verlagerte das Gewicht auf den anderen Fuß. »Hör zu, mein Junge. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, schließen wir einen ehrlichen Handel mit dir. Du warst oft genug Kunde bei den Behörden und weißt Bescheid, wie das System funktioniert.«
»Wenn das System wirklich funktionieren würde, wäre ich jetzt nicht hier, klar? Ich habe alles durchgemacht. Mir könnt ihr nichts mehr bieten. Lieber Gott, wenn ich gewusst hätte, dass da etwas lief, wär ich doch nie an der Ecke aufgekreuzt.«
Ein plötzlicher Aufruhr im Vorraum lenkte die Aufmerksamkeit der Polizisten ab. Phillip schloss lediglich die Augen. Er erkannte die bittere, zornig erhobene Stimme sofort.
Stinkbesoffen, war sein einziger Gedanke. Als die Frau ins Zimmer torkelte, machte Phillip die Augen wieder auf und stellte fest, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.
Sie hatte sich für den Besuch fein gemacht. Ihr gelbblondes Haar war toupiert und mit Haarspray gefestigt, außerdem hatte sie reichlich Make-up aufgelegt. Unter der dicken Farbschicht mochte sie eine hübsche Frau sein, aber die Schminke ließ ihre Züge hart und maskenhaft erscheinen. Ihre Figur war noch immer gut. Brauchte sie fürs Geschäft, diesen Körper. Und für Stripperinnen, die sich auf dem Strich etwas dazuverdienen wollten, war eine gute Verpackung wichtig. In ein knappes Oberteil und enge Jeans gezwängt, kam sie mit zehn Zentimeter hohen Absätzen ans Bett gestöckelt.
»Was glaubst du, wer das hier bezahlen soll, zum Teufel? Mit dir habe ich nichts als Ärger.«
»Hallo, Mam. Freut mich auch, dich zu sehen.«
»Werd’ bloß nicht frech. Wegen dir hatte ich die Bullen vor der Tür. Mir steht’s bis hier.« Seine Mutter warf einen kurzen Blick auf die beiden Männer, die rechts und links neben dem Bett standen. Wie ihr Sohn Phil, erkannte auch sie Polizisten sofort. »Er ist fast vierzehn. Ich bin fertig mit ihm. Dieses Mal wird er nicht zurückkommen. Ich habe keine Lust mehr. Dauernd die Polizei auf der Matte und das Jugendamt im Nacken.«
Phils Mutter schüttelte die Krankenschwester ab, die hinter ihr ins Zimmer geeilt war und sie beim Arm fasste. Dann beugte sie sich über das Bett. »Warum bist du nicht einfach abgekratzt?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Phillip ruhig. »Versucht hab’ ich’s.«
»Du hast noch nie zu was getaugt.« Phils Mutter zischte den guten Bullen an, der sie vom Bett zurückzog. »Verdammt, das ist die Wahrheit. Untersteh dich, bei mir aufzukreuzen, wenn sie dich hier rauslassen und du eine Bleibe suchst«, schrie sie, während man sie aus dem Zimmer zerrte. »Mit dir bin ich fertig.«
Phillip lag da und hörte, wie seine Mutter fluchte, schrie und Dokumente verlangte, die sie unterzeichnen konnte, um ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Dann blickte er zu dem guten Bullen auf. »Und Sie meinen, Sie können mir Angst machen? So geht das, seit ich denken kann. Schlimmer kann’s für mich nicht mehr werden.«
Zwei Tage später betraten zwei Fremde das Krankenzimmer. Der Mann war ein Hüne mit leuchtend blauen Augen und einem breiten Gesicht. Die Frau hatte wirres rotes Haar, das aus ihrem unordentlichen Nackenknoten quoll, und ihr Gesicht war voller Sommersprossen. Sie nahm die am Fußende hängende Krankenkarte, überflog die Daten und tippte mit der Karte gegen ihre Handfläche.
»Hallo, Phillip. Ich bin Dr. Stella Quinn. Das hier ist mein Mann Ray.«
»Ja, und?«
Ray zog einen Stuhl an die Bettkante und nahm behaglich seufzend Platz. Den Kopf zur Seite geneigt, warf er Phillip einen kurzen prüfenden Blick zu. »Du hast dich ganz schön reingeritten, was? Willst du raus aus dem Schlamassel?«
KAPITEL 1
Phillip löste den Windsorknoten seiner Fendi-Krawatte. Es war jedes Mal eine lange Fahrt von Baltimore an die Küste von Maryland, und er hatte sein CD-Gerät entsprechend programmiert, zuerst ein paar sanfte Klänge mit Stücken von Tom Petty und den Heartbreakers.
Der dichte Verkehr am Donnerstagabend war so zähflüssig wie im Radio gemeldet. Der Nieselregen tat sein Übriges, ebenso die Schaulustigen, die mit gereckten Hälsen aus den Seitenfenstern spähten, um sich den Unfall auf dem Baltimore Beltway, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren, nicht entgehen zu lassen.
Endlich befand sich Phillip auf der Route 50 nach Süden, doch selbst die wilden Beats der guten alten Stones konnten seine Stimmung nicht heben.
Phillip hatte Arbeit mitgenommen und musste über das Wochenende irgendwie Zeit für seinen Kunden Myerstone Tire herausschinden. Die Reifenfirma verlangte ein völlig neues Werbekonzept von ihm. Angenehme Fahrt auf sicheren Reifen, dachte Phillip und trommelte auf dem Lenkrad den Rhythmus von Keith Richards fetzigem Gitarrensolo mit.
War natürlich Blödsinn, dieser Spruch. Niemand würde behaupten, bei Nieselregen und im dichten Feierabendverkehr eine angenehme Fahrt zu haben, ganz gleich, auf welchen Reifen er über die Straße rollte.
Aber Phillip musste ein Slogan einfallen, der den Verbrauchern das Gefühl gab, Myerstone-Reifen machten glücklich, sicher und sexy. Werbetexte erfinden war sein Beruf, und er gehörte zur Spitze.
Wenigstens reichte es, um bei Innovations, einer noblen und erfolgreichen Werbefirma, vier wichtige Kunden zu betreuen, sechs kleinere Projekte zu überwachen und sich scheinbar mühelos um alles gleichzeitig zu kümmern. Die Firma erwartete von ihren Angestellten Kompetenz, Leistung und Kreativität.
Er wurde dafür bezahlt, dass er die Dinge im Griff behielt.
Wenn er allein war, geriet er manchmal ins Schwitzen.
Seit Monaten lud Phillip sich mehr auf, als er tragen konnte. Ein harter Schicksalsschlag hatte genügt, um ihn aus seiner selbstzufriedenen Existenz zu reißen, in der sich alles um das Wohlergehen von Phillip Quinn gedreht hatte. Jetzt fragte er sich des Öfteren, was aus seinem unbeschwerten Yuppieleben in der City geworden war.
Der Tod seines Vaters vor sechs Monaten hatte Phillips Leben völlig auf den Kopf gestellt. Ein Leben, das Ray und Stella Quinn vor siebzehn Jahren in Ordnung gebracht hatten. Die beiden waren in das trostlose Krankenhauszimmer gekommen und hatten ihm eine Chance geboten und eine Wahl. Phillip hatte gewählt, denn er war klug genug gewesen zu begreifen, dass es für ihn eigentlich keine Wahl gab.
Wieder auf der Straße zu leben lockte ihn nicht mehr, seit die Kugeln seinen Brustkorb durchsiebt hatten. Zu seiner Mutter konnte er auch nicht gehen. Selbst wenn sie ihre Meinung änderte und ihm gnädig erlaubte, in die enge, schäbige Wohnung zurückzukehren – die Behörden würden ihn unter strenger Kontrolle halten, und kaum wäre er wieder auf den Beinen, hätten sie ihn bereits erneut eingebuchtet.
Phillip hatte weder vor, im Jugendknast zu landen, noch zu seiner Mutter zurückzukehren oder wieder auf der Straße zu leben. So viel stand fest. Was er brauchte, war etwas Zeit, um einen Plan auszuarbeiten.
Im Augenblick verhalfen ihm ausgezeichnete Medikamente zu dieser Ruhepause, und er hatte diese Medikamente weder kaufen noch stehlen müssen. Allerdings war abzusehen, dass ihm diese Annehmlichkeit nur für begrenzte Zeit gewährt würde.
Unter der Wirkung des Beruhigungsmittels, das wohlig durch seinen Körper floss, taxierte Phillip die Quinns verschlagen von oben bis unten und tat sie als zwei schwachsinnige Weltverbesserer ab. Das kam ihm gerade recht. Wenn es die beiden glücklich machte, sich als Samariter zu betätigen und ihn aufzunehmen, bis er wiederhergestellt war, schön für sie – und für ihn.
Die Quinns erzählten ihm, sie besäßen ein Haus am Ostufer der Chesapeake Bay. Für ein Kind aus der City von Baltimore lag dieser Ort am Ende der Welt. Aber ein Tapetenwechsel könnte nicht schaden. Das Ehepaar hatte zwei Söhne in Phillips Alter. Zwei Schwächlinge, dachte er, die von diesen Weltverbesserern in die Welt gesetzt worden waren und mit denen er leicht fertig werden würde.
Bei ihnen gebe es feste Regeln, sagten die Quinns. Und eine gute Ausbildung sei wichtig. Das störte Phillip nicht. Er würde die Schule mit links schaffen, falls er sich entschloss hinzugehen.
Keine Drogen. Stellas kühler Ton bewirkte, dass Phillip sein Gegenüber erneut taxierte. Dann setzte er sein unschuldigstes Lächeln auf und antwortete höflich: Nein, Madam. Eine Bezugsquelle, wenn er Stoff brauchte, würde sich finden, selbst in einem verschlafenen Drecknest an der Bucht.
Dann beugte sich Stella über das Bett, einen unbestechlichen Ausdruck in den Augen und ein dünnes Lächeln auf den Lippen.
Du hast das Gesicht eines Engels, ein Gesicht wie auf einem Renaissance-Gemälde. Trotzdem bist du ein Dieb, ein Schläger und ein Lügner. Wir werden dir helfen, wenn du es willst. Aber behandle uns nicht, als wären wir Trottel.
Ray stimmte sein brüllendes Gelächter an, drückte Stellas Schulter und auch die von Phillip. Zu sehen, wie Stella und Phillip mit ihren Dickschädeln aneinander prallten, würde ein reines Vergnügen sein. Das hatte Ray gesagt, erinnerte sich Phillip später.
In den folgenden zwei Wochen kamen die Quinns mehrmals wieder. Phillip unterhielt sich mit ihnen und mit der Sozialarbeiterin, die wesentlich leichter einzuwickeln war als Quinn und seine Frau.
Zum Schluss holten sie Phillip aus dem Krankenhaus ab und nahmen ihn zu sich, in ihr hübsches kleines Haus am Wasser. Phillip lernte die beiden anderen Söhne kennen und versuchte, die Lage einzuschätzen. Als er erfuhr, dass Cameron und Ethan aus den gleichen Verhältnissen stammten wie er selbst, war er sicher: Die Quinns mussten völlig verrückt sein.
Phillip nahm an, dass er nur den richtigen Augenblick abwarten musste. Für eine Ärztin und einen Collegeprofessor besaßen die beiden nur wenige Wertgegenstände, die zu stehlen sich lohnte und die sich an einen Hehler weiterverkaufen ließen. Trotzdem kundschaftete er aus, was zu holen war.
Aber statt die Quinns auszurauben, gewann er sie lieb. Er nahm ihren Namen an und verbrachte die nächsten zehn Jahre seines Lebens in dem Haus an der Chesapeake Bay.
Als Stella starb, ging mit ihr ein wichtiger Teil von Phillips Welt für immer dahin. Sie war für ihn zur Mutter geworden, eine Mutter, die er sich nie hätte träumen lassen: verlässlich, stark, liebevoll und unbestechlich. Phillip trauerte um sie. Der Tod seiner Adoptivmutter war der erste wirkliche Verlust in seinem Leben. Um die Trauer wenigstens teilweise zu vergessen, stürzte er sich in Arbeit. Das College durchlief er im Eiltempo, machte einen glänzenden Abschluss – und begann seine Karriere bei Innovations.
Er wollte schnell nach oben, hatte Phillip sich damals vorgenommen.
Den Ortswechsel nach Baltimore, als er die Stelle bei Innovations antrat, empfand Phillip als einen kleinen persönlichen Triumph. Er kehrte in die Stadt seines Elends zurück, aber als gemachter Mann. Niemand, der Phillip in seinem Maßanzug sah, würde auf die Idee kommen, einen ehemaligen Bandenkriminellen, Drogenhändler und Strichjungen vor sich zu haben.
Alles, was Phillip in den vergangenen siebzehn Jahren an Gutem widerfahren war, konnte er auf den Augenblick zurückführen, als Stella und Ray Quinn sein Krankenhauszimmer betreten hatten.
Dann war Ray plötzlich gestorben, und sein Tod hinterließ dunkle Schatten, die noch erhellt und geklärt werden mussten. Der Mann, dem Phillips ganze Liebe gegolten hatte als wäre er sein leiblicher Vater, starb an den Folgen eines Autounfalls. Auf gerader Strecke und am helllichten Tag war sein Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Telefonmast geprallt.
Wieder ein Krankenzimmer. Dieses Mal lag der Große Quinn zerschmettert im Bett, über Schläuche mit einer Maschine verbunden, die geräuschvoll für ihn atmete. Zusammen mit seinen Brüdern hatte Phillip ihm ein Versprechen gegeben. Sie würden sich um den letzten Herumtreiber kümmern, noch einen Verlorenen, den Ray Quinn in die Familie aufgenommen hatte, und dafür sorgen, dass der Junge bleiben konnte.
Doch um diesen Jungen gab es Geheimnisse, und seine Augen glichen den Augen von Ray.
In der Hafengegend von St. Christopher, einem kleinen, am östlichen Ufer der Chesapeake Bay gelegenen Ort in Maryland, tuschelte man hinter vorgehaltener Hand von Ehebruch, Selbstmord und Skandal. Phillip hatte den Eindruck, dass er und seine Brüder der Wahrheit keinen Schritt näher gekommen waren, seit die Gerüchte vor sechs Monaten begonnen hatten. Wer war Seth DeLauter, und in welcher Beziehung stand er zu Raymond Quinn?
Noch ein Herumtreiber? Einfach ein halbwüchsiger Junge, der in dem üblen Sumpf von Vernachlässigung und Gewalt beinahe versunken wäre und den Ray aufgenommen hatte? Oder steckte mehr dahinter? War Seth ein Quinn nicht nur der Umstände wegen, sondern von Geburt?
Mit Sicherheit stand für Phillip nur fest, dass der zehnjährige Seth sein Bruder war. Genau wie Cam und Ethan seine Brüder waren – und die Brüder von Seth. Sie alle waren aus einem Albtraum erlöst worden und hatten die Chance zu einem neuen Leben erhalten.
Für Seth konnten Ray und Stella diesen Weg nun nicht mehr offen halten.
Ein Teil von Phillip, den es immer schon gegeben hatte, sogar in seinen schlimmsten Zeiten als jugendlicher Dieb und Herumtreiber, wehrte sich hartnäckig, auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Seth der leibliche Sohn von Ray sein könnte, bei einem Ehebruch gezeugt und anschließend schamhaft verleugnet. Das käme einem Verrat an allem gleich, was ihn die Quinns durch ihr lebendiges Vorbild gelehrt hatten.
Phillip war voller Selbstverachtung, wenn dieser Gedanke auftauchte oder sein kühler prüfender Blick auf Seth ruhte und er sich fragte, ob die Existenz des Jungen der Grund für Rays Tod sein könnte.
Wann immer ihm dieser furchtbare Verdacht kam, verlagerte er seine Konzentration auf Gloria DeLauter. Seths Mutter war die Frau, die Professor Raymond Quinn der sexuellen Belästigung bezichtigt hatte. Sie behauptete, der Vorfall liege Jahre zurück und habe sich damals ereignet, als sie an der Universität studierte. Aber es gab keinerlei Beweis dafür, dass sie jemals dort eingeschrieben war.
Dieselbe Frau hatte ihren zehnjährigen Sohn an Ray verkauft, als wäre der Junge eine Ware, die sich zu Geld machen ließ. Phillip war sicher, dass es sich bei der Frau, die Ray in Baltimore aufgesucht hatte, ebenfalls um Gloria DeLauter handelte – und auf der Rückfahrt hatte er den Unfall, an dessen Folgen er starb.
Sie war auf und davon. Frauen wie Gloria DeLauter schafften es immer, im richtigen Moment zu verschwinden. Vor einigen Wochen hatte sie den Quinns einen ziemlich unverblümten Erpresserbrief geschrieben: »Wenn Sie den Jungen behalten wollen, brauche ich mehr Geld.« Phillip presste die Kiefern zusammen. Er erinnerte sich an die nackte Angst, die in Seths Augen stand, als der Junge von dem Brief seiner Mutter erfuhr.
Sie würde den Jungen nicht wieder in ihre Fänge bekommen, gelobte sich Phillip. Gloria DeLauter würde schnell begreifen, dass die Quinn-Brüder ein härteres Kaliber waren als der weichherzige alte Quinn.
Nicht nur die Quinn-Brüder, dachte Phillip, als er in die schmale Landstraße einbog, die ihn seinem heimatlichen Ziel näher brachte. Gloria DeLauter hatte es mit einer richtigen Familie zu tun. Phillips Gedanken wanderten weiter, während links und rechts der Straße Felder mit Sojabohnen, Erbsen und übermannshohem Mais vorbeiflogen. Cam und Ethan waren verheiratet, und so standen Seth zwei entschlossene Frauen zur Seite.
Verheiratet. Phillip schüttelte amüsiert und ungläubig den Kopf. Wer hätte das gedacht? Cam hatte sich die attraktive Sozialarbeiterin geangelt. Ethan hatte die sanftäugige Grace geheiratet und war sofort Vater der engelgesichtigen Aubrey geworden, sann Phillip weiter.
Wie schön für alle. Phillip musste zugeben, dass Anna Spinelli und Grace Monroe wie für seine Brüder geschaffen waren. Wenn demnächst die Anhörung wegen der Erteilung des ständigen Sorgerechts für Seth stattfand, würde die Position der Quinns durch Anna und Grace als neue Familienmitglieder nur gestärkt werden. Außerdem schien Cam und Ethan das Eheleben zu bekommen. Phillip dagegen wurde es schon ganz anders, wenn er dieses Wort nur hörte.
Er zog das Leben als Single vor. Nicht, dass er in den vergangenen Monaten viel Zeit gehabt hätte, seine Freiheit zu genießen. Die Wochenenden verbrachte er in St. Christopher, mit der Betreuung von Seths Hausaufgaben, der Arbeit auf der neu gegründeten Werft Boats by Quinn, mit der Buchführung für das junge Unternehmen, mit Lebensmittelgroßeinkäufen – irgendwie war alles an ihm hängen geblieben. Von einem flotten Junggesellenleben in der Stadt konnte keine Rede mehr sein.
Phillip hatte seinem Vater auf dem Totenbett versprochen, sich um Seth zu kümmern. Er und seine Brüder waren übereingekommen, an die Küste von Maryland zurückzukehren, um gemeinsam die Verantwortung für Seth zu übernehmen. Folglich musste Phillip seine Zeit und seine Energie zwischen Baltimore und St. Christopher aufteilen, um einerseits seinen Beruf – und sein Einkommen – zu behalten und andererseits für seinen neuen und oft schwierigen Bruder sowie für das junge Bootsbau-Unternehmen da zu sein.
Viele Risiken auf einmal. Bei der Erziehung eines zehnjährigen Jungen wären selbst unter günstigsten Bedingungen gelegentliche Kopfschmerzen und Anfangsfehler unvermeidlich. Und im Fall von Seth DeLauter, der bei einer Gelegenheitsprostituierten und Amateurerpresserin aufgewachsen war, die den ganzen Tag unter Drogen stand, konnte von günstigen Umständen kaum die Rede sein.
Damit die Werft in Schwung kam, mussten unzählige Einzelheiten beachtet werden, die in Phillips Aufgabenbereich fielen. Und im Bootsbau war wirklich Knochenarbeit gefordert. Doch irgendwie lief das Geschäft. Wenn Phillip vom unmäßigen Aufwand an Zeit und Energie absah, konnte man sogar zufrieden sein.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte er seine Wochenenden noch mit attraktiven interessanten Frauen verbracht. Er ging mit ihnen essen, in die besten Restaurants, die gerade gefragt waren, mit anschließendem Theater- oder Konzertbesuch, und wenn die Chemie stimmte, war ein gemütliches Frühstück am Sonntagmorgen im Bett inbegriffen.
Bald würde er dieses Leben wieder führen, versprach er sich. Sobald die Einzelheiten geregelt waren, würde er seine Gewohnheiten wieder aufnehmen. Aber, wie sein Vater sagen würde, für die nächste Zeit …
Phillip bog in die Zufahrt ein. Der Regen hatte aufgehört, und die Feuchtigkeit glänzte auf den Blättern und Grashalmen. Langsam kroch die Dämmerung heran. Das Licht aus dem Wohnzimmer fiel als weicher gelber Schein nach draußen. Ein paar von den Sommerblumen, die Anna liebevoll gepflegt hatte, blühten noch immer, und im Schatten erkannte Phillip die ersten Herbstblumen, die in schimmernden Farben ihre Knospen öffneten. Er hörte den Welpen bellen. Mit neun Monaten war Foolish allerdings schon zu groß und kräftig, um noch als Welpe zu gelten.
Heute Abend war Anna mit dem Kochen an der Reihe, fiel ihm ein. Gott sei Dank. Wenn Anna kochte, stand bei den Quinns ein richtiges Essen auf dem Tisch. Phillip lockerte die Schultern und überlegte, ob er sich ein Glas Wein genehmigen sollte. In diesem Augenblick schoss Foolish um die Ecke, auf der Jagd nach einem schmutzigen gelben Tennisball.
Phillip stieg aus. Foolish bemerkte ihn, offensichtlich in seinem Spiel abgelenkt. Mitten im Lauf blieb der Hund stehen, die Vorderpfoten auf den Boden gestemmt, und bellte wild drauflos, als wäre er zu Tode erschrocken.
»Idiot.« Lächelnd nahm Phillip seinen Aktenkoffer aus dem Geländewagen.
Beim vertrauten Klang seiner Stimme wechselte der Hund von wütendem Gebell zu überschwänglichem Freudengeheul. Foolish sprang hoch, mit verzücktem Blick und schlammnassen Pfoten. »Nicht anspringen!« schrie Phillip, den Aktenkoffer wie ein Schutzschild vor sich haltend. »Wirst du wohl gehorchen! Sitz!«
Foolish zuckte, senkte aber das Hinterteil und hob anschließend eine Pfote. Seine Zunge hing heraus, und er sah Phillip mit glänzenden Augen an. »Guter Hund«, lobte Phillip. Vorsichtig nahm er die schmutzige Pfote und kraulte Foolish das seidenweiche Fell hinter den Ohren.
»Hallo.« Seth schlenderte über den Vorplatz. Seine Jeans waren fleckig vom Herumtollen mit dem Hund, und seine Baseballkappe saß schräg auf dem Kopf, so dass die strohblonden glatten Haare an einer Seite heraussahen. Das Lächeln kam dem Jungen sehr viel leichter und schneller auf die Lippen als noch vor wenigen Monaten, stellte Phillip fest. Aber es enthüllte eine Lücke.
»Hallo.« Phillip tippte an den Schirm der Baseballkappe. »Hast du etwas verloren?«
»Hmm?«
Phillip wies auf seine eigenen geraden Zähne von makellosem Weiß.
»Ach, das.« Mit dem für alle Quinns typischen Schulterzucken grinste Seth und schob seine Zunge durch die Lücke. Das Gesicht des Jungen war voller als noch vor sechs Monaten, und seine Augen blickten weniger misstrauisch. »Der Zahn saß locker. Musste ihn rausreißen vor ein paar Tagen. Hat schweinemäßig geblutet.«
Phillip sparte sich die Mühe, wegen Seths Ausdrucksweise zu seufzen. Für manche Dinge fühlte er sich einfach nicht zuständig. »Und hat die Zahnfee dir einen Wunsch erfüllt?«
»Red kein Blech.«
»Eines sage ich dir, Mann. Wenn du Cam keinen Dollar abgeluchst hast, bist du nicht wert, dass ich dich Bruder nenne.«
»Also gut. Ich habe zwei Dollar rausgeschlagen. Einen von Cam, den anderen von Ethan.«
Phillip lachte und schlang einen Arm um Seths Schulter. »Von mir bekommst du nichts mehr. Ich habe dich durchschaut«, sagte er und wandte sich zum Haus. »Wie war die erste volle Schulwoche?«
»Langweilig.« Eigentlich stimmte das nicht, gab Seth insgeheim zu. Die Schule war aufregend. Das ganze neue Zeug, das Anna mit ihm eingekauft hatte – ordentlich angespitzte Bleistifte, blütenweiße Schulhefte, Füllfederhalter mit vollen Tintenpatronen. Die Akte-X-Lunchbox hatte er abgelehnt. Nur ein Blödmann ging mit so einem Ding auf die Mittelschule. Immerhin, sich im Laden darüber lustig zu machen, war cool gewesen.
Seine Klamotten waren auch cool, und er hatte tolle Turnschuhe bekommen. Aber das Beste war, dass er zum ersten Mal in seinem Leben nach den großen Sommerferien, die im Juni begonnen hatten, in die gleiche Schule zurückkehren würde und die Kinder in seiner Klasse kannte.
»Hausaufgaben?« fragte Phillip mit erhobenen Brauen, als er die Haustür öffnete.
Seth rollte die Augen. »Mann, kannst du eigentlich an nichts anderes denken?«
»Junge, Hausaufgaben sind mein Leben. Vor allem deine.« Foolish stürmte vor Phillip durch die Tür und rannte ihn vor Begeisterung beinahe um. »Dem Hund musst du noch einiges beibringen.« Aber seine Gereiztheit verschwand sogleich. Er schnupperte. Auf dem Herd köchelte Annas Tomatensauce, und der köstliche Duft stieg ihm in die Nase. »Gottes Segen sei mit uns«, murmelte er.
»Manicotti«, teilte Seth ihm mit.
»Ach? Für diesen Anlass habe ich noch einen Chianti aufgehoben.« Phillip stellte den Aktenkoffer beiseite. »Die Bücher sind erst nach dem Essen dran.«
In der Küche stand seine Schwägerin und füllte Teigröllchen mit Käse. Die Ärmel ihrer tadellosen weißen Bürobluse waren hochgekrempelt, und über dem blauen Rock trug sie eine lange weiße Küchenschürze. Sie hatte ihre hochhackigen Schuhe ausgezogen und tanzte barfuß zu einer Arie, die sie summte. Carmen, erkannte Phillip. Annas wunderbare, dichte schwarze Locken waren hoch gesteckt.
Phillip blinzelte Seth zu und trat hinter sie, umfasste ihre Taille und drückte ihr einen geräuschvollen Kuss auf den Scheitel. »Lass dich entführen. Wir ändern unseren Namen. Dann bist du Sophia, und ich bin Carlo. Komm mit mir ins Paradies, wo du nach Herzenslust kochen kannst, nur für mich allein. Hier gibt es nur Bauernlümmel, und keiner weiß deine Künste so wie ich zu schätzen.«
»Ich fülle nur noch dieses eine Teigröllchen, Carlo. Dann packe ich meine Sachen.« Anna wandte sich um, und ihre dunklen, südländischen Augen lachten. »In einer halben Stunde gibt es Abendessen.«
»Ich entkorke die Weinflasche.«
»Und jetzt kann man nichts zu essen bekommen?« wollte Seth wissen.
»Im Kühlschrank steht Antipasto«, erklärte Anna. »Bedien dich.«
»Ach, nur Gemüse und so’n Fraß«, beschwerte sich Seth, als er die Platte herauszog.
»Genau.«
»O Mann.«
»Wasch dir die Hände, bevor du isst. Du hast den Hund angefasst«, sagte Anna.
»Hundespeichel ist sauberer als der von Menschen«, klärte Seth sie auf. »Ich habe gelesen, dass es gefährlicher ist, von einem Menschen gebissen zu werden als von einem Hund.«
»Toll, was du alles weißt. Und jetzt wasch dir den Hundespeichel von den Händen.«
»Mann.« Angewidert schlurfte Seth aus der Küche, und Foolish schlich hinter ihm her.
Phillip wählte den Wein aus einem kleinen Vorrat, den er in der Speisekammer angelegt hatte. Guter Wein gehörte zu seinen Leidenschaften, und sein Gaumen war außergewöhnlich anspruchsvoll. In seiner Wohnung in Baltimore besaß er eine große und sorgfältig zusammengestellte Sammlung, die er in einem von ihm speziell für diesen Zweck umgebauten Schrank aufbewahrte.
Hier an der Küste mussten sein geliebter Bordeaux und der Burgunder den Platz mit Reiswaffeln und Schachteln voller Puddingpulver teilen.
Phillip hatte sich mit diesem Zustand abgefunden.
»Wie war deine Woche?« fragte er Anna.
»Anstrengend. Jeder, der behauptet, Frauen könnten alles haben, sollte erschossen werden. Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen ist mörderisch.« Sie blickte mit strahlendem Lächeln auf. »Und ich finde es einfach wunderbar.«
»Wie man sieht.« Phillip zog gekonnt den Korken, schnupperte daran und nickte anerkennend, bevor er die Flasche auf den Küchentresen stellte, damit der Wein atmen konnte. »Wo ist Cam?«
»Müsste von der Werft unterwegs nach Hause sein. Er und Ethan wollten eine Extraschicht einlegen. Das erste von Boat by Quinn gebaute Schiff ist zur Auslieferung bereit. Morgen kommt der Eigner. Das Boot ist fertig, Phillip.« Anna strahlte vor Stolz und Freude. »Zu Wasser gelassen, seetüchtig und einfach fantastisch.«
Phillip spürte einen kleinen Stich der Enttäuschung, dass er am letzten Tag nicht auf der Werft gewesen war. »Darauf sollten wir mit Champagner anstoßen.«
Mit hochgezogenen Brauen studierte Anna das Etikett auf der Weinflasche. »Folonari, Ruffino?«
Anna hatte eine Vorliebe für guten Wein. Das war eine der Eigenschaften, die Phillip besonders an ihr mochte. »Fünfundsiebziger Jahrgang«, erwiderte er mit breitem Lächeln.
»Von mir wirst du keine Beschwerden hören. Meinen Glückwunsch für das erste Boot, Mr. Quinn.«
»Das ist nicht mein Verdienst. Ich habe mich nur um den Kleinkram gekümmert und war gerade gut genug für die Sklavenarbeit.«
»Natürlich ist es dein Verdienst. Kleinkram ist auch wichtig. Weder Cam noch Ethan haben dein Geschick, damit fertig zu werden.«
»Ich glaube, sie nennen es herumnörgeln.«
»Sie brauchen jemanden, der genau aufpasst. Und ihr drei solltet stolz auf das sein, was ihr in den letzten Monaten geleistet habt. Nicht nur in der neuen Firma, sondern auch, was die Familie angeht. Jeder von euch hat für Seth etwas aufgegeben, das ihm viel bedeutete. Und ihr alle habt etwas dafür zurückbekommen.«
»Ich hätte nie geglaubt, dass der Junge uns so viel bedeuten würde.« Während Anna die gefüllten Teigröllchen mit Sauce übergoss, holte Phillip Weingläser aus dem Küchenschrank. »Es gibt immer noch Augenblicke, in denen mir die ganze Sache zum Hals heraushängt.«
»Das ist völlig normal, Phillip.«
»Das macht es aber nicht besser für mich.« Phillip zuckte geringschätzig mit den Schultern und schenkte zwei Gläser Wein ein. »Aber meistens, wenn ich unseren kleinen Bruder ansehe, denke ich, wir hätten es schlechter treffen können.«
Anna verteilte geriebenen Käse auf das Nudelgericht. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Phillip das Glas an die Nase hob und das Bouquet genoss. Er sieht gut aus, dachte sie. Mit seinem kräftigen, vollen und bronzefarbenen Haar und mit Augen, die eher golden als braun schimmerten, war er für sie beinahe das Idealbild männlicher Schönheit. Das Gesicht lang und schmal, mit nachdenklichem Ausdruck. Sinnlich und engelhaft zugleich. Sein hoch gewachsener, wohlgeformter Körper schien wie für italienische Anzüge geschaffen. Doch Anna hatte Phillip mit entblößtem Oberkörper gesehen, nur mit einer Jeans bekleidet. An ihm war nichts Weiches.
Kultiviert, gebildet, zäh, gewieft. Ein interessanter Mann, wenn man sie fragte.
Anna schob die Kasserolle in den Backofen, drehte sich um und hob das Weinglas. Lächelnd stieß sie mit Phillip an. »Mit dir als großem Bruder haben wir es auch nicht schlecht getroffen, Phillip.«
Sie beugte sich vor und gab ihm einen leichten Kuss. In diesem Moment kam Cam herein.
»Nimm deinen Mund von meiner Frau.«
Phillip lächelte nur und schlang den Arm um Annas Taille. »Sie hat damit angefangen. Sie mag mich nämlich.«
»Mich mag sie lieber.« Zum Beweis schob Cam eine Hand hinter Annas Schürzenknoten, wirbelte sie zu sich herum, in seine Arme, und küsste sie bis zur Besinnungslosigkeit. Dann knabberte er grinsend an ihrer Unterlippe und tätschelte gönnerhaft ihr Hinterteil. »Stimmt’s, Liebste?«
Anna war noch immer schwindlig. »Scheint so.« Sie atmete aus. »Alles in allem.« Dann entwand sie sich. »Du bist ja ganz dreckig.«
»Bin nur gekommen, um ein Bier zu holen, das ich mit unter die Dusche nehmen kann.« Er schlenderte zum Kühlschrank, groß und schlank, dunkel und gefährlich. »Und um meine Frau zu küssen«, fügte er mit einem selbstgefälligen Blick auf Phillip hinzu. »Schaff dir selbst eine an.«
»Woher die Zeit nehmen, Mann?« gab Phillip trübsinnig zurück.
Nach dem Abendessen und einer Stunde, die er sich mit Divisionsrechnung, den Schlachten des Sezessionskrieges und Fremdsprachenvokabeln auf Fünftklässlerniveau um die Ohren geschlagen hatte, zog sich Phillip mit Laptop und Kundenakten auf sein Zimmer zurück.
Es war derselbe Raum, den ihm Ray und Stella zur Verfügung gestellt hatten, als sie ihn zu sich nahmen. Damals waren die Wände blassgrün gestrichen. Als Phillip sechzehn war, hatte er die Farbe aus einer plötzlichen Laune heraus in Magentarot geändert. Der Himmel mochte wissen warum. Er erinnerte sich, wie seine Mutter – denn mittlerweile betrachtete er Stella als seine Mutter – einen Blick hineingeworfen und ihn gewarnt hatte, er werde an unheilbaren Verdauungsstörungen erkranken.
Phillip hielt die Farbe für sexy. Ungefähr drei Monate lang. Dann wechselte er für eine Weile zu kaltem Weiß, unterbrochen von deprimierenden, schwarz gerahmten Fotografien.
Immer stilbewusst und auf Ambiente bedacht, überlegte Phillip jetzt, belustigt über sich selbst. Kurz bevor er nach Baltimore zog, war er zu dem sanften Hellgrün zurückgekehrt.
Seine Eltern hatten vermutlich von Anfang an Recht gehabt. So war es meistens.
Sie hatten ihm dieses Zimmer in diesem Haus und an diesem Ort gegeben. Phillip hatte es ihnen nicht leicht gemacht. In den ersten drei Monaten hatte es ständig Machtkämpfe gegeben. Phillip hatte Drogen ins Haus geschmuggelt, sich auf Prügeleien eingelassen, Alkohol gestohlen und war abends betrunken zur Tür hereingetorkelt.
Heute war ihm klar, dass er die Quinns getestet hatte, ob sie ihn nach diesen Provokationen hinauswerfen würden. Macht nur weiter, hatte er gedacht. Mit mir werdet ihr nicht fertig. Mich kriegt ihr nicht.
Aber sie kriegten ihn. Und sie kriegten noch mehr. Sie machten den Menschen aus ihm, der er heute war.
Eines frage ich mich, Phillip, hatte sein Vater gesagt. Warum willst du alles wegwerfen, deinen wachen Verstand und deinen gesunden Körper? Sollen die Dreckskerle denn wirklich gewinnen?
Damals hatte Phillip einen entsetzlichen Kater, von zu viel Alkohol und Drogen. Sein Hals fühlte sich rau an, und der Schädel drohte ihm zu zerspringen. Aber was Ray sagte, kümmerte ihn einen Dreck.
Ray nahm ihn in seinem Boot mit auf einen Segeltörn. Der frische Wind würde ihm das Gehirn durchpusten, sagte er. Krank vor Übelkeit stand Phillip über die Reling gebeugt und erbrach die Reste der giftigen Substanzen, mit denen er sich am Abend zuvor voll gepumpt hatte.
Zu dem Zeitpunkt war er gerade vierzehn geworden.
Ray verankerte das Boot in einer engen Bucht. Er hielt Phillips Kopf, wischte ihm das Gesicht sauber und bot ihm eine Dose mit kaltem Ingwerbier an.
»Setz dich.«
Phillip sackte förmlich zusammen. Seine Hände zitterten, und beim ersten Schluck aus der Dose verkrampfte sich sein Magen. Ray saß ihm gegenüber, die riesigen Hände ruhten auf den Knien, und das Silberhaar wehte in der leichten Brise. Mit seinen leuchtend blauen Augen sah er ihn an, ruhig und nachdenklich.
»Du hattest jetzt einige Monate Zeit, um dich hier einzuleben. Stella sagt, körperlich hast du dich vollkommen erholt. Du bist stark und kerngesund. Aber das wird nicht so bleiben, wenn du so weitermachst wie bisher.«
Phillip schob die Lippen vor und sagte einen langen Moment gar nichts. Im hohen Gras stand ein Reiher, reglos wie auf einem Gemälde. Die spätherbstliche Luft war frisch und klar. Durch die Äste der bereits kahlen Bäume strahlte der tiefblaue Himmel. Der Wind spielte mit den Grashalmen und riffelte die Wasserfläche.
Der Mann blieb sitzen, offenbar vollkommen zufrieden mit der Stille und dem Augenblick. Der Junge ließ die Schultern sinken, blass und mit einem harten Ausdruck in den Augen.
»Dieses Spiel können wir endlos weitertreiben. Es gibt viele Arten, Phil«, sagte Ray schließlich. »Da wäre die knallharte Tour. Wir legen dich an die kurze Leine, haben immer ein Auge auf dich, und wenn du versuchst, uns zu hintergehen, kriegst du Druck. Was dann meistens der Fall wäre.«
Bedächtig hob Ray seine Angelrute und heftete mit gespielter Gleichgültigkeit ein Marshmallow als Köder an den Haken. »Oder wir erklären das Experiment für gescheitert, und du gehst zurück in den Jugendknast.«
Phillips Magen drehte sich um. Er musste schlucken, um das Gefühl niederzukämpfen, das er nur widerstrebend als Angst wahrnahm. »Ich brauche Sie nicht. Ich brauche niemanden.«
»O doch.« Ray sprach leise und ließ die Leine ins Wasser fallen. Auf der Oberfläche breiteten sich endlose Kreise aus. »Wenn du in den Knast zurückgehst, wirst du dort bleiben. Noch ein paar Jahre in die gleiche Richtung, und dann heißt es nicht mehr Jugendfürsorge. Dann teilst du deine Zelle mit richtigen Verbrechern, Typen von der Sorte, die auf ein hübsches Gesicht wie deines nur gewartet haben. Eines Tages wird dich irgendein muskelstrotzender Zwei-Meter-Kerl unter der Dusche mit seinen breiten Pranken packen und vernaschen.«
Phillip gierte verzweifelt nach einer Zigarette. Das von Ray heraufbeschworene Bild trieb neue Schweißperlen auf seine Stirn. »Ich kann selbst auf mich aufpassen.«
»Junge, sie werden dich wie eine Platte mit Appetithäppchen herumreichen. Das weißt du so gut wie ich. Du hast ein flinkes Mundwerk, und mit den Fäusten bist du auch nicht ungeschickt, aber manche Dinge geschehen einfach. Bis jetzt war dein Leben ziemlich miserabel. Daran trägst du keine Schuld. Aber für alles, was von nun an geschieht, bist du selbst verantwortlich.«
Wieder schwieg Ray. Die Angelrute zwischen die Knie geklemmt, holte er in aller Gemütsruhe eine Dose Cola aus dem Kühlfach und riss die Lasche auf. Dann setzte er die Dose an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck.
»Stella und ich glaubten etwas in dir zu erkennen«, fuhr er fort und sah Phillip noch immer an. »Das tun wir auch immer noch. Aber solange du es nicht selbst siehst, ist alles vergebens.«
»Was kümmert Sie das eigentlich?« Phillip warf gequält den Kopf in den Nacken.
»Schwer zu sagen, im Augenblick. Vielleicht bist du es gar nicht wert und landest wieder auf der Straße, als kleiner Gauner und Dieb.«
Seit drei Monaten hatte Phillip ein ordentliches Bett, bekam regelmäßig zu essen und konnte – eine geheime Leidenschaft von ihm – alle Bücher lesen, die ihn interessierten. Bei dem Gedanken, dies wieder zu verlieren, wurde seine Kehle erneut eng, doch er zuckte mit den Schultern. »Ich werde mich schon durchschlagen.«
»Du hast die Wahl, falls du nicht mehr willst. Aber hier kannst du ein Zuhause haben und eine Familie. Du bekommst die Chance, aus dir und deinem Leben etwas zu machen. Natürlich kannst du auch den Weg weitergehen, auf dem du jetzt bist.«
Ray streckte die Hand nach Phillip aus. Der Junge stählte sich für den erwarteten Schlag und ballte die Fäuste zur Abwehr. Doch Ray zog nur Phillips Hemd hoch und entblößte die blassen Narben auf seiner Brust. »Du kannst dorthin zurück«, sagte er ruhig.
Phillip sah Ray in die Augen und erkannte darin Mitgefühl und Hoffnung. Und er sah sich selbst blutend am Boden liegen, im Schmutz am Straßenrand, in einer Gegend, in der ein Menschenleben weniger wert war als die billigste Portion Rauschgift.
Von Übelkeit gepackt, erschöpft und von Angst gepeinigt ließ Phillip den Kopf auf die Hände sinken. »Was für einen Sinn hat das alles?«
»Der Sinn bist du, Junge.« Ray fuhr mit der Hand über Phillips Haar. »Du bist der Sinn.«
Der Wandel hatte sich nicht von einem Tag auf den anderen vollzogen, dachte Phillip. Aber eine Veränderung war eingetreten. Es gelang seinen Eltern, ihm den Glauben an sich selbst zurückzugeben. Die Schule zu besuchen und zu lernen wurde für ihn zu einer Frage der Ehre. So erschuf er sich neu als Phillip Quinn.
Wie es schien, hatte er gute Arbeit geleistet. Er hatte dem Straßenjungen eine tadellose äußere Hülle verpasst, eine glanzvolle Karriere, eine bestens ausgestattete Eigentumswohnung mit traumhaftem Blick auf den Inner Harbor, das aufgeputzte Zentrum von Baltimore, und in seinem Kleiderschrank hing eine seinem Status angemessene Garderobe.
Anscheinend schloss sich nun der Kreis. Er verbrachte seine Wochenenden wieder in dem grün gestrichenen, praktisch eingerichteten Zimmer, dessen Fenster auf die Bäume und das Sumpfland hinausgingen.
Doch dieses Mal handelte es um Seth. Jetzt war Seth der Sinn.
KAPITEL 2
Phillip stand auf dem Vordeck der Neptune’s Lady. Das Schiff war fertig. Es musste nur noch getauft werden. Von der ersten Konstruktionszeichnung bis zur endgültigen Form hatte er mit eigenen Händen an die zweitausend Stunden schweißtreibender Arbeit geleistet. Jetzt waren die Decks aus Teakholz auf Hochglanz poliert, und das ganze Schiff blitzte in der gelben Septembersonne.
Phillips Gedanken wanderten weiter, unter Deck, in die Kabine – beste Zimmermannsarbeit, hauptsächlich Cams Werk und sein ganzer Stolz. Die Einbauten waren aus echtem Holz, auch sie auf Hochglanz poliert. Alles Handarbeit, individuell nach Kundenwunsch ausgeführt, mit aufklappbaren Kojen für vier Personen.
Das Schiff war solide, dachte er, und eine Schönheit. Ästhetisch ansprechend mit seinem Rumpf wie aus einem Guss, den glänzenden Decks und der langen Kiellinie. Ethans frühzeitige Entscheidung, das Spantgerüst aus im Dampf gebogenem Holz zusammenzusetzen, hatte ihnen viel zusätzliche Arbeit beschert, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Das Schiff war ein Juwel.
Der medizinische Fußspezialist aus Washington D.C. würde für jeden Zentimeter einen happigen Preis zu zahlen haben.
»Und …?« fragte Ethan, die Hände in den Taschen seiner verwaschenen Jeans und genüsslich in die Sonne blinzelnd.
Phillip fuhr mit der Hand über die satinglatte Oberfläche des Dollbords. Es hatte ihn viele Stunden Schweiß gekostet, die Planken an diesem Teil des Schiffes mit
Titel der OriginalausgabeINNER HARBOR
Deutsche Erstausgabe 5/2000
18. Auflage
Copyright © 1999 by Nora Roberts
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH www.heyne.de
Mitarbeit an der Übersetzung: Ulrike Laszlo Redaktion: Verlagsbüro Dr. Andreas Gößling und Oliver Neumann GbR Umschlagillustration: Stone/Laurence Monneret, München Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
eISBN 978-3-641-09184-2
www.randomhouse.de
Leseprobe





























