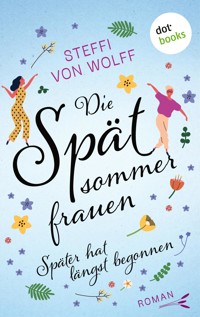Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ich, mein Mann und sein Segelboot – Ein Buch über Segelabenteuer zu dritt Die meisten Segler haben ihre große Liebe schon früh gefunden: das Segeln und, wenn alles gut läuft, sogar das eigene Segelboot. Erfolgsautorin Steffi von Wolff ist in genau so eine Beziehung hineingerutscht. Nach glücklicher Hochzeit mit einem Segelbootbesitzer stellt sie fest: Mein Mann liebt eine andere. Und hat gar nicht vor, sie aufzugeben. Aber anstatt zu verzweifeln, lässt sie sich auf eine fröhliche Dreiecksbeziehung ein: Ich, mein Mann und sein Segelboot. Die Seglerkolumne aus dem YACHT-Magazin – endlich als Buch Die lustigsten Segelabenteuer aus dieser Dreiecksbeziehung erzählt Steffi von Wolff, u.a. Autorin von Aufgetakelt und Fremd küssen, in ihrer beliebten Kolumne in der Segel-Zeitschrift YACHT. Die besten Artikel daraus gibt es in diesem Buch – mit viel (Selbst-)Ironie und großem Wiedererkennungswert aus dem Seglerleben, vom Hafenkino über Meinungsverschiedenheiten zwischen Skipper (er) und Crew (sie) bis hin zur ewigen Hassliebe zu den Liegeplatznachbarn. Das beste Seglerbuch für die Zeit bis zum nächsten Törn • die lustigsten Glossen aus Steffi von Wolffs Kolumne in der YACHT • perfekte Unterhaltung für Segelanfänger und erfahrene Skipper • ideales Geschenk für alle Vollblut-Segler (und ihre Partner) • humorvolle, pointierte Beschreibung der amüsantesten Situationen und Typen aus der Seglerwelt Hafenkino ist der neue Barawitzka für segelnde Paare – und alle, die es noch werden wollen. Leinen los!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Mann.Gibt’s denn heute noch ein Getränk?
INHALT
1 – Gelitten, gelernt, geliebt
2 – Wie die Eigner Nordwand!
3 – Männer außer Kontrolle
4 – Leute, die man erschlagen möchte
5 – Willkommen in unserem Hafen!
6 – Suleika und die harten Männer
7 – Gemeinsam statt einsam
8 – Glaub mir, das wird schön
9 – Stell dich nicht so an!
10 – Im Winter besuchen wir euch
11 – IKEA für Männer
12 – Die Alte von der ALTEN
13 – Manöver des letzten Augenblicks
14 – Einfach nur Generve
15 – Zu viel des Guten
16 – Na klar helfen wir dir
17 – Ich zeig euch, wie das geht
18 – Kreislauf des Lebens
Vor sechzehn Jahren hat alles angefangen. Damals lebte ich in Hessen und hätte im Traum nicht daran gedacht, mal auf ein Segelboot zu steigen. Ich kannte Tretboote auf Kurteichen und Ausflugsdampfer, die auf Rhein und Main fuhren. Mein Leben spielte sich mehr auf dem Land als auf dem Wasser ab, und ich habe nichts vermisst. Tja, und wie das Schicksal so spielt, bin ich dann zu meinem ersten Törn gekommen. Ahnungslos war ich, und der festen Überzeugung, dass es vor allem außerordentlich langweilig sein würde, tagelang auf einem Boot herumzudümpeln. Ich weiß noch, dass der Mann, den ich kurz zuvor kennengelernt hatte, mich fragte, ob ich mir das zutraue, mit ihm segeln zu gehen. Mehrere Wochen auch noch! Als Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, hart im Nehmen ist und vor nichts Angst hat außer vor Kugelblitzen und dem »Alien«-Filmen, habe ich ohne zu zögern zugesagt. Wenn ich daran zurückdenke, stehe ich vor ihm, strahle ihn an und sage …
»Natürlich komme ich mit.« Ich wäre wahrscheinlich auch mitgekommen, wenn er mit weißen Haien hätte tauchen gehen wollen. In meiner Fantasie sehe ich uns schon in kitschige Sonnenuntergänge segeln, ich sehe uns in lauwarmen Nächten auf dem Boot sitzen, Weißbrot mit Oliven essen und Weißwein trinken, ach, herrlich!
Er hat ein eigenes Boot, das imponiert mir schon. »Gut«, sage ich. »Ich komme mit. Wir machen uns eine schöne Zeit.« Es ist sehr aufregend, weil wir ja damit auch zum ersten Mal längere Zeit am Stück zusammen sein werden.
»Das ist toll.« Er ist begeistert.
»Ich kann dann leckere Sachen für uns kochen.« Das findet er fast noch toller. Essen war damals schon sehr wichtig. Der Zirkus beginnt bereits beim Packen. Ich bin es gewohnt, für jede Gelegenheit die entsprechende Kleidung dabeizuhaben. Man weiß ja nie, was kommt. Raimund Harmstorf, der Seewolf, könnte plötzlich vor mir stehen und mich fragen, ob ich mit ihm gemeinsam eine rohe Kartoffel zerquetschen möchte. Und was wäre, wenn die Segelyacht von König Carl Gustaf plötzlich neben unserem Boot vor Anker ginge? Ich konnte ja unmöglich Königin Silvia in einer alten Latzhose mit lustigen, zeitlosen Flicken begrüßen? Ganz sicher nicht!
Ich beschränke mich also auf drei Reisetaschen. Vielleicht waren es auch vier. Plus Beautycase.
Nach drei Stunden vorm Kleiderschrank rufe ich entnervt bei meinem Segler an und will wissen, ob Schuhspanner für Pumps an Bord seien oder ob ich meine mitbringen sollte. »Bist du verrückt? «, fragt er, und ich fürchte, er denkt das wirklich. Und dann sagt er den Satz, den er noch öfter in meiner Gegenwart sagen sollte: »Mir geht schon wieder die Pumpe, wenn ich so was höre.« Was ich denn mitbringen sollte?, frage ich schließlich. Ganz einfach:
Bequeme Kleidung, für den Landgang eine lange Hose und »feste Schuhe« (diesen Ausdruck habe ich schon immer gehasst). Dazu einen Pullover und eine Regenjacke. Die Betonung liegt auf »eine«. Ich beschränke mich also auf drei Reisetaschen. Vielleicht waren es auch vier. Plus Beautycase. Auf der Fahrt Richtung Boot muss ich mir theoretische Sicherheitsvorkehrungen anhören und denke zum ersten Mal: Hm. Was faselt er da die ganze Zeit über »Was macht man, wenn …«, denn: Was soll beim Segeln schon groß passieren? Gut, gut. Ich meine, wenn man über Bord geht, ruft man »Mayday« oder »Hallo« und wird halt wieder aufgefischt. Man kann sich auch anstellen und aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Vom Boot bin ich begeistert. Vom Namen nicht so. Es heißt ALTE. Da wollte er wohl witzig sein. Und ein Problem steht an: Ich muss erst mal hinaufkommen. Er sagt: »Das ist total einfach. Du musst dich nur am Vorstag festhalten, über den Bugkorb klettern, fertig. Jetzt mach doch bitte mal. Denk an meine Pumpe.« Es klappt bereits beim achten Versuch, in den sieben Versuchen vorher hüpfe ich unbeholfen auf dem Schwimmsteg herum.
Vom Boot bin ich begeistert. Vom Namen nicht so. Es heißt ALTE.
Ja, so war das damals. »Dann kannst du jetzt deine Sachen verstauen. Unten gibt es Schränke.« Die Mehrzahl hört sich doch schon mal ganz gut an. Theoretisch. In der Praxis waren es dann zwei. In einem befanden sich Öljacken, Jogginghosen und Overalls. Der zweite, kleinere Schrank war zehn Zentimeter breit. Gilt das überhaupt als Schrank? Ich schaffte es, zwei Kleider hineinzuhängen. Das Ende vom Lied war, dass ich sieben Achtel der Sachen wieder ins Auto packte. Mit mulmigem Gefühl, wegen Seewolf und Silvia und so.
Zur Feier des Tages machten wir einen Kneipenbesuch. Es war ja der erste Urlaubstag! Leider habe ich noch nie viel Alkohol vertragen. Die wiederholten Anmerkungen, ich solle mich zurückhalten, denn wir müssten am nächsten Morgen früh raus, ignorierte ich. Einer ging immer noch, denn schließlich: Mann, ich hatte Urlaub!
»Früh raus« heißt im Urlaub, dass ich mir gegen 10 oder 11 Uhr überlege, ob ich noch ein Stündlein weiterschlafe. Hier aber wurde ich um 5 Uhr wachgerüttelt. »Hättest du die Güte, aufzustehen?«, wurde gefordert. »Das Wasser läuft ab, da können wir nur jetzt noch aus der Ostemündung kommen. Wir sind eh spät dran. Kaffee koche ich vielleicht später.« Es gibt nichts Schöneres, als bei Nieselregen mit leerem Magen ein Boot aus dem Hafen zu bringen, um dann noch eine Ewigkeit unter Maschine Ruder zu gehen, bis man endlich die Segel setzen kann. Ohne Kaffee! Schönen Dank auch. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann … wäre ich wahrscheinlich trotzdem mitgefahren.
Der Wind steht gut, wir befinden uns im Fahrwasser der Elbe. Netter weise werde ich gleich voll in das Geschehen integriert. »Dirk den Großbaum mal an, damit ich leichter reffen kann. Vergiss aber nicht, den Baumniederholer zu lösen, und Wahrschau, der Großbaum!!!« »Ähh … was genau meinst du?«, Ich steuere galant durch die Elbe. Beflügelt von Sonne und Wind, werde ich immer sicherer an der Pinne. So sicher, dass ich direkt auf eine rote Tonne zusteuere, die ich aber nicht sehe, weil ich ja dauernd auf den Kompass schaue. Ein Unglück wird verhindert, indem mir der Mann meiner Träume einen Meter vor der Tonne das Ruder wegreißt. Und natürlich geht ihm wieder die Pumpe. Diesen Satz scheint er zu mögen. Wir fahren weiter.
Beflügelt von Sonne und Wind, werde ich immer sicherer an der Pinne.
Es ist schön. Bis der Wind stärker wird. Kurz vor Helgoland muss ich kübeln, während Trottellummen und Basstölpel über mir Kreise ziehen. Himmel, ist mir schlecht.
»Ist das nicht herrlich?«, fragt er mich. »Wenn alles erst mal draußen ist, geht’s einem doch besser.« Schönen Dank auch. Mir wird schon wieder übel. »Bitte nicht gegen den Wind spucken«, lautet sein Rat.
Während wir in Helgoland einlaufen, liege ich im Vorschiff, weil ich nicht mehr stehen kann. Und nicht mehr reden. Und nicht mehr leben.
»Oh, wir müssen im Päckchen liegen«, sagt er. Päckchen hörte sich gut an. So sicher. Wenn man »im Päckchen liegt«, ist das bestimmt sehr bequem. Als wir an Land gehen und ich feststelle, dass ich dazu über acht Boote klettern muss, finde ich Päckchen dann allerdings gar nicht mehr gemütlich.
Sehr viel später kann ich wieder etwas essen. Getrunken habe ich aber lieber an Bord. Denn bestimmt ist es nach drei Gläsern Wein nicht ohne, über acht Boote zu klettern. Ein agiler Mittvierziger macht es mir vor, indem er auf Boot Nummer drei das Gleichgewicht verliert und mit einem gutturalen Laut im Hafenbecken verschwindet. Als man ihn mit Leinen zurück an Bord zieht, klebt an ihm eine Bananenschale.
Unsere nächste Station ist Amrum. Hier merke ich zum ersten Mal, dass es plötzlich nicht mehr wichtig ist, ob die Haare anständig gefönt oder Nägel abgebrochen sind. Andere Prioritäten werden gesetzt – man freut sich schon darüber, wenn man zu den Duschen weniger als einen Kilometer laufen muss und die Waschmaschinen funktionieren.
Eigentlich ist alles so einfach. Ich merke, dass ich gar nicht so viel brauche wie sonst. Eine interessante Erfahrung. Sie gefällt mir.
Nach und nach klappt es immer besser mit dem Leben an Bord: Ich ziehe nach entsprechenden Erfahrungen automatisch den Kopf ein, wenn ich nach unten gehe; ich weiß, wo die Lebensmittelvorräte liegen (in der Bilge) und kann sogar Essen auf dem bordeigenen Herd zubereiten, ohne das Boot in einen offenen Grillplatz zu verwandeln. Wenn ich per Handy mit meinen Freundinnen in Hessen telefoniere, um beiläufig zu erwähnen, dass ich mich gerade auf dem Vorschiff sonne, aber gleich wieder nach achtern gehe, um dort wie immer um 15 Uhr den ersten Sherry des Tages zu mir zu nehmen, komme ich mir richtig toll vor. Fast see-erfahren. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich in den Mast hochgezogen wurde, um den Verklicker zu reparieren. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Lauter Dinge, von denen ich bis vor drei Wochen nicht mal wusste, dass es sie gibt! Aber jetzt: ist alles schön.
Die echte Katastrophe ereignet sich erst vor Sylt. Wir müssen kreuzen, was an sich schon entsetzlich genug ist, weil es länger dauert und ich Hunger habe, aber nicht runtergehen kann, weil mir dann schlecht wird. Das ist ein wirklicher Nachteil. Dass ich ständig angeblafft werde, ein weiterer. Wer sich an seinen ersten Törn erinnert, weiß, wovon ich spreche. Ich kann mir nicht alles merken und schon ganz sicher nicht den Sinn hinter »platt vor dem Laken«, »Vorsegel ausbaumen« oder »Patenthalsen« ergründen.
Dann passiert es: Der Großbaum kommt über. Er, der Mann, in den ich verliebt bin, befindet sich gerade auf dem Weg nach vorn, »um die Bullentalje anzuschlagen« und wird von einer kalten Aluminiummasse mitten ins Gesicht getroffen. Ich sehe nur noch seine Beine, der Oberkörper befindet sich schon weitgehend außenbords. Wenigstens bin ich so geistesgegenwärtig, ihn an der Hose festzuhalten. Und das Ruder.
Ich weiß nur noch, dass das Blut nicht aufhört zu fließen. Und er bleibt auch noch ganz cool und behauptet, alles sei nur halb so schlimm.
Sein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen, das Blut fließt in Strömen, doch das Ruder halte ich wohl irgendwie falsch, denn backbord (das ist links, wie ich gleich am ersten Tag gelernt hatte) hupt ein Fahrgastschiff, auf dessen Kurs wir geraten sind. Ich weiß bis heute nicht, was sich in den folgenden fünf Minuten abgespielt hat. Ich weiß nur noch, dass das Blut nicht aufhört zu fließen. Und er bleibt auch noch ganz cool und behauptet, alles sei nur halb so schlimm. Ich bestehe darauf, per Handy einen Notarztwagen zu bestellen, aber er meinte, die hätten Besseres zu tun, als wegen einer Platzwunde zu ihm an den Steg zu kommen. Außerdem würden dann alle Leute glotzen. Und gegen Krankenhäuser pflege er eine ausgeprägte Aversion. Ich rufe trotzdem dort an. Eine Sekunde später kollabiert er.
Irgendwie bekomme ich den Motor an, eiere dem Dampfer hinterher und formuliere mein Testament. Der Mensch, der unter mir liegt, ist nicht ansprechbar. Die Segel fliegen unkontrolliert herum und ich habe keine Ahnung, wie ich das Schiff in den Hafen von Hörnum bekommen soll. Trotzdem schaffe ich es. Als ich frontal in eine Steganlage krache, danke ich Gott und weiß seitdem, wie sich ein Schleudertrauma anfühlt.
Er erwacht aus seiner Ohnmacht, meckert – und muss natürlich erst mal das Boot richtig festmachen und schrubben. Vier Sanitäter stehen auf dem Anleger und beobachten das Ganze mit stoischer Gelassenheit. Irgendwann dauert es ihnen wohl zu lange, sie kommen an Bord und helfen. Dann, endlich, fahren wir ins Krankenhaus.
Es stellt sich heraus, dass die Nase gebrochen ist. Die Wunde muss mit sieben Stichen genäht werden. Seine einzige Sorge derweil: »Ist das Boot gut festgemacht?« Ob alle Segler so sind?
Ich überlege, ob wir den Törn abbrechen sollen (»Natürlich nicht!«). Ich resigniere und reise fortan mit einem Menschen weiter, dessen Gesicht aussieht, als ob ein Hornissenschwarm darüber hergefallen sei. Besonders nett sind die Verfärbungen rund um die Augen. Blauschwarz. Jedenfalls lernen wir ob dieses Zustandes viele Leute kennen, die uns allerdings immer das Gleiche fragen (»Gott, wie ist das denn passiert?«). Er fühlt sich großartig, wenn er die Geschichte in aller Ausführlichkeit ausbreitet. Hundertfünfzig Mal, schätzungsweise. Wobei sie von Mal zu Mal schlimmer wird.
Mit der Zeit stelle ich fest, dass ich tatsächlich im Prinzip nur ein Paar feste Schuhe, einen warmen Pullover, eine lange Hose und eine Regenjacke brauche. Alles andere gammelt nutzlos vor sich hin.
Und so segeln wir weiter und lassen es uns gut gehen. Es ist eine tolle Zeit.
Als wir nach vier Wochen wieder den Heimathafen einlaufen, sind meine Fingernägel abgesplittert, meine Haare haben mit ihrem ursprünglichen Zustand nichts mehr gemein, und was von meinen Kleidungsstücken noch übrig ist, gehört teilweise in die Altkleidersammlung. Es lohnt sich nicht mehr, all die Risse und Löcher zu flicken.
Ich lasse meine bisherigen Urlaube Revue passieren, vergleiche und stelle fest, dass Segeln anders ist. Klar, ich konnte mich früher auch dafür begeistern, in einem Robinson Club schon morgens in der Karibiksonne Champagner zu süffeln. Aber es ist eben nicht das, was ein wirkliches Erlebnis ausmacht.
Ich lasse meine bisherigen Urlaube Revue passieren, vergleiche und stelle fest, dass Segeln anders ist.
Ich springe auf den Steg (oh ja, das habe ich gelernt!). Und während ich die Leinen perfekt auf der Klampe belege, denke ich an den letzten Abend, an dem wir auf der Elbe vor Anker gegangen waren. Es hört sich sehr kitschig an, war aber tatsächlich genau so: Wir hatten einen Sonnen untergang genossen, »wie er im Buche steht«. Wir saßen mit einem guten Portwein im Cockpit, und plötzlich hatte ich dieses bestimmte Gefühl, diese Gewissheit, die man so selten hat: Das ist es. Genau das.
Ich verlasse das Boot nur sehr ungern. Es hat mir an nichts gefehlt, ich habe nichts vermisst. Nicht einmal den Seewolf oder Silvia.
Ein paar Wochen später ruft der Segler an, er habe ein Problem. Sein Kumpel hat den geplanten Törn kurzfristig absagen müssen. Er fragt, ob ich denn nicht Lust hätte, spontan einzuspringen. Na klar, antworte ich, nichts lieber als das. Sofort beginne ich, meine Klamotten zusammenzusuchen: ein Paar feste Schuhe, einen Pulli, bequeme Sachen, eine lange Hose für den Landgang, eine Regenjacke. Ratzfatz geht das. Und in nur eine Tasche.
Bootsbauer haben ihre Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Und sie machen ihre Arbeit meistens gut, auch keine Frage. Eins nur irritiert mich: Warum macht sich eigentlich keiner mal Gedanken darüber, dass man auch an Bord kommen muss?
Wenn ich noch einmal »Mach doch einfach einen großen Schritt« höre, werde ich zum Mörder. Ich kenne diesen Satz in jeder denkbaren Form: gelassen, sauer, zynisch, gezischt. Glücklicherweise gilt er gerade nicht mir, sondern – huch! – einem Mann! auf dem Boot schräg gegenüber. Mein Mann kommt erst morgen an Bord.
Wie eben: Jemand – in diesem Fall mal eine Frau – bellt Befehle und ihr Mann ist vorne und kommt nicht klar. Sonst sind ja oft die Frauen vorne und können sich mit den Problemen des Von-Bord-und-an-Bord-Kommens herumschlagen. Der Auf- und Abstieg, besonders auf den meisten neueren Schiffen, ist schlicht eine Zumutung. Die Boote werden immer voluminöser und vor allem hochbordiger, durch die senkrechten Steven sind lange Ankergalgen nötig, und offenbar denkt keiner daran, dass eben diese Konstellation höchst schwierig zu beklettern ist. Die Stege wachsen jas nicht mit, Schwimmstege schon gar nicht. Warum machen es einem manche Bootskonstrukteure so schwer? So viele Hindernisse! Von einem Vorstag wird man gehindert. Von einer Rollanlage. Von einem zweiten Vorsegel. Von einem Bugspriet. Von einem Anker. Im schlimmsten Fall von allem zusammen. Nichts zum Festhalten – und wenn dann noch der Wind das Boot zur Seite drückt, es regnet und alles rutschig ist, macht es noch mal mehr Spaß.
»Es fängt an zu regnen!«, ruft der Mann panisch. Die Frau antwortet: »Wir sind doch nicht aus Zucker.« Fast könnten das mein Mann und ich sein, nur umgekehrt. Lustig.
Wenn ich noch einmal »Mach doch einfach einen großen Schritt« höre, werde ich zum Mörder.
»Mach doch einfach einen großen Schritt«, kommt es wieder, aber er hängt nur da.
Während ich von der ALTEN aus nun voller Mitleid den armen Mann beobachte, dem es wie sonst mir geht, der also gebückt am Bug seines Schiffs steht und nicht runterkommt, werde ich mal wieder wütend auf die nicht nachdenkenden Konstrukteure.
Natürlich gibt es Menschen mit einem perfekt funktionierendem Gleichgewichtssinn, die noch nie ausgerutscht und gestürzt sind und auch keine Angst vor Verletzungen oder kaltem Wasser haben, aber es gibt mit Sicherheit genügend Leute – mich eingeschlossen – die einfach nicht mit traumwandlerischer Sicherheit auf ein und von einem Boot kommen. Beides kann sehr kompliziert sein, besonders, wenn man immer von Leuten zugebrüllt bekommt, dass man sich nicht so anstellen und einfach einen großen Schritt machen soll, man müsse ja schließlich nur ein Stück über die Ostsee und nicht über ein Salzwasserkrokodil klettern.
Jedes Mal, wenn ich durch einen Hafen gehe, schaue ich mir Boote an, und sehr oft muss ich den Kopf schütteln. Ein Meter lange Nasen, die um den hochstehenden Anker herum drapiert wurden. Der Bugkorb viel zu weit hinten. Vielleicht noch eine zweite Rollanlage, ein ausfahrbarer Gennakerbaum an Deck oder sonst irgendein Gedöns. Gern auch geschlossene Bugkörbe mit rechts und links je zwei Zentimetern Platz um das Vorstag herum, zum Draufklettern muss ein Zentimeter am Bug genügen, und wenn dann auch noch das Deck aus Kunststoff ist, rutscht man ja gern mal aus. Und weil die Steven so gerade sind, wird das Boot auch noch weiter vom Steg angebunden. Eine Abwärtsspirale, ein Teufelskreis, der Untergang des Abendlandes.
Oder auch: Das ist schlicht verbraucherunfreundlich.
Ich klettere von der ALTEN, was mittlerweile halbwegs gut geht, wenn sie dicht genug am Steg festgemacht wurde. Dann gehe ich rüber zu dem Mann, der zitternd und weiß im Gesicht vorne steht, und siehe: Es ist eins dieser Boote, die einfach entsetzlich sind. Langer Rüssel, wackelig, überall Stolperfallen, nichts Richtiges zum Festhalten und jetzt, der Regen wird langsam mehr, ideal, um sich schick das Steißbein zu prellen, von den Splittern auf dem Steg, die man sich unter die Fingernägel treibt, ganz zu schweigen.
»Kann ich Ihnen helfen?« Er schüttelt den Kopf. »Geht gleich wieder, oh …« Eine Windbö.
»Was ist denn nun?«, keift die Frau von hinten. »Was ist denn bloß dein blödes Problem?« Sie scheint die Situation zu genießen.
»Ist das peinlich«, wispert er verzweifelt und sieht sich um, so als ob er hoffen würde, dass ihn niemand erkennt. Ich verstehe ihn. Wenn alles rutscht und wackelt, ist die Ostsee kein Meer mehr, sondern ein bedrohlicher, gurgelnder Ozean, und im schlimmsten Fall bieten wir noch das beste Hafenkino für die anderen. Ringsum schießen bereits Köpfe hoch wie reifer Spargel.
»Ich verstehe Sie wirklich«, sage ich. »Das ist so beschissen konstruiert. Soll ich Ihnen von Bord helfen?«
»Nein, ist so weit weg. Hier ist’s so rutschig«, sagt der Mann.
»Sag ich doch«, bestätige ich und bin froh, einen Verbündeten gefunden zu haben. Die Frau bröselt hinten irgendwas. Ich ereifere mich: »Ich sage immer: Ist es denn zuviel verlangt, anständig und gern auch ohne Hilfe auf und von einem Boot zu kommen? Was spricht gegen eine weit nach vorn ragende Reling, die einem auch bei Regen sicheren Halt bietet, während man auf ein fest montiertes Stück Holz steigt, um bequem an Bord zu kommen! Sagen Sie doch mal. Das sind doch alles Schwachköpfe, diese Konstrukteure. Segeln die nie selbst? Was ist daran toll, ein Schiff so zu bauen, dass man auf gar keinen Fall ohne Probleme raufkommt? Ist das besonders cool? Ist es nicht. Ich habe schon Boote gesehen, da haben die Besitzer nachträglich im Selbstbau versucht, das Rauf- und Runterkommen halbwegs erträglich zu machen. Einer hatte ein Abwasserrohr mit Leinen als Aufstiegshilfe ans Boot geknotet, ein anderer die Reling mit Wanderstöcken verlängert, und auf einem Boot war vorne sogar eine Matratze festgenagelt! Warum denn bitte, wenn man doch nur einen großen Schritt machen muss? Geht es jetzt?«
Was ist daran toll, ein Schiff so zu bauen, dass man auf gar keinen Fall ohne Probleme raufkommt?
»Nein, mein Fuß hat sich verhakt. Oh, oh, es wackelt.«
»Geht es denn heute noch mal voran?«, ruft die Frau, die Leinen aufschießt.
»Auf Messen machen die das auch ganz geschickt«, rege ich mich weiter auf. »Da können die Leute immer bequem übers Heck aufs Schiff gehen. Und warum? Weil im Mittelmeer meistens mit dem Heck angelegt wird, wurde mir erklärt. Der Händler verkaufte aber Boote auf der Ostsee. In Flensburg. So ein Depp.«
»Mmpf«, macht der Mann, während eine Bö das Boot ein wenig zur Seite drückt.
»So ein Boot sollte doch ein zweites Zuhause sein – und daheim muss ich doch auch nicht erst mit einem großen Schritt über einen Fluss steigen und dann versuchen, durch das enge Gästeklofenster ins Haus zu kommen, oder? Jetzt sagen Sie doch mal.«
»Ja, sicher, ich … weiß auch nicht, ich mach es … oh je, oh je, es kippelt … ich bin nicht so oft auf Schiffen.«
Das Schiff ist aber auch weit weg vom Steg und in der Tat ein Paradebeispiel dafür, wie es komplizierter nicht geht. Noch nicht mal das Vorsegel ist eingerollt, es liegt einfach so auf dem Bug. Das Boot hat keine Reling, nichts. Es ist schmal, es ist wacklig, und nur am dünnen Draht des Vorstags kann sich der arme, arme Mann halten. Jetzt kommt seine Frau nach vorn. »Bist du immer noch nicht von Bord«, sagt sie. »Komisch. Es ist doch nur ein verdammter Schritt, oder? Ein einziger Schritt!« Ihre Stimme klingt giftig.
»Sie sind eine Giftspritze«, sage ich. »Schauen Sie sich doch mal Ihren Mann an! Er leidet, weil er nicht von Bord kommt, weil Sie es ihm schwermachen! Mir geht es ähnlich. Das ist für manche Leute einfach ein Riesenproblem. Ihr Mann ist am Ende mit seinen Nerven. Er kann gleich nicht mehr, und das nur, weil der idiotische Konstrukteur sich selbst verwirklichen wollte. So ein Vollidiot, so ein Lackaffe, so ein Bürohengst. Die kann man ja nicht ernst nehmen, diese Typen.«
»Hast du das gehört?«, fragt die Frau ihren Mann und muss lachen. »So. Nun zeig es den Schwachköpfen mal, den Lackaffen und geh von Bord. Es ist doch ganz einfach. So. Furchtbar. Einfach.«
Der Mann dreht sich um, sagt: »Gewonnen«, und geht gebückt nach hinten. Ich verstehe gar nichts und sehe die Frau fragend an.
»Er ist der Konstrukteur«, sagt sie freundlich. »Und ich glaube, bei seinen Konstruktionen wird sich demnächst sehr viel ändern, jetzt, wo er endlich mal gesehen hat, wie es ist.«
»Oh«, sage ich. »Ihnen geht es also normalerweise wie mir?«
Sie nickt. »Jahrelang hab ich mir den Zirkus anhören müssen, jetzt ist Schluss. Ich hab einfach mal den Spieß umgedreht.« Sie lacht mich an. »Manchmal geht’s halt nur mit kleinen Schritten. Lust auf einen Sherry?«
Später gehen wir noch am Strand spazieren. Ohne ihn. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, macht er erste Skizzen.
Den Winter empfinden viele Skipper als Zwangspause. Der eine mehr, der andere noch mehr. Ganze Schicksalsgemeinschaften bilden sich in den Bootshallen. Eine Eignersgattin über das alljährlich Unausweichliche.
Vor langer Zeit, als das Boot im Herbst zum ersten Mal aus dem Wasser kam und ich sah, was dabei passierte, da dachte ich: Es wird besser werden. Ganz bestimmt. Er wird sich daran gewöhnen, dass es im Winter nun mal kalt ist und man beim Segeln Frostbeulen bekommt. Und es irgendwann als gegeben hinnehmen.
Heute, viele Jahre später, weiß ich: Es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil: Es wird schlimmer. Und daran wird sich auch in den nächsten zwölf Jahren garantiert nichts ändern.
Die Trauerfeier fand wie in jedem Herbst statt. Den Kopf im Nacken, mit bebenden Lippen und in schwarzer Jacke stand mein offensichtlich emotional gebrochener Mann da und schaute gen Himmel. In seinen Augen schimmerten Tränen.
»Mach’s gut«, sagte er dann wie stets zu dieser Gelegenheit, und seine Stimme zitterte. In diesem Jahr dachte ich sogar, er würde sich mehrmals bekreuzigen, aber es stellte sich glücklicherweise heraus, dass er lediglich eine Fliege abgewehrt hatte.
Es ist immer dasselbe: Jedes Jahr im Oktober, sobald das letzte Segel und die letzte angebrochene Flasche Gin von Bord geholt wurde, wird das Boot gekrant und ins Winterlager gebracht. Der Leichenschmaus findet danach an der Schlei in einem Kappelner Restaurant statt. Bei Matjes »mit Hausfrauensoße« oder Jägerschnitzel beginnt das große Zählen der Tage, was auf einem Bierdeckel dokumentiert wird. »Der Oktober hat noch zwölf Tage, dann November bis mindestens Mitte März«, geht es los, nachdem das erste Pils vertilgt ist. »Das sind 12 Tage plus 30 plus 31 plus 31 plus 28 plus 15.« Das ist der Zeitpunkt, an dem ungefragt die Bedienung kommt und ihm einen Klaren bringt. »Das sind 147 Tage.« Schweigen. »Ein-hundert-und-sieben-und-vierzig Tage.«
Dann steht er auf, wankt Richtung Ausgang, weil er frische Luft braucht, und humpelt dabei wie ein Kriegsveteran, der seit 1945 mit einer schlechtsitzenden Prothese zu kämpfen hat. Ich bestelle derweil Kroketten nach. Die sind hier wirklich gut.
Die verbleibenden Oktobertage verbringt mein Mann stets in einer Mischung aus Melancholie – »Weißt du noch, der Sonnenuntergang in Ærøskøbing, als wir vorher mit diesen netten Leuten gegrillt haben? Sie war schwanger, er Lehrer« –, hilfloser Wut, wenn es nochmal warm wird und er Boote auf dem Wasser sieht – »Nächstes Jahr kommt das Schiff erst im Dezember raus!« – und der Feststellung von Tatsachen, auf die noch nie jemand vorher gekommen ist – »Nach dem Winter kommt ja der Frühling«, »Nach der Saison ist vor der Saison«.
Und da ist diese Trauer. Sie ist nicht gespielt, er kokettiert nicht damit, sie ist zweifellos echt.
Um das nachvollziehen zu können, brauchte ich einige Jahre. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus dem malerischen hessischen Wetteraukreis stamme. Der liegt nördlich von Frankfurt, und dort gibt es kleine pittoreske Rinnsale, auf denen man zehn Zentimeter lange, gefaltete Papierboote segeln lassen kann. Große Gewässer sind Kiesgruben oder Kurteiche und sehr große der Main und der Rhein. Wenn man allerdings auf einer Nordseeinsel geboren wurde und seit dem vierten Lebensjahr segelt, so wie mein Mann, ist der Main eine Pfütze. Und wenn es ginge, würde er nicht am, sondern im Wasser wohnen. Im Winter ist das im Norden Deutschlands allerdings schwierig.
Ich verstehe ihn. Es ist schön, auf dem Boot zu sein, es ist toll, am Freitagnachmittag im Hafen von Sønderborg anzukommen, das zu einer zweiten Heimat geworden ist, den ersten Gin Tonic zu trinken, sich über laute Liegeplatznachbarn aufzuregen und über Männercrews zu lachen, die gegen 22 Uhr und mit vier Promille aufgeblasene Gummipuppen in den Mast ziehen und dabei peinliche Shantys singen, in denen Möwen, das weite Meer und Frauen, die mit weißen Taschentüchern winken, eine tragende Rolle spielen.
Es endete damit, dass wir in der zugigen, unbeheizten Halle in Kappeln standen und das Unterwasserschiff bearbeiteten.
Und ja, die Wintermonate sind lang. Aber ich sehe das Ganze nun mal pragmatisch. Er nicht.«Wir können doch heute mal zum Boot fahren«, sagte mein Mann am ersten Novemberwochenende.
»Warum sollten wir?«, fragte ich und schaute nach draußen. Es regnete, nein, es stürmte, ich saß in einem Flanellanzug am Frühstückstisch und wollte eigentlich gleich in die Badewanne und dann »Sissi« schauen.
Er sagte: »Ich muss da noch mal was gucken.« – »Was denn?« – »Halt was gucken.«
Es endete damit, dass wir in der zugigen, unbeheizten Halle in Kappeln standen und das Unterwasserschiff bearbeiteten. Das Thermometer zeigte fünf Grad. Plus, immerhin. Meine braune Handtasche hat seitdem blaue Punkte, und ich nahm eine Blasenentzündung mit nach Hause. Zur Belohnung bekam ich in Kappeln Kroketten. Wenigstens das. Weil die ja wirklich gut sind.
Der kühle Herbst hat, wie ich finde, auch schöne Seiten: Man kann durchs feuchte Laub wandern, auf Märkte gehen, Kerzen kaufen und Grog trinken. Letzteres tut mein Mann auch immer um diese Jahreszeit. Und wird von Glas zu Glas trauriger.
Viele Menschen freuen sich auf Weihnachten. Er auch: »Dann sind es noch fünf Tage bis Silvester und dann nur noch 74 Tage bis Mitte März.«
»Wir könnten das Boot doch ins Mittelmeer legen, nach Mallorca oder so. Wenn wir früh viele Flüge buchen, kommen wir da günstig hin«, schlug ich ihm zitternd vor, als wir Ende November in der Winterlagerhalle auf dem aufgebockten Boot saßen. »Da ist es auch im Winter halbwegs warm.«
Ich trug drei Pullover übereinander, eine Daunenjacke und Handschuhe, trotzdem waren meine Finger so kalt, dass ich kaum den Becher mit dem auf unserem Spirituskocher erhitzten Glühwein halten konnte.
»Wenigstens liegt er nicht direkt neben uns, das kann ich nicht leiden.«
Auf einem Boot etwas weiter entfernt saß ein älterer Herr, der einsam etwas polierte. Er winkte rüber, mein Mann winkte höflich, aber verhalten zurück. »Wenigstens liegt er nicht direkt neben uns, das kann ich nicht leiden«, sagte er dann leise. »Aber zu deinem Vorschlag: Willst du mich eigentlich fertigmachen? Wenn das Boot im Mittelmeer liegt, kann ich es in drei Jahren wegschmeißen. Da ist es warm, da kriegt es Osmose.«
Hätte ich doch nichts gesagt. Osmose scheint für alle Segler so etwas wie Krebs im Endstadium zu sein. »Je wärmer die Umgebungsflüssigkeit, desto niedriger die Dichte«, sagte er böse. »Und das Mittelmeer ist wärmer als die Ostsee.«
Meine Füße erstarrten langsam. »Ist ja gut.« – »Willst du, dass wir Osmose kriegen?«
Wir! »Nein.«
»Als Nächstes schlägst du wohl vor, dass wir das Boot in die Karibik legen. Oder in den Indischen Ozean. Schönen Dank auch. Dann können wir den Blasen beim Wachsen zuschauen. Sag doch gleich, dass du das Schiff verkaufen willst.«
Der Mann auf dem anderen Schiff rief fast weinend herüber: »Das hat meine Frau auch schon gesagt.«
Die Frau war mir auf Anhieb sympathisch. »Wo ist Ihre Frau denn?«, fragte ich. Vielleicht könnte ich mit ihr in ein mollig warmes Café gehen und heiße Schokolade trinken.
Er glotzte mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Zu Hause natürlich. Es wäre ja eine Zumutung für sie, bei dieser Kälte hier zu sein. Heute wäre übrigens guter Wind, um nach Sønderborg zu segeln«, rief er dann zu meinem Mann, nein, er schrie es. »3 bis 4. Südost! Und das bei der Sonne!«
Ja, die Sonne schien. Aber es war eiskalt.
Mein Mann sackte in sich zusammen und sagte mit brüchiger Stimme: »Wie schrecklich. Wollen Sie auf einen Glühwein zu uns rüberkommen?«
Der Nachbar kletterte die am Boot angelehnte Leiter in einer Geschwindigkeit runter, an der sich die Ratten, die aus der dritten Klasse kommend die Flure der sinkenden titanic entlanggerast waren, ein Beispiel hätten nehmen können.