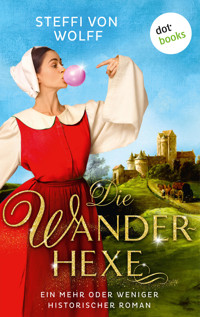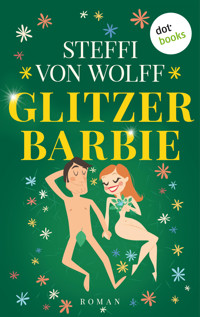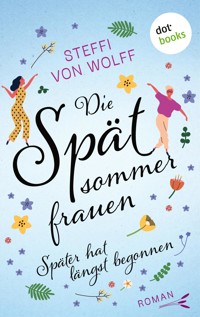
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Flüchtigkeit des Glücks: Der bewegende Roman »Die Spätsommerfrauen« von Steffi von Wolff jetzt als eBook. Leonor weiß, dass sie ihr Leben immer in vollen Zügen genossen hat – dennoch kann sie sich nur schwer damit abfinden, dass ihr nun nur noch ein paar Monate bleiben. Die reiche Witwe Hedy wiederum hat nie richtig gelebt und sieht allmählich die Zeit wie Sand durch ihre Finger rinnen. Als die beiden so unterschiedlichen Frauen zufällig aufeinander treffen, fassen sie einen Entschluss: Leonor soll Hedy dabei helfen, ihre spontane, wagemutige Seite zu erleben, während Hedy ihnen all die Dinge ermöglicht, nach denen ihnen der Sinn steht. Eine ebenso verrückte wie emotionale Reise beginnt, auf der die beiden alles tun, die sie immer auf später verschoben haben. Denn Später hat längst begonnen … Eine ebenso humorvolle wie berührende Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft und darüber, dass das Leben zu kurz ist, um irgendetwas auf später aufzuschieben: »Witzig, anrührend, temporeich.« Stern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Leonor weiß, dass sie ihr Leben immer in vollen Zügen genossen hat – dennoch kann sie sich nur schwer damit abfinden, dass ihr nun nur noch ein paar Monate bleiben. Die reiche Witwe Hedy wiederum hat nie richtig gelebt und sieht allmählich die Zeit wie Sand durch ihre Finger rinnen. Als die beiden so unterschiedlichen Frauen zufällig aufeinander treffen, fassen sie einen Entschluss: Leonor soll Hedy dabei helfen, ihre spontane, wagemutige Seite zu erleben, während Hedy ihnen all die Dinge ermöglicht, nach denen ihnen der Sinn steht. Eine ebenso verrückte wie emotionale Reise beginnt, auf der die beiden alles tun, die sie immer auf später verschoben haben. Denn Später hat längst begonnen …
Über die Autorin:
Steffi von Wolff, geboren 1966 in Hessen, war Reporterin, Redakteurin und Moderatorin bei verschiedenen Radiosendern. Heute arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen und Magazine wie »Bild am Sonntag« und »Brigitte«, ist als Roman- und Sachbuch-Autorin erfolgreich und wird von vielen Fans als »Comedyqueen« gefeiert. Steffi von Wolff lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Die Autorin im Internet: steffivonwolff.de und facebook.com/steffivonwolff.autorin
Steffi von Wolff veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Bestseller »Glitzerbarbie«, »Gruppen-Ex«, »ReeperWahn« und »Rostfrei«, »Fräulein Cosima erlebt ein Wunder«, »Das kleine Segelboot des Glücks«, »Der kleine Buchclub der Träume«, »Das kleine Hotel an der Nordsee«, »Das kleine Haus am Ende der Welt«, »Das kleine Appartement des Glücks«, »Die Spätsommerfrauen«, »Kein Mann ist auch (k)eine Lösung« und »Die Wanderhexe« sowie die Kurzgeschichten-Sammelbände »Das kleine Liebeschaos für Glückssucher« und »Das kleine Glück im Weihnachtstrubel«. Eine andere Seite ihres Könnens zeigt Steffi von Wolff unter ihrem Pseudonym Rebecca Stephan im ebenso einfühlsamen wie bewegenden Roman »Zwei halbe Leben«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2024
Dieses Buch erschien bereits 2017 unter dem Titel »Später hat längst begonnen« bei Fischer, Frankfurt am Main
Copyright © der Originalausgabe 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 144, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/GoodStudio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-035-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Spätsommerfrauen«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Steffi von Wolff
Die Spätsommerfrauen
Roman
dotbooks.
Widmung
Für Susi.
Freundin und Seelenverwandte.
Zitat
»Der Sinn des Lebens besteht darin, die gegebene Frist sinnvoll zu nutzen.«
ROGER WILLEMSEN
TEIL I
Kapitel 1
Hamburg Montag, 26. September
»Ja, ja«, sagt Herr Dinkelgärtner weise und nickt dabei wie ein Wackeldackel. »Der Tod kostet halt Geld. So ist das halt.« Gütig lächelt er mich an, senkt den Kopf dabei, und seine Lesebrille rutscht bis ganz vorn auf die Nasenspitze. »Aber das Leben ist ja auch teuer. Das muss man halt auch in die Waagschale werfen.«
Ich glaube, ich höre nicht richtig. »Wie jetzt? Wollen Sie mir damit sagen, dass ich froh sein kann, bald unter der Erde zu liegen? Damit ich mich nicht mehr darüber aufregen muss, dass ein Standardbrief schon wieder zwei Cent teurer wird?«
Er zögert kurz und sagt dann: »Das war halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt.« Jetzt setzt er seine Brille ab, wofür ich dankbar bin, denn sie ist so verschmiert, dass ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, wie er dadurch überhaupt etwas erkennen kann. Übertrieben haucht er auf die Gläser ein und wienert mit einem Papiertaschentuch darauf herum, dann setzt er die Brille wieder auf. »Wir haben halt gestern erfahren, dass wir in drei Monaten mehr Miete zahlen müssen. Fünfzehn Prozent. Also das ist halt schon ein Happen. Da hab ich mich mit meiner Frau halt ganz schön drüber aufgeregt.« Herr Dinkelgärtner schüttelt den Kopf. »Alles Halsabschneider. Aber so ist das halt.« Er überlegt kurz. »Irgendwas wollte ich noch sagen, was war es nur ... ach ja, habe ich schon erwähnt, dass man Beerdigungen steuerlich absetzen kann?«
»Halt«, sage ich.
»Was ist?«, fragt er erschrocken.
»Sie haben einen Satz ohne ›halt‹ gesagt. Das verwirrt mich ehrlich gesagt ein bisschen.«
»Hahahaha«, macht Herr Dinkelgärtner und gibt Geräusche von sich wie ein Ferkel, das sich an irgendetwas verschluckt hat. »Sie sind ja lustig. Sie sind ja lustig! Hahahahaha! Nein, hahaha ... aaaaalt.« Er freut sich über diesen Hammerscherz, kriegt sich aber zum Glück wieder ein. »Sie sind mir eine«, sagt er und wackelt gespielt drohend mit einem Zeigefinger. »Aber zurück zur Sache. Das ist halt ein wichtiger Aspekt. Das steuerliche Absetzen.«
»Herr Dinkelgärtner«, sage ich. »Ich glaube, Sie verstehen die Situation nicht ganz. Wie soll ich denn bitte meine eigene Beerdigung von der Steuer absetzen?«
»Das ist halt eine außergewöhnliche Belastung.«
Herr Dinkelgärtner kapiert irgendwie gar nichts.
»Wenn ich tot bin, bin ich tot«, erkläre ich ihm. »Möglicherweise sitze ich dann zwar im Himmel auf irgendeiner Wolke und freue mich, dass ich noch eine Steuererstattung bekommen hätte, aber das glaube ich eher nicht.«
Obwohl – das ist eigentlich wirklich interessant. Ich bin freiberufliche Journalistin. Wir haben Ende September, und ich habe trotz der Krankheit in diesem Jahr so halbwegs was verdient, was daran lag, dass ich, wann immer ich auch nur ansatzweise konnte und nicht flachlag, gearbeitet habe, um nicht über Metastasen nachzudenken. Ich habe auch schon Vorauszahlungen ans Finanzamt geleistet. Wer kriegt denn dann die Erstattung? Auch wenn’s nur fünfhundert Euro sind oder so, an wen geht das? Ich habe noch gar kein Testament gemacht, weil ich ganz schön durch den Wind bin, seit die endgültige Diagnose feststeht. Wer gesagt bekommt, dass es leider, leider nach ärztlichem Ermessen keine Hoffnung mehr gebe und man noch ungefähr drei Monate zu leben habe, ohne dass man sich hier festlegen wolle, das nicht, es seien schon Zeichen und Wunder geschehen, andererseits aber könne es auch gut sein, dass es nur noch sechs Wochen oder zwei Monate oder was weiß ich dauert, und die Statistik, die Statistik ..., der darf das schon mal sein, finde ich. Vor zehn Tagen war das. Dafür ziehe ich das hier ganz gut durch. Ich habe mich im Griff. Noch. Natürlich gibt es schlimme und sehr schlimme Tage, aber auch gute. An diesen guten Tagen habe ich gearbeitet. Glücklicherweise hatte ich einige Aufträge, das war auch nötig. Was dieser Herr Dinkelgärtner mich kostet, ist schon der Wahnsinn.
Der Krebs hat mich verändert. Früher war ich ein fröhlicher Mensch, lebenshungrig, spontan, nicht an Konsequenzen denkend. In Australien bin ich fast mal von einem Hai gefressen worden, weil ich nicht auf die Warnungen der Einheimischen gehört hatte und zu weit rausgesurft bin. Ich hatte ein gutes Leben. Freunde. Jetzt ist das anders. Ich habe mich während des Krankheitsverlaufs ziemlich zurückgezogen, und viele konnten nicht gut damit umgehen. Wie denn auch? Krebs ist ja kein abgebrochener Fingernagel. Ich bin nicht sauer, es war ja meine Entscheidung. Bei manchen Leuten hatte ich allerdings das Gefühl, dass sie über meinen Rückzug erleichtert waren.
Hin und wieder keimt eine Wut in mir auf, die ich so gar nicht an mir kenne. Dann denke ich darüber nach, was ich alles tun könnte, ohne dass es Konsequenzen hätte, weil ich ja todkrank bin. Ich könnte zum Beispiel Herrn Dinkelgärtner einfach anschreien, weil er so einen Mist von sich gibt. Oder mit der rechten Hand ausholen und seinen Schreibtisch leerfegen, weil er gepfefferte Preise verlangt und dauernd »halt« sagt. Aber das wäre unhöflich. Und was hätte ich davon? Herr Dinkelgärtner trägt keine Schuld an meiner Lage. Der Mann macht nur seinen Job. Und er scheint ihn schon lange zu machen, denn als ich ihm sagte, dass es bei mir zu Ende gehen wird, und ich vorher alles regeln will, hat er nur genickt und »Ist halt nicht zu ändern« gesagt.
»Ach ja«, sagt er nun. »Ich hatte so einen Fall halt noch nie. Hoffentlich sind Sie nicht nachtragend, aber so schätze ich Sie auch gar nicht ein. In ein paar Monaten lachen Sie drüber.«
Ich starre ihn an und überlege doch kurz, irgendwas zu tun. Der Mann tritt in keine Fettnäpfchen, er lässt sich reinfallen, mit seinem ganzen Körpergewicht, und das ist nicht wenig. Herr Dinkelgärtner ist klein, und zwar so klein, dass seine Füße den Boden nicht berühren, wenn er in seinem Drehstuhl bis an die Rückenlehne rutscht, was er getan hat. Er ist rund wie eine Kugel, ganz außer Atem, und er hat kleine Wurstfinger. Sie müssen im Laufe der Jahre dicker geworden sein, denn der Ehering sitzt so eng am rechten Ringfinger, dass man vom Hinschauen Beklemmungen bekommt. Die Kleidung ist ebenfalls zu eng. Alles an dem Mann lässt einen nach Luft schnappen. Sogar die Haare liegen so eng am Kopf, dass man sie mit Rundbürste und Föhn bearbeiten möchte, damit ein bisschen Lockerheit in die Gestalt kommt.
Kurz überlege ich, ihn wegen der Steuererstattung zu fragen, aber womöglich sagt er dann, dass er das innerhalb eines Jahres rauskriegen und mich anrufen wird, also lasse ich es. Himmel, ich muss ein Testament machen! Nicht dass ich dem lieben Staat meine Steuererstattung schenke! Dann vermache ich die lieber einer Waldorfschule. Damit kann dann neues Saatgut und haufenweise naturbelassene Wolle für schicke Pullis gekauft werden.
»Nein, ich bin nicht nachtragend. Wie auch?«, sage ich.
Herr Dinkelgärtner geht nicht darauf ein, was ich fast schade finde.
»Dann lassen wir das halt mal mit den steuerlichen Geltendmachungen«, sagt er. »Sie wollten ja eine Grabstelle aussuchen. Ich habe mich halt schon mal erkundigt, und schauen Sie hier. Es gibt sogar Fotos. Ich bin ja mit den Mitarbeitern auf den Friedhöfen gut bekannt.« Stolz sieht er mich an. »Mit einigen gehe ich halt auch hin und wieder mal ein Bier trinken. Gerade gestern hat ...«
»Toll«, sage ich und frage mich, warum ich eigentlich ausgerechnet bei Herrn Dinkelgärtner einen Termin gemacht habe. Wahrscheinlich wegen des Fotos, das er von sich auf seine Homepage gestellt hat. Er sieht darauf aus wie eine dicke männliche Hebamme, die während ihres ersten Geburtsvorgangs feststellt, den falschen Berufsweg gewählt zu haben. Die Website strotzt vor Rechtschreib-, Logik- und allen möglichen anderen Fehlern. Warum auch immer, fand ich das irgendwie sympathisch. Haben wir nicht alle unsere Fehler?
Außerdem wollte ich keinen Bestatter, der mit Nachnamen »Sarg« heißt (das habe ich beim Googeln wirklich gefunden, einen Stephan Sarg, der Bestattungen macht). Oder einen namens »Hahn«, der seinen Laden ganz witzig TrAuerHahn nennt. Oder den mit dem Foto von seinem Hund auf der Website, der zwischen zwei Särgen Männchen macht, und dazu die Überschrift: Bei unseren günstigen Preisen dreht sogar der Hund durch! Was für ein Unsinn.
Herr Dinkelgärtner kramt in seiner Mappe herum und legt Fotos auf den Tisch. Er räuspert sich. »Also: Bei der Bestattung in einem Sarg ist die Auswahl an möglichen Grabalternativen halt schon sehr eingeschränkt. Die traditionelle Methode ist dabei halt die Beisetzung eines Sarges in ein Erdgrab, die auch Beerdigung genannt wird.« Er macht eine Pause und sieht mich an. »Haben Sie bis hierhin alles verstanden?«
»Ja. Ich weiß jetzt, dass die Beisetzung eines Sarges in ein Erdgrab Beerdigung genannt wird«, erkläre ich.
Dankbar nickt er. »Genau. Dabei kann zwischen einer Beerdigung in einem Erdwahlgrab, einem Erdreihengrab oder halt einer anonymen Beisetzung gewählt werden. Die Auswahl hat unter anderem halt Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten und mögliche Folgekosten, etwa für die Grabpflege. Bei einem Wahl- bzw. Reihengrab kann die Gestaltung des Grabbeetes nach den Richtlinien des Friedhofs halt persönlich vorgenommen werden. In Ohlsdorf ist das, glaub ich, kein Problem, da frag ich noch mal nach. Bei anonymen Gräbern ist eine individuelle Grabgestaltung halt untersagt. Auch die Grabbepflanzung wird hier vom Friedhof übernommen. Dann hat man die ...«
»Moment, Moment, Moment ...« Das wird mir zu viel. Ich möchte nicht Beisetzung studieren, sondern in drei Monaten beerdigt werden. Vielleicht sogar schon früher.
Der Mist ist, dass ich manchmal immer noch denke, alles wird gut. Alles wird gut. Alles muss gut werden. Das liegt an den Medikamenten. Es sind richtige Hammermedikamente, und manchmal sind die Schmerzen verschwunden. Einfach weg. Dann denke ich, vielleicht haben sich doch alle geirrt. Sie müssen sich geirrt haben! Man hört ja immer mal wieder von Fehldiagnosen. Dass Krankenakten vertauscht wurden oder der Arzt denkt, er hätte einen anderen Patienten vor sich. Aber immer, wenn ich mir sicher bin, dass die Schmerzen nicht mehr wiederkommen, schlagen sie zu. Diese Schmerzen sind sadistische Schweine. Sie warten nur darauf, dass ich Hoffnung schöpfe, dann kommen sie hämisch grinsend und fies kichernd wieder aus ihrem Versteck gesprungen und zeigen mir, wer hier das Sagen hat.
Wenigstens ist heute ein guter Tag: Die Sadisten halten Ruhe. Wahrscheinlich warten sie bis zum Abend, wenn ich müde bin, um mir ihren Besuch abzustatten. Die Medikamente, die ich dann einnehmen muss, stellen mich so ruhig, dass ich noch nicht mal mehr fernsehen kann. Ich liege nur tumb herum und nehme alles wie durch Watte wahr – und wenn ich ehrlich bin, könnte ich dann eigentlich auch gleich tot sein.
Apropos. Ich schaue mir die Fotos durch und ziehe eine Grabstätte in die engere Wahl, weil sie neben einem schönen Baum liegt. Die Blätter haben ein hübsches, sattes Grün, was mir komischerweise wichtig ist. Wenn ich schon tot bin, will ich wenigstens neben einem schönen, gesunden Baum liegen. Ich will nichts, was anfällig ist für Schädlingsbefall. Ich möchte auch nicht, dass über mir mit giftigen Bekämpfungsmitteln gearbeitet wird. Ich will, dass alles in Ordnung ist. Ich will mich gut fühlen, wenn ich da liege.
»Sie haben einen guten Geschmack«, freut sich Herr Dinkelgärtner. »Die Grabstätte ist gerade abgelaufen. Es wurde schon wieder alles eingeebnet und wartet auf den nächsten Besuch.«
»Da hab ich ja richtig Glück.«
Er nickt eifrig. »Haha, ja, aber nicht vergessen: ›Besuch und Fisch bleiben nur drei Tage frisch.‹ Das hat meine Mutter immer gesagt, sie ...« Er stockt und knetet seine Hände. »Bitte entschuldigen Sie. Also so was. Herrje, ich wollte halt nur nett sein.«
»Das sind Sie ja auch.«
Er ist es ja wirklich. Aber der Mann quasselt sich um Kopf und Kragen und wirkt dabei hilflos wie ein Welpe, der ohne Mutter auf einer starkbefahrenen Kreuzung steht und nicht weiß, wohin. Ich bin froh, dass ich allein hier bin und Nupsi nicht darauf bestanden hat mitzukommen. Sie ist meine älteste Freundin, wir kennen uns schon Ewigkeiten, und sie kann ganz schön barsch werden, wenn’s nötig ist, auch wenn es ihr hinterher oft leidtut. Ich bin eher der Typ Mensch, der die Dinge als gegeben hinnimmt. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles mit mir machen lasse, das nicht. Aber wenn ich etwas nicht ändern kann, rege ich mich einfach nicht drüber auf oder versuche es zumindest – was wiederum Nupsi total aufregt. Nupsi war mal dabei, als ich zwei weiße Blusen aus der Reinigung abholen wollte. Das ist ein Luxus, den ich mir schon immer gegönnt habe: Blusen in die Reinigung bringen. Dort werden sie schön gebügelt, und ich hasse Bügeln. Das Problem war jetzt nur, dass sie diesmal nicht nur gut gebügelt, sondern auch zartblau geworden waren. Ich wies natürlich auf diesen Zustand hin, aber die Reinigungsbesitzerin gehörte nicht zu den Menschen, die Fehler eingestehen, sondern zu denen, die immer nach etwas suchen, was Schuld an der Misere hat, damit sie bloß im Recht sind. Das habe ich noch nie begriffen: Was ist so schlimm daran, etwas falsch zu machen? Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie das zugeben, zeigen sie Schwäche. Ich finde es viel stärker, zu sagen: »Ja, Sie haben recht. Die Bluse ist verfärbt. Ich ersetze Ihnen natürlich den Schaden.« Nicht so die Reinigungsfrau.
Ich sagte: »Die Blusen waren weiß. Jetzt sind sie blau. Ich wollte sie nur reinigen und nicht umfärben lassen.«
»Umfärbe biete mer auch gar net an«, sagte die schmallippige, hagere, offenbar aus Hessen stammende Frau und sah uns herablassend an.
»Warum sind die Blusen dann jetzt blau, wenn Sie Umfärben nicht anbieten?«, fragte ich, während man Nupsi ansah, dass sie die Frau am liebsten geschüttelt hätte.
»Des is e schönes Blau«, sagte die Frau. »Des steht Ihne.«
»Unbestritten«, sagte ich, während Nupsi nun schon schwerer atmete. »Aber hätte ich blaue Blusen gewollt, hätte ich blaue Blusen gekauft. So einfach ist das. Oder ich hätte Ihnen beim Herbringen gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn die Blusen blau werden.«
»Isch hab die Blusen net angenomme«, sagte die Frau.
»Ich habe ja auch gar nichts gesagt, weil ich die Blusen einfach nur reinigen lassen wollte.«
Die Frau dachte nach. »Die Bluse sin ja gereinischt«, sagte sie dann.
»Und blau«, sagte ich.
»Aber schön blau. Des ist wirklisch schön«, rechtfertigte sie sich erneut und dachte kurz über ihren nächsten Schachzug nach. »Isch versteh Ihr Problem aa net. Des is einfach e Farbumkehrung.«
»Was?«
Nun war sie sich ihrer Sache sicher: »Ei, e Farb-um-keh-rung.« Sie nickte und verschränkte die Arme. »Des bassiert manschemal aafach so. Des is e höhere Macht.«
»Was ist denn das für ein Schwachsinn?«, fragte Nupsi, die sich nun nicht mehr zurückhalten konnte. »Wir sind doch hier nicht bei Photoshop oder so. Sie haben doch bestimmt eine Versicherung gegen so was.«
»Net gesche Farbumkehrung«, sagte die Reinigungsfrau und zuckte bedauernd mit den Schultern.
Ich sagte: »Ach so. Na dann.«
»Wie ›na dann‹?«, fragte Nupsi erschüttert. »Du willst jetzt einfach so gehen?«
»Ja«, sagte ich. »Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Reinigung in Blau aufs Haus geht.«
Die Reinigungsfrau öffnete den Mund und wollte etwas sagen, aber Nupsi tötete sie mit Blicken, also schwieg sie. Ich nahm die Blusen, sagte »Auf Wiedersehen« und verließ die Reinigung; Nupsi stapfte wütend hinter mir her.
»Was sollte das denn? Du kannst die doch nicht einfach so vom Haken lassen.«
»Doch«, sagte ich. »Du glaubst ja wohl nicht, dass ich es auf einen Rechtsstreit wegen zwei Blusen ankommen lasse. Die sind auch nur von H&M. Und da waren sie sogar noch reduziert.«
»Das ist doch völlig egal«, sagte Nupsi wütend. »Die Frau war im Unrecht.«
»Ja, war sie. Aber das ist mir egal. Die Aufregung, die da jetzt entstanden wäre, überleg mal. Das ist mir die Sache nicht wert. Gönnen wir der Frau ihren Triumph, und ich habe jetzt umsonst saubere blaue Blusen bekommen.«
»Das ist doch eine total bescheuerte Argumentation«, fing Nupsi an. »Ich würde an deiner Stelle ...«
»... das Thema jetzt abhaken«, sagte ich. »Genau. Lass uns irgendwo einen Cappuccino trinken gehen.«
Ja, so bin ich. Was soll ich mir das Leben unnötig schwermachen? Und jetzt schon gar nicht mehr. Ich merke, dass ich meinen Pragmatismus mittlerweile als Schutzschild vor mich halte, und das funktioniert sehr gut. So lasse ich nichts an mich rankommen, regle die Dinge und versuche, mich damit über Wasser zu halten, solange es eben geht. Ich versuche, die Emotionen zu unterdrücken, was mir erstaunlich gut gelingt. Nupsi sagt, irgendwann würde alles geballt aus mir herausbrechen. Nun gut. Aber bis dahin bin ich so, wie ich bin. Recht gelassen. Und freudlos. Früher war ich lebensfroh, und das bin ich nun eben nicht mehr. Wozu auch? Meine einzige Freude ist momentan der schöne Baum.
»Ich nehme das Grab«, sage ich nun zu Herrn Dinkelgärtner.
»Wollen Sie sich halt nicht die anderen Fotos erst noch ausgiebig ansehen beziehungsweise erst mal auf den Friedhof gehen und schauen, ob ...«
»Nein, es ist schön, ich will es haben. Ich nehme es, und dann gehe ich später auf den Friedhof, um es mir anzuschauen.« Ich will das jetzt erledigen.
»Gut.« Er zuckt mit den Schultern und macht sich Notizen. »Was ist mit einem Grabstein? Ich habe hier halt gute Angebote von einem Steinmetz. Ich hab auch Steine zur Ansicht hinten im Lager. Da gebe ich Ihnen Prospekte mit. Er hat halt wirklich hübsche Ideen. An einem Stein von ihm werden Sie lange Freude haben.«
Ich stehe auf. Es genügt.
»Sie wollen schon gehen?« Herr Dinkelgärtner sieht richtiggehend erschüttert aus. »Habe ich etwas falsch gemacht?«
Nein. Natürlich nicht.
»Nein, natürlich nicht«, seufze ich. »Sie machen alles richtig.«
»Der Ohlsdorfer Friedhof bietet halt Vorsorgeleistungen an. Das heißt, Sie bezahlen im Voraus und reservieren halt gegen eine geringe Gebühr den Platz, und die eigentliche Ablaufzeit beginnt dann aber erst mit dem Tag der Beisetzung. Das machen viele so. Sonst sind die guten Gräber halt schnell weg.«
»Deswegen nehme ich es ja auch«, sage ich. »Das wollen wir ja nicht, dass das gute Grab weg ist.«
»Gräber neben Bäumen werden halt gern genommen.«
»Ich nehme ja auch eines neben einem Baum.«
»Gut.« Herr Dinkelgärtner räuspert sich. »Also noch eine Info zur Vorsorge: Die Vorsorge umfasst neben der Grabstätte halt folgende Leistungen: Verstorbenenannahme, Ausheben der Gruft und ...«
»Danke. Ich schaue mir das alles in Ruhe an.«
»Okidoki«, sagt er. »Aber warten Sie. Für die Vorsorge hab ich halt auch einen Flyer. Und das Grab blocke ich schon mal, ja? Dann unterschreiben Sie bitte hier. Ich räume Ihnen dann trotzdem noch Zeit zum Nachdenken ein. Dann haben Sie es sicher und müssen sich nicht ärgern, wenn jemand schneller ist, falls Sie noch überlegen wollen. Die sind wie gesagt halt schnell weg, die guten Gräber. Hier, bitte, da ist die Nummer und der Standort des Grabes. Ein schönes Grab, wirklich. Der Baum ist halt auch wirklich wunderhübsch. In vielen Bäumen nisten Singvögel. Der Gesang ist wirklich hübsch. Sehr melodisch halt.« Er wird rot. So langsam scheint er zu merken, was für einen Dünnpfiff er von sich gibt. Er steht nun auch auf und reicht mir die Flyer. »Also wegen der Singvögel«, sagt er, »ich meinte, das ist doch schön, wenn man da nicht immer so alleine ist.«
Ach je. Das finde ich jetzt aber doch süß von Herrn Dinkelgärtner.
»Wie lieb von Ihnen«, sage ich. »Ja, vielleicht höre ich es ja dann hin und wieder.« Nur nicht dramatisch werden. Wir sind ja hier in keiner Schnulze.
»Äh«, macht Herr Dinkelgärtner. »Sie? Nein, Sie meinte ich gar nicht. Ich meinte die Friedhofsgärtner. Die haben ja nicht viele, mit denen sie während der Arbeit reden können. In den Gräbern liegen ja Tote. Aber dann haben sie wenigstens den Gesang der Vögel.«
Bevor er noch irgendetwas sagen kann, verlasse ich sein Büro.
Als ich vor kurzem die endgültige Diagnose bekam, wollte ich anfangen, Tagebuch zu schreiben. Eine Viertelseite habe ich geschafft. Der erste Satz lautete: Dieses Tagebuch gehört Leonor Sperber zu Lindenfels. Ich kann nichts dafür, dass ich so heiße, aber es gibt schlimmere Nachnamen. Schade übrigens, dass er nun gar nicht mehr fortgeführt wird. Vielleicht sollte ich Nupsi adoptieren, das ist ja überhaupt mal eine Idee. Nupsi heißt nämlich Ninette Nups. Sie findet es heute noch unmöglich von ihren Eltern, dass sie sie so genannt haben. Aber da Jakob und Emilie mittlerweile in irgendeiner Alters-WG am Starnberger See wohnen und dement sind, ist ihnen das egal. Ninette Nups hört sich jedenfalls an wie eine Comicfigur, die einen Gastauftritt in einer Folge von Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg hat. Ninette Nups könnte eine kleinwüchsige, aus Paris stammende Nachwuchsjournalistin spielen, die der rasenden Reporterin bei Benjamin Blümchen, Karla Kolumna, den Rang ablaufen will, indem sie heimlich eine schlimme Sache recherchiert und dann mit großem Knall einen Betrug aufdeckt, nämlich den, dass die Vortagsbrötchen in der Neustädter Bäckerei frisch sind. Aber Nupsi ist keine Journalistin, Nupsi arbeitet in einer Galerie. In ihrer Jugend hat sie gemodelt. Sie ist groß, hat hellblonde Locken, ist superschlank und hat etwas selbstverständlich Schönes an sich, um das sie viele Frauen bis heute beneiden. An ihr sieht einfach alles gut aus. Wenn andere Frauen stundenlang beim Friseur hocken, um eine Undone-Frisur zu erhalten, wuschelt Nupsi einmal durch ihre Haare und sieht umwerfend aus. Das Alter macht ihr nichts aus, und man sieht es ihr auch nicht an. Nupsi kann eine viel zu weite, ausgeleierte Herrenstrickjacke anhaben, und man denkt: ›Wow! Wie sie diese Jacke trägt!‹ Nupsi hat kaum Falten, sondern eine wunderbare Haut, obwohl sie nur eine recht günstige Creme aus der Drogerie benutzt. Und Nupsi sieht aus, als würde sie täglich einmal um die Alster rennen, aber sie hasst Sport und kann alles essen, alles, eine Nupsi nimmt nicht zu. Sie ist Single und wohnt im selben Stadtteil wie ich. Nupsi könnte viele Männer haben – viele reiche kommen ja auch in die Galerie in der Hamburger Innenstadt –, aber sie hat die Nase gestrichen voll. Und warum? Nupsi war mal verheiratet – mit einem Baron, der Gandulf von und zu noch was hieß. Sie wohnten ganz feudal in einem Stadthaus Richtung Alster im Harvestehuder Weg, und Nupsi, die mal Kunstgeschichte studiert hatte und eigentlich selbst eine Galerie eröffnen wollte, verbrachte ihre Tage nun mit dem, was reiche Frauen so tun. Also irgendwie mit gar nichts. Wenigstens jammerte sie nicht rum wie so viele andere dieser Weiber. Doch, einmal hat sie gesagt, die Reisen nach Hawaii und ins Chalet in die Schweiz würden sie stressen, da hab ich ihr mal so richtig den Marsch geblasen. Unserer Freundschaft hat das aber alles keinen Abbruch getan. Wir lieben uns. Irgendwie, so fällt mir gerade ein, von Tag zu Tag mehr. Vielleicht, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
Irgendwann hat Gandulfs Firma – Immobilien, nur das Beste vom Besten – Insolvenz anmelden müssen. Nupsi hatte nichts gewusst und kippte völlig aus den Latschen. Von heute auf morgen war alles weg, und Nupsi stand ohne etwas da, wohnte erst mal bei mir, und dann stellte sich auch noch raus, dass Gandulf kriminell war. Nupsi hatte aus ihrer Modelzeit ziemlich viel Geld gespart und angelegt, doch Gandulf hatte es auf ein Firmenkonto verschoben, und da war das Geld auch weg, Anwälte wurden engagiert, kosteten viel Geld, und Nupsi musste sich von der Prada-Tasche, ihrem Jaguar und ihren Armbanduhren trennen. Aber sie versuchte, sich nicht unterkriegen zu lassen, und arbeitete vorübergehend an der Kasse bei Edeka in Eppendorf, um wenigstens erst mal ein bisschen Kohle zu haben. Das zog sie ziemlich herunter, weil dort natürlich ihre ehemaligen Nachbarinnen einkauften. Mittlerweile arbeitet Nupsi in der Galerie, wo sie nicht rasend viel verdient, und alles, was sie entbehren kann, bekommen ihre dementen Eltern im Heim. Nupsi kommt über die Runden, aber eben gerade so. Ihr Traum ist eine eigene Galerie, aber die Erfüllung weit weg. Nupsi sagt immer, sie wolle mir finanziell unter die Arme greifen, aber das will ich verdammt nochmal nicht. Wie soll denn das auch gehen? Emilie braucht eine neue Spezialmatratze für ihr Bett; ich könnte Nupsi nicht mehr in die Augen schauen, wenn das Geld, das für diese Matratze bestimmt ist, für mich draufgeht. Und wir reden hier ja nicht mehr von allzu langer Zeit, in der es mir etwas nützen könnte. Emilie hat, wenn sie nicht plötzlich von der Pest dahingerafft wird, die Matratze länger als drei Monate. Nein. Ich bin immer allein klargekommen, und so wird das bis zu meinem absehbaren Ende bleiben.
Ich selbst war nie reich, so wie das viele dachten. Bei »Sperber zu Lindenfels« denkt man eine alte Adelssippe auf einer trutzigen Burg, die vor siebenhundert Jahren von ausgemergelten Untertanen gebaut wurde, die dabei auch schon mal von Quadern erschlagen wurden. Aber das war den Adligen egal, sie wohnten auf sechstausend Quadratmetern, trugen Keuschheitsgürtel und arbeiteten in kritischen Situationen mit Säbel und Morgenstern, anstatt erst mal alles zu reflektieren oder sacken zu lassen. Und anstelle von Ausdrücken wie »Achtsamkeit« oder »Da bin ich ganz bei dir« gab’s eins auf die Zwölf. Es existierte wohl tatsächlich mal eine Familienburg, aber die wurde Papas Familie abgenommen, weil sie sich so hoch verschuldet hatte, so genau kriege ich das nicht mehr zusammen. Und die Burg würde mir ja jetzt auch nichts mehr nützen. Nein, wir waren eine ganz durchschnittliche Familie. Das dazu.
So. Dann stand da noch im Tagebuch: Geboren am 2. Oktober 1966 (ja, ich werde bald 50, in einer Woche, um genau zu sein!), Beruf: Journalistin. Wohnt in: Hamburg.
Und dann? Sollte ich da reinschreiben: ›Liebes Tagebuch, ich vertraue dir ab sofort meine geheimsten Geheimnisse an, damit ich mich, wenn ich alt bin, mal an alles erinnere.‹? So ein Blödsinn. Ein »alt« wird es nicht mehr geben.
Ich war bei vielen Ärzten und werde jetzt nicht herunterleiern, was sie mir alle erzählt haben. Letztendlich zählt ja auch nur das Ergebnis: Lungenkrebs, genau gesagt nicht-kleinzelliger Lungenkrebs. Ich gehöre zu den geschätzt 85 von 100 Fällen mit dieser Krebsart. Kleinzelliger ist schlimmer, da der Krebs schneller wachsen kann und sich auch gern auf andere Organe ausbreitet. Wenn der nicht-kleinzellige aber streut, ist er genauso schlimm. Wenn er streut, ist er tödlich. Und bei mir hat er letztendlich gestreut.
»Sie können froh sein«, habe ich anfangs oft gehört. Und: »Freuen Sie sich doch mal.« Einer der Onkologen, bei denen ich war, konnte nicht verstehen, dass ich nicht vor Freude jubelnd aufgesprungen bin und geschrien habe: »Ich habe nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, ist das herrlich!« Er konnte nicht begreifen, dass ich in eine Art Schockstarre fiel. Er war einer von den Ärzten, die grundsätzlich nur Fakten sehen und nicht den Patienten, nicht den Menschen. Ich finde ja, Onkologen müssten ALLE ein begleitendes Psychologiestudium absolvieren. Denn allein die Diagnose Krebs haut einen völlig aus der Bahn.
Der Arzt erzählte mir dann etwas von einem Tumor im Lungenoberlappen, sehr ungünstig sei das – ich dachte mir, es würde wohl auch niemand sagen, dass es günstig sei, einen Tumor in der Lunge zu haben. Er sagte, er würde sich dann über die weitere Therapie Gedanken machen, danke, das war’s für heute, er müsse zu einem anderen Patienten. Gut, der Mann war eine Ausnahme und hatte vielleicht einen schlechten Tag, aber kann man sich da nicht mal zusammenreißen? Es geht ja nicht um ein aufgeschlagenes Knie.
Und dann ist der Krebs leider doch gewachsen.
Ich habe geraucht bis zu dem Tag, an dem ich so stark husten musste, dass ich endlich zum Arzt ging. Ja, ich hatte es rausgezögert – man kennt ja diese Halbschnupfen oder -husten, die nie richtig weggehen, aber einen auch nicht weiter stören. Nur dass es bei mir schlimmer wurde, und ich irgendwann Blut im Mund hatte.
Bis dahin habe ich viel geraucht. Sehr viel. Zwei große Schachteln am Tag, 360 Euro im Monat wurden verqualmt. Meine Güte, was habe ich mich über das Nichtrauchergesetz aufgeregt. Nupsi rauchte auch, und gemeinsam wurden wir zu richtigen Kampfraucherinnen, die sich ihren Platz in der Gesellschaft ertrotzen wollten. Immerhin waren wir beide in einer Zeit groß geworden, in der Rauchen einfach dazugehörte. Hallo, in Krankenhäusern gab es in jedem Stockwerk Raucherräume, an den Aufzügen standen Sandaschenbecher, man durfte beim Arzt im Wartezimmer rauchen, im Flugzeug, im Restaurant, in der Bahn! Ich weiß noch, wie ich im VW Käfer meiner Eltern ohne Gurt auf der Rückbank herumgehopst bin, und Vater und Mutter rauchten und rauchten und kurbelten das Fenster auch nicht nur ein Stück runter, weil meine Mutter immer Angst hatte, dass sie vom Zug einen steifen Nacken bekommen könnte. Ich sehe heute noch die Rauchschwaden, die durch das kleine Wageninnere waberten. Der Zug, sagte meine Mutter jedenfalls immer, würde sie umbringen. Und rauchte dabei fleißig weiter, ohne darüber nachzudenken, was sie sich damit antat. Bei uns zu Hause wurde in jedem Raum gequalmt, meine Eltern rauchten sogar im Schlafzimmer. Es war normal, dass Besuch Zigaretten angeboten bekam. Ich habe sogar ein Benimmbuch aus den fünfziger Jahren, in dem steht im Kapitel »Patientenbesuch im Krankenhaus«, dass es unhöflich sei, sich vor dem bettlägerigen Kranken eine Zigarette anzuzünden – erst solle man ihm eine anbieten, denn er sei ja geschwächt und könne nur mit Mühe oder gar nicht aufstehen. So war das. Heute gibt es die demütigenden Glaskästen in Flughafengebäuden, man muss Tausende Euro blechen, wenn man im Flugzeug auf dem Klo raucht, in den USA kann man sogar ins Gefängnis wandern, und in arabischen Ländern gibt es, wenn man erwischt wird, 50 Peitschenhiebe. Im Winter stehen zitternde Arbeitnehmer während ihrer Rauchpausen frierend und mit ihrem Schicksal hadernd auf der Straße, und wenn es regnet, drängeln sich alle unter ein viel zu kleines Vordach. Die Chefs und Kollegen sind sauer, weil die Rauchpausen ja von der Arbeitszeit abgehen.
Ich war einige Male im Krankenhaus, mir ist unter anderem der rechte obere Lungenlappen entfernt worden, was aber letztendlich auch nichts nützte, und konnte von meinem Fenster aus den Raucherplatz sehen, es war ein groteskes Bild. Menschen in Rollstühlen, mit Infusionsständern, Gips und Verbänden standen da in Jogginghosen oder Morgenmänteln und quarzten hektisch vor sich hin. Ich weiß noch, dass ich dachte: ›Eigentlich müsste ich runtergehen und denen meine Röntgenbilder zeigen und von den Chemos erzählen und davon, wie beschissen es einem insgesamt geht.‹ Aber ich tat es nicht.
Damals habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, das Nichtrauchergesetz. Mittlerweile würde es mich freuen, wenn das Rauchen komplett verboten worden wäre, damals, als ich es tat. Aber das wäre ja mit den gewünschten Tabaksteuereinnahmen nicht zu vereinbaren. Leider. Ich würde gern noch mehr Steuern zahlen und dafür den Krebs verschenken.
Jedenfalls rauche ich seitdem nicht mehr. Ich habe einfach aufgehört. Einfach so. Eigentlich sollte man allen Leuten, die mit dem Rauchen aufhören wollen, weismachen, dass sie Lungenkrebs haben. Dann bräuchte man keine Entwöhnungsseminare mehr. Es war ganz einfach für mich, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl ich immer gedacht hatte, dass es unmöglich sei. Aber es ging. Trotzdem verstehe ich wirklich jeden Raucher, jeden einzelnen. Es ist wunderbar, morgens zum Kaffee die erste Zigarette zu rauchen. Überhaupt ist rauchen schön. Gesellig. Man fühlt sich gut. Rauchen ist Belohnung und Freizeit. Wenn ich einen Artikel schrieb, habe ich mich nach jeder Seite mit einer Zigarette belohnt. Wer sich an die Tabakwerbungen von früher erinnert, wird nie einen hektischen Raucher gesehen haben. Alles war gelassen und friedlich. Allein der Marlboro-Cowboy, wie er da im Sonnenuntergang auf dem Gaul saß und sich erst mal eine anzündete ... Aber ich möchte zu jedem einzelnen Raucher hinrennen und ihm die brennende Zigarette aus dem Gesicht schlagen. Ich möchte ihm sagen, dass er in Kauf nimmt zu sterben. Jeder einzelne Zug kann ihn näher ans Grab bringen. Aber die meisten wollen das nicht hören. Ich habe es auf einer Feier mal angesprochen, da war ich schon krank. Es kamen nur bekloppte Sätze wie: »Dafür trinke ich wenig Alkohol«, »Meine Oma hat ihr Leben lang Kette geraucht und ist fast hundert geworden« oder, die Krönung: »Ich rauche nur Tabak, der biologisch angebaut worden ist.«
Natürlich wissen die Leute, dass das eigentlich schwachsinnig ist. Doch sie rauchen weiter. Und weiter. Und weiter.
Ich könnte jetzt auch rauchen, wenn ich wollte. Jetzt wäre es egal. Der Kampf ist eh verloren. Aber dann hätte ich das Gefühl, total aufgegeben zu haben. Ich will wenigstens in der Zeit, die mir noch bleibt, gesund leben. Klingt das blöde? Na ja, vielleicht nehme ich eine Stange Marlboro mit ins Grab.
Dauernd denke ich: Wäre ich bloß früher zum Arzt gegangen! Aber erst, als ich richtige Schmerzen hatte, habe ich einen Termin gemacht. Mein damaliger Freund Sven war auf einer Auslandsreise, und ich rief Nupsi an. Damals, vor vier Jahren, nachdem ich nach dem Gespräch mit dem Arzt, der sich über eine Therapie Gedanken machen wollte, eine Stunde lang planlos und frierend, weil ich meine Jacke in der Praxis vergessen hatte, in der Innenstadt herumgeirrt war. Sie kam sofort, las mich auf, schleppte mich in eine Bar und bestellte uns Hochprozentiges. Ich weiß noch, dass ich dachte: ›Ach, stecken da schöne Sonnenschirmchen in den Cocktails.‹ Es war eine Raucherbar, und Nupsi holte ihre Zigaretten raus.
»Ich rauche ab sofort nicht mehr«, sagte ich tonlos.
»Entschuldige. Wie saublöd ich bin!«, sagte Nupsi und steckte die Packung weg. Dann holte sie sie wieder raus und gab sie dem Barmann mit der Bitte um Entsorgung.
»Kann ich die haben?«, fragte er.
»Wenn Sie Bock auf ein Bronchialkarzinom haben, wie meine Freundin hier es hat, dann nur zu«, sagte Nupsi.
Der Barmann guckte erschrocken und warf die Packung weg.
Nupsi sagte zu mir: »Ich höre auch auf. Und zwar heute. Jetzt in diesem Moment.«
Sie streckte die Hände nach meinen aus, ich nahm sie, wir drückten sie uns gegenseitig fest und schauten uns dabei an. Nupsi blickt einem so in die Augen, dass man sich sicher und geborgen fühlt. Sie nickte mir kurz zu, dann strich sie mir über die Wange. Sie musste nichts sagen, ich wusste, was es bedeutete: ›Ich lass dich nie allein.‹
Am nächsten Tag ging Nupsi zu dem Arzt und machte ein Riesentheater im Empfangsbereich der Praxis, bis er endlich angerauscht kam. Nupsi brüllte ihn zusammen, wie man eine Patientin nach einer solchen Diagnose einfach so wegschicken könne, ohne zu fragen, ob man jemanden anrufen solle. »Ich glaube, die Belegschaft fand das auch gut«, erzählte mir Nupsi. »Die haben alle bloß dagestanden und gehofft, dass ich ihn noch trete oder so. Sie hatten ein Glitzern in den Augen. So nach dem Motto: ›Endlich sagt mal jemand das, was wir schon lange sagen wollen.‹ Ich würde es wieder machen. Haben dich noch mehr Ärzte schlecht behandelt?«
Das war also vor vier Jahren. Ein Behandlungsplan bei einem neuen Arzt wurde erstellt, und noch bevor man überhaupt angefangen hatte, ging ich mit Nupsi eine Perücke aussuchen. Als ich die ganzen Perücken auf den Plastikköpfen sah, musste ich an Table-Dancerinnen denken. Ich war ein paarmal für Reportagen in solchen Etablissements gewesen, und wirklich viele Damen dort trugen falsches Haar, wahrscheinlich, damit sich die falschen Brüste nicht so allein fühlten.
Ich fragte die Perückenfrau, die sich uns mit »Ich grüße Sie, ich bin die Frau Maurer, Zweithaarspezialistin« vorgestellt hatte, ob hier auch Table-Dancerinnen einkauften. Sie reagierte seltsam und meinte, das sei hier schließlich kein Bordell. Was ich denn denken würde? Dann fing sie an, uns zu belehren: Das seien Haare von Menschen, die sie freiwillig hätten abschneiden lassen – was wir gar nicht in Frage gestellt hatten. Ihr, also Frau Maurers, Perückenhaar käme überwiegend aus Indien. Indisches sei das schönste, da die Frauen dort so kräftige, dicke Haare hätten. »Sie opfern in Tempeln nach alten hinduistischen Bräuchen ihre Haare, und die Tempel verkaufen diese Haare dann weiter.« So sei das nämlich. Ich fragte, warum ausgerechnet Indien – das seien doch viele arme Leute dort, nicht dass sich die Mönche an dem Haargeld bereicherten und die armen Frauen nichts davon abkriegten. Frau Maurer bekam Schnappatmung. Was ich denn jetzt noch von ihr wolle. Solle sie nach Indien fahren und die ehemaligen Besitzerinnen der Haare suchen? Und außerdem: Wichtig für die weitere Bearbeitung des Haares sei nämlich unbehandeltes Haar. Das sei zum Beispiel auch einer der Gründe, warum so gut wie nie Haare aus Mitteleuropa zur Perückenherstellung verwendet würden. Hier würde nämlich durch die ganzen Haarpflegeprodukte und Färbemittel die Haarstruktur angegriffen. Abgeschnittene Zöpfe und Strähnen hätten außerdem gegenüber »aufgefegtem« Haar den Vorteil, dass sie die gleiche Wuchsrichtung hätten, was ein weiteres Qualitätskriterium sei. Deswegen Indien. Frau Maurer war richtig sauer. Ob wir sie denn für eine Betrügerin hielten?
Nupsi meinte: »Ich hab doch gar nichts gesagt.«
»Trotzdem«, sagte die Frau. »Sie sind ja dabei.« Dann wandte sie sich wieder an mich: »Wollen Sie denn nun eine Perücke oder nicht?«
»Eigentlich möchte ich keine«, antwortete ich. »Eigentlich würde ich gern mein mitteleuropäisches, überpflegtes Haar behalten. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Umstände mache.«
Da sagte sie nichts mehr und bekam einen roten Kopf. Ich wollte dann auch gar nicht mehr wissen, was aufgefegtes Haar eigentlich ist. Ich mochte Frau Maurer nicht.
Trotzdem probierte ich alle möglichen Perücken an, und Nupsi fotografierte mich. Mit einer sah ich aus wie eine minderbemittelte Serienkillerin, deren Friseurbesuch nicht so optimal verlaufen war, mit einer anderen wie eine bräsige Studienrätin, und mit wieder einer anderen hätte man mich für eine abgewrackte Hafennutte halten können. Wir mussten schrecklich lachen, was Frau Maurer irgendwie pietätlos zu finden schien, obwohl wir allein im Laden waren. Wir diskutierten dann mit ihr, und sie war nun professionell geworden, passte an, schaute und was weiß ich, und schließlich nahmen wir eine Perücke, die mir wirklich super stand. Ich trug sie dann sogar schon vor der Chemo, weil ich damit fünf Jahre jünger aussah und kein dünnes Fummelhaar mehr hatte, sondern kräftiges, wenn auch kastanienbraun eingefärbtes von einer Frau aus Indien, die es sich freiwillig hatte abschneiden lassen. Das Ding kostete über tausend Euro, und ich war wirklich froh, dass die Kasse das übernahm. Immer hatte ich über die hohen Beiträge gemeckert, doch jetzt war ich froh, dass ich eingezahlt hatte. Denn wer wusste schon, was noch kommen würde. Wer wusste das schon? Bis vor kurzem hatte ich mir ja im Traum nicht vorstellen können, dass ich mal Zweithaar brauchen würde.
So kann es gehen im Leben. Andererseits war es mir damals so lieber, als wenn ich aus dem Leben hätte gehen müssen. Und heute bin ich so weit, dass ich mir gar nicht mehr über eine Perücke Gedanken machen würde. Ich wäre bereit, für den Rest meines Lebens mit einer Glatze herumzulaufen. Einfach so. Für den Rest meines Lebens, wenn es länger dauern würde als drei Monate.
Gerade eben bin ich ein wenig traurig. Das gestehe ich mir nur selten ein. Es heißt ja, man soll jeden Moment genießen. Alles, was man tut, kann zum letzten Mal sein. Jedes Gefühl kann man zum letzten Mal haben. Doch eins ist sicher: Die Traurigkeit wird mich bis zum Schluss begleiten, auch wenn ich sie unterdrücke, wann immer ich kann. Ich bin sicher, dass sie nicht zum letzten Mal hier ist.
Ich bleibe stehen und atme tief durch, lehne mich an die nächstbeste Hauswand und drehe mich von den vorbeilaufenden Menschen weg.
Ich glaube, ich muss mich übergeben.
Verdammt nochmal, ich wäre so gern gesund.
Ich reiße mich zusammen, und als ich mit meinen Flyern auf mein Auto zulaufe, sehe ich einen Hilfspolizisten, der mir gerade ein Ticket verpassen will. Erst will ich ihm sagen, dass ich sehr krank bin und immer vergesse, meinen Schwerbehindertenausweis unter die Scheibe zu legen – was wirklich blöd ist, ich könnte ihn fest anbringen, aber ich will nicht, dass jeder sieht, dass ich schwerbehindert bin. Aber dann überlege ich es mir anders und sage freundlich: »Ach, wie schön. Ein Strafzettel! Hoffentlich nicht nur zehn Euro!«
Der Hilfspolizist, der sich schon rechthaberisch vor mir aufgebaut hat, ist irritiert. »Äh, ja, äh, also nein, also es sind zehn Euro.«
»Aber es wird mehr, wenn ich nicht zahle?«, vergewissere ich mich, und er nickt. »Wie läuft das dann ab?«, will ich wissen.
»Das weiß ich jetzt auch nicht«, sagt er.
»Aber ich. Erst kommen Mahnungen, dann Gerichtsvollzieher, und es kann sogar zur Erzwingungshaft kommen. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen. Wenn ich aber Einspruch einlege, kommt es irgendwann zur Gerichtsverhandlung, und in den meisten Fällen muss man dann doch zahlen. Und zwar ganz schön viel, weil man alle Kosten zusätzlich aufgebrummt bekommt. Oder?«
Er zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich schreib hier nur auf.«
»Ja, vergessen Sie das nicht«, sage ich. »Ich freue mich schon so auf den Bußgeldbescheid.«
Er glotzt mich an, als sei ich eine Irre.
»Ich werde nämlich nicht bezahlen«, sage ich stolz. »Und jetzt gebe ich Ihnen ein Rätsel mit auf Ihren Weg: Was glauben Sie, warum nichts passieren wird, obwohl ich diesen Strafzettel niemals bezahlen werde? Warum mir niemand etwas anhaben kann, egal wie hoch die Summe letztendlich ist?«
Der Hilfspolizist scheint zu überlegen. »Weil Sie vorhaben, sich irgendwohin abzusetzen?«
Ich nicke. »So was in der Art«, sage ich und öffne die Autotür.
Er steht da und runzelt die Stirn. Dann lässt er den Stift sinken. Offenbar hat er es sich anders überlegt.
Warum habe ich das nicht schon früher immer so gemacht?
Kapitel 2
Ich kann nicht mehr oft Auto fahren und musste es auch schon mal stehen lassen. Aber heute ist ein guter Tag. Irgendwie würde ich es als totale Selbstaufgabe ansehen, wenn ich mein Auto abmelde. Ich fahre ein kleines, in die Jahre gekommenes dunkelgrünes Cabrio, das ich sehr mag. Was passiert mit dem Auto, wenn ich mich irgendwohin abgesetzt habe? Es gibt noch so viel, worum ich mich kümmern muss. Was auch irgendwie nicht fair ist – soll ich jetzt drei Monate damit verbringen, meinen Nachlass zu regeln? Ich sollte mal lieber noch richtig auf die Kacke hauen! Aber ich bin ja so gewissenhaft, und mir graut davor, dass sich andere um meinen Kram kümmern müssen. Wenigstens habe ich genug gespart, um meine Beerdigung zu bezahlen. Ich muss mit Nupsi über alles sprechen. Plötzlich bin ich furchtbar müde. Trotzdem, jetzt suche ich erst mal meine Grabstelle.
Also fahre ich zum Friedhof Ohlsdorf, parke, steige aus und halte mein Gesicht kurz in die Sonne. Mir ist schwindlig, und ich warte einen Moment, bis ich wieder das Gefühl habe, gerade gehen zu können. Dann mache ich mich auf den Weg.
Auf dem Ohlsdorfer Friedhof sind viele Promis begraben. Hans Albers, Heinz Erhardt, Gustaf Gründgens, Inge Meysel. Der Friedhof ist schön. Ich komme sogar am Grab von Hans Albers vorbei, es hat eine ganz schlichte Platte mit roten Blumen davor. Er ist 1960 gestorben, sechs Jahre, bevor ich geboren wurde. Und ich sterbe 56 Jahre nach ihm. Interessant, dass ich, mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls, mein Sterbejahr weiß, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Hans ist 1891 geboren, also 75 Jahre vor mir. Was ja eigentlich auch egal ist. Wir werden uns nicht persönlich darüber austauschen. Über was für einen Quatsch ich hier sinniere! Ich schaue auf meinen Plan und gehe weiter. Es ist ein warmer Mittag und ordentlich was los. Viele ältere Damen sind hier, die die Gräber ihrer verstorbenen Männer pflegen. Sie unterhalten sich über dies und das, und wahrscheinlich haben sich schon Friedhofsgemeinschaften gebildet, und Freundschaften sind entstanden. Wahrscheinlich trifft man sich »immer montags am Eingang Hoheneichen«.
Herr Dinkelgärtner hatte recht: Es singen viele Vögel. Die Friedhofsgärtner können sich glücklich schätzen.
Jetzt muss ich nach rechts, und da hinten sehe ich schon den Baum, unter dem ich liegen werde. Das Grün der Blätter ist in natura noch schöner als auf dem Foto. Noch ein paar Schritte, dann stehe ich vor der Grabstelle und rieche die Baumrinde und frische Erde. Das Grab ist eingeebnet worden, so wie Herr Dinkelgärtner es gesagt hat. Mich interessiert, wer hier vorher gelegen hat. Sind da auch noch Knochen, oder werden die rausgeholt? Ich sehe mich um. Neben mir liegt ein Mann, der im Alter von 75 gestorben ist, und zwar vor fünf Jahren. Der weiße Marmorgrabstein ist groß, aber trotzdem schlicht gehalten, die Inschrift ist in glänzendem Silber verfasst. Es sieht edel aus, nicht protzig. Über dem Grab auf der anderen Seite des Baumes thront ein schöner Engel, der es zu bewachen scheint. Die Inschrift auf der Grabplatte ist nicht mehr zu erkennen, weil der Grünspan überhandgenommen hat.
Ich sehe mich um. Schön ruhig hier. Nur Vögel. Von ganz weit ein paar Stimmen und Straßengeräusche. Anfahrende Autos. Da scheint irgendwo eine Ampel zu sein. Ich gehe den Weg ein Stück entlang, dann wieder zurück. Es ist hier alles sehr gepflegt. Da kommt einer der Gärtner mit einer Schubkarre. »Moin«, sagt er, und ich grüße zurück.
»Sind Sie hier zuständig? Für diesen Bereich?« Er nickt. »Also auch für dieses Grab hier?« Ich deute auf meins, und er nickt wieder.
»Für das und noch für etliche andere. Wieso?«
»Ach, ich wollte es nur wissen. Und Sie pflanzen dann auch die Blumen drauf?«
»Ja klar. Ich bin ja der Gärtner.«
»Das ist schön. Wie ist denn Ihr Name?«
»Knut Hansen.«
»Dann werden wir uns zukünftig öfter sehen, Herr Hansen.«
»Aha. Wieso?«
Ich reiche ihm die Hand, und er nimmt sie und schüttelt sie. »Weil ich in ein paar Monaten hier liegen werde, und da ist es doch nett, jemanden zu kennen. Ich werde noch genau aufschreiben, welche Bepflanzung ich möchte.«
Knut Hansen kratzt sich am Kinn. »Das ist Ihr Grab?«
Ich nicke. Keine Ahnung, warum ich den Mann damit behellige, es ist nur gerade niemand sonst da. Die Situation ist schon irgendwie bizarr.
»Klar, ich werd das schön machen«, sagt er dann langsam und denkt kurz nach. »Und wenn Sie wollen, also wenn Ihnen das nicht zu viel ist, dann kann ich auch gern hin und wieder hier auf der Bank meine Frühstückspause machen. In der Sonne. Aber vielleicht woll’n Sie ja lieber allein sein.«
»Nein, ich bin ja auch sonst schon viel allein. Also wäre das sehr schön, wenn Sie mal kämen«, sage ich. »Dann hören wir den Vögeln zu, wenn sie singen.«
Ich muss mir tatsächlich das Szenario vorstellen: Knut Hansen sitzt auf der Bank, isst ein Mettbrötchen, neben ihm steht eine Thermoskanne, er starrt auf mein Grab, und die Vögel zwitschern.
Komisch. Ich stelle mir mein Grab und das Drumherum immer im Sommer vor, wenn es warm ist. Mir wird kalt, wenn ich an den Winter denke. Ich bin sowieso eine Frostbeule. Und unter der Erde ist es doch eisig. Vielleicht werde ich Herrn Dinkelgärtner noch sagen, dass ich in meinem warmen Mantel und mit Schal beerdigt werden möchte. Und in Fellstiefeln. Wer weiß, vielleicht ist es unter einer Schneedecke ja auch warm. War das nicht so, dass einem immer warm wird, kurz bevor man erfriert?
Ich glaube, ich drehe langsam durch. Ich mache mir zu viele Gedanken um Dinge, die ich bald sowieso nicht mehr ändern kann, denn selbst wenn es unter einer Schneedecke kalt ist, habe ich keine Wahl. Ich liege drunter. Ich habe auch überlegt, mich verbrennen zu lassen, aber das finde ich doch irgendwie gruselig. Gut, dass man von Würmern und so aufgefressen wird, ist auch nicht gerade erstrebenswert, aber verbrennen hat so was Endgültiges. Außerdem – angenommen, ein Forscher erfindet in ein paar Jahren ein Mittel gegen Lungenkrebs und gleichzeitig ein Serum, mit dem Tote aufgeweckt und wiederhergestellt werden, dann werde ich vielleicht ausgebuddelt, wache auf und kann da anknüpfen, wo ich aufgehört habe.
Aber das ist natürlich Quatsch. Ich werde allein hier liegen, bis ich verrotte. Wenigstens ist Knut Hansen dann da, und wir lauschen gemeinsam den Vögeln. Vielleicht setzt er sich auch im Winter zu mir. Er kann ja ein Kissen auf die Bank legen, damit die Nieren und die Blase schön warm bleiben. Damit ist nicht zu spaßen.
»Es ist eine wirklich schöne Vorstellung, dass Sie dann bei mir sitzen«, wiederhole ich. »Vielen Dank.« Mir liegt ein ›Ich kann es kaum erwarten‹ auf der Zunge, aber so sehr freue ich mich nun auch nicht darauf. Dafür sage ich: »Vielleicht singen die Vögel dann besonders schön.«
»Ich kann Ihnen dann auch gern was aus der BILD-Zeitung vorlesen. Ihr Horoskop oder so«, sagt Herr Hansen, der in diesem Moment der Bruder von Herrn Dinkelgärtner sein könnte, und nimmt so der Situation ihre von mir heraufbeschworene Schwülstigkeit. Es hätte nur noch ein getragenes Violinkonzert gefehlt.
Herr Hansen hat mir versprochen, sich besonders gut zu kümmern. Er soll unter anderem Rosenbüsche pflanzen, rosa und weiß, die sind zwar öfter mal von Schädlingen befallen, aber er wird gute aussuchen. Winterharte, versteht sich, aber sind Rosen das nicht immer? Und dann noch schöne Bodendecker, da macht er sich Gedanken. Gießen wird er auch, aber natürlich nicht übermäßig. Das täten einige Kollegen nämlich leider. Man müsse die Natur machen lassen, hat er mir erklärt, und nur im äußersten Notfall nachhelfen. Aber das wird schon. Ich zwinge ihn, hundert Euro von mir anzunehmen, was er eigentlich nicht will, dann aber doch tut. Herr Hansen ist ein sehr netter Mann. Er sagte, von dem Geld werde er guten Dünger kaufen, was mich einerseits freut, andererseits möchte ich, dass er sich selbst eine Freude macht, also haben wir beschlossen, dass er für fünfzig Euro Dünger kauft und die anderen fünfzig Euro für sich verjubelt. Er würde die Bierchen auf mich trinken, sagte er, und mir vielleicht auch mal zuprosten, wenn er nach der Arbeit auf der Bank sitzt und sich ein Schlückchen genehmigt. Mir gefällt diese Abmachung. Falls ich das mit dieser Vorsorge mache, werde ich die Rosen ansprechen. Auf keinen Fall werden die mir so typische Friedhofsblumen andrehen; Chrysanthemen kommen mir unter gar keinen Umständen aufs Grab.
Nun ist Herr Hansen gegangen, und die Müdigkeit, die während unseres Gesprächs kurzzeitig weg war, kommt wieder, vermischt mit Kopfschmerzen, die nach unten in die Gelenke strahlen. Ich setze mich auf die Bank. Nicht, dass ich hier noch umkippe, dann kann ich gleich auf dem Friedhof bleiben.
Die Gedanken rasen durch meinen Kopf. Ich muss alles aufschreiben. Ich muss meine Wohnung, die ich schon gekündigt habe, renovieren, ich muss meine Konten jemandem anvertrauen, Himmel, ich muss in jedem Fall ein Testament machen. Ich möchte nicht, dass der Staat mein Geld bekommt und damit Schindluder treibt. Was hat man nicht schon alles von Steuerverschwendung gehört. Es wurden schon Brücken gebaut, die nach fünf Jahren zusammenkrachten, es wurden intakte Fahrradwege saniert, Geld für Toilettenstudien wurde ausgegeben und in NRW im Zuge eines Strukturprogramms Aussichtsplattformen gebaut, die aber gar keine nennenswerten Aussichten hatten.
Nupsi soll alles bekommen. Viel wird es ja leider nicht sein. Und sie wird wohl einiges nach meinem Tod regeln müssen, auch wenn ich versuchen werde, so viel wie möglich vorher selbst zu erledigen. Ach je, ums Finanzamt muss ich mich auch kümmern. Die Steuererstattung, die Steuererstattung!
Es ist inzwischen 15 Uhr und die Septembersonne wirklich schön warm. Sie umhüllt mich wie ein Mantel; ich friere leicht in letzter Zeit. Da fliegen zwei Bienen vorbei. Ich erkenne sie als solche, weil sie rund und behaart sind. Wespen sind lang und glatt. Das hat Papa mir beigebracht. Er war Hobbyimker. Ich habe noch einige unangebrochene Gläser mit Honig von ihm. All die Jahrzehnte habe ich sie aufgehoben, weil es irgendwie das Letzte ist, was ich von ihm habe. Wenn der Honig, den er geschleudert hat, aufgegessen ist, dann ist Papa endgültig fort. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ihn leer zu machen. Den Honig kriegt auch Nupsi. Honig ist ja ewig haltbar. Ich leider nicht.
Ich schließe die Augen und halte mein Gesicht in die Sonne. Ich denke weiter nach, aber darf die Zeit nicht vergessen, denn später habe ich noch einen wichtigen Termin. Wichtige Termine lege ich mir neuerdings gern zeitnah und auch mehrere auf einen Tag, denn wer weiß, wann ich gar nichts mehr machen kann. Die beiden heute schaffe ich hintereinander. Ich muss mich nur zwischendurch ausruhen.
Was wird aus den ganzen Fotos, die ich sorgfältig in Alben geklebt habe? Fotos von Mama, Papa, den Omas und Opas, meinem Bruder Stefan. Fotos von Grillabenden, alle sehen glücklich aus, hoch die Tassen. Urlaube in Dänemark und Spanien und Italien und Jugoslawien, Hilfe, ich weiß noch, wie wir da eine schreckliche Straße entlanggefahren sind, eine Haarnadelkurve hinter der nächsten, und unser Ford Taunus hatte wie alle Autos damals keine Servolenkung. Links von uns war eine Felswand, rechts von uns ging es hundert Meter in die Tiefe, ohne Leitplanke. Als wir endlich auf Krk ankamen, feierten wir lautstark unser Überleben.
Ein halbes Jahr später, es war wie eine schreckliche Ironie des Schicksals, sind meine Eltern und mein Bruder auf der A5 tödlich verunglückt. Ein Lkw-Fahrer war am Steuer eingeschlafen. Wir wohnten im Taunus, in Bad Homburg, und meine Eltern hatten Stefan zu einem Fußballturnier in die Wetterau gebracht, mitgefiebert, sich gefreut, dass die Mannschaft gewonnen hatte, und dann war man nach Hause gefahren. Ich war nicht dabei. Ich hasste Fußballturniere, und damals mochte ich auch Stefan nicht besonders, wir waren nur am Zanken. Kurz vor dem Turnier hatten wir uns auch in den Haaren gehabt. Ich wollte meine enge Jeans bei 60 Grad waschen, damit sie noch enger saß und ich damit Klaus Hollinger, in den ich damals verknallt war, beeindrucken konnte, aber Stefan blockierte die Waschmaschine mit den blöden Trikots seiner Mannschaft. Wir fetzten uns wie die Kesselflicker. Ich war damals 15, er 16. Noch ein Jahr davor hatte es anders ausgesehen, da hingen wir aneinander wie Kletten. Aber wenn man erwachsen wird, ändert sich die Sichtweise. Ich fand die Mädchen doof, die Stefan anschleppte, und Stefan fand es unmöglich, dass seine Schwester sich so schminkte, wie ich es tat. Ich liebte lange Zeit ganz treu Abba und Cat Stevens, er dagegen Iron Maiden, Black Sabbath und Judas Priest. Wir gingen beide ins Jugendcafé, sprachen dort aber kein Wort miteinander. Trotz seines Musikgeschmacks war er ein Popper – deswegen hörte er seine Musik nur heimlich, denn die Popper mochten eigentlich nur Synthie-Pop wie Depeche Mode, Camouflage oder A Flock of Seagulls –, und ich war eine von denen, die man Ökos nannte. Ich färbte meine Haare mit Henna und trug indische Kleider mit Glöckchen und Samtpantoletten aus der indischen Boutique. Stefan trug Seitenscheitel, Benetton, Fiorucci und Lacoste und warf sich Pullover über die Schultern und verknotete die Ärmel vor der Brust, was er total cool fand. Er trug Collegeschuhe mit Bömmelchen, und ich hatte Angst, einen schwulen Bruder zu haben.
Früher hatten wir stundenlang über das Leben sinniert und dabei Nutellabrote gegessen. Und zwar ganz spezielle: Wir schnitten uns dicke Scheiben Brot ab, schmierten ordentlich Butter drauf, streuten Salz auf die Butter und strichen dann Nutella drauf. Himmel, war das lecker. Als Stefan tot war, habe ich öfter mal solche Nutellabrote geschmiert, bin zu seinem Grab gegangen, habe mich danebengesetzt und sie gegessen. Einmal vergrub ich eins in einer Brottüte in der Erde, Stefan sollte auch was abhaben. Was natürlich unmöglich war, und außerdem wollte ich nicht, dass Tiere es ausgruben und möglicherweise dabei das Grab verwüsteten – also buddelte ich die Tüte wieder aus und aß das Brot selbst. Später begann ich, mit Nupsi Nutellabrote zu essen, immer, wenn wir vor Entscheidungen standen oder wenn es um Männer ging. Ich habe lange keine Nutellabrote gegessen, weil es keine Entscheidungen und Männer mehr geben wird. Jedenfalls nicht für mich.
Ich weiß noch, dass ich mit Stefan früher oft im Garten gelegen und in den klaren Sternenhimmel geschaut habe. Damals war der Tod für uns ein großes Thema, weil Opa gerade gestorben war. Ich fragte Stefan mal: »Wie ist es wohl, tot zu sein?« »Es ist gar nicht mehr«, antwortete Stefan, und wir starrten weiter zu den Sternen und hofften, trotzdem ein Zeichen von Opa zu bekommen, aber da kam nichts.
Und kurze Zeit später waren Stefan und meine Eltern auch tot. Ich kam bei der Schwester meiner Mutter in Frankfurt unter, bis ich 18 war. Es war okay bei Tante Margaret. Kurz nach meinem Auszug ist sie mit ihrem Lebensgefährten nach Tasmanien gezogen. Während meiner Jahre bei ihr und in den Jahren darauf starben meine beiden Omas und der andere Opa, und dann gab es eigentlich niemanden mehr. Meine Eltern und Stefan waren in Bad Homburg beerdigt, und ich besuchte ihre Gräber, sooft ich konnte.