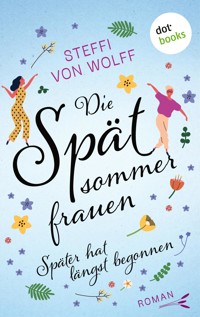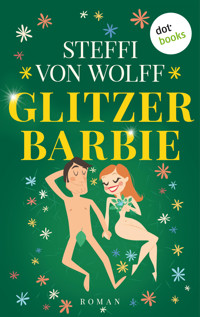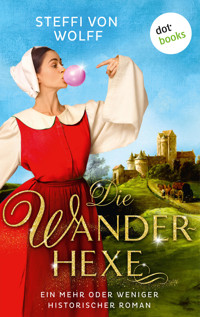
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Mittelalter ist nichts für Feiglinge: Der historische Satire-Roman »Die Wanderhexe« von Steffi von Wolff jetzt als eBook bei dotbooks. Hessen, 1534: Die siebzehnjährige Lillian Knebel ist gelangweilt. Außer dem ein oder anderen Pesttod oder der gelegentlichen Hinrichtung herrscht in dem kleinen Dorf Münzberg absolut tote Hose. Als die örtliche Kräuterkundige als Hexe auf dem Scheiterhaufen landet, beschließt Lillian, sich selbst mit Tränken und Salben zu versuchen – und erfindet dabei zufällig die Anti-Baby-Pille. Natürlich sehr zum Missfallen der kirchlichen Obrigkeit, der es gar nicht passt, dass die Frauen im Dorf plötzlich so viel Selbstbestimmung haben. Also beschließen sie: Lillian muss brennen! Wenig begeistert davon flieht sie zusammen mit Bertram, einem Scharfrichter mit Blutphobie, dem talentlosen Hofnarren Laurentius und ihrer depressiven Kuh Hiltrud. Es beginnt eine verrückte Reise quer durch Deutschland und bis nach Britannien … »Schnell, absurd, echt komisch!« Cosmopolitan Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die humorvolle Romanparodie »Die Wanderhexe« von Steffi von Wolff wird alle Fans der Bestseller von David Safier und Tommy Jaud begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Hessen, 1534: Die siebzehnjährige Lillian Knebel ist gelangweilt. Außer dem ein oder anderen Pesttod oder der gelegentlichen Hinrichtung herrscht in dem kleinen Dorf Münzberg absolut tote Hose. Als die örtliche Kräuterkundige als Hexe auf dem Scheiterhaufen landet, beschließt Lillian, sich selbst mit Tränken und Salben zu versuchen – und erfindet dabei zufällig die Anti-Baby-Pille. Natürlich sehr zum Missfallen der kirchlichen Obrigkeit, der es gar nicht passt, dass die Frauen im Dorf plötzlich so viel Selbstbestimmung haben. Also beschließen sie: Lillian muss brennen! Wenig begeistert davon flieht sie zusammen mit Bertram, einem Scharfrichter mit Blutphobie, dem talentlosen Hofnarren Laurentius und ihrer depressiven Kuh Hiltrud. Es beginnt eine verrückte Reise quer durch Deutschland und bis nach Britannien …
»Schnell, absurd, echt komisch!« Cosmopolitan
Über die Autorin:
Steffi von Wolff, geboren 1966 in Hessen, war Reporterin, Redakteurin und Moderatorin bei verschiedenen Radiosendern. Heute arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen und Magazine wie »Bild am Sonntag« und »Brigitte«, ist als Roman- und Sachbuch-Autorin erfolgreich und wird von vielen Fans als »Comedyqueen« gefeiert. Steffi von Wolff lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Die Autorin im Internet: steffivonwolff.de und facebook.com/steffivonwolff.autorin
Steffi von Wolff veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Bestseller »Glitzerbarbie«, »Gruppen-Ex«, »ReeperWahn« und »Rostfrei«, »Fräulein Cosima erlebt ein Wunder«, »Das kleine Segelboot des Glücks«, »Der kleine Buchclub der Träume«, »Das kleine Hotel an der Nordsee«, »Das kleine Haus am Ende der Welt«, »Das kleine Appartement des Glücks«, »Kein Mann ist auch (k)eine Lösung«, »Die Spätsommerschwestern« und »Die Wanderhexe«, sowie die Kurzgeschichten-Sammelbände »Das kleine Liebeschaos für Glückssucher« und »Das kleine Glück im Weihnachtstrubel«. Eine andere Seite ihres Könnens zeigt Steffi von Wolff unter ihrem Pseudonym Rebecca Stephan im ebenso einfühlsamen wie bewegenden Roman »Zwei halbe Leben«.
***
eBook-Neuausgabe April 2024
Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »Die Knebel von Mavelon« bei Fischer, Frankfurt am Main
Copyright © der Originalausgabe 2006 Fischer Taschenbuch Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Master1305, VolodymyrSanych und eines Gemäldes von Canaletto »Festung Königstein« und David Teniers der Jüngere »Eine Burg und ihre Besitzer«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-941-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Wanderhexe«an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Steffi von Wolff
Die Wanderhexe
Ein mehr oder weniger historischer Roman
dotbooks.
Widmung
Meinem Schwiegervater, Professor Dr. Wilfried Gunkel.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps und Bücher
übers Mittelalter.
Du hättest dich bestimmt sehr über dieses hier gefreut.
Ich danke dir für alles!
I.
Ich finde die Pest zum Kotzen.
Man muss sich das mal vorstellen: Bloß wegen einer Ratte bekommt man plötzlich einen heißen Kopf, und dann bilden sich am ganzen Körper Beulen. Die Schmerzen sind unerträglich. Neun Dorfbewohner sind jetzt schon an der Pest gestorben, und ich weiß, dass es noch mehr werden. Da bevorzuge ich doch einen vereiterten Appendix. Das geht dann schneller mit dem Sterben. Der einzige Vorteil, den die Pest bringt, ist, dass man sich ab einem bestimmten Stadium keine Sorgen mehr über sein Aussehen und sein Gewicht machen muss. Das erledigt die Pest dann für einen.
Aber was rede ich da. Ich bin schließlich gesund und hoffe, das auch zu bleiben. Mein Name ist Lilian Knebel, ich bin siebzehn Jahre alt. Ich habe blonde Haare und bin darüber sehr froh, denn wenn meine Haare rot wären, hätte ich möglicherweise ein Problem. Ich habe auch keine unreine Haut oder gar Warzen im Gesicht, denn dann hätte ich ebenfalls ein Problem. Also, nicht mit mir selbst, sondern mit Richter Tiburtius oder Pater Quentin, der ziemlich dicke mit dem Erzbischof von Fulda ist. Die mögen alle keine Frauen mit roten Haaren und Warzen und machen gern mal kurzen Prozess. Dann müssen sich die Frauen mit den roten Haaren und den Warzen unangenehmen Verhören aussetzen. Hochnotpeinliche Verhöre, falls Sie verstehen, was ich meine. Die enden dann meistens damit, dass die Frauen gestehen, schon mal nachts auf einem Besen durchs Mittelhessische geflogen zu sein. Oder sie geben zu, schon mal ein Huhn für was auch immer geopfert zu haben. Oder so was Ähnliches.
Wir wohnen in Münzenberg. Das ist eine idyllische Ortschaft inmitten des hügeligen Hessenlands in der Gemarkung Mavelon. Wir, das sind ich, meine Eltern, meine sechs Geschwister und ungefähr siebenhundert andere Menschen. Alle von uns sind Untertanen. Derer von Pritzenheim. Die von Pritzenheimer wohnen auf der Burg Münzenberg, die hoch herrschaftlich über uns allen thront. Sie ist ungefähr dreihundert Jahre alt, und ständig bauen irgendwelche Handwerker daran herum. Ab und zu verliert einer der Handwerker durch das Aufeinandertreffen unglücklicher Zufälle eine Hand oder wird von einem recht großen Stein erschlagen, und ebenfalls ab und zu verliert einer das Gleichgewicht und stürzt in die Tiefe. Das ist allein schon deswegen nicht so schön, weil man leider ziemlich lange und auch tief fällt. Aber schon am nächsten Tag sind andere Handwerker da, die dann auch irgendwann von einem Stein getroffen werden oder herunterfallen. Nun ja. Mir tun die Leute leid, aber man gewöhnt sich eben an alles. Ich bin froh, dass mein Vater Bauer ist und nicht an der Burg herumbauen muss.
Ansonsten ist Münzenberg ein wirklich schönes Dorf mit breiten Gassen und eng beieinanderstehenden Häusern. Umgeben ist das Dorf von Laubwäldern und weitläufigen Feldern, die wir bewirtschaften. Jeder hier hat Vieh, und das Vieh weidet im Sommer auf grünen Weiden.
Wir schreiben das Jahr 1534. Es ist Frühling und schon ein wenig warm. So warm jedenfalls, dass wir in der Nacht die Tür ein Stück weit auflassen können. Das Vieh ist seit zwei Wochen wieder auf der Weide und muss nicht mehr bei uns in der Hütte hausen. Der Gestank ist ab und zu wirklich unerträglich.
Unerträglich ist auch der Graf. Gernot von Pritzenheim. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Sobald er auf seinem Schimmel ins Dorf geritten kommt, müssen alle seine Untergebenen alles stehen und liegen lassen und sich verbeugen beziehungsweise auf die Knie fallen.
»Heda, ihr Leut!«, pflegt der Graf zu rufen, während der Schimmel schnaubt und manchmal auch wiehernde Geräusche von sich gibt. Der Schimmel ist fast noch eingebildeter als der Graf. Er ignoriert die Leute und schlägt manchmal aus, und ich habe oft das Gefühl, er möchte lieber ein Rappe sein und kein gemeiner Schimmel. Pritzenheim geht oft ins Schankhaus und lässt sich da volllaufen. Natürlich ohne zu bezahlen. Er ist schließlich der Graf.
Wenn im Dorf geheiratet wird, kommt er ebenfalls angeritten und nimmt die Braut für die Dauer der Hochzeitsnacht mit auf seine Burg. Ius primae noctis eben.
Allein schon aus diesem Grund werde ich nie heiraten. Die Vorstellung, das Geschlechtsteil des Grafen auch nur anzuschauen, lässt mich erschaudern. »Dein Stecken und Stab trösten mich« bekommt dann mit Sicherheit eine ganz andere Bedeutung.
Aber ich schweife ab. Schließlich geht es hier nicht nur um den Grafen.
Wir sind eine ziemlich nette Gemeinschaft hier in unserem Dorf. Überschaubar. Ich mag fast alle. Manche sind sogar richtig nett. Zum Beispiel Bertram. Bertram ist Scharfrichter. Und mit ihm beginnt auch die Geschichte, die ich erzählen möchte.
»Was soll ich nur tun, Lilian, sag es mir!« Bertram ist völlig verzweifelt. In einer Stunde müssen wir alle am Schafott stehen. Eine erneute Hinrichtung steht heute auf dem Terminplan, und alle aus der Gemarkung Mavelon müssen teilnehmen. Das hat Graf von Pritzenheim so angeordnet. Wer einer Hinrichtung beiwohnt, überlegt sich im Anschluss
daran nämlich zehn- bis zwanzigmal, ob er zum Dieb oder Mörder wird. Ich mag keine Hinrichtungen. Sie kosten unsere Zeit, die Kühe werden nicht rechtzeitig gemolken, die Ziegen und Hühner und Karnickel nicht gefüttert, und die dummen Sprüche, die der Graf vor der Hinrichtung von sich gibt, mag ich noch weniger. Hinrichtungen bringen den ganzen Tagesplan durcheinander. Am nervigsten ist das Hängen, bis der Tod eintritt. Das kann Stunden dauern, und im Herbst oder Winter bekommt man kalte Füße, während der Delinquent ununterbrochen versucht, den Strick von seinem Hals zu lösen, was natürlich gar nicht geht, weil ihm die Hände auf den Rücken gebunden sind. Manchmal sind die Hinrichtungen aber ganz erträglich, nämlich dann, wenn Pritzenheim sich überlegt hat, den zum Tode Verurteilten in einem Eisenkäfig, der an der Burgmauer befestigt ist, verhungern oder verdursten zu lassen. Da kann man ja nicht die ganze Zeit dabeibleiben, das sieht selbst er ein. Das dauert ja bislang Ewigkeiten. Man muss nur aufpassen, dass man einige Wochen später nicht von einem Oberschenkelknochen oder einem Schädel getroffen wird, wenn man direkt unter dem Käfig vorbeiläuft oder -reitet. Das ist schmerzhaft. Und das Pferd könnte scheuen.
Nun gut. Zurück zu Bertram.
Bertram weint fast. Mit roten Augen schaut er mich an: »Ich konnte Köpfungen noch nie gut vertragen«, klagt er. »Weißt du, wie furchtbar das ist, wenn das Blut spritzt?« Ich nicke mitfühlend. Bertram stampft mit dem Fuß auf: »Warum musste ich Vater am Sterbebett versprechen, dass ich in seine Fußstapfen trete? Hätte ich doch nur abgelehnt. Ich wollte Müller werden. Aber nein, aber nein, ich soll ständig jemanden töten. Das sei Familienehre, hat Vater gesagt. Wie ich das hasse.«
Wir sitzen auf einer Holzbank vor Bertrams Hütte. Irgendwo verbrennt jemand Holz, und der beißende Geruch weht über uns hinweg. Bertram hat sich mir schon immer anvertraut, ich bin die Einzige, die weiß, dass er seinen Beruf aus ganzer Seele hasst. Aber alle Männer in Bertrams Familie waren Scharfrichter, und da blieb Bertram nichts anderes übrig, als auch Scharfrichter zu werden. Sein Vater hat ihm das Töten von der Pike auf beigebracht; schon mit sieben Jahren wusste Bertram, wie man einen Menschen so hängt, dass das Genick auch wirklich bricht. Er hat auch gelernt, mit Messern und Äxten umzugehen. Bei seiner ersten eigenständigen Hinrichtung war Bertram sechzehn und so nervös, dass er vorher mehrere Male in unseren kleinen Fluss gekotzt hat. Ich habe damals seinen Kopf gehalten und gebetet, dass niemand mitbekommt, dass Bertram vor lauter Angst kotzen muss. Sein Vater hätte ihn hingerichtet. Und mich dazu.
»Denk einfach an was Schönes«, versuche ich Bertram zu trösten.
Der sieht mich mit seinen tränenden Augen fassungslos an: »Wie soll ich denn an was Schönes denken, wenn ich diesem armen Opfer, das meiner Meinung nach sowieso wie fast alle unschuldig ist, den Kopf abtrenne?«, fragt er mich und schaut auf seine Hände. »Ich bin ein Mörder«, sagt er. »Ein Mörder, Mörder, Mörder!«
»Das stimmt«, gebe ich zu, sage dann aber schnell: »Aber du bist ein netter Mörder.«
Doch das hilft Bertram in diesem Moment auch nicht weiter. Schließlich muss er gleich einen Unschuldigen enthaupten.
»Ich könnte sagen, dass ich unpässlich bin«, meint er und sieht mich an, als ob er gerade die Idee seines Leben hätte. »Unpässlich sind nur Frauen«, erkläre ich ihm zum wiederholten Mal.
»Dann sage ich einfach, dass ich mich in letzter Zeit so fiebrig fühle und auch nässende Wunden habe. An den Beinen«, kommt es wieder von Bertram, der verzweifelt einen glaubwürdigen Grund sucht, um nicht die Messer zu wetzen. »Nein«, frohlockt er, »hier! Schau! Meine Hand! Sie eitert. Von innen. Man kann es von außen noch nicht sehen. Und mit der linken Hand kann ich nichts tun!«
Ich schüttele den Kopf: »Dann wirst du selbst hingerichtet«, sage ich und verdrehe die Augen. Es sind immer wieder dieselben Diskussionen und sie führen dazu, dass Bertram dann doch Köpfe abtrennt, Hälse stranguliert und Körper mit der Hilfe von Kaltblütern vierteilen lässt. Gar nicht selten muss er auch vorher foltern, was für ihn die größte Folter überhaupt ist. Zum Glück trägt er bei der Folter und auch bei den Hinrichtungen eine blickdichte Kutte, so dass die Zuschauer sein entsetztes Gesicht nicht sehen müssen. Aber ich weiß, wie er sich fühlt. Weil ich Bertram kenne, seit ich auf der Welt bin.
Die schlimmste Hinrichtung war die vorletzte. Bertram hatte sich am Abend zuvor in der Dorfschänke die Kutte volllaufen lassen und war jenseits von Gut und Böse. Barthel, der Handlanger, musste immer neuen Most holen, aber das nützte auch nichts. Nachts dann klopfte Bertram an die Wand unserer Hütte, und ich schlich mich raus.
Er sah schrecklich aus. Davon mal ganz abgesehen, dass er weder klar sprechen noch gerade stehen konnte, schwang er ununterbrochen ein Beil um seinen Kopf herum.
»Was tust du denn da?«, fragte ich flüsternd und sah mich verstohlen um. Wenn uns hier irgendjemand sehen würde, wäre das nicht ganz so gut.
»Ich will ... ich will ... mich köpfen«, presste Bertram hervor und schwang erneut das Beil. »Damit ich morgen den
armen Wiedekind nicht ... AAAH!« Erschrocken sprang ich nach vorn. Bertram hatte sich mit der Axt an der Schulter getroffen und blutete stark. Auch das noch. Bertram stand unter Schock. Er schielte auf die klaffende Wunde und war nicht zu beruhigen. Dann ging es los: »Lilian, Lilian, LILIAN! Das Blut, das Blut, DASBLUT! Mach, dass das Blut weggeht!« Er war zwar immer noch nicht in der Lage, sich in irgendeiner Form zu bewegen, wegen des Schocks, des Schocks, aber mich anschreien, das konnte er.
Dann rumorte Hiltrud auch noch in unserer Hütte herum. Hiltrud ist eine unserer Milchkühe und ein fürchterlich nervöses Huhn. Hiltrud ist des Weiteren sehr rücksichtslos. Wenn sie sich schlafen legt, und das tut sie ja im Winter in unserer Hütte, achtet sie überhaupt nicht darauf, wohin sie ihre vierhundert Kilo bettet, sondern lässt sich einfach da fallen, wo es ihr gerade passt. Also im Zweifelsfall direkt auf mich. Ich habe auch schon geträumt, dass ich gerade eben im Sumpf versinke und als Moorleiche ende, aber als ich aufwachte, musste ich feststellen, dass Hiltrud sich über mir entleert und einen zentnerschweren Kuhfladen abgelassen hat. Auf mein Gesicht. Nicht nur aus diesem Grund wasche ich mich täglich. Hiltrud ist wirklich schwierig. Manchmal führt sie sich wie eine Prinzessin auf. Immer dann, wenn es ans Melken geht und sie aber lieber weiter grasen möchte. Will man sie von der Weide führen, lässt sie sich grundsätzlich auf den Rücken fallen, streckt alle vier Läufe von sich, schließt die Augen und tut so, als hätte sie gerade einen ganz, ganz schlimmen Albtraum. Und den Menschen, der eine Kuh melken kann, die auf dem Rücken liegt und Albträume vorschützt, soll man mir mal zeigen.
»Sei still!«, herrschte ich Bertram an und begutachtete erst mal die Wunde. Er übertrieb wie immer. Warum kann er nicht einfach mit seinem Beruf leben, so wie jeder andere auch? Ein Bauer sticht sich doch auch nicht mit der Heugabel, wenn die Ernte ansteht.
Ich drehte mich um. Niemand hatte uns bis jetzt bemerkt. Wenn Bertram jetzt leise blieb, würde uns auch niemand bemerken. Aber Bertram war nicht zu beruhigen:
»Es geht hier um Wiedekind Gottholf!«, sagte er anklagend und drückte an seiner Fleischwunde herum, so, als ob er hoffte, dass die Wunde schon angefangen hätte zu eitern und er mehr Grund hätte, lauthals zu greinen.
»Ich weiß, Bertram, ich weiß«, sagte ich und streichelte seinen Arm.
»Wiedekind ist einer meiner besten Freunde«, klagte Bertram und setzte sich erschöpft auf den Lehmboden. Wenigstens lallte er nicht mehr lauthals herum. »Wir sind zusammen aufgewachsen, so wie wir alle hier, Lilian, falls du verinnerlichen möchtest, was ich meine. Und dann diese Anschuldigung, dass er die Hühner vergiftet hat. Dabei haben die Hühner einfach bloß zu große Holzstücke gefressen und sind daran erstickt. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Aber Richter Tiburtius glaubt ihm nicht. Er will ihn loswerden. Wiedekind war ihm schon immer ein Dorn im Auge. Weil seine Tochter mit ihm angebändelt hatte. >Denk dir was Grausames aus<, hat Tiburtius zu mir gesagt. Kannst du dir das vorstellen?«
»Verdammt!«, sagte ich und seufzte.
Aus einem offenen Fenster steckte Hiltrud ihren Kopf und wollte gestreichelt werden. Sie bleckte die Zähne und fuhr ihre riesige Zunge aus. Nachdenklich kraulte Bertram ihr zwischen den Augen herum, die Hiltrud genüsslich verdrehte. »Ich wollte Wiedekind eigentlich schon gestern Abend umbringen, um ihm größeres Leid zu ersparen«, sagte er. »Und Tiburtius dann erzählen, Wiedekind hätte sich das Leben genommen.« Hiltrud ließ ihre Zunge so weit heraushängen, dass man für sechs Leute Teller und Tassen darauf hätte abstellen können. Und eine große Suppenschüssel.
Wir schwiegen beide und starrten in die sternenklare Nacht, und ein Schauder lief mir über den Rücken. Bertram ist nun mal kein erfinderischer Scharfrichter, der sich einen Spaß daraus macht, sich immer neue Tötungsarten zu überlegen. Er altert mit jeder Hinrichtung und sieht manchmal schon aus wie ein Greis Anfang zwanzig.
Bertram berichtete mir dann haarklein, wie er mit Wiedekind in den Wald gegangen war, um giftige Pilze zu sammeln, die Wiedekind dann essen sollte. Da aber keiner der beiden wusste, wie man giftige von ungiftigen Pilzen unterscheidet, und sie nach dem siebten offensichtlich ungiftigen Pilz keine Lust mehr hatten, noch mehr Pilze zu probieren, kehrten sie unverrichteter Dinge wieder zurück und überlegten die ganze Nacht lang, wie Wiedekind schmerzfrei unter die Erde gebracht werden könnte. Schließlich suchten sie Rat und Hilfe bei Egbert, dem Dorfschmied. Der ist für die ganzen Folter- und Hinrichtungsinstrumente zuständig. Er ist zwar etwas, nun sagen wir mal, langsam und schwerfällig in seinen Gedanken, aber man kann ihm trauen. Und Egbert hatte schließlich die zündende Idee: »Ganz einfach«, meinte er. »Du, Bertram, solltest dir was Grausames ausdenken. Ich rate dir, dem Richter vorzuschlagen, Wiedekind wirklich grausam hinzurichten.«
»Und dann?«, fragte Bertram neugierig.
»Ja, und dann?«, wollte auch Wiedekind wissen.
»Lasst mich doch mal ausreden«, meinte Egbert und schwieg, um einige Minuten später zu sagen: »Wirklich grausam hinzurichten.«
»Ja, mein Freund, das haben wir vernommen«, Wiedekind wurde ungeduldig. »Wie geht es weiter?«
»Nun, dann wirst du grausam hingerichtet«, verkündete
Egbert stolz. »Ich halte das für die beste Lösung. Es wird sicher nicht schnell gehen«, meinte er zu Wiedekind und klopfte ihm dabei wohlwollend auf die Schultern. »Gar nicht schnell gehen, da kannst du ganz unberuhigt sein.« Aber sonst ist Egbert wirklich ein netter Mensch. Und so hilfsbereit.
Die Hinrichtung war dann eine einzige Katastrophe. Bertram fesselte seinen Freund auf die Streckbank und versprach ihm leise, ihm irgendwann, wenn keiner hinschaute, schnell einen Dolch in die Rippen zu stoßen, aber durch die ganze Aufregung vergaß er das dann wieder und verhedderte sich zu allem Überfluss auch noch mit dem linken Fuß in einem Seil, das unter einer Winde hing, und musste dann kurbeln, und zwar ziemlich stark und schnell, weil das Seil seinen Fuß doch arg abquetschte, und wir standen alle da und beteten für Wiedekind, und meine Mutter bekreuzigte sich, und der blöde Gaul vom Grafen Pritzenheim tat so, als ob ihn das alles sehr stark mitnehmen würde, und dann gab es einen fürchterlichen Schlag, weil Bertram so fest an dem Seil zog, dass die ganze Streckbank brach, und Wiedekind gab es dann nicht mehr in einem Stück, sondern in ungefähr vierzehn, und das, was von ihm übrig war, flog durch die Gegend. Was mich am meisten an der ganzen Sache freute – abgesehen davon, dass Wiedekind nun doch einen schnellen Tod hatte – war die Genugtuung, dass sein Arm mit geballter Faust direkt in das Gesicht vom Grafen flog, der zuvor dastand und Maulaffen feilhielt und dann nicht mehr dastand und Maulaffen feilhielt, weil er nämlich nach hintenüber fiel und zwei Zähne verlor.
Wirklich, es ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal. Erst das große Gejammer von Bertram, und dann müssen sie doch alle sterben, ob sie nun Wiedekind oder sonst wie heißen.
Die arme Seele, die heute sterben muss, hat es wahrlich nicht verdient, da bin ich mir sicher. Zum Glück sind Bertram und ich unbeobachtet geblieben, und ich konnte ihn irgendwann dazu bringen, nun endlich seine Scharfrichterkutte zu holen.
Die Sonne steht schon recht hoch am Himmel, als wir uns alle auf dem Marktplatz versammeln. Eigentlich ist der Marktplatz sehr schön. Es gibt einen großen Brunnen, und Linden spenden Schatten. Unter den Linden spielen normalerweise Kinder, aber heute nicht. Es ist beinahe unheimlich still. Noch nicht mal das Getrappel von Hufen ist zu hören, weil die Tiere heute alle im Stall sind. Wegen der Hinrichtung.
Der Delinquent ist diesmal eine Delinquentin. Sie heißt Anneke, ist das Eheweib von Friedhelm Engefers und wird bezichtigt, der Hexerei zu frönen. Wer nämlich in der Gemarkung Mavelon mit Heilkräutern herumwirtschaftet, hat es nicht leicht. Auch, wenn die Heilkräutermischungen sich als hilfreich bei Krankheiten erweisen sollten. Nein, das wird hier nicht gern gesehen. Anneke jedenfalls wird Folgendes vorgeworfen: Sie soll einen Zaubertrank aus neunerlei Kräutern gebraut haben. Unter anderem aus Malve, Vogelknöterich, Mutterkraut, Lavendel, Eberraute und Pestwurz.
Ja, und? Soll man Anneke doch brauen lassen.
Aber nein. Es hat zwar niemanden interessiert, für was oder gegen was diese Mixtur gut oder schlecht ist, aber Anneke sei eine Hexe. Der Meinung war Richter Tiburtius, und weil niemand sich jemals trauen würde, auch nur das Geringste gegen das Wort von Richter Tiburtius zu sagen, ist Anneke eben eine Hexe. Wegen des Vogelknöterichs und der ganzen anderen Sachen.
Ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass Anneke eine Hexe ist.
Ich glaube überhaupt und gar nicht, dass es Hexen gibt, aber das werde ich niemandem auf die Nase binden. Was ich glaube, ist etwas ganz anderes: Die haben Angst. Mit die meine ich Richter Tiburtius, den Grafen Pritzenheim und die ganzen komischen Bischöfe, die manchmal in prunkvollen Kutschen durch Münzenberg ziehen, huldvoll lächeln und uns den Segen Gottes erteilen. Die haben Angst davor, dass jemand herausfinden könnte, dass nicht Gott allein Krankheiten heilt, sondern eventuell jemand, der sich mit diesen ganzen Kräutern auskennt und dazu noch ein Weib ist. Was ich nämlich weiß: Annekes Salben und Getränke, die sie aus den verschiedenen Kräutern herstellt, haben schon vielen hier geholfen. Anneke musste heimlich zu den Kranken gehen. Frische Pfefferminze, in kochendes Wasser gegeben, hat schon manches Unwohlsein gelindert, und selbst ich habe schon meine Erfahrung mit Annekes Kräutern gemacht. So etwa alle fünfundzwanzig Tage ereilt uns Weibsleute nämlich dieser denkwürdige Schmerz, dem Krämpfe und heftiges Unwohlsein folgen können. Blutungen sind an der Tagesordnung in dieser Zeit, und ich weiß bis heute nicht, warum dies so ist, woher es kommt und was es zu bedeuten hat. Meine Mutter kann ich solche Dinge nicht fragen. Anneke gab mir Johanniskraut, das ich aufbrühen und trinken sollte, was ich auch getan habe. Seitdem geht es mir während der Tage, an denen ich diese Schmerzen habe, wirklich besser. Es ist ein Gefühl der Leichtigkeit, gepaart mit Freude. Ein gutes Gefühl. Gut, manchmal ist mir ein wenig schwindelig, aber trotzdem ist es ein gutes Gefühl. Ein Gefühl, über das ich mit niemandem zu sprechen wage. Noch nicht mal mit Bertram.
Anneke ist eine wunderschöne Frau. Das kommt noch erschwerend hinzu. Anneke hat dunkelgrüne, wissende Augen, hüftlanges schwarzes Haar, das ihr in vollen, üppigen Locken über die Schultern fällt, und immer leicht rötliche Lippen. Ihre Figur ist vollkommen. Selbst nach zwei Geburten ist sie rank und schlank, ihr Körper wirkt biegsam wie eine Gerte, ihr Busen ist rund und fest. Aber das eigentlich Faszinierende an Anneke ist ihre Ausstrahlung. Wenn Anneke die Dorfschänke betritt oder auf die Bleiche kommt, um ihre Wäsche zum Trocknen auszubreiten, ist jeder still. Niemand sagt ein Wort. Keine ist so schön wie Anneke. Und niemand nimmt das mit einer solch gelassenen Selbstverständlichkeit hin wie sie. Niemals würde sie mit ihrer Schönheit kokettieren. Ich glaube, Anneke weiß ganz genau, was viele über sie denken, Frauen wie Männer. Die Frauen, nun ja, die sind neidisch, und die Männer, ja, die Männer, die würden nur zu gern mit Anneke anbändeln. Aber Anneke nicht mit ihnen. Sie liebt ihren Mann von ganzem Herzen. Und er sie.
Ich schaue über den Marktplatz, und alles kommt mir so unwirklich vor. Da vorn das Schafott, ein paar Meter weiter zwitschern die Vögel, und hier unten stehen wir alle und warten darauf, dass ein Mensch sein Leben lassen muss. Um dann weiterzuleben, bis es uns selbst trifft, wenn wir nicht höllisch aufpassen.
Hexen. Hexen gibt es nicht. Genauso wenig wie den Teufel. Das sind alles die Erfindungen dieser rot gekleideten Pfaffen, die die Menschheit klein halten wollen. Alles im Dienste des Herrn, so tönen sie immer herum. Warum müssen wir dann im Winter so oft frieren, und warum haben manche Familien hier kaum genug zu essen? Warum muss ein jeder Abgaben an die Kirche zahlen? Damit die hohen Herren in den Kirchen sich noch mehr Edelsteine an ihre Gewänder nähen und noch mehr Rotwein aus goldenen Kelchen trinken können. Wer hat das mit der Kirche eigentlich erfunden? Ich weiß es nicht.
Da wird Anneke gebracht. Gekleidet in einen dunkelbraunen Leinensack, der in der Mitte von einer Kordel gehalten wird, kauert sie in einem Holzkäfig, der von einem Ackergaul gezogen wird. Gehen darf sie nicht, eine Hexe darf nach ihrer Verurteilung den Boden nicht mehr berühren. Hat sich mit Sicherheit auch so ein Bischof oder vielleicht sogar der Papst selbst ausgedacht. Ich werde nicht müde zu behaupten, dass das alles Humbug ist, dieser ganze Hexenkram. So überflüssig wie die Hodensäcke unseres Papstes. Bertram steht auf dem Schafott und zittert am ganzen Leib, und ich hoffe inständig, dass es niemand bemerkt. Es ist nämlich so, dass Bertram trotz allem auf seine Stellung angewiesen ist. Ein Scharfrichter wird geächtet und kann nirgendwo anders mehr Fuß fassen. Es sei denn, er wandert aus und lässt sich in einer anderen Stadt nieder. Und das will ich nicht. Gut, ich gebe zu, ich bin zwiegespalten; es wäre ja dann schließlich so, dass Bertram nicht mehr töten muss. Das hätte sein Gutes. Andererseits: Würde Bertram Münzenberg und die Gemarkung Mavelon verlassen, käme sofort der nächste Scharfrichter. Wer weiß, wer das ist. Dem fällt dann vielleicht ein, dass junge blonde Frauen Hexen sind oder sein könnten. Dann stehe ich fein da. Nein, nein. Bertram soll bloß bleiben.
Anneke steigt aus dem Holzverschlag und setzt direkt den Fuß auf eine kleine Holztreppe, die vorm Schafott angebracht ist (der Boden, der Boden). Sie sieht aus, als hätte sie nicht besonders gut geschlafen letzte Nacht. Aber sie geht aufrecht und stolz. Ich blicke auf Friedhelm, ihren Mann. Er steht ruhig da und beobachtet seine Frau. Da kommt Richter Tiburtius zusammen mit dem Erzbischof, dessen Namen ich mir nie merken kann. Ich weiß nur, dass er schon mal in Rom war und den Papst persönlich kennt. Klemens vn. Wo Rom liegt, weiß ich auch nicht. Weit weg, hat Vater mir erzählt. Ich werde irgendwann mal nach Rom gehen und mir Klemens vorknöpfen. Verlaufen werde ich mich bestimmt nicht. Alle Wege führen nach Rom, habe ich mir sagen lassen.
Der Marktplatz ist mittlerweile so voll, dass es schon eng wird. Kurz überlege ich, für Anneke zu beten, aber was würde es ihr nützen? Die Enthauptung ist beschlossene Sache, ohne Wenn und Aber, und ich kann ihr nur wünschen, dass es schnell geht. Mit Schaudern denke ich daran, dass Bertram sich verschlagen könnte mit diesem Beil und – oh nein, nicht daran denken. Er wird es schon richtig machen. Bertram allerdings steht da, als ob er im nächsten Augenblick der Länge nach hinfallen würde.
»Wir sind heute zusammengekommen«, beginnt der komische Bischof, der richtiggehend lächerlich aussieht in seinem viel zu großen, roten Gewand, »um die Seele dieser armen Sünderin ihrem Richter zu übergeben. Du«, er deutet auf Anneke, die reglos dasteht und zuhört, ohne eine Gemütsbewegung zu zeigen, »du hast Schande über uns alle gebracht. Du wirst deine gerechte Strafe im Himmel erfahren, und dann sei Gott mit dir!« Warum muss der Mann so brüllen? »Welche Sünden hat dieses Weib begangen?«, fragt der Bischof dann Richter Tiburtius.
Der rollt Papier auseinander, schaut auf das Geschriebene und fängt an vorzulesen: »Sie hat einen Pakt mit dem Teufel, sie ...«
»Wer? Wer?«, unterbricht der Bischof den Richter.
»Die arme Seele hier!«, ruft Tiburtius zurück.
»Wo?« Der Bischof sieht ein wenig verzweifelt aus. Ein Raunen geht durch die Menge.
»Hier!« Tiburtius deutet auf Anneke. »Sie hier!«
»Wer ist das?«, will der Bischof wissen.
»Die Sünderin, die in wenigen Augenblicken erfahren wird, was es heißt, Buße zu tun. Die gleich zum Allmächtigen aufsteigen wird, um ihre gerechte Strafe aus Gottes Hand zu erhalten!«, leiert Tiburtius herunter.
»Warum? Wer?« Der Bischof ist am Ende mit seinen Nerven. Verwirrt schaut er abwechselnd auf Anneke und auf Tiburtius und dann in die Menge.
Bertram steht mit seinem Beil da und weiß auch nicht, was er machen soll.
»Eure Exzellenz, Euer Hoch würden, äh«, Tiburtius ringt nach Fassung, »Ihr habt doch eben selbst gesagt, dass wir diese reuige Sünderin nun ihrem Richter gegenüberstellen und sie Buße erfahren lassen. Das habt Ihr doch eben gesagt!«
»Was? Was habe ich gesagt?« Nun wird der Bischof böse. »Wollt Ihr mir unterstellen, dass ich etwas gesagt habe? Gar nichts habe ich gesagt. Wer seid Ihr?« Verwirrt schaut der Bischof herum.
Ob er betrunken ist? Das Abendmahl zu sehr genossen hat? Ich verstehe gar nichts mehr.
Neben mir steht Cäcilie, eine ungefähr dreißigjährige Frau, die sehr zurückgezogen lebt. Sie ist verwitwet und spricht kaum mit uns. Und wir, wir lassen sie in Ruhe. Cäcilie hat einen kleinen Hof, den sie allein bewirtschaftet. Ich habe bislang kaum drei Worte mit ihr gewechselt. Einmal habe ich sie bei Anneke gesehen.
»Amnesie«, sagt Cäcilie leise. »Er kann sich an sein eben Gesagtes nicht mehr erinnern.«
Auf dem Schafott geht es minutenlang so weiter. Tiburtius erzählt dem Bischof immer wieder, dass die arme Sünderin nun ihrem Richter übergeben werden muss, und der Bischof fragt ständig »Wer?«, »Wie?« oder »Was?« und macht einen ganz verrückt.
Für Anneke ist das bestimmt auch nicht gerade toll. Aber sie beobachtet den Richter und den Bischof nur, und fast habe ich das Gefühl, dass sie ab und an amüsiert lächelt. Aber irgendwann wird es Tiburtius dann zu viel, und er stellt sich vor den überforderten Bischof, um lautstark zu verkünden, dass die Sünde nun bestraft und das Urteil nun vollstreckt würde.
»Nein!«, brüllt der Bischof. »Nein!« Er greift sich an den Hals. Bertram scheint nicht zu wissen, was er tun soll, und schwingt vorsorglich schon mal das Beil.
Diese Amnesie muss ja entsetzlich sein. Bestimmt weiß der Bischof noch nicht mal mehr, dass er Bischof ist. Vielleicht erzählt er uns gleich, was er schon alles an Hexentränken gebraut hat, und bettelt um Gnade. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen.
Tiburtius ist rot im Gesicht. »Nicht Ihr sollt sterben!«, fährt er den Bischof an, der schwitzt wie ein Schwein. »Diese Hexe dort soll sterben!«
»Ah! Ah!«, macht der Bischof und beruhigt sich etwas.
Mittlerweile regt sich aber Bertram so auf, dass ihm das Beil aus seinen verschwitzten Händen gleitet und krachend auf den Holzboden fällt. Ich danke welcher höheren Macht auch immer, dass es Bertrams Fuß nicht gespalten hat. Wer sollte dann mit der Hinrichtung weitermachen? Und Bertram kann doch kein Blut sehen. Dazu kommt noch, dass seine blickdichte Kutte zwischenzeitlich so blickdicht ist, dass er quasi gar nichts mehr sehen kann, auf die Knie fällt und um Tiburtius und den Bischof herumkrabbelt, um das Beil wiederzufinden.
Nun stehen wir schon beinahe eine Stunde hier und noch nichts ist passiert; ich muss noch raus aufs Feld und auch noch zum Fluss, um die Wäsche zu waschen und so weiter und so fort. Ich sage es ja, diese Hinrichtungen nerven. Das Köpfen selbst geht ja eigentlich schnell, bloß das ganze Trara davor ist zeitraubend. Aber ich kann nicht einfach gehen. Dann wasche ich eben morgen.
Der Bischof ist zu nichts mehr in der Lage. Er lässt sich schnaufend auf den Boden fallen und röchelt vor sich hin. Ich nehme an, dass er zusätzlich zur Amnesie nun auch noch Probleme mit der Atmung hat. Ganz offensichtlich sogar. »Möchtest du noch etwas zu deiner Verteidigung sagen, oder möchtest du noch einmal beten und deine Sünden im Gebet bereuen?«, fragt Tiburtius Anneke lautstark. Die schüttelt den Kopf, und ich glaube, dass es Bertram recht ist, dass sie nichts mehr sagen will; er möchte das nun alles nur noch hinter sich bringen. Was ich unschwer nachvollziehen kann. Mit festem Schritt schreitet Anneke zu dem Holzklotz, auf den sie ihren Kopf gleich legen wird. Sie dreht sich um und schaut in die Menschenmenge, die stillschweigt. Man hört nur einige Vögel zwitschern, und etwas weiter entfernt blökt eine Kuh (die Kühe sind weit über der Zeit, wie immer an solchen Tagen). Anneke blickt auf ihren Mann und auf ihre Kinder, die gar nicht verstehen, was ihre Mutter da oben eigentlich zu suchen hat. Und dann blickt Anneke plötzlich zu mir. Ihre grünen Augen suchen meine, ich schaue sie an, und sie wendet den Blick nicht ab.
Ihre Lippen formen Worte.
II.
»C-ä-ci-lie. Du – und – Cä-ci-lie. Geh – zu – Cä-ci-lie«, meine ich von Annekes Lippen zu lesen. Aber was will sie mir damit sagen? Verstohlen schaue ich neben mich und bemerke, dass Cäcilie Anneke zunickt. Offenbar hat Anneke auch etwas in Cäcilies Richtung gesagt. Wie merkwürdig.
»Nun lass die Sünderin sündigen, äh, büßen!«, kommt es von Tiburtius, der ebenfalls keine Lust mehr hat, weil der Bischof ja auch noch am Boden herumkauert und ständig husten muss. Das würde noch fehlen, dass der Bischof jetzt elend verendet hier auf dem Schafott. Das wäre auch zu viel für Bertram. Er braucht nach einer Hinrichtung unbedingt eine längere Pause. Ich hoffe für ihn, dass niemand in den nächsten Tagen einen Apfel klaut, sonst muss er wieder zur Tat schreiten und jemandem die Hand abhacken.
Dann muss Anneke sterben. Leider. Es tut mir sehr leid, dass sie sterben muss. Aber Bertram macht seine Sache gut und trifft die richtige Stelle sofort. In dem Moment, als Annekes Kopf rollt, öffnet sich ihre rechte Hand, und ein Bündel Kräuter fällt auf den Holzboden herab. Niemand
außer mir scheint es zu bemerken.
»Du wirst keinesfalls zu dieser Cäcilie gehen, hörst du, Lilian? Ich verbiete es«, sagt meine Mutter böse, während sie am Herd steht und mit einem großen Holzlöffel in der Gemüsesuppe herumrührt, die über dem offenen Feuer vor sich hinköchelt. »Es ist besser, mit diesen Leuten nichts zu tun zu haben.«
»Ha!« Das kommt von meiner Großmutter Bibiana. Sie ist mit ihren 45 Jahren die Dorfälteste, hat noch alle Zähne im Mund, was selten ist für jemanden ihres Alters, und lehnt am offenen Ausguck, den wir wegen des schon relativ warmen Wetters heute nicht mit Vorhängen verschlossen haben.
»Ha! «, macht sie wieder. Unter ihren aufgestützten Ellbogen liegt ein Kissen, damit Großmutter es bequemer hat.
»Was hast du?«, frage ich besorgt. Sie ist ja nicht mehr die Jüngste.
»Meinert Frangers hat seine Karre schon wieder mitten auf dem Weg abgestellt«, meint Großmutter böse und hämmert mit ihrem Gehstock auf dem Hüttenboden herum. »Schon zum dritten Mal in der Woche. Da kommt ja kein Fuhrwerk mehr richtig vorbei. Da ist ja kaum noch Platz. Ich werde es melden, ich werde es Richter Tiburtius melden.«
Beinahe jeden Tag wandert Bibiana mit ihrem Gehstock ins Rathaus, um Tiburtius davon in Kenntnis zu setzen, dass entweder Meinert Frangers seine Karre falsch abgestellt oder Lothar Bingering seine große Kutsche so platziert hat, dass kein Reiter mehr vorbeikommt. Bibiana fordert dann immer eine gerechte Strafe bei Tiburtius, der ihr die auch immer verspricht, aber es passiert nie etwas. Ich glaube, Tiburtius ist von Großmutter etwas genervt. Bibianas ganzes Leben dreht sich um Parksünder. Sie kann im Haushalt nicht mehr allzu viel helfen, ihre Beine machen es nicht mehr so richtig, und auch sonst kränkelt sie vor sich hin. Komischerweise immer dann, wenn was zu tun ist. Denn ich habe Bibiana schon dabei beobachtet, wie sie mit Höchstgeschwindigkeit einen Fuchs gejagt hat, der sich im Hühnerstall bedienen wollte. Ihren Gehstock hat sie als Handwaffe benutzt, und humpeln musste sie auch so gar nicht. Aber ich mag Bibiana. Nicht nur, weil sie meine Großmutter ist, sondern weil sie herzensgut ist und immer ein offenes Ohr für mich hat.
»Mutter«, sagt Mutter zu Großmutter. »Reg dich nicht so auf. Denk an deine Gesundheit.«
»Gesundheit, Gesundheit«, keift Bibiana. »Ich will doch nur, dass alles seine Ordnung hat. Auf dem Weg da vorn hat nichts seine Ordnung.«
Dann nimmt sie eine kleine runde Holztafel (mein Vater musste ihr mehrere hundert Stück zurechtsägen) und malt mit rot gefärbter und weißer Kreide darauf herum, um daraufhin hinauszuhinken und die Holztafel, die an einem Holzstab befestigt ist, mit einem Hammer neben Meinerts Karre in den Boden zu rammen. »Damit er sieht, dass er seine Karre da nicht abstellen kann«, meint sie, als sie zurückkommt. Dann lehnt sie sich wieder auf ihr Kissen und beobachtet weiter den Verkehr.
»Ich sage es dir nun noch einmal, Lilian«, fängt meine Mutter wieder an. »Ich werde es nicht dulden, dass du diese Cäcilie besuchst. Keinesfalls werde ich das dulden. Denn ich möchte nicht, dass wir zum Dorfgespräch werden, hast du mich verstanden?«
»Aber, Mama«, sage ich, »was ist denn schon dabei? Sie ist einsam und allein, und ein wenig Gesellschaft wird ihr bestimmt nicht schaden.«
»Ich sagte NEIN!«, jetzt klingt die Stimme meiner Mutter fast bedrohlich. »Und nun geh, Lilian, und füttere die Schweine.«
Mist. Wäre ich nun schon verheiratet, was ja die meisten Frauen in meinem Alter sind, müsste ich mir von meiner Mutter gar nichts mehr sagen lassen. Aber ich möchte nicht heiraten. Genauso wenig aber habe ich Lust, den Rest meines Lebens in dieser Hütte hier zu verbringen. Man ist keine Sekunde allein. Ständig scharwenzelt die Verwandtschaft um einen herum. Nur seinen Stuhlgang kann man alleine erledigen. Das kleine Holzhäuschen befindet sich neben dem Schweinestall, und es stinkt erbärmlich, weswegen keiner von uns dort mehr Zeit als nötig verbringt. Lediglich mein Vater setzt sich stundenlang auf das Holz. Da hat er wenigstens seine Ruhe. Ich ärgere mich über mich selbst. Hätte ich Mutter nichts von Cäcilie gesagt, hätte sie mir auch nicht verbieten können, dass ich zu ihr gehe. Ich werde ihr einfach gar nichts mehr sagen. Nur – wie schaffe ich es, zu Cäcilie zu kommen, ohne dass Mutter es mitbekommt? Gut, ich könnte sagen, dass ich zur Beichte gehe. Oder nach den Schafen auf der Weide sehe. Aber da braucht man eigentlich gar nicht hinzugehen, zu den doofen Schafen. Sie stehen den ganzen Tag nur dumm herum und mähen, was das Zeug hält. Manchmal fallen die Schafe auch einfach um, weil das Gewicht der Wolle für sie zu schwer ist. Dann wissen wir, dass es an der Zeit ist, die Schafe zu scheren.
»Das hat er jetzt davon!«, krakeelt Großmutter herum. Die Karre von Meinert wurde von einer vorbeifahrenden Holzfuhre getroffen, vor die ein Ochse gespannt war, und nun ist das Rad gebrochen. »Hätte er das Schild beachtet, wäre seine Karre noch heil!«, frohlockt Bibiana schadenfroh. »Geschieht ihm recht, falls ihr versteht, was ich meine.«
Ich werde gar nichts sagen, sondern einfach gehen. Also zu Cäcilie. Sie hat mich nach Annekes Hinrichtung so merkwürdig angeschaut und dabei geblinzelt. Ich muss zu ihr gehen. Ich muss wissen, ob ich Annekes Lippenbewegungen richtig gedeutet habe.
Außerdem muss ich nach Bertram sehen. Es ging ihm nach Annekes Tod gar nicht gut. Ich habe ihn zu seiner Hütte begleitet.
»Meine Zunge ist angeschwollen«, klagte Bertram. »Sie wird immer dicker. Das ist die Aufregung. Ich mochte Anneke so gern. Sicher ächtet ihr Mann mich jetzt auch. Oh, oh, was mache ich denn nur? So langsam aber sicher ächten sie mich alle.«
Da hat Bertram Recht. Von Tod zu Tod wird er einsamer. »In jedem Beruf gibt es Höhen und Tiefen«, sagte ich zu Bertram. »Egbert geht es doch manchmal auch nicht gut. Weißt du noch, letztens war er am Boden zerstört, weil er die bestellten Messer nicht richtig geschärft hatte. Das hat ihn sehr mitgenommen.«
»Mich hat es noch mehr mitgenommen«, regte Bertram sich auf. »Achtunddreißig Mal musste ich auf diesen Kuhhirten, wie hieß er noch, ich hab es vergessen, einstechen, bis sein Lebenslicht ausgepustet war. Und das nur, weil Egbert so lahm ist wie ein Esel und nichts richtig hinbekommt. Er ist ein Taugenichts, auch wenn ich ihn mag. Aber er hat keine Ahnung. Von nichts.«
Was stimmt. Aber noch dämlicher sind seine beiden Pferde Pontius und Pilatus. Sie sind ununterbrochen am Fressen, aber nicht, weil sie dauernd Hunger haben, sondern weil sie so lange brauchen, ihre erste Mahlzeit zu vertilgen, bis die zweite kommt. Und mit der zweiten sind sie dann so lange beschäftigt, bis der Morgen graut und sie wieder ihre erste Mahlzeit erhalten. Wenn ihre Hufe beschlagen werden sollen, ist das immer eine Aktion, die mehrere Wochen dauern kann. Was daran liegt, dass Egbert der Meinung ist, Pontius und Pilatus könnten auf einem Bein stehen, und versucht, ihre drei verbleibenden Beine hochzuheben, was ihm aber noch nie gelungen ist. Dieser Annahme liegt zugrunde, dass in der Taverne mal jemand zu Egbert gesagt hat, er könne auf einem Bein stehen. Jedenfalls hat das Egbert so verstanden. Und es stimmt ja auch. Ein Mensch kann ja auch auf einem Bein stehen. Ein Pferd nicht. Aber eigentlich war es so, dass Egbert das falsch verstanden hatte, denn derjenige hatte gesagt: »Auf einem Bein kann man nicht stehen«, und sich noch ein Hopfengetränk bestellt.
»Ich werde erst einmal eine Mütze Schlaf nehmen«, verkündete Bertram. »Ich hoffe sehr, dass die Schwellung an meiner Zunge dadurch gelindert wird. Wenn nicht, habe ich es wahrscheinlich nicht anders verdient. Ich komme mit nichts mehr klar«, fügte er abschließend hinzu, um dann in seine Hütte zu gehen. »Das mit der Zunge darf ich Tiburtius nicht erzählen«, redete er dann noch weiter. »Sonst muss ich womöglich bald jemandem die Zunge abschneiden. Das überlebe ich nicht.«
Ich füttere dann die Schweine.
Großmutter Bibiana bemalt schon wieder neue Holzschilder.
»Der Weg da vorn ist zu eng, als dass man da aneinander vorbeifahren könnte«, meint sie böse. »Da muss man was tun. Ich werde mit einem Pfeil die Richtung angeben, falls ihr versteht, was ich meine.« Sie sägt an dem Schild herum und malt das Wort Eynbahnstraße darauf.
Ich schaue mich auf dem Hof um. Alle sind irgendwo beschäftigt, niemand ist zu sehen. Die Gelegenheit ist günstig. Schnell mache ich mich auf den Weg.
Die Hauptstraße gehe ich nur ein kleines Stück entlang, dann biege ich in einen Seitenpfad ab. Ich halte mein Gesicht in die Sonne und genieße die Wärme. Es geht an einer Baumgruppe und an einem Teich vorbei und dann den kleinen Hügel hoch, hinter dem sich das Wäldchen befindet. Dort wohnt Cäcilie.
Sie ist zu Hause, und mir ist, als hätte sie mich erwartet.
»Komm herein, Lilian«, sagt sie freundlich, und ich betrete ihre Hütte. »Ich weiß, warum du hier bist«, Cäcilie lächelt. »Möchtest du einen Lindenblütentee?«
Ich nicke.
Kurze Zeit später sitzen wir uns gegenüber. Cäcilie ist niemand, der um den heißen Brei herumredet.
»Anneke und ich haben viel gemeinsam«, fängt sie an. »Hatten«, fügt sie dann hinzu, und ein Hauch von Trauer liegt in ihrer Stimme. »Und Anneke hat sehr viel von dir gehalten«, fährt sie fort. »Sie meinte, du seiest klug und etwas Besonderes. Sie hat mir erzählt, dass du dir selbst das Lesen beigebracht hast.«
»Woher wusste sie das denn?« Ich bin ein wenig erstaunt, denn ich habe mir das Lesen und das Schreiben heimlich beigebracht. Ich wollte nicht, dass das irgendwer weiß, denn eine Frau, ein gemeines Weib, hat nicht zu lesen und zu schreiben. Jedenfalls nicht hier in Münzenberg in der Gemarkung Mavelon. Da hat ein Weib zu knechten und zu kochen und Kinder in die Welt zu setzen, aber keinesfalls etwas anderes zu tun.
»Sie wusste es eben«, meint Cäcilie geheimnisvoll. »Anneke hat einiges gewusst.« Cäcilie steht auf und geht auf und ab. »Sie wollte, dass du zu mir kommst«, erklärt sie. »Sie wollte, dass du mit mir da weitermachst, wo sie leider ... aufhören musste.«
Ich verstehe nicht. »Was soll ich mit dir weitermachen?«, frage ich.
»Du hast doch gesehen, wie ihr diese Kräuter aus der Hand gefallen sind, oder?«, möchte Cäcilie wissen, und ich nicke. »Nun«, redet sie weiter, »das waren nicht irgendwelche Kräuter. Das war eine ganz besondere Mischung. Ich habe sie mir geben lassen. Von Valentin.«
Valentin räumt nach den Hinrichtungen immer den Marktplatz auf. Eine unschöne Arbeit.
Cäcilie holt ein Stoffpäckchen aus einer Lade und breitet es vor mir aus. »Hier, schau«, sie deutet auf das Kräuterbündel, das sich darin befindet. »Salbei, Myrrhe, Lorbeer, ach, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Und es kommt ja auch auf die richtige Mischung an.«
»Ja, aber ...« Ich begreife immer noch nichts.
Cäcilie beugt sich zu mir. »Die richtige Mischung für ... das ewige Leben«, sagt sie leise und eindringlich und richtet sich dann wieder auf. »Sieh dir doch die Menschen an, Lilian. Sieh dir mich an. Ich bin jetzt neunundzwanzig. Und eine alte Frau. Wenn ich fünfzig werde, habe ich Glück gehabt. Ach, was rede ich, Riesenglück habe ich dann gehabt. Deine Großmutter, die hat solch ein Glück. Aber viele von uns haben es nicht. Kaum ist man auf der Welt, bekommt man Krankheiten. Erinnerst du dich noch daran, wie dein kleiner Bruder nach nur zwei Monaten gestorben ist? Niemand konnte ihm helfen. Von Gott wurde er uns gegeben und Gott hat ihn genommen, sagt die Kirche. Ich will dir mal was sagen: Gott gibt nichts und Gott nimmt nichts. Gott ist eine Erfindung, die alles bedeutet, nur nichts Gutes. Wer an Gott glaubt und danach handelt, was die Kirche uns befiehlt, der kann seine Tage zählen.«
Ich erschrecke. Gut, dass hier niemand Cäcilie hören kann. Ob sie weiß, dass sie mir aus der Seele spricht? Sofern ich überhaupt eine Seele habe. Das mit den Seelen ist auch so eine Erfindung. Angeblich fährt ja die Seele nach dem Tod in den Himmel. Ich habe leider noch nie eine von den ganzen Seelen gesehen. Weder tagsüber noch nachts. Ist vielleicht auch besser so. Ich wüsste nämlich gar nicht, was ich zu der Seele sagen sollte, wenn sie an mir vorbeifliegt: »Grüß dich« oder »Mach’s gut« oder »Nicht so schnell«? Aber vielleicht kommen die Seelen ja nicht aus den Holzkisten raus, in denen die Toten liegen. Ach, Unsinn. Es gibt keine Seelen.
»Ich sage dir jetzt etwas, Lilian«, fährt Cäcilie fort und ihre Augen glitzern. »Wir beide, wir sind klug. Wir sind klüger als die ganzen Kirchenmänner und Richter und Grafen. Wir werden Annekes Werk gemeinsam fortführen. Wir werden so lange experimentieren, bis wir die richtige Kräutermischung gefunden haben. Anneke hat mir einiges gesagt. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist es so weit.«
»Wie soll das denn gehen mit dem ewigen Leben?«, frage ich verwirrt.
Cäcilie flüstert jetzt. »Nimm einmal täglich eine Hand voll Kraut, immer bevor der Morgen graut. Zerkau es gut, dann schluck’s hinunter, für alle Ewigkeiten bleibst du munter«, zischt sie, und ich bekomme es ein klein wenig mit der Angst zu tun. Habe ich irgendwann mal gesagt, dass es keine Hexen gibt? Zum Glück hat Cäcilie keine roten Haare. Und auch keine Warzen im Gesicht. Sie schlägt mit der Hand auf den Tisch. »Nicht allen Menschen sollst du’s geben, nicht alle sollen ewig leben. Nur die, die gut sind, soll’n es haben, alle and’ren sollen darben.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: