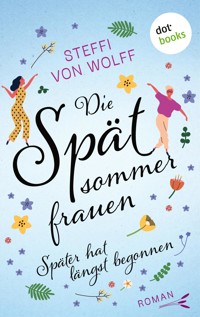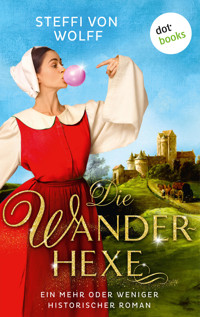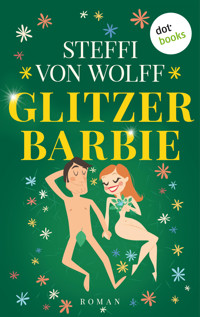4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leinen los und mit 30 Knoten ins Gefühlschaos: Der humorvolle Roman »Das kleine Segelboot des Glücks« von Steffi von Wolff als eBook bei dotbooks. Eigentlich ist Andreas ein angenehmer Ehemann, der wenig schmutzt und pflegeleicht ist. Bis zu dem Tag, als er sich ein neues Hobby zulegt, um männlicher zu wirken: das Segeln. Das passt Britta gar nicht. Ihre Vorstellungen von einem schönen Wochenende haben viel mit ihrem Sofa zu tun … und nichts mit einem schwankenden Boot und Seekrankheit! Aber es hilft nichts: Britta muss mit an Bord – und merkt zu ihrer Überraschung, dass es ein Vergnügen ist, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Zumal sie so auch neue Freunde findet. Björn zum Beispiel, dessen Talente sich nicht nur auf das Lenken eines Segelbootes zu beschränken scheinen … Da gibt es leider nur ein Problem: Andreas. Aber Probleme sind dazu da, dass man sie löst – oder aus der Welt schafft! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Comedy-Highlight »Das kleine Segelboot des Glücks« von Steffi von Wolff, auch bekannt unter dem Titel »Aufgetakelt«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eigentlich ist Andreas ein angenehmer Ehemann, der wenig schmutzt und pflegeleicht ist. Bis zu dem Tag, als er sich ein neues Hobby zulegt, um männlicher zu wirken: das Segeln. Das passt Britta gar nicht. Ihre Vorstellungen von einem schönen Wochenende haben viel mit ihrem Sofa zu tun … und nichts mit einem schwankenden Boot und Seekrankheit! Aber es hilft nichts: Britta muss mit an Bord – und merkt zu ihrer Überraschung, dass es ein Vergnügen ist, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Zumal sie so auch neue Freunde findet. Björn zum Beispiel, dessen Talente sich nicht nur auf das Lenken eines Segelbootes zu beschränken scheinen … Da gibt es leider nur ein Problem: Andreas. Aber Probleme sind dazu da, dass man sie löst – oder aus der Welt schafft!
Über die Autorin:
Steffi von Wolff, geboren 1966 in Hessen, war Reporterin, Redakteurin und Moderatorin bei verschiedenen Radiosendern. Heute arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen und Magazine wie »Bild am Sonntag« und »Brigitte«, ist als Roman- und Sachbuch-Autorin erfolgreich und wird von vielen Fans als »Comedyqueen« gefeiert. Steffi von Wolff lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Die Autorin im Internet: www.steffivonwolff.de und www.facebook.com/steffivonwolff.autorin
Steffi von Wolff veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Bestseller »Glitzerbarbie«, »Gruppen-Ex«, »Reeperwahn« und »Rostfrei«, »Fräulein Cosima erlebt ein Wunder«, »Der kleine Buchclub der Träume«, »Das kleine Hotel an der Nordsee«, »Das kleine Haus am Ende der Welt« und »Das kleine Appartement des Glücks« sowie die Kurzgeschichten-Sammelbände »Das kleine Liebeschaos für Glückssucher« und »Das kleine Glück im Weihnachtstrubel«. Eine andere Seite ihres Könnens zeigt Steffi von Wolff unter ihrem Pseudonym Rebecca Stephan im ebenso einfühlsamen wie bewegenden Roman »Zwei halbe Leben«.
***
eBook-Neuausgabe August 2021
Unter dem Titel »Aufgetakelt« erschien dieser Roman bereits 2005 als gedruckte Ausgabe bei Delius Klasing und 2015 als eBook-Ausgabe bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2005 Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld
Copyright © der eBook-Neuausgabe 2015, 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Wstockstudio, Lifestyle Travel Photo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-709-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das kleine Segelboot des Glücks« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Steffi von Wolff
Das kleine Segelboot des Glücks
Roman
dotbooks.
Für Fridtjof. Wie immer. Für immer.
Kapitel 1
Es ist Freitag, als alles begann. Erst mal begann natürlich das Wochenende. Ich freue mich immer aufs Wochenende. Wochenende bedeutet, dass man sich erholt und vielleicht auch mal einfach nichts tut.
Aber seit diesem Freitag war alles anders. Mein Mann Andreas kam nach Hause, so wie sonst, und ich bekam, anders als sonst, einen Katalog über Stechzirkel oder so was Ähnliches hingepfeffert und ein Stück Band, mit dem ich einen Palstek knoten sollte, obwohl ich lieber ein wenig in der ›Gala‹ blättern wollte oder meine verwelkten Rosen im Garten abschneiden.
Es folgten Freitage, an denen ich meinen letzten Besichtigungstermin (ich bin Immobilienmaklerin) so früh legen musste, dass ich pünktlich um 16 Uhr zu Hause war, um hektisch ein paar Sachen in eine Tasche zu stopfen, und mich dann mit meinem lieben Mann in unser Auto setzen konnte, das uns an die Ost- oder Nordsee brachte. Da warteten dann irgendwelche Boote auf uns, auf denen wir unser Wochenende verbrachten.
Mein Name ist Britta Schüchen, ich bin 34 Jahre alt und habe naturblonde Haare. Ich mag meine Haare und ich mag Blondinenwitze, sofern ich sie verstehe. Ich lege Wert darauf, nicht mit Frau »Schühchen« angesprochen zu werden. Ursprünglich, also vor meiner Hochzeit, hieß ich Britta Höschen, und damals legte ich auch schon Wert darauf, nicht als Frau »Höööööschen« angesprochen zu werden. Insofern hat sich namenstechnisch nach meiner Eheschließung nichts wirklich Gravierendes verändert.
Ansonsten hat sich relativ viel getan.
Ich bin jetzt zwölf Jahre verheiratet. Vor einiger Zeit hat mein Mann Andreas diese schreckliche Krankheit, die man »die Liebe zum Segeln« nennt, bekommen. Es fing damit an, dass er auf N3 eine Dokumentation über einen Mittfünfziger gesehen hat, der sich selbst verwirklichen wollte, indem er Fertiggerichte für ein Jahr in eine Nussschale warf und die Welt ganz allein umsegelte.
»Das ist ja unglaublich«, sagte Andreas und rückte noch näher an den Fernseher heran, während der Mittfünfziger eine Dose Ravioli auf dem Bordkocher erhitzte und den Inhalt direkt aus dem Topf in sich hineinschlang. Zu dieser Zeit war er schon ungefähr zwei Monate unterwegs und hatte einen Vollbart, lange Haare, schwarze Fingernägel und diesen irren Blick, den Leute manchmal haben, wenn man sie von einer einsamen Insel rettet und sie eine halbe Kokosnuss umklammern, während man sie in ein Schlauchboot verfrachtet.
»Ganz allein auf sich gestellt, niemanden zum Reden haben und Mutter Natur ausgeliefert. Oh Gott!«
»Was ist daran unglaublich?«, fragte ich und blickte von meiner Zeitschrift hoch. »Der Mann hat das doch freiwillig gemacht. Und außerdem – er hätte doch jederzeit seinen Ausflug abbrechen können.« Aber Andreas war der Meinung, dass ich das alles nicht verstünde. »Das ist das wahre Leben, das ist Reduktion auf ein absolutes Minimum.« Andreas war fasziniert von diesem Mann und rannte am nächsten Mittag sofort los – unrasiert –, um mit ungefähr einhundert Büchern übers Segeln wiederzukommen. Manchmal ist es ja so, dass eine Begeisterung kurzlebig ist und man eine Woche später wieder zum normalen Leben zurückfindet. Bei mir war das auch mal so, ich hatte mir eine gebrauchte Nähmaschine gekauft und fing an, Tischdecken und Sofakissenüberzüge zu nähen, beziehungsweise ich habe es versucht, aber weil es nicht sofort so funktionierte, wie es in den tollen Prospekten immer aussah – die lachenden Frauen, die darin abgebildet waren, haben mir nichts, dir nichts Bettbezüge für die ganze Familie und Nachbarschaft fertig gestellt –, habe ich die Nähmaschine nach genau fünf Tagen auf den Dachboden gebracht, wo sie heute noch steht.
Bei Andreas war es anders. Er redete von nichts anderem mehr als davon, dass Segeln so natürlich ist und was Ursprüngliches hat.
»Stell dir vor, wenn man vor Anker liegt und einen Sonnenuntergang beobachtet und nichts hört außer den Wellen, die langsam und behäbig an den Bug klatschen«, schwärmte er. »Und die sinnigen, tief schürfenden Gespräche, die man in diesen Situationen führt. Das ist Leben, Britta, das ist Leben. Früher, so im 15. Jahrhundert, muss es noch schöner gewesen sein, da waren die Menschen ja monatelang auf See. Ich möchte wissen, über was sie damals gesprochen haben!«
Ich konnte mich dieser Begeisterung nicht anschließen, noch war ich davon überzeugt, dass die Menschen, die im 15. Jahrhundert monatelang auf See waren, tief schürfende Gespräche geführt haben.
Die einzigen Gespräche werden sich darum gedreht haben, mit wie vielen Peitschenhieben man die Sklaven, die im Schiffsbauch saßen und ruderten, ohne Grundnahrung zu noch mehr Leistung anspornen konnte. Oder wie man Skorbut behandelt oder die Pest, und was man mit Besatzungsmitgliedern anstellte, die gemeutert haben. Fingerabhacken war da ganz sicher an der Tagesordnung im 15. Jahrhundert bei den Leuten, die laut Andreas tief schürfende Gespräche geführt haben.
Aber ich ließ Andreas sein neues Hobby. Es schadete mir ja nicht wirklich. Dachte ich.
Doch dann wurde es immer schlimmer.
Mein Göttergatte Andreas ist 39 und behauptet gern von sich, dass er Roger Moore in jungen Jahren verdammt ähnlich sieht. Auf einer Party hat er es allen Ernstes mal fertig gebracht, einen Martini mit den Worten »geschüttelt, nicht gerührt« zu bestellen. Oder andersherum. Er konnte es gar nicht verstehen, dass niemand darüber lachte. Er ist ein ziemlich häuslicher Typ. Einmal – wir hatten die eine oder andere Flasche Wein intus, hat er mal zugegeben, dass er sich gern einen elektrischen Fußwärmer bei Tchibo kaufen würde. Für die kalten Winterabende. Am anderen Tag hat er behauptet, das nie, aber wirklich nie gesagt oder gedacht zu haben. Beim Häkeln habe ich ihn auch schon mal erwischt, aber nichts gesagt.
Andreas ist Geschäftsführer bei Püppi-Company. Es handelt sich dabei keineswegs um einen Escort-Service für Männer, die Damenbegleitung für Messeabende suchen, sondern um eine Firma, die Ersatzteile für kaputtgegangene Einrichtungsgegenstände von Puppenküchen herstellt und auch Puppenhäuser nach Maßanfertigung baut. Es gibt nichts, was Püppi nicht herstellt. Ein Kunde wollte ins Puppenhaus seiner Tochter eine Dunkelkammer eingebaut haben, ein anderer hat Wäscheklammern in der Größe von Staubkörnern geordert. Kein Problem für Püppi. Es existiert sogar eine Puppenküche mit einem Sessellift an der Treppe, damit Opa (84 und etwas schwach auf den Beinen) bequem zu Bett gebracht werden kann. In einem anderen Puppenhaus befindet sich ungelogen ein Extraeingang für Papas Geliebte, sodass sie nicht mit Mama zusammentreffen muss.
Andreas hatte bislang keine wirklich nennenswerten Hobbys. Okay, er ist ab und an mal mit Freunden einen trinken gegangen oder hat unseren Dachboden ausgebaut (und dabei die Nähmaschine stehen gelassen; man weiß ja nie).
Wie gesagt, bis vor ein paar Wochen.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem wir das erste Mal eine Wochenend-Charter-Tour machten. Mit uns unbekannten Menschen, die auch eine Wochenend-Charter-Tour machten. Das Boot war ziemlich groß und lag an irgendeinem Steg. Es schaukelte bedrohlich hin und her. Den Namen des Ortes, in dessen Hafen das Boot lag, habe ich verdrängt, um nicht wahnsinnig zu werden.
Andreas hatte mich nämlich, kurz nachdem diese Dokumentation auf N3 gelaufen war, händeringend überredet, mit ihm »wenigstens ein einziges Mal« segeln zu gehen. Weil ich das Desaster endlich hinter mich bringen wollte, sagte ich schließlich Ja und Andreas lief weg, kaufte sich eine Segelzeitschrift und telefonierte mit irgendwelchen Charterstützpunkten an der Ostoder Nordsee und wurde tatsächlich fündig. Also machten wir uns an einem sonnigen Freitag auf an die Ostsee.
Als ich vor diesem Boot stand, hatte ich vorausschauend zwei große Probleme:
Problem 1: Wie komme ich ohne Sprungbrett oder zumindest eine acht Meter lange Planke an Bord?
Problem 2: Wie komme ich ohne Sprungbrett oder zumindest eine acht Meter lange Planke von Bord?
Es war leider niemand da, der mir diese – für mich lebenswichtigen – Fragen beantworten konnte. Alle Teilnehmer hatten einen ungemein arroganten Gesichtsausdruck und unterhielten sich die ganze Zeit darüber, dass es eine Frechheit sei, wie teuer die Liegegebühren geworden seien. Ich habe nicht verstanden, was sie meinten. Was bedeutet »Liegegebühren«? Heißt das, dass man extra bezahlen muss, wenn man im Schlaf liegt? Schläft man auf Segelbooten normalerweise wie Pferde oder Kühe im Stehen?
Andreas kümmerte sich nicht im Geringsten um mich. Er sprang wie ein aufgescheuchtes Karnickel hin und her, gab zum Besten, wie er sich auf diesen Törn freue und schrie, dass er, sobald alle an Bord seien, Gin-Tonics zu mixen gedenke. Mir graute es davor, an Bord zu gehen (falls mir das überhaupt jemals gelingen sollte).
Das Peinlichste war, dass wir uns (ich notgedrungen) für dieses Wochenende komplett neu eingekleidet hatten. Ich hatte Segelschuhe, sie hießen »Docksides«, zum Preis von ungefähr 200 Euro an den Füßen, die fürchterlich schubberten und mir an jeder überhaupt nur möglichen Stelle Blasen bescherten. Sogar in den Zehenzwischenräumen, weiß der Geier warum. Der Rest der Ausstattung von Musto oder Marine Pool, alles Markennamen, die ich vorher gar nicht kennen wollte. Und schweineteuer. Ölzeug hatten wir uns auch gekauft. Ich kam mir vor wie ein Stadtwerkemitarbeiter in dieser unförmigen Latzhose, die aber, so stand es jedenfalls in der Produktinformation, »absolut wasserundurchlässig« sei, was ja wichtig ist wegen der Welle und wenn das Boot nass segelt wegen unvorhergesehener Schräglage.
Das Schlimme: Alle anderen hatten auch diese ganzen Sachen an, aber den Sachen sah man an, dass sie schon tausendfach in Gebrauch gewesen waren.
Ich stand unbeholfen herum und fand keinen Anschluss. »Ich bin Sören«, sagte ein ungefähr 35-jähriger Mann böse zu mir und schüttelte mir die Hand. »Ich bin hier der Skipper.«
»Und ich bin Britta«, sagte ich zu Sören, der so aussah, als würde er alle Anwesenden am liebsten auf offener See über Bord werfen, warum auch immer.
»Britta«, sagte Sören zu mir, »wenn wir abgelegt haben, sorge bitte dafür, dass die Leinen aufgeschossen werden und mach dann die Fender ab.«
Ich schaute ihn an, als ob er von mir verlangen würde, ihm jetzt auf der Stelle eine Niere zu spenden.
Verzweifelt überlegte ich, was Fender sind. Love me fender?
Nein, das war Love me tender. Oder? Was hat Elvis Presley mit Fendern zu tun? Oder heißt es doch Love me fender, und man soll einfach nett zu Fendern sein. Sind Fender Tiere, die man nach dem Ablegen freilassen soll? Vielleicht ist das der seemännische Ausdruck für Brieftauben? Aber wo sind sie, die Brieftauben? In Käfigen unter Deck? Ist das so ein alter Brauch mit den Fendern? Ich wusste es nicht. Ehrlich.
»Ich weiß nicht, wie das geht und was du meinst«, sagte ich und bereute es im gleichen Moment, denn zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine Angst erregende Furche.
»Wieso bist du dann hier?«, fragte mich Sören, während er sich zischend eine Bierdose öffnete.
»Wegen meinem Mann!« Wo war Andreas bloß?
»Ich segle bloß seinetwegen mit. Wir sind beide noch nie gesegelt. Ich habe zwar was darüber gelesen, aber ich weiß praktisch quasi noch nichts«, versuchte ich mich zu rechtfertigen.
Ich kam mir vor wie eine Hebamme, die in einer abgelegenen Berghütte ohne Telefonanschluss, aber bei Schneesturm, nach siebenundzwanzig Stunden andauernder Presswehen zu einer werdenden Mutter sagt, dass sie eigentlich Rechtsanwaltsgehilfin ist, aber seit heute Lust auf was Neues hat.
Sören grinste.
»Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, das Segeln«, zischte er mir zu, nachdem er einen tiefen Schluck aus der Bierdose genommen hatte.
»Es kann viel passieren. Ich könnte da Geschichten erzählen ...«
Sofort bekam ich Angst. Hatte Sören vor, mich schon im Vorfeld seeuntauglich zu machen?
»Sicherheit ist ganz wichtig«, dozierte Sören, nachdem er zwei vorbeilaufenden Mitseglerinnen klar gemacht hatte, dass er ihr Outfit »verschärft« fand.
»Vor einigen Jahren ist im Mittelmeer was ziemlich Schreckliches passiert«, klärte er mich auf. »Die waren zu acht oder so unterwegs und wollten mitten auf dem Meer schwimmen gehen. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Die See war ruhig und die mussten noch nicht mal den Anker werfen. Also sind alle einfach so ins Meer gesprungen.«
Eine tolle Geschichte. Ich wartete nur darauf, dass Sören mir jetzt erzählt, dass einer von den Badenden einen Wadenkrampf bekommen hat oder Durst. Oder Heimweh.
»Tja«, sinnierte Sören vor sich hin, während er mich anschaute, als ob ich Schuld sei an dem, was er jetzt gleich erzählte.
»Irgendwann wollten sie an Bord zurück. Das ging aber nicht, weil das Boot keine Badeleiter hatte. Und wenn sie den Anker geworfen hätten, hätten sie sich wenigstens an der Kette hochziehen können. Aber es gab keine Möglichkeit, wieder aufs Boot zu kommen. Es war zu hoch! Verstehst du, Britta? Es war zu HOCH!«.
Mein Mund trocknete in Sekundenschnelle aus. Entsetzlich. Entsetzlich!
»Sie haben sich dann ihre Schwimmsachen ausgezogen, verknotet und versucht, damit eine lange Leine zu machen, aber an der Reling oben gab es keinen Halt. Die aneinander geknoteten Badesachen fielen immer wieder ins Wasser zurück. Die Leute sind alle gestorben. ERTRUNKEN! Alle! Verstehst du jetzt, warum Sicherheit so wichtig ist?«
Ich nickte. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich war am Ende mit meinen Nerven.
»Aber jetzt gehen wir an Bord, Britta«, sagte Sören wichtigtuerisch. Und vergiss nicht, die Fender!«
Außer mir und Sören waren alle schon auf dem Boot, auch Andreas. Leider hatte ich nicht mitbekommen, wie sie auf das Boot gekommen waren.
Die nächste halbe Stunde war ein Alptraum. Sören stieg mit seinem Seesack an Bord, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich stand auf dem Steg und überlegte mir tausend Erklärungen dafür, warum ich nicht an Bord klettern konnte.
Ich schwöre hiermit: Es waren ungelogen mindestens zehn Meter, die es zu überwinden galt, und ich war in Weitsprung noch nie gut. Ich hatte in Sport immer eine Vier.
Was sollte ich sagen?
»Oh, mein linkes Bein fällt gerade ab, Moment noch, bitte! Ich hole eben eine Krücke.«
»Ach, dumm, gerade bin ich am grauen Star erkrankt, meine Augen müssen sich erst an die neuen Entfernungen gewöhnen!«
»Es dauert nur noch einige Minuten, ich hatte gerade diesen unangenehmen Anruf auf dem Handy. Der beste Freund meines Großneffen in Stuttgart hat angerufen und mir erzählt, dass die Kusine seiner Patentante jetzt neben ihrer Stauballergie auch noch die Befürchtung hat, keinen Rosenkohl zu vertragen!«
»Wollt ihr wirklich, dass ich mit meinen Kopfläusen an Bord komme?«
»Mach die Leinen los!«, rief Sören vom Boot aus. »Und dann spring schnell an Bord!«
Verzweifelt lief ich zu den Knoten, die an irgendwelchen Holzpfählen festgemacht waren, und versuchte sie loszubinden, was mir auch irgendwann gelang.
»Jetzt spring!«, schrie Sören.
Ich stand mit den Seilen da wie ein Ölgötze. Das Boot zog an den Leinen und ich stand auf dem Steg und lehnte mich verzweifelt nach hinten, um es zu halten.
»Spring doch endlich«, brüllte Sören böse.
Eine zwanzig Kilo leichte, braun gebrannte Schönheit stand neben ihm und lachte.
»Ich kann nicht, das ist zu weit«, brüllte ich zurück, während mir der Schweiß in Strömen den Rücken runterlief und ich die Braungebrannte hasste.
Das Boot zerrte immer mehr an den Bändern.
Das Nächste, was ich sah, war Sören, der unter Motor hektisch versuchte das Boot so zu steuern, dass es wieder Richtung Steg fuhr.
Das Übernächste waren zirka fünfzig Leute, die neben mir auf dem Steg standen plus die Besitzer von den Booten rechts und links von uns, die an Deck kamen und uns prustend zusahen.
Das Überübernächste, was passierte, war, dass ich kreischend mit allen Bändern ins Wasser fiel.
Als ich wieder auftauchte, waren alle Schaulustigen verschwunden.
Wahrscheinlich, weil sie sich fremd schämten.
Ich kann es ihnen nicht verübeln.
Das war der Anfang und das Ende meines ersten Segelwochenendes. Ich bin dann in einem Hotel abgestiegen und habe Andreas Sonntag irgendwann mittags wieder abgeholt an diesem komischen Steg. Nie wieder, habe ich mir geschworen, werde ich einen Fuß auf ein Segelboot setzen. Nie. Ich grübel auch bis heute darüber nach, wie Andreas damals an Bord gekommen ist. Wahrscheinlich haben sie ihn geworfen. Denn alleine kann der das so gar nicht. Aber ich greife vor. Ab jetzt ging es erst richtig los.
Kapitel 2
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Mit einem Bein wäre es auch noch schwieriger, an Bord zu kommen. Nein – ich bin allem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Wirklich. Aber Andreas übertreibt immer. Allein diese Diskussionen, ob man nun segeln soll oder nicht. Ich bin dagegen, er dafür:
»Wir haben an unseren Wochenenden doch sowieso nie was vor«, schwadroniert er herum. »Also können wir die Wochenenden doch mit etwas Nützlichem verbinden. Dem Segeln. Wir sind sowieso zu wenig an der frischen Luft. Ich wette mit dir, wenn wir Freitag spätnachmittags da ankommen, wo unser Boot liegt, ist das so, als ob wir den ersten Urlaubstag haben.«
Weil ich so gutmütig bin, lasse ich ihn gewähren. Und weil ich so doof bin, lasse ich ihn zu lange gewähren. Weil ich nämlich so gutmütig bin.
»Ich wette, du möchtest nie wieder was anderes machen, wenn du erst mal Salzluft geschnuppert hast und bei acht Windstärken merkst, dass du das Boot immer noch unter Kontrolle hast«, ruft Andreas beschwingt.
In Gedanken male ich mir aus, was ich anstelle von Segeln alles machen möchte. Innerhalb von Sekundenbruchteilen fallen mir dreitausend Dinge ein. Angefangen von Ausschlafen bis hin zu Töpfern. So verzweifelt bin ich schon, dass ich töpfern will. Ich glaube, ich habe damals überlegt, dass ich lieber freiwillig in einer Volkshochschule Vorträge über homöopathische Handchirurgie halten möchte, als jemals wieder einen Fuß auf ein Segelboot zu setzen.
Nach dem besagten Wochenende, als Sören mir die Geschichte von dem entsetzlichen Badeunfall im Mittelmeer erzählt hat und ich kopfüber mit den ganzen Leinen ins Hafenbecken gefallen bin, hatte ich die Nase voll.
Aber Andreas lässt nicht locker: »BRITTA! Nun hab dich nicht so. Du redest doch immer davon, dass wir Sport machen sollen. Schau dir doch die ganzen durchtrainierten Leute an, die segeln!«
Diesen Aspekt finde ich wiederum durchaus verständlich. Über die Jahre hinweg hat Andreas immer mal wieder gern das eine oder andere Bier zu viel zu sich genommen, und Bratwurst mit Pommes rot-weiß sind schließlich auch nicht zu verachten. Seinem Hüftspeck und dem nicht erst beginnenden Bauch würde ein wenig Sport ganz sicher gut tun.
»Diese kräftigen Arme, die an diesen Kurbeln drehen«, er blättert in einem Buch, »und diese Bauchmuskeln hier bei dem Mann, der an dem Rad da dreht.«
Ich nehme mir das Buch und muss leise lachen.
Was er nämlich nicht weiß, ist, dass es sich bei den von ihm beschriebenen Menschen in eben jenem Buch um Profisegler handelt, die sich – jedenfalls während sie segeln – von Astronautennahrung ernähren. Diese Segler sind monatelang auf dem Wasser unterwegs und waschen sich noch nicht mal anständig! Weil sie nämlich keine Zeit dazu haben. Diese durchtrainierten Segler powern 18 Stunden am Stück, was das Zeug hält, um dann in Rohrkojen, oder weil das Regattaboot Gewicht auf der einen Seite braucht, in der Reling hängend, die Füße über Bord, zu schlafen. Freiwache heißt das, glaube ich. ICH habe nämlich die ganzen Bücher gelesen, die Andreas angeschleppt hat.
Der gemeine Fahrtensegler (oh ja, auch ich kenne mich mit Fachausdrücken aus) dagegen überlegt sich schon nach dem Frühstück, was es mittags zur Bratwurst mit Speck gibt. Kartoffelbrei oder Bratkartoffeln oder einfach nur Bier. Oder er entschließt sich gleich für das sogenannte australische 7-Gänge-Frühstück: ein Steak und ein Six-Pack Bier. Als Fahrtensegler dümpelt man von Hafen zu Hafen, am besten unter Motor. Unter Motor, weil es so anstrengend ist, Segel zu setzen, weil man ja keine elektrische Winschkurbel hat. So jedenfalls ist mein erster Eindruck. Gleich werde ich verrückt.
Es ist gemein, ich weiß, aber ich bin nun mal der Ansicht, dass Segeln, wenn man es nicht wirklich berufsmäßig betreibt, einfach nur ein lächerlicher Zeitvertreib für Menschen ist, die nichts mit sich anzufangen wissen. Ich habe mich nämlich informiert! Oh ja. Es gibt Kataloge mit Zubehör, da rollen sich bodenständigen Menschen wie mir die Fußnägel bis zum Gehtnichtmehr auf. Buddelschiffe gehen ja noch. Das sage ich jetzt aber nur deswegen, weil ich mich als Kind immer gefragt habe, wie man die Schiffe durch den engen Flaschenhals bekommen hat. Als ich dann erfahren habe, dass man die reinschiebt und dann an einem Faden zieht, sodass die Masten sich aufrichten, hat das alle Illusionen bei mir zunichte gemacht. Trotzdem. Buddelschiffe sind okay. Dann Knotentafeln. Gute Güte, wozu braucht man Knotentafeln? Hängt man die in den Salon und muss jedes Mal, wenn man einen Knoten machen will, runterrennen und nachschauen, wie es geht?
Am romantischsten finde ich die Flaschenpost. Aber die gibt es in keinem Zubehörkatalog.
»Meinst du, wir finden irgendwann mal eine Flaschenpost?«, frage ich Andreas an einem Donnerstagabend. Wir sitzen auf unserer Terrasse, ich muss dringend noch eine Besichtigung für Freitagmorgen vorbereiten. Wenn ich Glück habe, kauft dieses Ehepaar das Haus. Von meiner Provision werde ich ganz sicher kein Segelboot kaufen. Vielleicht aber ein Buddelschiff.
»Wie, Flaschenpost?«, fragt Andreas und blickt mich verständnislos an.
»Ich wünsche mir so sehr, einmal eine Flaschenpost zu finden«, schwärme ich vor mich hin. Allein die Vorstellung, dass ein verzweifelter Seemann irgendwann im 16. Jahrhundert kurz vorm Untergang des Schiffes noch eine letzte Nachricht an seine Verlobte in eine Flasche steckt, bevor sein Schiff kentert und sich in den letzten Sekunden seines Lebens fragt, ob irgendjemand diese Nachricht mal irgendwann liest, wann auch immer, berührt mich so, dass ich eine nicht enden wollende Gänsehaut bekomme.
»Segeln hat nichts mit einer Flaschenpost zu tun«, doziert Andreas und hält mir ein Buch vor die Nase. »Schau, hier, da wird einem gezeigt, wie man eine Wende fährt. Das ist Können, Britta. Wenn du erst mal so weit bist, dass du eine Wende fahren kannst, habe ich Hochachtung vor dir!«
Ich werde sauer. »Sonst hast du also keine Hochachtung vor mir?«, frage ich böse und pfeffere das Buch auf den Tisch.
»Was ist denn bloß los mit dir?«, fragt Andreas. »Du bist ja richtig komisch. Früher warst du nicht so.«
Ja. Das stimmt. Die neue Vorliebe meines Mannes macht mich zunehmend aggressiv. So aggressiv, dass ich mir schon nicht mehr die Hände waschen möchte, weil das mit Wasser verbunden ist.
»Ich würde gern morgen Nachmittag mit dir an die Ostsee fahren. Ich hab, als ich mit diesem Sören unterwegs war, nette Leute kennen gelernt, die mir oder vielmehr uns angeboten haben, mal bei ihnen mitzusegeln, damit wir das alles mal so richtig von der Pike auf lernen. Das geht kurzfristig, ich muss sie nur anrufen, sie sind jedes Wochenende auf dem Boot. Weißt du nicht mehr, das nette Ehepaar, er ist Ende vierzig und sie hatte ganz kurze Haare. Die machten doch einen netten Eindruck. Was hältst du davon?«
Nichts wäre mir lieber, als jetzt sofort einen Hörsturz zu bekommen. Aber das geht ja nicht so ohne weiteres. Und ich muss vom Teufel geritten sein, dass ich antworte:
»Ja, warum eigentlich nicht.«
»Du bist ein Schatz«, strahlt Andreas und springt von seinem Stuhl auf. »Das wird super.«
Ja. Das wird super.
Freitag. Ich absolviere meine Hausbesichtigung in einem wirklichen Traumhaus. Jahrhundertwende, Parkettboden, offener Kamin und Sprossenfenster. Dazu ein wunderschöner Garten. Ich bin begeistert, die potenziellen Käufer sind nur am Meckern.
Die Industriellengattin hat toupierte Haare und beschwert sich ununterbrochen:
»Liebling, ich weiß nicht, wo wir hier in diesen engen Räumen unsere Biedermeiermöbel hinstellen sollen. Und die Louis-Seize-Stühle. Ach, da muss dann womöglich ein Architekt ans Werk.« Sie seufzt und fährt sich mit ihren ringgeschmückten Fingern durchs aufgedonnerte Haar.
Die Leute heißen »von Haldersleben« und die gute Gattin legt großen Wert auf dieses »von«. »Marita VON Haldersleben, guten Tag. Und das ist mein Mann, Lothar VON Haldersleben.« Man merkt Marita an, dass sie vor ihrer Heirat Meier oder Müller oder Schmidt geheißen haben muss.
»Ach, schauen Sie sich doch mal unseren Porsche an«, Marita schaut aus einem der Fenster und deutet auf die Reifen. »Alles voller Schlamm. Ich habe ja gleich zu Lothar gesagt, ›lass uns den Jeep nehmen‹, aber Lothar liebt nun mal seinen 911-er. Nicht wahr, Lothar? Mir liegt der ja zu tief. Ich habe mir jetzt einen neuen BMW bestellt, wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob ich den noch will. Jetzt ist doch gerade dieses schicke Jaguar-Cabrio rausgekommen. Wo ist eigentlich Benni? Benni, komm her und sag nett guten Tag.«
Hinter Lothar kommt ein ungefähr 14-jähriger pubertierender Junge hervor. Er trägt viel zu weite Hosen, an denen sich überall Taschen befinden. Dazu ein amerikanisches College-Sweatshirt. In der Mitte prangt eine große 13. Eine Baseball-Mütze sitzt schief auf Bennis Kopf, und der Knabe macht ununterbrochen riesengroße Kaugummiblasen. Benni hält es nicht für nötig, seine Hände aus den Hosentaschen zu nehmen, sondern nickt nur mürrisch in meine Richtung.
»Na, Bennilein, meinst du, du würdest dich hier wohl fühlen?«, fragt Marita und schaut Benni beifallheischend an.
»Is doch alles die komplette Scheiße«, kläfft Benni. »Voll uncool. Totale Megakacke. Ich kotz gleich.«
»Aber Bennilein«, ruft Marita. »Deine Zimmer haben zusammen fast 100 Quadratmeter. Und ein eigenes Bad hast du auch!«
»Ich kotz gleich«, keift Benni.
Kinder zu haben muss die totale Erfüllung sein.
Lothar zündet sich eine Zigarre an und blickt mit Vaterstolz auf seinen Sohn.
»Hahaha«, ruft er jovial. »So sind sie nun mal, die Kinder. Benni wird aber seinen Weg schon machen. Nächste Woche wird er 15, die Liste mit seinen Geburtstagswünschen kann ich Ihnen mal zeigen, Frau Schüchen, da werden Sie blass vor Neid. Einen Urlaub mit drei seiner Kumpels nach Ibiza und eine nagelneue Rolex! Damit unser Bennilein mitreden kann. Nicht wahr, Benni!«
»Ich kotz echt gleich«, bellt Benni und produziert eine Kaugummiblase, die so groß ist wie sein Kopf. Die Blase zerplatzt an seinem Kappenrand, was Bennilein aber nicht weiter stört. Er zieht das Kaugummi aus seinem Gesicht und lässt es auf den Boden fallen.
Dann glotzt er mich mit seinen zu eng stehenden Augen an, als sei ich eine Küchenschabe.
»In der Schule läuft es momentan nicht so gut«, erklärt mir Marita und verdreht die Augen. »Musik und Freunde sind dem Benni wichtiger als alles andere. Wir haben ja schon zu Benni gesagt, dass er Nachhilfe kriegt in Mathe und Physik und Englisch und Französisch und Deutsch und in all den anderen Fächern, aber wenn es darum geht, da macht der Benni dicht. Aber – das kriegen wir schon alles hin, nicht wahr, mein Zuckerbengel?«
»Halt's Maul!«, pöbelt Benni in die Richtung seiner Mutter und spuckt auf den Parkettboden. »Und der Alte soll auch das Maul halten!«
Wie auf Befehl sind beide Elternteile mucksmäuschenstill.
Ich glaube, dass dem kleinen Bennilein hin und wieder eine Tracht Prügel oder zumindest eine Ohrfeige, verbunden mit Taschengeldentzug und Wegnahme der Playstation oder der X-Box, gut tun würde, aber das ist schließlich nicht meine Sache.
Ich sehe Benni vor meinem geistigen Auge die Schule irgendwann abbrechen und auch mit dreißig oder vierzig in seinem Jugendzimmer bei den Eltern wohnen, ohne auch nur einmal einer geldbringenden Tätigkeit nachgegangen zu sein.
»Na ja, also wir überlegen uns das noch mal mit dem Haus«, entschärft Marita VON letztendlich die Situation. »Renoviert werden muss ja wirklich einiges, aber ich bekomme langsam Platzangst in den 300 Quadratmetern, die wir jetzt bewohnen. Und ein Garten fehlt mir auch. Wenn hier ein Gärtner mal so richtig loslegt, kann daraus vielleicht noch was werden!«
»Über den Preis müssen wir auch noch mal sprechen«, erklärt Lothar wichtigtuerisch. »Für 1,5 Millionen will man ja auch was geboten bekommen!«
»Aber ja«, sage ich zuckersüß und ziehe eine Visitenkarte aus meiner Aktentasche. »Sie können mich immer anrufen. Und wenn Sie noch Fragen haben, bin ich jederzeit für Sie da.«
Benni rülpst und zieht die Nase hoch.
»Der Benni findet es ja toll, dass es im Keller ein Hallenbad und draußen einen Pool gibt«, flüstert mir Manita noch zu. »Da würde er dann eine Menge Spaß mit seinen Kumpels haben. Eigentlich ist der Benni ein ganz Lieber.«
Benni kratzt sich ungeniert zwischen den Beinen und stiert nur dümmlich in der Gegend herum.
Ich bringe die glückliche Familie noch zu ihren schlammverspritzten 911-er und verabschiede mich.
»He, Alte, stopp mal, wie viel Scheiß-Meter hatten der Pool draußen?«, krakeelt Benni und läuft hinter mir her.
Ich drehe mich um und mustere ihn angeekelt von oben bis unten.
»Halts Maul!«, schnauze ich und gehe zu meinem Wagen.
Ich glaube, den Hausverkauf kann ich vergessen.
Kapitel 3
Zu Hause wartet Andreas schon auf mich. Er ist wütend: »Du hast mir versprochen, dass du spätestens um 16 Uhr hier bist«, motzt er herum.
Mürrisch packe ich meine Sachen zusammen. Wie schön wäre es, jetzt gemütlich eine Pizza zu bestellen und dann einen Rosamunde-Pilcher-Film zu schauen.
Aber ich muss ja jetzt nach Dänemark fahren.
Sønderborg heißt der Ort, und von Hamburg aus ist man in gut zwei Stunden da. Wenn kein Berufsverkehr ist. Doris und Werner, das ach so nette Ehepaar, das Andreas kennen gelernt hat, freut sich jedenfalls auf unser Kommen.
Kurz nachdem wir auf die A7 gefahren sind, stehen wir im Stau. Ich fahre und Andreas tut so, als sei es meine Schuld, dass wir nicht vorankommen.
»Jetzt lass den doch nicht auch noch rein, wir kommen ja nie an«, meckert er herum, weil ich im Reißverschlussverfahren einen Opel vorlasse, der schon ungefähr seit drei Stunden auf der Beschleunigungsspur wartet.
Dann drückt er auf dem Autoradio herum und verstellt alle Sender, was mich wiederum wütend macht, weil ich den Verkehrsfunk hören möchte.
»Wo hast du eigentlich Autofahren gelernt!«, ruft Andreas. »Jetzt gib doch mal Gas!«
Ich schlage mit der Hand auf das Lenkrad: »Es reicht. Wie soll ich denn Gas geben, wenn kein Auto mehr fährt!«, schreie ich ihn an.
»Dann fahr auf dem Standstreifen«, kreischt Andreas herum und ist ganz rot im Gesicht. »Da kommen wir wenigstens voran!«
»Und behindern eventuell Polizei oder Feuerwehr oder den Rettungswagen«, blöke ich zurück. Meine Stimme wird schon schrill. »Ich sage dir, was ich mache! Bei der nächsten Ausfahrt fahr ich ab und nach Hause!«
»Das wirst du nicht tun«, brüllt Andreas und greift mir ins Lenkrad, um mehrmals hintereinander zu hupen. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich Auto fahre und jemand anderes mischt sich auch noch handgreiflich in meinen Fahrstil ein. Wobei ich im Moment gar keinen Fahrstil habe, weil wir ja seit einer halben Stunde stehen und nichts passiert.
»Lass das sein!« Jetzt bin ich richtig wütend. Zu Recht. Andreas redet nun gar nicht mehr mit mir und schmollt vor sich hin. Nachdem wir über die Grenze gefahren sind, will er sich wieder mit mir vertragen:
»Komm, nun sei nicht so. Wir haben uns doch schon öfters gestritten und dann immer wieder vertragen«, schmeichelt er mir. Ich bin aber immer noch böse. Zumal mir auch noch im Stau siedend heiß eingefallen ist, dass ich meine Sonnenbrille zu Hause vergessen habe. Ich hasse es, etwas zu vergessen. Um ganz ehrlich zu sein, hasse ich im Moment alles. Das vertane Wochenende, den verpatzten Besichtigungstermin, den Mann neben mir und mich.
Also lasse ich Andreas schmoren.
In Sønderborg finden wir den allerletzten Parkplatz, der natürlich hundert Kilometer von den Stegen entfernt ist. Bepackt wie ein Esel keuche ich durch die Dunkelheit. Zu allem Überfluss hat es auch noch angefangen zu regnen. Auf dem Holzsteg ist es glitschig, und ich muss höllisch aufpassen nicht auszurutschen. Ich trage unsere beiden Taschen, einen Rucksack und zwei Leinenbeutel mit Lebensmitteln. Andreas muss am Auto noch was nachschauen: »Das hat vorhin so komische Geräusche gemacht. Ich mach mal die Motorhaube auf. Nimm du die Sachen mit und geh schon mal vor, ich komme dann nach«, sagt er zu mir.
Das Boot von Doris und Werner liegt am Steg F, was ziemlich am Ende der ganzen Stege ist. Verzweifelt suche ich die Nummer 58, was wegen Regen und der Finsternis gar nicht so einfach ist.
Ein Mann kommt mir entgegen. »Britta?«, fragt er mich. Ich nicke und bin erleichtert. »Das ist ja ganz schön spät geworden«, sagt der Mann, der wohl Werner sein muss. »Wir müssen hier entlang«, er deutet in die Nacht. »Noch zweihundert Meter, dann hast du's geschafft. Ich geh eben duschen. Aber Doris ist an Bord.«
Wie, er geht duschen? Wo geht er duschen? Gibt es auf dem Boot etwa keine Dusche? Und was ist mit dem Klo? Gibt es etwa auch kein Klo? Mir wird übel, als ich daran denke, dass ich jedes Mal, wenn ich aufs Klo muss, vom Boot klettern und ewig lange laufen muss. Ich will, dass das Boot von Werner und Doris ein Klo hat. Wie auf Befehl muss ich aufs Klo. Und zwar dringend.
Ich schleppe den ganzen Kram bis zur Liegeplatznummer 58 und rufe laut nach Doris, die irgendwann ihren Kopf aus dem Niedergang steckt.
»Hallo, du bist wohl Britta«, ruft sie freundlich, »willkommen auf der Victoria. Komm doch an Bord.«
Da ist sie wieder, die Situation, die ich hasse. Neben mir stehen die ganzen Taschen. Ich muss also erst die ganzen Taschen irgendwie da rüberkriegen und dann selbst rüberklettern. Das Boot ist kleiner als das von diesem entsetzlichen Sören, aber es schaukelt genauso und der Bug ist ebenso meterweit vom Steg entfernt.
Ein Pärchen, das einen Spaziergang im Abendregen macht, bleibt in einiger Entfernung stehen und beobachtet mich. Vielleicht waren sie letztes Mal auch schon irgendwo, als ich mit den Leinen ins Wasser gefallen bin, und freuen sich jetzt auf eine Fortsetzung.
»Ähem, Doris, wäre es eventuell möglich, dass du mir mit den Taschen hilfst?«, rufe ich in Richtung Niedergang. Aber Doris hat die Luke wegen des Regens schon wieder geschlossen und wartet lieber im Trockenen auf mich.
Ich habe eine Idee. Ich werfe die Taschen einfach vom Steg aus auf das Schiff drauf und dann versuche ich es etwas näher zu mir zu ziehen und dann muss ich probieren, rüberzusteigen.
Warum werden Boote so unglücklich festgemacht? Kann man nicht überall so Seitwärtsstege anbringen, sodass man bequem seitlich auf das Boot klettern kann? Warum machen Menschen es sich selbst so verdammt schwer?
Ich nehme Andreas' Tasche und schleudere sie an Deck. Das ist ja ein Kinderspiel. Dann ist meine Tasche dran und dann sind ja nur noch die zwei Tragetaschen mit den Wein- und Bierflaschen. Den Rucksack setze ich mir auf.
Ich versuche, die beiden Jutetaschen zwischen unsere Reisetaschen zu werfen. Dummerweise bin ich noch nie gut im Zielen gewesen, und blöderweise habe ich weder dran gedacht, die Taschen a) zu verschließen und b) vielleicht die Bier- und Weinflaschen und Marmeladengläser herauszunehmen. Es gibt einen furchtbaren Schlag, als die Flaschen und Gläser beim Aufprall auf Deck zerbersten. Das Regenspaziergangspärchen lacht leise.
Doris steckt den Kopf wieder aus dem Niedergang und fragt: »Hallo? Was ist denn hier los? Ist jemand verletzt?«
»Nein, Doris, ich bin das bloß«, rufe ich verzweifelt. »Ich habe, glaube ich, Mist gebaut. Ich wollte die Taschen an Bord werfen und mir ist, hahaha, sozusagen ein kleines Missgeschick passiert.«
»Warum hast du die Taschen denn nicht an Land gelassen. Dein Mann kann die doch an Bord tun«, fragt Doris und dann: »Iiiih, stinkt das hier nach Bier. Und gerade heute, wo ich das Deck stundenlang geschrubbt habe! Also wirklich!«
Ich glaube, besser kann ein gemeinsames Wochenende nicht beginnen.
»Britta, nun komm doch endlich an Bord«, ruft Doris. Ihre Stimme klingt sauer. Ich kann hier nicht dauernd offen lassen, das ganze Schiff wird nass.«
»Jaha, ich komme ja schon«, rufe ich betont gelassen und beuge mich nach vorn, um den Bugkorb, oder wie das heißt, zu fassen zu kriegen. Es will so gar nicht zu mir, das Boot. Dann komme ich auf die Idee, an den Befestigungsleinen zu ziehen, um es so näher zu ziehen, was mir auch gelingt. Aber immer nur für einige Sekunden ist die Victoria so nah dran, dass ich aufsteigen könnte. Sobald ich aber einen Fuß auch nur anhebe, schwimmt sie wieder zurück. Ich habe die Befürchtung, dass die Victoria nicht meine Freundin wird.
Und kein Werner und kein Andreas weit und breit zu sehen. Endlich scheine ich eine günstige Situation erwischt zu haben, ich ziehe an den Leinen, die Victoria kommt mir entgegen und verharrt etwas länger in meiner Nähe. Todesmutig setze ich einen Fuß auf die Bugspitze. In diesem Moment überlegt es sich Vicky aber wieder anders und legt den Rückwärtsgang ein. Dummerweise verhakt sich mein Fuß im Bugkorb und ich habe nur zwei Möglichkeiten:
Ich bleibe mit Bein zwei an Land und Bein eins wird mir abgerissen – oder umgekehrt.
Ich halte mich jetzt fest und ziehe das Bein mit rüber.
Meine Hände umklammern die Reling. Mit letzter Kraft stoße ich mich ab und kauere daraufhin in der Hocke auf dem Bugkorb, der viel zu klein für einen längeren Aufenthalt ist. Ich schwitze. Ich traue mich nicht, nach rechts oder links zu schauen, weil da sowieso nur schwarzes Wasser ist, und ich traue mich nicht, aus der Hocke hochzukommen, weil ich entsetzliche Angst davor habe, dass ich da nichts finde, woran ich mich festhalten kann. Verstohlen blicke ich irgendwann doch nach oben und sehe meine Rettung: Eine Stange, um die ein Segel festgewickelt ist. Meine schweißnassen Hände umklammern die Stange und ich richte mich auf.
Eine Sekunde später knalle ich mit dem Rücken auf das Deck. Das Segel hat sich durch mein Klammern abgewickelt, und ich liege wie ein Käfer auf dem Rücken in einer Bier- und Weinlache und schnappe nach Luft. Beim Versuch mich aufzurichten ergreife ich die Reisetaschen. Die machen sich daraufhin selbstständig und schliddern auf dem alkoholgetränkten Deck herum, um dann ihre letzte Reise in die Ostsee anzutreten. Ich versuche, sie zu retten, greife versehentlich dabei in eine Glasscherbe und schneide mir die ganze Hand auf.
Ich bin an Bord!
»Du bist eben mein kleines Dummerchen«, sagt Andreas später gutmütig zu mir. Seine komische Art macht mich zunehmend aggressiv. Wir sitzen mit Doris und Werner unter Deck im Salon und »trinken einen auf den Schrecken«. Meine verbundene Hand tut höllisch weh und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich gegen Wundstarrkrampf geimpft bin. Die beiden unbrauchbaren Reisetaschen sind mittels Bootshaken nun auch wieder an Bord, zum Glück ist das Wasser nicht so tief an diesem Liegeplatz. »Die Sachen kannst du morgen im Hafengebäude waschen und trocknen«, sagt Doris.
Andreas ist ganz leicht an Bord gekommen, denn Werner hat ihm die Victoria so dicht an den Steg gezogen, dass sie quasi schon auf dem Steg gestanden hat. Doris meint die ganze Zeit nur: »Jetzt muss ich morgen wieder alles putzen!«
Doris und Werner gehören zu dem Schlag Leute, mit denen ich noch nie wirklich klar gekommen bin. Spießig und viel zu ordentlich.
Vor dem Niedergang liegt ein Fußabtreter mit einem Anker drauf. Daneben steht »Ahoi!« geschrieben. Im Boot selbst sind überall Putzlappen verteilt, und Doris ist ununterbrochen am Wischen und Polieren: »Wenn man nicht ständig dranbleibt, hat man verloren auf dem Boot«, sagt sie. Sie wohnen in Flensburg. Doris arbeitet in der Verpackungsstelle beim Orion-Versand und Werner verkauft auf Provisionsbasis Teppichbodenreinigungsmittel. »Ich habe eine Firma«, pflegt er zu sagen.
Das Boot ist winzig klein und man kann nicht aufrecht stehen darin. Dauernd stoße ich mir den Kopf.
Auf dem schwenkbaren Salontisch liegt eine geblümte Plastikdecke. Darauf steht eine Plastikvase mit Plastikrosen drin. Der Wein wird aus Plastikbechern getrunken. »Porzellan und Glas an Bord, das geht nicht«, erklärt Werner. »Das klötert beim Segeln durch die Gegend und geht sofort kaputt.« Deswegen kaufen die beiden auch keine Weinflaschen mehr, sondern Wein im Tetrapak. Das klingt beruhigend, dann ist es ja nicht weiter schlimm, dass unsere Weinflaschen kaputt sind.
»Das ist auch viel besser vom Gewicht her«, erzählt Doris keuchend, während sie den Salon feudelt. Wenn ich still sitzen bleibe und so tue, als gehörte ich zum Bootsinventar, feudelt sie bestimmt auch gleich mich. Ich sehe mich schon blank poliert als Galionsfigur am Bug der Victoria enden.
Mittlerweile habe ich schrecklichen Hunger. »Sagt mal, wollen wir nicht noch essen gehen?«, frage ich zögernd. Um zwölf Uhr heute Mittag habe ich einen Müsliriegel zu mir genommen, das war alles. Doris und Werner schauen mich an, als sei ich völlig übergeschnappt.
»Essen gehen?«, fragt Werner. »Weißt du, wie teuer in Dänemark essen gehen ist?«
»Nein, das weiß ich nicht«, gebe ich leicht giftig zurück. »Aber ich habe Hunger und würde gern etwas essen. Und eine Pizza wird schon nicht die Welt kosten.«
»Britta, nun sei mal nicht so zickig«, mischt sich Andreas ein. »So ist sie immer, wenn sie Hunger hat«, sagt er beschwichtigend zu unseren neuen Freunden auf Lebenszeit.
»Ich könnte uns etwas kochen«, schlägt Doris vor, woraufhin wir zustimmend nicken. Doris öffnet daraufhin eine Dose Ravioli und zündet den Spirituskocher an. Während der mickrige Inhalt in einem Topf vor sich hinköchelt, beschlagen die Scheiben, und Kondenswasser fließt und tropft von den Plastikwänden. Werner raucht auch noch Zigarre, und lüften kann man nicht wegen des Regens. Dann wird das Boot ja noch nasser! Nach zehn Minuten habe ich das Gefühl, Asthmatikerin zu sein.
»So, Essen ist fertig«, ruft Doris fröhlich, so als hätte sie in stundenlanger Arbeit ein Fünf-Gänge-Menü kreiert, und füllt jedem von uns fünf Ravioli auf die Plastikteller. »Selbst Konserven sind teuer geworden«, schmatzt Werner, »da muss man auf den Cent achten.«
Ich bin, nachdem ich aufgegessen habe, was weniger als fünfzehn Sekunden gedauert hat, noch hungriger als vorher. Wie ich diese Nacht überstehen soll, weiß ich nicht. Ich kann es nicht ertragen, hungrig zu sein. Ich ärgere mich maßlos darüber, dass ich keine Lebensmittel eingepackt habe – die wären auch nicht zerbrochen. Andreas scheint es genauso zu gehen wie mir und er erdreistet sich zu fragen: »Du, Werner, nimm's mir nicht übel, aber satt bin ich nicht geworden. Ist es möglich, noch eine Kleinigkeit zu bekommen?«
Doris und Werner schauen sich an. »Ich könnte noch eine Dose Ravioli aufmachen«, sagt Doris schließlich langsam und unwillig und macht dabei ein Gesicht, als hätte sie ein Dutzend Zitronenscheiben im Mund.
»Das ist doch ein Wort«, lacht Andreas und setzt noch einen drauf: »Die bezahlen wir euch natürlich, hahaha!«
»Darum wollte ich sowieso bitten«, gibt Werner zurück. »Schließlich soll ja alles gerecht zugehen. Zwei Euro dann bitte.«
Ich glaube, ich höre nicht richtig.
So unwohl habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt.
Werner steht in einer unmissverständlichen Haltung vor Andreas; es fehlt nur noch, dass er die Hand aufhält.
»Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Portemonnaie ist«, sagt Andreas und schaut zu mir. »Britta, wenn du so lieb wärst!«
Weil mir nichts anderes übrig bleibt, hole ich meine Geldbörse aus dem Rucksack und suche nach Kleingeld. Ich habe immer Kleingeld. Natürlich habe ich heute kein Kleingeld; das Einzige, was ich finde, sind 20- und 50-Euro-Scheine.
»Kannst du mir rausgeben?«, frage ich Werner. Der schüttelt den Kopf. »Leider nein«, sagt er, »aber ihr habt ja auch schon Wein getrunken. Aber keine Angst, ich schreibe das alles genau auf und am Sonntag wird abgerechnet auf Heller und Pfennig, hahaha!«
Ich schwöre, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Kann irgendjemand mir verübeln, dass ich in diesem Moment Segler noch mehr hasse als vorher? Nein. Ganz sicher nicht.
Also drücke ich Werner den 20-Euro-Schein in die Hand, den dieser sofort übereifrig wegpackt.
Doris wischt unterdessen, nachdem sie die zweite Dose Ravioli geöffnet hat, die Rumpffenster (nicht jedes Boot hat Rumpffenster, das hab ich in einem von Andreas' Büchern gelesen), die ja schon ganz beschlagen sind, mit Küchentüchern und Glasreiniger trocken, sodass man wieder rausschauen kann. Gleich nehme ich einen herumliegenden Putzlappen und erwürge sie damit.
Sie schwitzt schon, denn es ist so gut wie kein Sauerstoff mehr im ganzen Boot vorhanden. Ich bekomme schleichend Kopfschmerzen. Und Werner raucht weiter wie ein Schlot seine Zigarre. Meine Augen brennen.
Nachdem wir die zweite Portion Ravioli (mit Maggi macht das Kochen Spaß) zu uns genommen haben, bin ich immer noch schlimm hungrig und müde und wünsche mir nichts sehnlicher, als zu Hause zu sein.
Werner und Andreas fachsimpeln darüber, ob alte oder neue Segelboote besser sind. »Glaub mir«, beteuert Werner, während eine Qualmfontäne aus seinem Mund schießt, »die alten waren so schwer und waren nicht so wendig und haben völlig nass gesegelt. Unsere kleine Victoria ist behände und schnell. Klar kriegt man auch mal 'nen Schauer ab, sie ist ziemlich klein, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit ihr!«
»Papperlapapp«, schnaubt Andreas und gießt sich noch einen Tetrapak-Wein ein. »Dann bist du noch nie auf einem Folkeboot gesegelt. Das sind wenigstens noch Schiffe. Nur Holz und Handarbeit. Da fühlt man sich noch wie ein echter Segler!«
Ich blicke Andreas an, als hätte er sie nicht mehr alle. »Du spinnst ja«, sage ich. »Folkeboote sind total unhandlich, total schwer, da gibt's noch nicht mal elektrische Winschkurbeln, und eine Wende dauert so lange wie das Ablegen der Titanic in Southampton. Also wirklich ...«
Andreas wird rot vor Scham. Aber er wäre nicht Andreas, also der neue Andreas, der Segeln-ist-mein-Traum-und-ich-weiß-alles-darüber-Andreas, wenn er seinen Fehler zugeben würde.
»Was redest du denn da für einen Mist, Brittalein?«, fragt er süffisant und trinkt einen Schluck. »Folkeboote sind total spitze!«
»Britta hat Recht«, so Werner und blinzelt mir aufmunternd zu, was ich leider nur erahnen, aber nicht sehen kann (der Qualm, der Qualm). »Folkeboote wurden früher zuhauf gebaut und sie werden auch jetzt noch gebaut, aber für behände Fahrtensegler, für richtige Männer, wie du und ich sie sind, sind die nichts! Aber sag mal, Britta, woher kennst du dich eigentlich so gut aus?«
Ich zucke mit den Schultern: »Naja, ich lese halt viel. Wenn man etwas von der Pike auf lernen will, sollte man sich doch darüber informieren. Und Andreas hat einen Haufen Sachliteratur angeschleppt, da hab ich eben reingeschaut.«
Werner nickt und Andreas wird rot vor Zorn. Ob das jetzt ein Fehler von mir war? Aber man sollte sich doch wirklich informieren. Oder nicht? Andreas jedenfalls sagt gar nichts mehr, blickt wütend vor sich hin und ignoriert mich. Eine peinliche Stille entsteht, die zum Glück von Doris unterbrochen wird, die vom Putzen rote Backen hat:
»So, die Herrschaften, morgen müssen wir früh raus, denn wir wollen ja was vom Tag haben, auf in die Kojen!«
Welche Kojen? Außer einem Schlafplatz im Vorschiff ist leider keine einzige Koje zu entdecken. Aber Werner schraubt schon den Salontisch auf Polsterhöhe:
»Hier werdet ihr schlafen. Da kommt noch ein Polster in die Mitte, das ist super bequem.«
»Ich müsste aber noch mal auf die Toilette«, werfe ich ein. »Tja«, Werner kratzt sich am Kopf, »das ist jetzt doof. Du willst ja sicher nicht im strömenden Regen bis zu den Hafenklos laufen, oder?« Ich schüttele den Kopf. Da müsste ich ja von Bord und auch wieder an Bord. Wer weiß, was da wieder passiert.
»Für Notfälle der Damen haben wir natürlich einen Eimer an Bord«, grinst Werner. »Wir Männer verrichten unsere Notdurft am Bootsrand, aber bei euch ist das ja ein Problem, hihihi!« So ausführlich will ich das eigentlich nicht mit einem Menschen diskutieren, den ich erst ein paar Stunden kenne, aber meine Blase platzt gleich.
Eine Minute später sitze ich im Platzregen im Cockpit und ziehe mir die Hose runter. Innerhalb von zehn Sekunden bin ich patschenass. »Du kannst auch hier im Salon aufs Klo«, bietet Werner mir an. »Wir anderen schauen dann weg.« Nein danke. Nein danke.
›Du bist die blödeste Kuh auf der ganzen Welt‹, sage ich in Gedanken zu mir. ›Warum tust du dir das eigentlich an?‹ Niemand antwortet.
Es ist die schlimmste Nacht, die ich jemals verbracht habe. Ich liege mit Andreas im Salon, der völlig ungelüftet ist, weil ja sonst das Boot nass wird. Es stinkt nach Schweiß, nassen Klamotten, Ravioli, Spiritus und, nicht zu vergessen, Zigarrenqualm.
Ich tue kein Auge zu. Das Einzige, was Andreas zu mir sagt, bevor er einschläft, ist: »Du genießt es wohl, mich zu blamieren, ja?« Dann dreht er sich weg und kurze Zeit später schnarcht er so, dass meine Kopfschmerzen sich anfühlen, als ob eine Kreissäge in meinem Kopf arbeiten würde.
Werner und Doris sind in ihrem Vorschiff verschwunden, nicht ohne uns zu sagen, wie praktisch sie es finden, dass man da die Luke einen Spalt öffnen kann, ohne dass es reinregnet, das sei ja schrecklich mit dem Gestank im Salon.
Gegen drei Uhr morgens weine ich sogar vor Selbstmitleid. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht schlafen zu können, obwohl man total müde ist, und ich mochte es, unter uns gesagt, noch nie, mit Menschen auf so kurze Distanz die Nacht zu verbringen. Deswegen mochte ich auch noch nie Jugendherbergen oder Hotels mit Vier-Bett-Zimmern.
In meiner Verzweiflung stehe ich irgendwann auf und öffne das Schiebeluk, aber sofort peitscht der Regen seitlich herein, also schließe ich es schnell wieder.
Ich denke an Andreas' Bücher. Die meisten Menschen, die auf den Fotos darin abgebildet sind, lachen, und die pure Lebensfreude entspringt den Gesichtern.
Eine Profiseglerin, Ellen MacArthur, die allein durch die Meere schippert, hat sogar in einem Buch behauptet, sie habe sich in ihrem Leben noch nie so wohl gefühlt wie auf ihrem Boot. Warum kann es mir nicht so gehen wie Ellen MacArthur? Warum kann ich nicht einfach Ellen MacArthur sein?
Ganz einfach: a) Sie war meistens allein auf dem Boot und hat wahrscheinlich deswegen so gute Laune gehabt und b) sie ist erst Mitte zwanzig. Ich bin Ende dreißig und muss meine Fältchen wegschminken. Das muss Ellen noch nicht. Weil sie ja auch immer lacht und glücklich ist auf dem Boot. Deswegen passt das alles nicht. Ich muss noch mehr weinen.
Ich hab schlimm Angst vor morgen. Weil wir da segeln gehen.
Kapitel 4
Samstagmorgen. Sieben Uhr dreißig. Oh Gott, ist das früh. Ich blinzle und reiße dann die Augen auf.
Ach, das ist ja ein Service. Plötzlich ist alles gelüftet, meine Kopfschmerzen sind weg und der Regen hat auch aufgehört. Das Leben scheint es ja gut mit mir zu meinen!
Ich rieche frisch gekochten Kaffee und höre eine Brötchentüte knistern. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Meine Güte, Doris hat im Cockpit den Tisch gedeckt und es gibt alles, was zu einem gemütlichen Samstagmorgenfrühstück dazu gehört: Aufschnitt, Schinken, Eier, Marmelade, Honig und Müsli und Räucherlachs. Sogar Tageszeitungen liegen bereit. Ich liebe es, samstags Zeitung zu lesen! Das müssen die beiden irgendwie gespürt haben!
»Wir wollen doch gestärkt den Tag beginnen«, lacht Doris. »Kommt hoch, alles ist gedeckt!«
Ich schäme mich. Wie habe ich nur die ganze Nacht lang schlecht über Doris und Werner denken und mit meinem Schicksal hadern können? Ich werde das alles wieder gutmachen. Ich werde Doris unter anderem anbieten, heute allein fürs Spülen und Saubermachen verantwortlich zu sein. Und mit Andreas werde ich mich auch vertragen. Man soll ja nicht immer so nachtragend sein.
Aber ich muss mich gar nicht mit Andreas vertragen. Er wacht nämlich gerade auf, schaut mich verschlafen an und sagt: »Guten Morgen, meine kleine Zaubermaus. Na, wird das ein wunderschöner Tag?« Ach, auf dem Boot zu sein, ist doch gar nicht so übel. Ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen. Herrlich, wie die Sonne auf dem Wasser glitzert. Und die Möwen! Also wirklich, ich bin richtig beschwingt. Wie ich mich aufs Frühstück freue! Sehe ich da nicht eine Laugenbrezel aus der Tüte ragen?
Werner sitzt schon am Tisch und gießt uns Kaffee ein. Das Leben ist schön, schön, schön. Das Wochenende ist gerettet!
»Aufstehen, wir wollen bald los!«
Nein, noch ein bisschen dusseln.
»Britta, Andreas, aufstehen, wir wollen doch was vom Tag haben. Heute ist Samstag, das ist der einzige volle Tag! Wenn wir nicht bald ablegen, können wir das alles vergessen!«
Ich setze mich verschlafen auf. Hat Werner nicht eben noch in der Sonne im Cockpit gesessen und uns Kaffee eingegossen? War der Tisch nicht draußen gedeckt? Waren nicht alle freundlich? Wo ist der Sonnenschein, der eben noch da war?
Langsam werde ich wach. Neben mir schnarcht Andreas wie ein Waldarbeiter. Mein Schädel dröhnt. Wie eine zum Tode durch den Strang Verurteilte wird mir langsam, aber sicher klar, dass ich offenbar doch ein wenig geschlafen haben muss, weil ich sonst diesen wunderschönen Traum nicht gehabt hätte.
Von einem gedeckten Tisch ist nichts zu sehen, auch nicht von Brötchen. Von fröhlichen Gesichtern erst recht nichts. Werner und Doris stieben umher wie ein Ehepaar, das schon seit längerem an BSE erkrankt ist, dies aber nicht wahrhaben will. Es fehlt bloß noch, dass sie Schaum vorm Mund haben.
»Äh, wie spät ist es denn?«, wage ich zu fragen.